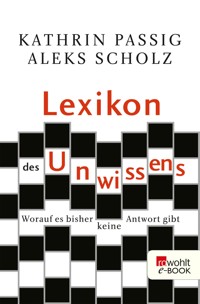9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Das Verirren hat keinen guten Ruf: Es gilt als gefährlich, zeitraubend und peinlich – und außerdem im Zeitalter von GPS und Smartphone als höchst überflüssig. Doch Verirren ist eine der ältesten Kulturtechniken der Menschheit, und ihre Vorzüge sind gar nicht zu überschätzen: Ohne sie wäre Polynesien unbesiedelt geblieben, Hänsel und Gretel hätten keinen Schatz gefunden, und wir selbst könnten nur von wenigen spannenden Urlaubsabenteuern erzählen. Auf ebenso intelligente wie witzige Weise zeigen Kathrin Passig und Aleks Scholz, warum Verirren klüger, reicher und zufriedener macht – und manchmal sogar schneller zum Ziel führt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 301
Ähnliche
Kathrin Passig • Aleks Scholz
Verirren
Eine Anleitung für Anfänger und Fortgeschrittene
Über dieses Buch
«Homer hätte wenig zu erzählen gehabt, wenn Odysseus auf dem kürzesten Weg nach Hause gekommen wäre …»
Das Verirren hat keinen guten Ruf: Es gilt als gefährlich, zeitraubend und peinlich – und außerdem im Zeitalter von GPS und Google Maps als höchst überflüssig. Doch Verirren ist eine der ältesten Kulturtechniken der Menschheit, und ihre Vorzüge sind gar nicht zu überschätzen: Ohne sie hätte etwa Kolumbus nie Amerika entdeckt, Hänsel und Gretel hätten keine Hexe erlegt, und wir selbst könnten nur von wenigen spannenden Urlaubsabenteuern erzählen. Auf ebenso intelligente wie witzige Weise zeigen Kathrin Passig und Aleks Scholz, warum Verirren klüger, reicher und zufriedener macht – und manchmal sogar schneller zum Ziel führt.
Vita
Kathrin Passig, geboren 1970, ist eine Vordenkerin des digitalen Zeitalters. Sie ist Mitbegründerin der Zentralen Intelligenz Agentur in Berlin sowie des Blogs «Techniktagebuch». 2006 gewann sie in Klagenfurt sowohl den Bachmann-Preis als auch den Publikumspreis. Gemeinsam mit Aleks Scholz veröffentlichte sie auch das «Lexikon des Unwissens» (2007) und das «Handbuch für Zeitreisende» (2020). 2016 wurde Kathrin Passig mit dem Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik und Essay ausgezeichnet.
Aleks Scholz lebt in Schottland und ist Astronom mit dem Forschungsschwerpunkt Entstehung und Entwicklung von Sternen und Planeten. Zudem ist er Autor, schrieb für den «Merkur», die «taz», «Spiegel Online» und die «Süddeutsche Zeitung»; 2010 gewann er mit seinem Text «Google Earth» beim Bachmann-Wettbewerb den Ernst-Willner-Preis.
Inhaltsübersicht
Einleitung: Verirren zum Spaß
A: Der Anfang · Norden ist da, wo der Daumen rechts ist
Das Niagaraexperiment
Abschied von der Karte
Die erste Verirrung
Die reale Virtualität
Verirrensursachen I
Der Weg zurück
Die vier wichtigsten Richtungen
Konfluenzen mit Koordinaten
Operation Osorno
B: Die Fortgeschrittenen · Sie haben Ihr Ziel verfehlt
Berge im Kopf
Innere Kartografie I
Schottland als Biotop
Der dreifache Ben Oss
Verirrensursachen II
Stadien der Verirrung
Notizen zur Geschichte des Verirrens
Urlaubsdenken
Risikomanagement
C: Die Unverirrten · Folgen Sie dem unsichtbaren Pfeil
Erfahrene irren nie
Die Wegweiser der Welt
Innere Kartografie II
Verirrensursachen III
Sehr viel Wasser
Das Prinzip Coolness
Lob der Unsicherheit
Schluss: Im Dienste der Erkenntnis
Quellen
Dank
Einleitung:Verirren zum Spaß
Will Turner: «Wie sollen wir mit einem Kompass, der nicht funktioniert, zu einer Insel segeln, die niemand finden kann?»
Mr. Gibbs: «Aye, der Kompass zeigt nicht nach Norden. Aber wir suchen ja auch gar nicht Norden.»
Fluch der Karibik
Verirren hat keine Zukunft. Dank GPS, Google Maps und den zahlreichen Geräten, die davon Gebrauch machen, muss sich heute niemand mehr verirren. Selbst von so entlegenen Gebieten wie dem Mars gibt es detaillierte Landkarten, die man sich im Internet ansehen könnte, wenn es auf dem Mars Internet gäbe. Wir leben in Zeiten, in denen man für wenige Euro zu jedem Zeitpunkt die eigene Position auf wenige Meter genau bestimmen kann. Spätestens seit 2014 gehört das Verirren endgültig der Vergangenheit an. So steht es jedenfalls in der 2007 veröffentlichten «Extinction Timeline», in der die Trendforscher Ross Dawson und Richard Watson Ausgestorbenes und Aussterbendes von 1950 bis 2050 verzeichnen.
Das ist natürlich Quatsch: Verirren wird nie aussterben. Ist etwa das mühsame Herumlaufen ausgestorben, nur weil jemand motorisierte Verkehrsmittel erfunden hat? Im Gegenteil, man trifft sich heute zu Tausenden, um nur so zum Spaß 42 Kilometer zu Fuß zurückzulegen. Ist das langwierige Angeln von Fischen ausgestorben, weil man sie schneller im Kühlregal erlegt? Hört irgendjemand damit auf, zum Spaß im Kopf die Quadratwurzel aus achtstelligen Zahlen zu ziehen, nur weil es Taschenrechner gibt? Vielleicht war das dritte Beispiel etwas unglücklich gewählt. Aber dass man sich nicht mehr verirren muss, heißt jedenfalls nicht, dass man sich nicht mehr verirren kann. Gerade wenn das versehentliche Verirren (fast) ausgerottet ist, wird das absichtliche Verirren interessant.
Zugegeben, derzeit hat das Verirren noch ein denkbar schlechtes Image, und Reiseführer wie Ratgeber befassen sich – wenn sie das Thema überhaupt erwähnen – vornehmlich mit der Frage, wie man es vermeidet. Aber das muss nichts heißen. Die Alpen galten bis ins 18. Jahrhundert als hässliche und gefährliche Region, in die man am besten keinen Fuß setzte, und der Wolf wurde erst vor wenigen Jahren in den Stand einer touristischen Attraktion erhoben. Warum soll da nicht auch das bislang ungeliebte Verirren seine Chance bekommen, zur Trendbeschäftigung des 21. Jahrhunderts aufzusteigen?
Es gibt natürlich gute Gründe, warum Verirren unbeliebt ist: Immer wieder führt fehlende Orientierung auf Umwegen zum Tod oder zu verpassten Mahlzeiten. Allerdings liegt das nur selten wirklich am Verirren, sondern vielmehr daran, dass kaum jemand es richtig beherrscht. Wir werden diesen Missstand im Laufe des Buches zu beheben versuchen. Von den vielen Vorteilen des Verirrens ist hingegen zu selten die Rede. Dabei profitiert von einer Beschäftigung mit der schönen Kunst des Umherirrens jeder Mensch, der mit einem normalen Maß an Neugier und Urlaubstagen ausgestattet ist. Die wichtigsten Vorzüge in Kürze:
1. Verirren spart Zeit: Natürlich geht es vordergründig betrachtet schneller, der Karte oder den Anleitungen einer Navigations-App zu folgen, wenn man beispielsweise vom Flughafen London-Heathrow zum Big Ben will. Ohne Anleitung wird man zwangsläufig an den falschen Stellen die U-Bahn-Linien wechseln, man wird beim Verlassen des U-Bahnhofs in die falsche Richtung laufen, um dann mit einigem investigativem Aufwand am Ende doch den Big Ben zu finden, vor allem, weil er recht schwer zu übersehen ist. Eine empirische Faustformel ergibt, dass man ohne Karte und ohne Vorkenntnisse im Mittel sechsmal so viel Zeit benötigt, um vom Flughafen zum Big Ben zu kommen, wie mit diesen Hilfsmitteln. Wer das aber für einen guten Grund hält, dieses Buch wegzuwerfen, hat eindeutig zu kurz gedacht. Denn niemand kommt in seinem Leben nur einmal nach London (oder in eine beliebige andere Stadt, in die man mindestens zweimal kommt). Und beim zweiten Mal interessiert man sich womöglich nicht für den Big Ben, weil Big Ben immer noch derselbe ist, sondern für den Swiss-Re-Tower, das dildoförmige Bankhochhaus im Finanzdistrikt. Mit Hilfsmitteln fängt man wieder von vorne an. Hätte man sich beim ersten Mal gründlich genug verirrt, wäre das unnötig, denn eine goldene Regel besagt, dass man, bevor man den Big Ben findet, alle anderen Sehenswürdigkeiten per Zufall entdeckt. Ehemals Verirrte finden so ohne Recherche und ohne Schwierigkeiten auf Anhieb die gläserne Gurke und sparen viel Zeit. Bei jedem weiteren London-Aufenthalt wird sich dieser Vorgang wiederholen, und am Ende verwechselt der Kartenbesitzer immer noch Tower Bridge und London Bridge, während die Verirr-Expertin längst von Einheimischen nach dem Weg gefragt wird.
2. Verirren spart Geld: Es ist ein teurer Spaß, echte Abenteuer zu erleben. Dank Globalisierung funktionieren die meisten Länder mehr oder weniger gleich – es gibt dieselben Supermärkte, dieselben Biersorten, dieselben Hotelketten. Zudem kann man dank Internet praktisch alles vorher herausfinden, was man zum Überleben im fremden Land braucht. Es gibt zwei Methoden, diese Mechanismen zu umgehen. Entweder man zahlt sehr viel Geld und begibt sich in die wenigen Regionen, die man noch Wildnis nennen kann. Zum Beispiel in die Arktis: keine Supermärkte, kein Bier, kein Hotel, aber Anreisekosten im hohen vierstelligen Bereich. Oder aber man verzichtet auf Vorabinformationen und den Kauf von Landkarten und Reiseführern und spart damit sowohl Zeit (siehe 1.) als auch Geld. Denn für kartenlose Reisende ist jede Gegend Terra incognita, auch wenn es sich nur um die Mecklenburgische Seenplatte handelt (Anreisekosten: unter 100 Euro). Man wird sich zwangsläufig verirren, so wie sich unsere Vorfahren in Mecklenburg verirrt haben, und auf diese Weise seine eigene private Wildnis erschaffen. Geldersparnis pro Abenteuer: einige durchschnittliche Monatseinkommen.
3. Verirren vermeidet Streit: Einer britischen Studie aus dem Jahr 2010 zufolge streiten sich fast 70 Prozent der Befragten mindestens einmal im Monat beim Autofahren, ein Drittel dieser Streits dreht sich um den richtigen Weg. Beliebte Streitanlässe sind: Eine der beteiligten Personen kann (nach Meinung der anderen) nicht navigieren, weigert sich, nach dem Weg zu fragen, oder hat sich vor dem Losfahren nicht über den richtigen Weg informiert. Die Studie wurde von einem Autozubehör-Unternehmen in Auftrag gegeben, vermutlich, um den Umsatz von Navigationsgeräten anzukurbeln. Inzwischen gibt es in den meisten Autos ein bis mehrere solche Geräte. Über den richtigen Weg streiten kann man immer noch. Man kann es aber auch einfach bleiben lassen und sich stattdessen gemeinsam verirren.
4. Verirren ist Urlaub: Die meiste Zeit im Leben gehorchen wir einer grausamen Diktatorin: der Uhr und ihren willigen Schergen Terminkalender, Weckerklingeln und Fahrplan. Der Alltag der mitteleuropäischen Durchschnittsfamilie ist ein unflexibler Prozess. Er gleicht in seiner mechanischen Abfolge den Vorgängen an einem Fließband – ein einziger Fehler, und der Betrieb, das heißt das Leben, gerät ins Stocken. Dieser Hamsterradlauf wird in den allermeisten Fällen auch dann weitergeführt, wenn es gar nicht sein müsste, nämlich im Urlaub. Monate im Voraus werden Landkarten und Reiseführer gekauft, Hotels gebucht, jeder Aspekt der Reise durchgeplant, und nach der Rückkehr teilt man im Internet mit, wie viele Stunden und Minuten man für jede Etappe der Bergbesteigung oder Radtour gebraucht hat. Der sogenannte Urlaub ähnelt in Vorbereitung und Durchführung eher einer Militäroperation als einer Vergnügungsreise. Warum das so ist, darüber ist sich die Forschung uneinig. Ist es zu anstrengend, das enge Zeitkorsett für ein paar Wochen im Jahr abzulegen? Gibt es so etwas wie die Angst vor der freien Zeit? Sind die Reisebüros schuld? Oder herrscht eine heimliche Begeisterung für Militäroperationen? Wie dem auch sei, es gibt ein einfaches, billiges, stressfreies Gegenmittel, man ahnt es: Verirren. Wer im Urlaub nichts anderes vorhat, als sich zu verirren, spart die umfassende Vorausplanung und lässt sich nicht vom Wecker oder den eigenen Ansprüchen verrückt machen.
5. Wer sich verirrt, entdeckt die Welt: Reiseführer leiten in möglichst effizienter Weise von Sehenswürdigkeit A zu Sehenswürdigkeit B. Die logische Folge: Man bekommt nur das zu sehen, wovon andere behaupten, es sei sehenswert. Am Ende des Urlaubs hat man zwar alles gesehen, was im Reiseführer steht, aber darüber hinaus immer noch keine Ahnung, wo man eigentlich war. Verirrungen hingegen verschaffen Reisenden einen vollkommen neuen, angenehm willkürlichen Eindruck von der Urlaubsgegend, außerdem lernt man seine Umgebung viel intensiver kennen als auf herkömmliche Weise. Wer mit einer Landkarte unterwegs ist, starrt mindestens die Hälfte der Zeit in die Karte oder aufs Gerät. Wer ohne Landkarte auskommt, sieht also doppelt so viel von der Umgebung. Man wird doppelt so viele seltene Tiere, doppelt so viele Burgruinen und doppelt so viele kristallklare Bergseen zu Gesicht bekommen. Mehr noch: Verirrte betrachten die Umgebung, über die sie praktisch nichts wissen, wie mit einer Lupe und entwickeln so die Fähigkeit, auch in scheinbar trostlosen Gegenden Interessantes zu finden. Wer sich im Nebel verirrt und nicht einfach per Kompass den Weg nach Hause finden kann, wird sich jeden Stein ganz genau ansehen, um ihn im Notfall wiederzuerkennen. Auf diese Weise findet man auch den Klippschliefer, der sich in einer Felsspalte versteckt hält, oder wenigstens hin und wieder einen Kronkorken. Mit einer Karte ausgerüstet, wird man die Welt stark verkleinert wahrnehmen und so zwangsläufig zu dem Schluss kommen, dass die jeweilige Umgebung, ob Großstadt oder Wildnis, nur eine begrenzte Anzahl von Einzelheiten enthält, nämlich die, die auf der Karte eingezeichnet sind. In Wirklichkeit ist jeder Quadratmeter der Erde (mit Ausnahme vielleicht einiger Stellen in der Innenstadt von Málaga) voll interessanter Details – wenn man nur genau genug hinsieht. Bei der Gelegenheit lernt man außerdem, wie das eigene Gehirn mit der existenziellen Herausforderung mangelnder Orientierung umgeht. Das ist gut, denn über das Innere des eigenen Kopfes wissen wir viel weniger als über die meisten exotischen Länder.
6. Wer sich verirrt, lebt länger: Auch nach dem Ende des unfreiwilligen Verirrens wird es voraussichtlich noch eine Weile möglich sein, GPS-fähige Geräte im Kofferraum oder zu Hause liegenzulassen. Fehlende Orientierung als Ursache von Unfällen wird daher nicht vollständig aus der Statistik verschwinden. Die kausale Abfolge sieht traditionell wie folgt aus: Zunächst verirrt man sich, dann gerät man in Panik, was einen derart in Anspruch nimmt, dass man nicht mehr in der Lage ist, auf die eigenen Füße und die im Weg stehenden Hindernisse zu achten, was wiederum zu verstauchten Knöcheln, Beinbrüchen und hässlichen Erfrierungen führt. Es schadet daher nicht, sich eingehender mit der Frage zu befassen: Wie kann man sich verirren, ohne in Panik zu geraten? In Kampfsportschulen lernt man als Erstes das Hinfallen, und Kajakfahrende üben die Kenterrolle, anstatt das Wildwasser ängstlich zu meiden. Aus den gleichen Gründen empfiehlt es sich, hin und wieder den Umgang mit der Orientierungslosigkeit zu üben. Wenn man das Verirren beherrscht, wird man nicht gleich nervös, nur weil man sich im Himalaja oder auf dem Weg zur Post verläuft, und stürzt darum nicht in den nächstbesten Abgrund. So hat man einen sicheren Notausgang für den Fall, dass die Orientierung versagt – man verirrt sich einfach auf kultivierte Art und Weise und stirbt deshalb nicht sofort, sondern später (aus vollkommen anderen Gründen).
7. Karte und Kompass sind Laienwerkzeuge: Viele tausend Jahre vor der Erfindung der Landkarte fanden polynesische Seeleute den Weg von Insel zu Insel, oft über Tausende von Kilometern, in winzigen Holzkanus. Sie navigierten mit Hilfe von Sternen, Sonne, Mond unter guten Bedingungen oder anhand der Wind- und Strömungsrichtung, wenn es bewölkt war. Sie waren in der Lage, die Positionen von Walen, Quallen und Fliegenden Fischen zu lesen und zur eigenen Orientierung zu nutzen. Noch heute gibt es in der Südsee Fachleute, die auf dem Boden von Kanus liegen und anhand verschiedener Strömungen fühlen, in welche Richtung sie sich bewegen. Echte Orientierungsprofis kalkulieren die Fehlbarkeit menschlicher Erkenntnis ein, und darum ist kunstvolles Verirren ein wesentlicher Bestandteil ihrer Reisen. Verirren ist nicht das Gegenteil von Orientierung – Orientierungskompetenz ist gleichzeitig auch Verirrenskompetenz.
8. Orientierung ist eine Illusion: Noch vor relativ kurzer Zeit glaubte die Menschheit ihren Standort ganz genau zu kennen – nämlich im Mittelpunkt einer Scheibe, die wiederum im Mittelpunkt des Kosmos liegt. Es hat mehrere tausend Jahre, große Mühen und zahlreiche Updates im Weltbild gekostet, um herauszufinden, dass diese Ansicht falsch ist. Der wissenschaftliche Konsens heute: Wir befinden uns irgendwo im Universum. Paradox ist es, wenn im selben Zeitraum, in dem sich diese weise Erkenntnis durchsetzt, Google Maps und GPS erfunden werden, die uns von Neuem die Illusion verschaffen, wir wüssten ganz genau, wo wir uns befinden. In einem engbegrenzten Bereich mag das zwar stimmen, aber das dadurch vermittelte Weltbild ist arrogant, größenwahnsinnig und genauso falsch wie das der Vorsokratiker. Es ist keine große Kunst, auf Anhieb die Akropolis zu finden, darauf muss man sich wirklich nichts einbilden. Wer sich jedoch auf dem Weg durch Athen gründlich verirrt und am Ende alles Mögliche, nur nicht die Akropolis findet, erhält eine praktische Einführung in die verwirrende Natur des Kosmos. Man bleibt bescheiden und erhält sich ein realistisches, undogmatisches Weltbild.
Mit etwas Übung fällt es leicht, dem Verirren vielfältige Vorzüge abzugewinnen. Tatsächlich lautete der ursprüngliche Plan für dieses Buch, eine 250-seitige schöngefärbte Reklameschrift für das Verirren zu erstellen, in großen, blinkenden Leuchtbuchstaben. Dann stellte sich allerdings heraus, dass die bisher existierenden Bücher, die sich mit dem Verirren befassen, auf wenige Regalzentimeter passen. Deshalb blieb uns nichts anderes übrig, als eine – zumindest stellenweise – ernsthafte Betrachtung des Verirrens und seiner Vor- und Nachteile zu schreiben, inklusive der dafür nötigen theoretischen Konzepte. Während die Lesenden im ersten Teil langsam an das Verirren als Freizeittechnik herangeführt werden, steigen wir anschließend tiefer in die Materie ein und beleuchten Hintergrund, Geschichte, Praxis und Folgen größer angelegter Verirrungen. Im abschließenden Teil geht es dann darum, wie es Fortgeschrittenen gelingt, das Prinzip Verirren zu transzendieren.
Dabei handelt es sich in den Grundzügen um eine empirische Studie. Im Verlauf der Arbeit an diesem Buch verirrten sich die Beteiligten circa zwölfmal in den schottischen Highlands, mehrfach in Kanada und Chile, je einmal in Hawaii, Tschechien, Dublin und auf dem Flughafen von Atlanta sowie zweimal auf dem Nachhauseweg. Abgesehen von den vielen interessanten und noch mehr uninteressanten Dingen, die dabei versehentlich entdeckt wurden, hatte dieses Verfahren einen großen Vorteil: Wer das Verirren erforscht, kann beim Waten durch weglose Sümpfe immer sagen: «Ich bin kein Idiot, ich sehe nur so aus. Ich recherchiere.»
A: Der AnfangNorden ist da, wo der Daumen rechts ist
Das Niagaraexperiment
Gegen 11 gingen wir spazieren und verliefen uns. Etwas sehr Bemerkenswertes trug sich zu. Gott nahm Parliament Hill für eine Weile vollständig hinweg. Es war ungemein verwirrend.
Evelyn Waugh: Tagebuch, 24. Juni 1924
Den kanadischen Indian Summer muss man sich wie einen Wanderzirkus vorstellen. Jede Woche zieht er ein Stück nach Süden und verwandelt die bislang grünen Wälder in ein Chaos aus Rot, Orange, Gelb. Gleichzeitig hinterlässt er weiter im Norden kahle Bäume und braunes Laub, das von Herbststürmen unordentlich im Land verteilt wird. Jede Woche bespielt der Indian Summer eine neue Gegend, und die Reisenden folgen seiner Wanderung von Norden nach Süden.
Als wir davon Wind bekommen, ist der Wanderzirkus schon an der Südkante des Landes angekommen. Auf dem Weg von Toronto nach Südwesten haben wir abgesehen von rotgelben Laubwäldern nur ein Ziel: auf keinen Fall die Niagarafälle aufsuchen, sondern stattdessen ein paar unbedeutende kleine Wasserkaskaden anderen Namens finden. Dieser Plan scheitert aufgrund einer winzigen Karte, die aus einem Informationsfaltblatt stammt und kurz vor den gesuchten Fällen endet. Nur zwei Tage nach dem Aufbruch landen wir zufällig doch in der Niagara-Gegend. Offenbar geht es nicht anders. Wir nehmen die Herausforderung an.
Wir parken das Auto am Eingang der «Niagara Parks’ Botanical Gardens», weil das so klingt, als sei es nah genug für einen Spaziergang zu den Wasserfällen. Ein Blick auf eine beliebige Karte der Gegend hätte gezeigt, dass es von hier noch zehn Kilometer zu den Fällen sind – auf der Straße jedenfalls. Lektion Nummer eins: Für die zurückzulegende Wegstrecke zwischen zwei Orten A und B gibt es zwar eine untere, aber keine obere Grenze.
Direkt östlich des Botanischen Gartens führen steile Treppen zum «Niagara Glen» hinab, in dem auch tatsächlich viel schäumendes Wasser zwischen Felsen dahinfließt. Wir sind ganz offensichtlich auf der richtigen Spur. Weil das Gewässer flussaufwärts noch etwas wilder aussieht als flussabwärts, liegt es auf der Hand, dass sich dort die großen Fälle befinden müssen. Mit etwas gutem Willen kann man schon ein mächtiges Rauschen vernehmen. Wahrscheinlich liegen sie gleich hinter der nächsten Flussbiegung. So denken wir auch noch nach der dritten Flussbiegung, die immer noch mehr Fluss und Wald, aber keinen Wasserfall ins Gesichtsfeld rückt. Schon länger gibt es keinen Pfad mehr. Links der brodelnde Fluss, vor uns weglose Wildnis, rechts die senkrechte Flanke der Schlucht, weit über uns die Straße mit den Eisverkäufern und allen sonstigen Annehmlichkeiten der Zivilisation. Der Fluss schlägt Haken durch den Fels, springt über Steine und benimmt sich überhaupt auf recht charismatische Art und Weise. Die Badebuchten am Ufer erscheinen oft minutenlang friedlich und glatt, um sich dann ohne erkennbaren Anlass in brodelnde Kessel zu verwandeln. Wasser ist eben unberechenbar, voller Turbulenzen und Chaos. Straßen dagegen sind vergleichsweise langweilig. Seit mehreren Stunden haben wir jetzt niemanden mehr getroffen. Wir kommen nur langsam voran, weil die Natur uns lauter interessante Dinge in den Weg stellt. Wer vorneweg läuft, hat zwar den Vorteil, sich den Weg durch Gebüsch, Felsen und von den Klippen heruntergeworfenen Sperrmüll aussuchen zu können, muss aber zum Ausgleich die Spinnennetze aus dem Weg räumen, in denen riesige Tiere auf Verirrte warten. Wir könnten umkehren, aber was würde das bringen? Langsam verschwindet die Sonne am oberen Ende der Schlucht.
Etwa vier Kilometer nördlich der Niagarafälle verengt sich die Schlucht und zwingt den Fluss durch einen schmalen Korridor. An dessen Ende biegt das Tal im rechten Winkel nach Osten ab. Weil das Wasser eine Weile braucht, um das zu verstehen, sammelt es sich hinter der Engstelle in einem Becken und dreht ein paar sinnlose Runden, bevor es nach einigem Nachdenken beschließt, ordnungsgemäß weiterzufließen. Die Engstelle jedoch enthält eine Serie an spektakulären Stromschnellen, die angeblich zu den gefährlichsten der Welt zählen, und ist damit die zweite wichtige Touristenattraktion, die der Niagara River zu bieten hat. Man erreicht die «Whirlpool Rapids» bequem, indem man knapp 20 Dollar bezahlt, an der Straße einen Aufzug besteigt, durch den Felsen nach unten fährt, um dann ein paar Minuten auf einer Aussichtsplattform zu stehen und versonnen ins schäumende Wasser zu sehen. Das alles kann man überall nachlesen – uns war es dank sorgfältiger Vermeidungsstrategien unbekannt.
Als unsere Verwunderung über das Ausbleiben der Niagarafälle und unser Missmut über die Spinnen im Gesicht ihren Höhepunkt erreichen, taucht aus dem dunklen Unterholz ein Geländer auf. Das Geländer gehört zur Aussichtsplattform ebenjener «Whirlpool Rapids». Über das Geländer klettern wir zurück in die Zivilisation. Das schäumende Wasser interessiert uns nicht mehr so sehr, die kalten Getränke in dem Getränkeautomaten auf der Plattform dafür umso mehr. Der Aufzug zurück in die Zivilisation ist von unten übrigens kostenlos.
Wir gelangen an diesem Tag doch noch zu den Niagarafällen. Vom oberen Ende des Whirlpool-Aufzugs sind es nur noch etwa vier Kilometer auf einer weitgehend spinnenfreien Straße. Statt zehn Minuten mit dem Auto haben wir etwa fünf Stunden zu Fuß benötigt. Aber dafür waren wir seit Langem die ersten Menschen, die die Niagarafälle vollkommen auf sich allein gestellt gefunden haben, ohne Karte, ohne Wegbeschreibung und nur mit einer vagen Vorstellung von ihrer Existenz. So ungefähr muss sich der französische Priester Louis Hennepin gefühlt haben, der im Jahre 1678 vermutlich als erster Europäer die Fälle entdeckte und sich von ihrer Größe und Macht äußerst beeindruckt zeigte. Im Jahr 2005 stellt sich nun heraus, dass die Niagarafälle von einem dichten Unterholz aus Luxushotels, Kasinos und Restaurants umgeben sind. Die Entdeckung der Welt schreitet eben unaufhörlich voran.
Abschied von der Karte
Verirren, heisset in eigentlichem Verstande von einem ordentlichen und gewöhnlichen Wege abkommen, dergleichen einem Reisenden sonderlich in den Wäldern leicht begegnen kan.
«Verirren», aus: Zedlers großes vollständiges Universallexicon aller Wissenschaften und Künste, 1732–1754
Es ist heute nicht einfach, sich auf dem Weg zu den Niagarafällen zu verirren. Das liegt vor allem an der Menge an leicht verfügbaren Informationen über die Lage und die Besonderheiten aller wichtigen geografischen Orte auf dem Planeten. Große Verlage und Outdoor-Unternehmen haben nichts anderes im Sinn, als Menschen davon abzuhalten, sich zu verirren. Diese Instanzen sind unsere natürlichen Gegenspieler. Der erste wichtige Schritt auf dem Weg zum qualifizierten Verirrten ist es daher, die allgegenwärtigen Reiseführer und Landkarten als das zu begreifen, was sie sind: eine Bedrohung. Danach kann man damit beginnen zu lernen, wie man am besten nichts über Weg und Ziel weiß.
Unkenntnis ist eine wichtige Grundvoraussetzung für richtiges Verirren. Man kann sich in der Gegend der Niagarafälle nur verirren, wenn man sich vorher gründlich damit befasst, nichts über die Topografie dieser Region zu erfahren. Insbesondere hilft es, über keine Landkarte zu verfügen. Landkarten sind Spielverderber. Sie sagen einem vorab, was man auf dem Weg zu seinem Ziel zu erwarten hat. Es ist, als würde man einen Film sehen, dessen genaue Handlung und Ende schon in allen Einzelheiten bekannt sind. Aus kaum verständlichen Gründen kommt jedoch fast niemand auf die Idee, zu verreisen, ohne sich vorher genau über Verlauf und Ende der Reise zu informieren. Jedes Jahr besuchen 15 Millionen Touristen die Niagarafälle, obwohl sie ganz genau wissen, was sie dort erwartet. Es ist ein großes Mysterium. Sie erforschen nicht die Welt, sondern ihre Vorstellung davon. Zunächst erstellen sie ein Modell der Zielgegend in ihrem Kopf, basierend auf den Informationen, die andere Leute vorher zusammengetragen haben. Dann gleichen sie das Modell mit der Wirklichkeit ab – eine klassische wissenschaftliche Vorgehensweise. Die Entdeckung des Planeten Neptun im Jahr 1846 lief zum Beispiel nicht anders ab: erst ein Modell ausdenken, dann vorhersagen, wo sich der Planet aufhält, dann nachsehen, ob er auch wirklich dort ist. Was bei Neptun gut funktioniert hat, wirkt bei den Niagarafällen albern. Auf diese Art beweisen jedes Jahr 15 Millionen Menschen durch ihren Aufenthalt an den Niagarafällen, dass die Reiseführer recht haben. Mehr findet man so aber kaum heraus.
Der erste Schritt zum Verirren ist es daher, nicht auf die Karte zu sehen. Am leichtesten widersteht man der Versuchung, wenn man gar keine hat, weder aus Papier noch auf den Geräten. Das kostet am Anfang etwas Überwindung, vergleichbar etwa mit dem Abmontieren von Stützrädern am Fahrrad oder dem ersten Mal im tiefen Wasser ohne Schwimmflügel. Und ähnlich wie beim Radfahren und beim Schwimmen wird es beim ersten Mal nicht sofort klappen. Die Anfängerin wird sich in schwachen Momenten die Karte zurückwünschen. Sie wird zeitweilig ihre Entscheidung verfluchen, zum Beispiel dann, wenn ihr andere von all den Sehenswürdigkeiten vorschwärmen, die sie am Urlaubsort besichtigt haben, während sie vorwiegend in Industriegebieten und Vorstädten herumgeirrt ist. Aber es wird sich am Ende auszahlen.
Wir haben mit den Niagarafällen absichtlich ein harmloses Beispiel für den Anfang ausgewählt. Es gibt dort weder Gletscherspalten noch wilde Tiere, die sich diese Bezeichnung durch regelmäßigen Verzehr von Menschen verdienen. Dasselbe Prinzip lässt sich jedoch grundsätzlich auf jede Gegend der Welt anwenden. In der Wahl ihrer Ziele unterscheiden sich Unerfahrene von Profis, die einen verirren sich besser im Ruhrgebiet, die anderen im australischen Outback.
Chris McCandless gehörte zur zweiten Kategorie. Der junge Amerikaner lebte jahrelang auf der Straße, in den Wäldern, in der Wüste, in Abkehr von der Zivilisation. Im Frühjahr 1992 trampte er nach Alaska, um sein Ideal zu verwirklichen. Jon Krakauer schreibt dazu in seinem Buch «Into the Wild»: «McCandless sehnte sich danach, unerforschtes Territorium zu durchwandern, einen weißen Fleck auf der Landkarte zu finden. Leider gab es 1992 keine weißen Flecken mehr auf der Landkarte – weder in Alaska noch anderswo. Aber Chris fand eine elegante Lösung für das Problem: Er nahm einfach keine Karte mit. Wenigstens in seinem Kopf war das Land immer noch unbekannt: terra incognita.» McCandless soll hier nicht als Vorbild dienen, denn er kam bei seinem Unterfangen um. Das Mantra der Verirrten sollte lauten: Wenn man dabei stirbt, war es nur halb so gut. Wenn überhaupt.
Auf der Suche nach einer akademischen Definition des Begriffs «Verirren» stößt man auf Kenneth Hill, Professor für Psychologie an der Universität Saint Mary in Halifax in Kanada. Hill ist einer der wenigen Forscher weltweit, die sich vorwiegend mit dem Verirren befassen. Der Schwerpunkt seiner Forschung liegt auf dem Verhalten verirrter Personen. Wenn man – so seine Argumentation – weiß, wie Verirrte denken, was sie bewegt und wie sie sich bewegen, kann man sie leichter retten. An dieser Stelle wird bereits deutlich, dass es Hill nur um die Unterkategorie der hilflos Verirrten geht, denn nur solche müssen gerettet werden. Für uns sind seine Forschungen vor allem nützlich, um herauszufinden, wie man es anstellen kann, möglichst wenig gerettet werden zu müssen. Deshalb wird Kenneth Hill noch häufiger eine Rolle spielen.
Hills Definition des Verirrtseins hat zwei Teile: Die verirrte Person weiß zum einen nicht, wo sie sich in Relation zu bekannten Orten befindet. Zum anderen ist die verirrte Person nicht imstande, die Orientierung wiederzuerlangen. Diese Definition ist für unsere Zwecke untauglich, denn zumindest der zweite Teil impliziert, dass Verirren in jedem Fall problematisch ist. Sie bedeutet auch, dass man sich unmöglich in Städten oder zivilisierten Landstrichen verirren kann, wo es normalerweise genügt, auf der Straße jemanden zu fragen. Auch die eingangs geschilderte Episode auf dem Weg zu den Niagarafällen hätte mit Verirren nichts zu tun, denn natürlich hätten wir jederzeit einfach zurück zum Auto laufen können. Legt man den strengen Maßstab von Hill an, wird man es als Neuling schwer haben. Wir brauchen also eine Definition für den Zustand, in dem man nur ein bisschen verirrt ist – und zwar freiwillig.
Hills Definition lässt sich unserem Zweck leicht anpassen, indem man «nicht können» durch «nicht wollen» ersetzt: Zum einen will die verirrte Person nicht wissen, wo sie sich in Relation zu bekannten Orten befindet. Zum anderen ist sie – zumindest vorübergehend – nicht daran interessiert, die Orientierung wiederzuerlangen. Ungefähr das ist es, was wir mit Verirren meinen.
Will man vermeiden, dass aus dem gewollten Verirren eine Notlage wird, aus dem «Nicht-Wollen» unfreiwillig ein «Nicht-Können», dann muss man sich ein Repertoire an Techniken und Kenntnissen aneignen, mit deren Hilfe man sich aus der selbstverschuldeten Desorientierung wieder befreien kann. Nur wenn man jederzeit in der Lage ist, das Verirrspiel zu beenden, kann man wirklich behaupten, das Verirren zu beherrschen. (Niemand würde sagen, er könne schwimmen, nur weil er imstande ist, in tiefes Wasser zu springen.) Für den Anfang sind die Selbstrettungsstrategien denkbar einfach; sie umfassen so naheliegende Kulturtechniken wie «Menschen ansprechen» und «Taxi rufen», wir werden das im Einzelnen noch durchgehen. Profis dagegen müssen praktisch alles über ihre Umgebung lernen, bevor sie ernsthaft daran denken können, sich in ihr zu verirren. Doch darüber später mehr.
Die erste Verirrung
Er hatte keine Ahnung, wo er sich befand. Wenn man am Wittenbergplatz auf den Autobus 1 klettert, an der Potsdamer Brücke in eine Straßenbahn umsteigt, ohne deren Nummer zu lesen, und zwanzig Minuten später den Wagen verlässt, weil plötzlich eine Frau drinsitzt, die Friedrich dem Großen ähnelt, kann man wirklich nicht wissen, wo man ist.
Erich Kästner: «Fabian»
Im Unterschied zur Wissenschaft kann sich die Weltliteratur kaum über einen Mangel an Auseinandersetzung mit dem Verirren beklagen. Die Erfahrung, nicht zu wissen, wo man sich aufhält, hat offenbar Auswirkungen auf den Arbeitsprozess von Kunstschaffenden, anders lässt sich die Vielzahl der erfundenen Irrfahrten nicht erklären. Vielleicht verirren sich Autorinnen und Autoren auch einfach unverhältnismäßig oft. Vermutlich hat alles mit Odysseus angefangen, der sich mit seinen Gefährten auf der Heimfahrt vom Krieg um Troja gründlich im Mittelmeerraum verirrte und auf dem Weg eine Reihe von bizarren Abenteuern erlebte. Nicht etwa, weil er nicht wusste, wo er sich befand, sondern weil es damals noch einäugige Riesen und Sonnengötter gab.
Die Odyssee stellt so etwas wie den Prototyp aller Irrfahrten dar. Odysseus selbst gilt als Vorbild für einen ganzen Katalog von verirrten und darüber hinaus verwirrten Menschen in der abendländischen Literatur. Dabei hatten Odysseus und seine Zeitgenossen es sehr einfach mit dem Verirren. In einer Zeit, in der die Erde nur aus Griechenland und Mittelmeer besteht und ungefähr an der Stelle von Marokko die Unterwelt vermutet wird, reicht eine minimale Verkettung unglücklicher Umstände, und schon findet man jahrelang sein Zuhause nicht mehr. Odysseus musste keine Landkarte wegwerfen, um sich zu verirren, denn er hatte überhaupt keine. Er musste auch keinen Ratgeber kaufen, um sich verirren zu können. Stattdessen geriet er einfach in ein paar Stürme, die sein Schiff in Gegenden spülten, die vorher noch kein Mensch gesehen hatte. Glückliche, sorgenfreie Zeiten waren das damals.
Wir dagegen müssen zu Tricks greifen, um die Orientierung zu verlieren und die erste kleine Odyssee zu erleben. Hier ist ein Vorschlag: Man suche sich einen Startort und einen Zielort, die mindestens ein paar Kilometer auseinanderliegen. Ideal sind zwei Dörfer mit nichts als Wald und Wiesen dazwischen oder zwei U-Bahn-Stationen in einer großen Stadt oder zwei Kneipen in unterschiedlichen Stadtteilen. Wichtig ist, dass sowohl Start als auch Ziel in Gegenden liegen, deren Topografie man nur unzureichend kennt, wofür es normalerweise ausreicht, sich ein paar Meter von seiner Wohnung wegzubewegen. Natürlich ist die Benutzung von Landkarten und GPS strikt zu unterlassen, sowohl vor dem Ausflug als auch währenddessen. Noch ein Hinweis: Durch Auswahl von Start- und Zielort trifft man gleichzeitig eine Entscheidung über das Areal, in dem man sich verirren wird. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass man sich überdurchschnittlich oft auf dem Weg von A nach B verirrt, also grob gesagt in der Nähe von A und B – und nicht etwa ganz woanders. Wer als Startort Kathmandu wählt, die Hauptstadt Nepals, und als Ziel Lhasa in Tibet, darf sich nicht wundern, wenn er unterwegs auf ein paar recht hohe Berge trifft. Für den Anfang nimmt man vielleicht besser Orte, für die zumindest sichergestellt ist, dass sie sich in Mitteleuropa befinden.
Dieses Experiment kann natürlich auch schiefgehen. Im schlimmsten Fall führt ein breiter, geteerter Radweg direkt von A nach B, gänzlich ohne hilfreiche Eigenschaften wie unbeschilderte Kreuzungen oder Sackgassen. Durch solche Umstände sind schon zahllose Menschen zu uninteressanten Spaziergängen gezwungen worden. Aber es gibt einen einfachen Ausweg: den Weg verlassen. «Den Weg verlassen» ist das ultimative Rezept zum Verirren. Haken schlagen, ein, zwei Rechts-links-Kombinationen in unbekanntes Terrain, Wegweiser ignorieren, und schon fängt man an, heimlich nach dem Stand der Sonne zu sehen – ein klares Zeichen, dass man sich erfolgreich verirrt hat.
Wege sind eine wundervolle Einrichtung. Trampelpfade kennzeichnen das Ergebnis einer über lange Jahre geführten demokratischen Abstimmung bezüglich der besten Strecke zwischen zwei Orten. Sie symbolisieren Zivilisation, Klarheit, Struktur, im Unterschied zum Chaos der weglosen Wildnis. Wege vereinfachen das oft mühsame Geschäft der Fortbewegung, speziell, wenn zwischen A und B nichts als Sumpf und Busch liegen. Andererseits sind Wege auch Konventionen; sie geben aus einer unendlich großen Anzahl von möglichen Routen eine vor, und alle rennen hinterher. Insofern halten Wege Menschen davon ab, sich Gedanken über die Umgebung zu machen, Gedanken über Steine, Pflanzen, Gewässer, Richtung, Orientierung. Wege nehmen uns viel Arbeit ab, aber leider auch Arbeit, die überaus interessant ist.
Ein gespaltenes Verhältnis zu Wegen ist ein Markenzeichen der Verirrensfachleute. Wenn man sie fragt, wie am besten von A nach B zu gelangen sei, werden sie zum Beispiel nie sagen: «Einfach dem Weg folgen.» Stattdessen ist eine Antwort wie diese hier wahrscheinlicher: «Lauf ungefähr in die Richtung des Kirchturms am Horizont.» So nämlich gehen Erfahrene vor: Wege nicht ignorieren, aber wahrnehmen als das, was sie sind – eine von vielen Optionen, von A nach B zu gelangen. Es ist nichts falsch daran, über Zäune zu steigen, quer über Felder zu laufen oder durch Bäche zu waten, auch wenn der Weg uns das einzureden versucht.
Eric Newby kündigt im Sommer 1956 seinen Job, der mit Frauenkleidern zu tun hatte, um mit seinem Freund, dem britischen Diplomaten Hugh Carless, nach Afghanistan zu reisen und dort einen furchteinflößenden Berg im Hindukusch zu besteigen. Die beiden sind schlecht ausgerüstet und haben keine Ahnung vom Bergsteigen, dafür aber viel Ahnung vom Improvisieren. In einem verlassenen Tal in der Provinz Panjshir ignorieren Newby und Carless die Straße, weil es anderswo bequemer aussieht, und kommen daraufhin beinahe um, als sie einen reißenden Strom zu überqueren versuchen. Ihr afghanischer Begleiter bemerkt weise: «Es gibt nur einen Weg, und das ist der Weg der Straße.» Hugh Carless interessiert sich nicht besonders für Weisheiten. Wenige Kilometer später überquert die Straße einen Fluss, Carless jedoch wandert alleine und weglos am anderen Ufer weiter. Wie Newby bald herausfindet, verwandelt sich die Straße in einen Schlammpfuhl und verläuft außerdem in wirren Schleifen. Carless ist ohne Straße deutlich früher am verabredeten Rastplatz. «Es gibt nur einen Weg, und das ist der Weg der Straße», hält er dem Afghanen entgegen, der errötet. Newbys Bericht über den «Spaziergang im Hindukusch» wurde sein erfolgreichstes Buch.
So verhält es sich mit Wegen. Oft sind sie nützlich und brauchbar. Dann aber auch wieder nicht. Man weiß es immer erst hinterher.
Die reale Virtualität
Es ist übrigens sehr auffallend, daß die Einwohner einer Gegend oder eines Orts immer von den Gegenständen oder Merkwürdigkeiten derselben am wenigsten Bescheid wissen und weil sie an ihren Anblik gewöhnt sind, gar keine Aufmerksamkeit darauf wenden.
Friedrich August Köhler:
«Eine Alb-Reise im Jahre 1790 zu Fuß von Tübingen nach Ulm»
Ein Ansatz, um Verirrungen und den Umgang damit zu üben, sieht wie folgt aus: Man betrachte die echte Welt so, als sei sie ein Computerspiel. Gemeint sind nicht die Simulationen von Autorennen, in denen man mit 300 Stundenkilometern durch Fußgängerzonen manövriert, auch nicht Spiele, in denen es vor allem darauf ankommt, die Raumschiffe von Außerirdischen zu vernichten. Nein, es geht hier um dreidimensionale virtuelle Welten, in denen man eine Figur bewegt, die spezifische Aufgaben zu erfüllen hat. Im Interesse seiner Umgebung sollte man allerdings darauf verzichten, Spiele in die materielle Welt zu übertragen, bei denen die Aufgabe im Wesentlichen darin besteht, alle Mitlebewesen umzubringen. Der verallgemeinerte Ablauf solcher Abenteuerspiele sieht ungefähr wie folgt aus: Eine Person, zum Beispiel ein Avatar des Spielers, wird in eine Umgebung gesetzt. Die Umgebung kann aussehen wie eine normale Landschaft, aber auch wie eine exotische Galaxie mit metallischen Wesen, denen Qualm aus den Ohren kommt und dergleichen mehr. Auf solche Dinge muss man in virtuellen Welten immer gefasst sein. Über die Landschaft verstreut sind interaktive Elemente, die für