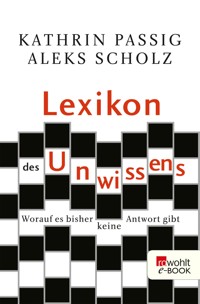4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Siegeszug des Internets ist unaufhaltsam. Zugleich verschärft sich die Debatte zwischen Netzoptimisten und Kritikern. Ob Google Street View, der digitale Mob oder die heiklen Datenmassen auf Facebook und Wikileaks – das Internet verändert unseren Alltag und sorgt für gesellschaftspolitische Diskussionen mit teils kulturkampfartigen Zügen: Macht uns das Smartphone freier oder abhängiger? Sind soziale Medien gut oder schlecht für das Sozialleben? Beeinflusst das Netz unsere Wahrnehmung, unser Denken? Hilft es den Kreativen, oder zerstört es geistiges Eigentum? Unterstützt es die Demokratisierung der Welt, oder erlaubt es Diktaturen die totale Überwachung? Die beiden Internet-Vorreiter Kathrin Passig und Sascha Lobo kennen die Streitfälle und Positionen zum Netz. Nun, nach der ersten großen Welle der digitalen Revolution, ziehen sie Bilanz: Sie erörtern klug, unterhaltsam und mit enormer Sachkenntnis alle drängenden Probleme, geben Antworten und wagen den Ausblick, wohin sich unsere vernetzte Welt entwickeln wird. Ein wichtiger, klärender Beitrag zur Debatte, eine glänzende Analyse unserer Gegenwart und ein Blick in die Zukunft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Kathrin Passig • Sascha Lobo
Internet – Segen oder Fluch
Rowohlt Digitalbuch
Inhaltsübersicht
Einleitung
Können andere Menschen mal aufhören, immer diese anderen Meinungen zu haben? Das macht alles so unnötig anstrengend.
Jan Bölsche, Twitter, 3. März 2009
Unbestreitbar: das Netz verändert die Welt. Die Frage aber, ob zum Guten oder zum Schlechten, ist nicht so eindeutig zu beantworten, wie die Verfechter beider Ansichten es gern hätten. Die einen bewegen sich in einem Feld zwischen fortschrittsgläubiger Naivität und selbstbewusstem Optimismus, die anderen verharren zwischen gesunder Skepsis und verbittertem Pessimismus. In der Diskussion steht oft Bauchgefühl gegen Bauchgefühl, und Argumente werden nur akzeptiert, wenn sie zu diesem Gefühl passen. Einen ärgerlich großen Raum nehmen reflexhafte Phrasen und kaum belegbare Behauptungen ein, verbunden zu einem emotionalen Amalgam, das mehr die Gruppenzugehörigkeiten festigen als irgendjemanden überzeugen soll. Regelmäßig lassen sich Diskussionspodien, Talkshowkonfrontationen und Artikelgefechte beobachten, deren Teilnehmer weniger an der Vermittlung und Erklärung interessiert sind als an der Selbstvergewisserung, und oft genug waren diese Teilnehmer die Autoren des vorliegenden Buches. Der dringend notwendige Diskurs um das Internet, seine Bedeutung für unser Leben und seine Folgen für die Welt ist ritualisiert und erstarrt. Die Diskussionsteilnehmer laben sich am Gefühl der eigenen Wichtigkeit, das Gegenüber verstärkt dieses Gefühl – denn ein Pluspol ist nichts ohne einen Minuspol und umgekehrt.
Zu allem Überfluss erweist sich die Lagerzugehörigkeit der Beteiligten auch noch als ausgesprochen unzuverlässig: Wer eben noch als Teil der Avantgarde den Fortschritt bejubelte, kann sich schon beim direkt benachbarten Thema als Erztraditionalist entpuppen, für den jede Diskussion über eine Weiterentwicklung Teufelszeug ist. Wenn wir in diesem Buch von «Skeptikern» und «Optimisten» schreiben, meinen wir damit also nicht, dass es grundsätzlich zwei Sorten von Menschen gibt. Niemand hat eine konsistente Haltung in diesen Fragen.
Was Politiker, Journalisten, Verleger, Blogger, Datenschutzbeauftragte, Musikmanager, Optimisten und Pessimisten allerdings nicht daran hindert, immer wieder dieselben Argumente auszutauschen. Und so geht das nicht erst seit gestern. Die Risiken, die der Einsatz von Computern mit sich bringt, werden seit den siebziger Jahren diskutiert. Ob Maschinen die Welt verbessern oder nicht, beschäftigt die Menschheit seit mindestens zweihundert Jahren, ebenso wie die Frage, ob technische Weiterentwicklungen Arbeitsplätze schaffen oder vernichten. Soll jeder einfach alles veröffentlichen können, was er sich so ausgedacht hat? Wie soll sich noch irgendjemand in der dadurch entstehenden Informationsflut zurechtfinden? Diese Themen waren schon vor der Einführung des Buchdrucks umstritten.
Die Recherchen zu diesem Buch haben eine zuvor nur vage vorhandene Ahnung bestätigt: Die Diskussion, die heute vom Internet handelt, ist weitgehend unverändert seit Jahrhunderten im Gang, wir sind Marionetten, die ein uraltes Stück aufführen.
Bauch – Hose
Autor – Deadline
Dagobert – Klaas Klever
Staub – Wedel
Schwerkraft – Entropie
Figur im linken Wetterhäuschen – Figur im rechten Wetterhäuschen
Kasperle – Krokodil
ein ultimatives Schlussbier – ach, noch eins
Death Metal – Power Metal
Popper – Adorno
Punk – Popper
Popper – Lakatos
Roadrunner – Wile E. Coyote
brenne auf, mein Licht – nur meine liebe Laterne nicht
Wenn sich über derart lange Zeiträume lediglich die aktuellen Symptome ändern, die Diskussion aber lebendig bleibt, zeigt das: Es handelt sich eben nicht um ein Verständnisproblem, das sich in Bälde durch den Generationenwechsel von allein lösen wird, sondern um einen dauerhafteren, komplexeren Konflikt, mit dem wir einen Umgang finden müssen.
Es ist also Zeit für ein wenig Völkerverständigung: Was sagen die Skeptiker? Was die Optimisten? Und was meinen sie damit eigentlich? Dieses Buch soll beiden vermitteln, dass die andere Seite Gründe für ihre Haltung hat und nicht aus unbegreiflich vernagelten Personen besteht. Oder jedenfalls nicht nur. Eine Lösung im Sinne versöhnlicher Antworten enthält dieses Buch aber nicht. Schon weil es gar keine Lösung gibt, mit der alle zufrieden wären. Letztlich wollen mehr oder weniger alle Beteiligten die Welt besser machen, sie haben nur unterschiedliche Meinungen darüber, was genau «besser» bedeutet und wie man dorthin gelangt.
Wir schreiben dieses Buch natürlich nicht zufällig genau jetzt. Beide Autoren haben ein Alter erreicht, in dem man auch ganz ohne historische Kenntnisse bei einigen Debatten feststellt: Moment, das hatten wir doch schon mal. Gleichzeitig wachsen Anhänger des noch Neueren heran, die unsere Position bedrohen. Die Statistik spricht dafür, dass wir uns ab jetzt allmählich verpuppen werden und in ein paar Jahren mit dem Verfassen nostalgischer Klagen über das schöne Internet von früher sowie schlecht gelaunter Zukunftsprognosen beginnen. Im Moment aber stehen wir noch mit einem Bein in beiden Welten und können deshalb über beide schreiben.
Das Buch ist praktisch stufenlos verstellbar. Zu Beginn werden die Themenfelder behandelt, die selbst hartnäckige Internetverweigerer beschäftigen dürften, weiter hinten geht es dann um wesentliche Fragen des digitalen Alltags. Es gibt Kapitel für jedes Interesse und jeden Kenntnisstand. Einige Kapitel enthalten am Ende einen Anhang mit schlechten Argumenten. Wir wollten die Diskussion optimieren, weshalb wir zeigen, auf welche Argumente man verzichten kann und warum. Das spart Zeit und erhöht die Chance, dass die Debatte fruchtet, bevor alle Beteiligten versterben.
In den ersten vier Kapiteln werden einige Probleme erklärt, die Diskussionen und Technologien ganz allgemein betreffen. Im ersten Kapitel geht es um Verständigungsschwierigkeiten in Debatten, insbesondere zwischen Technikoptimisten und Technikskeptikern. Die unter anderem daher rühren, dass man selbst dann subjektiv argumentiert, wenn man fest davon überzeugt ist, objektiv zu sein, und dafür sogar Studien und Zeugen sonder Zahl aufbringen kann. Danach geht es um die Vor- und Nachteile der Metapher als Erklärungsinstrument und die Wirkung der Narrative – der oft kolportierten Erzählungen, die die Weltsicht prägen.
Das dritte Kapitel handelt vom schwierigen Umgang mit allem Neuen. Die einen halten das Neue grundsätzlich für den Untergang des Abendlandes, die anderen vermuten in jedem neuen Gadget diesmal aber wirklich den Bringer des Weltfriedens. Warum ist es so schwer, einen entspannten Umgang mit dem Neuen zu finden? Und schließlich geht es um die Frage, was eigentlich mit dem oft zur Rechtfertigung von Veränderungen herbeibemühten «Fortschritt» gemeint ist. Gibt es ihn überhaupt? Und wenn ja, worin äußert er sich? Lebensglück? Reichtum? Geschwindigkeit der Internet-Anbindung?
Direkt danach kommen wir bereits zur eigentlichen Sache. Das fünfte Kapitel widmet sich der Disruption, also der schöpferischen Zerstörung und dem Umstand, dass es zwar aus der Ferne lustig anzusehen ist, wenn sie den Stummfilm oder irgendeine andere Branche dahinrafft, in der man nicht selbst tätig ist. Bis man kurz nicht aufpasst und der eigene Arbeitsplatz durch eine iPhone-App für neunundneunzig Cent überflüssig gemacht wird. Im sechsten Kapitel geht es um die Beschleunigung, die im Prinzip seit ihrer Erfindung beklagt wird. Aber beschleunigt sich mit dem Internet jetzt sogar die Beschleunigung selbst in einem Maß, das uns endgültig überfordert? An dieses Kapitel schließt sein zweieiiger Zwilling an, die Informationsüberflutung. Schon vor der Erfindung des Buchdrucks war mehr aufgeschrieben worden, als ein einzelner Mensch je hätte verarbeiten können, und trotzdem dreht sich die Erde weiter. Sind also alle diesbezüglichen Probleme mit der digitalen Datenflut bloß ausgedacht und eingebildet? Wobei nicht nur die Menge der Informationen ständig wächst, sondern auch und vor allem die Menge an Quatsch, der so dahinbehauptet wird. Damit sind wir schon mitten im achten Kapitel, das von der Verlässlichkeit der Informationen handelt. Denn dass jeder ins Internet alles hineinschreiben kann, hat Vor- und Nachteile, eine Diskussion übrigens, die die Geisteswelt kurz nach der Erfindung des Buchdrucks praktisch baugleich geführt hat.
Das daran anschließende neunte Kapitel über Kollektive und Kollaborationen untersucht, was die Vielen und ihre angebliche oder tatsächliche Weisheit im Internet so bewirken und was nicht. Werden die genialischen Leistungen des Einzelnen überflüssig, oder verderben viele Köche auch digitalen Brei? Daran knüpft das zehnte Kapitel über Politik mit Hilfe des Internets an, in dem es um Segen und Fluch der Digitalen Demokratie geht und darum, was das ist oder sein könnte. Wird durch Liquid Democracy, Piratenpartei und twitternde Politiker alles besser? Oder ist das nur Kommunikationskosmetik, und die parlamentarische, repräsentative Demokratie lässt sich auch durch das Netz so schnell nicht ändern? Es folgt ein Kapitel über den Handlungsrahmen der Politik, also über Regulierung. Wo und wie kann, darf, soll die Politik in das Internet eingreifen? Die Streitigkeiten darüber gehören zu den heftigsten, aber auch wirkungsvollsten Internet-Debatten. Wirkungsvoll insofern, als hier der öffentliche Diskurs messbare Folgen hat.
Das zwölfte Kapitel handelt vom Datenschutz. Ist die Privatsphäre längst weg, und wir haben uns nur noch nicht damit abgefunden? Oder kann entschlossenes Eingreifen des Gesetzgebers das Ruder noch herumreißen? Die Fronten verlaufen bei dieser Diskussion nicht entlang abgesteckter Lagergrenzen wie progressiv und konservativ, ahnungslos und hochinformiert, Feuilletonautoren und Techniker, sondern ganz woanders.
Nach dem Umgang mit persönlichen Daten im Netz geht es um den Umgang der Personen im Datennetz miteinander, im Kapitel über Soziales, Nähe und Entfremdung. Kommen wir durch das Netz einander näher, beginnt ein empathischeres Zeitalter, wie Jeremy Rifkin 2009 schrieb? Und wie verträgt sich das mit den Vereinsamungstheorien der achtziger und neunziger Jahre, die seit 2010 einen neuen Schub bekommen haben, obwohl oder weil die sozialen Medien unglaubliche Verbreitung erfuhren?
Die sozialen Medien, zu deren Grundfunktionen das Teilen von Inhalten gehört, bohren in einer schon lange schwärenden Diskussionswunde. Das Urheberrecht wurde ab 2011, nicht zufällig mit den ersten Parlamentseinzügen der Piratenpartei, Gegenstand noch heftigerer Auseinandersetzungen als bisher und ist Thema unseres vierzehnten Kapitels. Digitale Kopien machen ohne Qualitätsverlust aus einem Ding zwei. Die bisherigen Gesetzes- und Geschäftsmodelle sowie Moralvorstellungen wollen zu dieser neuen Situation nicht mehr so recht passen. Oder?
Danach geht es um Filter- und Empfehlungsalgorithmen und um die Frage, ob wir uns von der Intuition und der Vielfalt menschlicher Empfehlungen zugunsten einer intransparenten, maschinengemachten Auswahl verabschieden. Führt diese Entwicklung zu einer Einengung unseres Horizonts? Sitzt das Problem im Kopf? Oder gibt es vielleicht gar kein Problem? Das sechzehnte und letzte Kapitel schließlich behandelt die Herrschaft der Maschinen. Werden wir selbst zur Maschine, sind wir Sklaven der Technik? Wie gefährlich ist die Benutzung von Ziehbrunnen? Sind Gesellschaft und warme Pullover vielleicht auch nur Technik? Am Ende steht ein Nachwort, in dem wir die ungeborenen Kapitel dieses Buchs betrauern.
Auch diesmal wird es wieder aufmerksame Leser und Rezensenten geben, denen auffällt, dass beide Autoren, trotz des Versuchs der Vermittlung in diesem Buch, hin und wieder das Digitale mehr loben als das bedruckte Papier, die Buchform und die klassische Verlagslandschaft. Vorwürfe der inkonsequenten Lebensführung werden nicht ausbleiben. David Weinberger wünschte sich in seinem letzten Buch «Too Big to Know» einen vorgefertigten Standardabsatz zur Rechtfertigung des Bücherschreibens, «den alle Autoren nicht-pessimistischer Bücher über das Internet einfach einfügen können». Weil es diesen Absatz noch nicht gibt, verweisen wir stattdessen auf Theodor Fontane, in dessen «Effi Briest» sich die beiden Romanfiguren Innstetten und Golchowski im späten 19. Jahrhundert darüber unterhalten, dass der Fürst Bismarck ausgerechnet eine Papiermühle betreibt. «‹Ja›, sagte Golchowski, ‹wenn man sich den Fürsten so als Papiermüller denkt! Es ist doch alles sehr merkwürdig; eigentlich kann er die Schreiberei nicht leiden, und das bedruckte Papier erst recht nicht, und nun legt er doch selber eine Papiermühle an.› ‹Schon recht, lieber Golchowski›, sagte Innstetten, ‹aber aus solchen Widersprüchen kommt man im Leben nicht heraus. Und da hilft auch kein Fürst und keine Größe.›»[1]
1. Null oder Eins? – Ja.
Über Verständigungsschwierigkeiten
Warum müssen Diskussionen über Heizungsbau nur immer in persönliche Beleidigungen und wüste Unterstellungen ausarten?
Daniel R./@kchkchkch, Twitter, 6. Juli 2009
Wenn wir von unserem Plan berichteten, dieses Buch zu schreiben, äußerten unsere Gesprächspartner nicht selten die Hoffnung, es werde uns darin gelingen, den komischen Internetskeptikervögeln einfach alles noch einmal ganz langsam und geduldig zu erklären und damit die Streitereien rund um das Netz endlich beizulegen.
Hinter dieser Annahme steckt ein Versagen der Vorstellungskraft beziehungsweise des Vorstellungswillens: Mangelhafte Kenntnis der Tatsachen sei der einzig denkbare Grund dafür, dass jemand eine andere Meinung vertreten könnte als die eigene. Das ist auf einem Gebiet, auf dem man noch vor sehr kurzer Zeit Politiker öffentlich darüber rätseln hören konnte, was wohl ein Browser sei, zwar nachvollziehbar, aber trotzdem falsch. Konflikte entspringen nur selten dem einfachen Mangel an Informationen. Ernsthafte Konflikte entspringen überhaupt recht selten Ursachen, zu denen das Adjektiv «einfach» passt. Und noch seltener lässt sich das, was zur Schlichtung erforderlich wäre, mit diesem Wort beschreiben.
Außerdem glaubt die gegnerische Seite mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls, sie habe sich nur noch nicht ausreichend verständlich gemacht. Nach einer Weile erliegen dann beide Seiten dem Irrglauben, es sei offensichtlich böser Wille, dass der Kontrahent immer noch nichts begreifen wolle, und deshalb dürfe man ruhig zu immer schrofferen und extremeren Argumenten greifen. Das ist ähnlich erfolgversprechend wie die Strategie, schlecht Deutsch verstehenden Ausländern den Weg zum Bahnhof einfach immer lauter zu erklären.
Dieses Kapitel widmet sich deshalb noch keinen konkreten Technikfragen, sondern den grundsätzlichen Verständigungsproblemen – speziell denen zwischen Technologieoptimisten und Technologieskeptikern. Die Auseinandersetzungen um das Internet entstehen nicht dadurch, dass die Menschen auf einer Seite der Debatte nur noch nicht genug wissen. Dabei handelt es sich bloß um das bequemste Argument, weil es die Lokalisierung des Problems und mögliche Lösung gleich ab Werk eingebaut hat. Genauso wenig aber werden sich die Konflikte auflösen, weil die neuen Techniken und Gebräuche als unnützer Tand erkannt werden und wieder aus der Mode kommen. An ihre Stelle treten dann ja nicht wieder die vorigen Zustände, sondern noch neuere, noch unverschämtere Zumutungen.
Auch Max Planck hatte nicht die Lösung gefunden, als er schrieb: «Eine neue wissenschaftliche Wahrheit pflegt sich nicht in der Weise durchzusetzen, dass ihre Gegner überzeugt werden und sich als belehrt erklären, sondern vielmehr dadurch, dass ihre Gegner allmählich aussterben und dass die heranwachsende Generation von vornherein mit der Wahrheit vertraut gemacht ist.» Plancks Darstellung stimmt zum einen schon in der Wissenschaftswelt nicht ganz, denn dort gelingt es immer wieder, sich zwar mühsam, aber doch zu Lebzeiten vieler Beteiligter auf ein neues Paradigma zu verständigen. Zum anderen beruht Plancks These auf der Vorstellung einer immer näher rückenden universellen «Wahrheit». Diese Idee ist in der Wissenschaft heute zumindest stark umstritten. Und im Unterschied zur öffentlichen Technikfolgendiskussion gibt es in der Wissenschaft ein zwar keineswegs perfektes, aber doch einigermaßen funktionierendes, formalisiertes System zur Einigung darüber, welche Behauptungen vorerst vom Tisch sind. Es kann nicht mehr jeder in ernstzunehmenden Medien eine Verteidigung des Phlogistons[2] oder neue Theorien über ein geozentrisches Weltbild veröffentlichen.
Das ist bei den in diesem Buch behandelten Meinungsverschiedenheiten anders. Die nachwachsenden Diskussionsteilnehmer mögen mit bestimmten Ausprägungen des Neuen vertraut sein, aber die Auseinandersetzungen über neue Technologien und soziale Praktiken hören dadurch nicht auf. Wer im 19. Jahrhundert davon ausging, mit dem Ableben einer Generation würden auch die Klagen über Beschleunigung und Informationsüberflutung durch die Telegraphie verschwinden, der täuschte sich. Die Symptome verschieben sich an eine andere Stelle, aber die Konflikte dahinter bleiben bestehen – vielleicht nicht ewig, aber zumindest so lange, dass einfaches Abwarten für keinen heute lebenden Menschen eine Lösung darstellt.
Zu den Hoffnungen auf eine einfache Lösung gehört auch die Vorstellung, man könne einen Konflikt durch Technik zum Verschwinden bringen. Der Informatiker Joseph Weizenbaum nennt in seinem 1976 erschienenen Buch «Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft» ein Beispiel: «Zur Zeit der Studentenunruhen an den amerikanischen Universitäten konnte man oft von wohlwollenden Rednern hören, die Unruhe, zumindest die an der eigenen Universität, sei hauptsächlich auf eine ungenügende Kommunikation zwischen den verschiedenen Teilen der Universität zurückzuführen, z.B. den Fakultäten, Fachschaften, der Administration usw. Somit wurde das ‹Problem› im Prinzip unter dem Aspekt der Kommunikation, d.h. als technisches gesehen. Aus diesem Grund konnte es mit technischen Mitteln gelöst werden, indem man z.B. verschiedene ‹heiße Drähte› etwa zwischen den Büros des Präsidenten und der Dekane legte.» In diesem Fall geht es um die etablierte Technik des Telefons, eine häufige Variante ist die Ankündigung, gerade frisch erfundene oder in naher Zukunft zu erwartende Technologien könnten den Konflikt aus der Welt schaffen.
Tatsächlich ist es in Einzelfällen möglich, soziale Probleme mit rein technischen Mitteln zu lösen. Die Verdrängung der Metallzahnpastatuben durch nicht knitternde Plastiktuben war das Ende des Beziehungsstreits um die Frage, ob die Zahnpasta ordentlich vom Tubenende her ausgedrückt werden muss oder man auch mal auf die Mitte drücken darf, wodurch die Tube vor der Zeit faltig wird. Hinter dem Streit steckt die Frage, was im Leben wichtiger ist: Aufmerksamkeit für kleinste Details (denn ohne sie gäbe es keine schön anzusehende Apple-Hardware) oder die Fähigkeit, an der richtigen Stelle und im rechten Moment Großzügigkeit walten zu lassen.
Vielleicht war die Zahnpastatube der einzige Konfliktanlass in einer ansonsten harmonischen Beziehung. Dann wäre die Plastiktube tatsächlich eine technische Lösung für ein soziales Problem. Wahrscheinlicher ist aber, dass die zerknitterte Tube nur einer von vielen möglichen Kristallisationskeimen des Streits war und dass sich die Diskussion nach ihrem Verschwinden aus dem Badezimmer auf das Thema Apple-Hardware verlagerte. Oder auf die Frage, wer eigentlich die Tube immer so schlampig hinlegt, anstatt sie auf den Deckel zu stellen.
Hinter der Vorstellung, eine Meinungsverschiedenheit beruhe lediglich auf Kommunikationsschwierigkeiten oder anderen technisch lösbaren Problemen, steckt die Annahme, es gebe gar keinen realen Konflikt zwischen den Beteiligten. Diese Annahme aber ist in den meisten Fällen mit dem Wort «Wunschdenken» noch schmeichelhaft umschrieben. Die von Weizenbaum angeführten Studentenunruhen beruhten auf echten Interessenkonflikten, und nicht anders verhält es sich mit den heutigen Diskussionen um die Folgen der Digitalisierung. Solange man sich nicht eingesteht, dass diese unterschiedlichen Interessen existieren, führt kein Weg zu einer einvernehmlichen Lösung oder wenigstens friedlichen Koexistenz.
Bei solchen Interessen geht es zum einen oft ganz schnöde ums Geldverdienen: Neue Entwicklungen gefährden den eigenen Arbeitsplatz. Mal ist die ganze Branche bedroht, mal konkurrieren eine alte und eine neue Strategie innerhalb derselben Firma, und man muss ganz konkret den eigenen Arbeitsplatz verteidigen. Eine mindestens ebenso große Rolle spielt das Selbstbild der Beteiligten. Niemand lässt sich gern öffentlich für nutzlos erklären, erst recht nicht von Leuten, denen das angeblich nutzlose Feld unbekannt, egal oder eine Mischung aus beidem ist. Aber Loblieder auf eine neue Technologie sind schwer zu singen, ohne dass darin nicht mindestens zwischen den Zeilen diejenigen schlecht wegkommen, die noch auf die Vorgängertechnik setzen.
Die Diskussion des Konflikts bringt ein weiteres Problem mit sich. Viele Interessengruppen und Einzelpersonen profitieren von Extrempositionen stärker als von einer entspannten Erläuterung der Neuerungen. Sachbuchautoren und Journalisten erhalten für alarmistische Thesen oder goldene Zukunftsvisionen mehr Aufmerksamkeit als für sachliche Aufklärung. Lobbygruppen und Institutionen können durch Verweis auf die Gefahren oder Chancen der neuen Technologien mehr Geld vom Staat und von anderen Geldgebern einwerben. Die Optimisten nutzen die Gelegenheit, sich moderner, jünger, angstfreier und zukunftszugewandter darzustellen, die Skeptiker sehen verantwortungsbewusster, kritischer und erwachsener aus. Wenn der eigene Lebensunterhalt oder das Selbstverständnis von der Meinung abhängen, die man über das Internet hegt, wird der Austausch von Argumenten zumindest kurzfristig wenig an dieser Meinung ändern.
Eine weitere verständigungshemmende Idee ist die Vorstellung eines digitalen Grabens, der die Welt in zwei klar unterschiedene Kulturen teilt. Vor wenigen Jahren waren das noch die «Onliner» und die «Offliner», aber weil demnächst selbst Heizdecken einen Internetanschluss mitbringen werden[1], verläuft die aktuelle Grabenversion zwischen «Digital Natives» und «Digital Immigrants». Wohlwollend interpretiert dient dieses Konzept der Verständigung. Die Begriffe tragen ja dem Umstand Rechnung, dass man den Umgang mit dem Internet in einem gewissen Alter nicht mehr so locker nebenbei lernt wie als Kind und Jugendlicher – und das Wissen um eben diesen Unterschied könnte die Toleranz im Umgang durchaus fördern. Allerdings sind solche Begriffe nicht ohne Tücken: Während man auf dem Weg vom «Offliner» zum «Onliner» nur ein paar geistige und technische Hürden zu überwinden brauchte, wird ein Immigrant aber zeitlebens einer bleiben. Das entmutigt einerseits Menschen, die ganz gern im Internet heimisch werden würden. Und es erlaubt anderen, die keine Lust auf eine Auseinandersetzung mit dem Netz haben, die Entwicklung tatenlos an sich vorbeiziehen zu lassen – schließlich haben sie ja in der Zeitung gelesen, dass sie sich im Internet sowieso nie mehr einleben werden.
Die alternativen Begriffe Digital Visitors und Digital Residents suggerieren zwar immer noch eine Schwarz-Weiß-Welt, aber immerhin eine mit flexiblerer Rollenwahl: Jeder ist irgendwo zu Hause und an den meisten anderen Orten nur zu Besuch. Aufs Netz übersetzt bedeutet das, dass sich (anders als bei der Migrantenmetapher) die Gruppenzugehörigkeit relativ leicht ändern lässt, indem man sich mehr mit dem Internet beschäftigt und so vom Besucher zum Bewohner wird. Es heißt aber auch, dass man nicht an beliebig vielen Orten gleichzeitig heimisch sein kann. Wer sich im Internet von 1995 bewegte wie ein Fisch im Wasser, der muss sich deshalb in den sozialen Netzwerken der nuller Jahre noch lange nicht zu Hause fühlen. Und wer mit Facebook gut zurechtkommt, der empfände vielleicht Twitter als Zumutung (wenn er es nutzen würde) und Google+ als steril (wenn er es kennen würde).
Würde die Vorstellung temporärer Daseinszustände die von unverrückbarer Gruppenzugehörigkeit ablösen, wäre also schon mal ein Schritt in Richtung Verständigung getan. Aber wenn wir der unpraktischen Komplexität menschlichen Herummeinens Rechnung tragen wollen, reichen auch zwei Schubladen nicht aus. Was die Haltung der Menschen zum Netz betrifft, stellte das «Deutsche Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet», ein Ableger der Deutschen Post, in einer Anfang 2012 veröffentlichten Studie sieben Gruppen vor: «Internetferne Verunsicherte», «Ordnungsfordernde Internet-Laien», «Verantwortungsbedachte Etablierte», «Postmaterielle Skeptiker», «Effizienzorientierte Performer», «Unbekümmerte Hedonisten» und «Digital Souveräne». Der Autor und Think-Tank-Gründer Robert Atkinson macht allein in den Debatten um die US-Netzpolitik acht verschiedene Milieus aus.[3] Mit nur ein wenig Recherche ließen sich sicher Studien finden, die die Menschheit in neun, zehn, elf oder achtunddreißig Kategorien einteilen, es fehlen eigentlich nur noch «Internetnutzer, die dem Kaiser gehören».
Und da das Internet aus vielen verschiedenen Welten, Aspekten und Möglichkeiten besteht, geht kaum jemand in nur einer einzigen Gruppe auf. Wer soziale Netzwerke etwas ausführlicher nutzt, wird feststellen, dass Freunde, mit denen er sich bisher in allen wichtigen Fragen einer Meinung glaubte, dort regelmäßig Überraschendes kundtun. Kaum hat man sich mühsam die Vorstellung einer verbindenden Netzavantgarde gebildet, stellt sich auch schon heraus, dass man in Wirklichkeit von regulierungsfreudigen CDU-Wählern umgeben ist, und Freunde, mit denen man sich eben noch über die Wichtigkeit des Datenschutzes einig war, wandern plötzlich zu Facebook ab. Dank der menschlichen Fähigkeit, an mehrere unvereinbare Dinge gleichzeitig zu glauben, kann sich jeder problemlos für einen Freund des Neuen und des Fortschritts halten, während er zugleich ein Internet in den Grenzen von 1995 fordert. Die populäre Vorstellung eines «Wir gegen die Anderen» zerfällt im Netz mehrmals täglich in neue, unerwartete Einzelteile.
Das bedeutet, dass man sich den im eigenen Umfeld vorgebrachten Ansichten und Forderungen nicht ohne weiteres Nachdenken anschließen sollte. Und auch die Gegenseite ist nicht der geschlossene Block, den Begriffe wie «die Netzgemeinde» oder «das Internet» versus «Urheberrechtsmaximalisten» oder «konservative Politiker» suggerieren. Bei Google+ sortiert man die Menschen, deren Updates man verfolgt, in «Kreise», die diesen Sachverhalt anschaulich machen. Schon in der analogen Welt gehört jeder Mensch verschiedenen Kreisen an. Von den Schwierigkeiten, die sich ergeben, wenn man gleichzeitig Urheber, Nutzer und womöglich sogar Verwerter kreativer Werke ist, wird im Kapitel über das Urheberrecht noch ausführlicher die Rede sein.
Obwohl die Welt so kompliziert ist, wird in diesem Buch immer wieder von den beiden Gruppen der «Optimisten» und der «Skeptiker» die Rede sein. Das ist eine grobe, aber notwendige und zweckmäßige Vereinfachung der eigentlichen Zustände. Bitte sehen Sie uns nach, dass wir nicht in jedem Kapitel acht neue Milieus anlegen, aus deren Sicht man das Thema eigentlich beleuchten müsste. Das Buch wäre dann zwar ungefähr acht Mal korrekter, aber auch acht Mal umständlicher. Denken Sie sich, wenn die beiden Gruppen genannt werden, bitte dazu, dass damit nicht immer dieselben Menschen gemeint sind. Wer Facebook misstrauisch gegenübersteht, kann das Konzept der Post-Privacy (siehe Kapitel 12) aus ganz anderen Gründen gut finden, und wer an ein möglichst freies und unreguliertes Internet glaubt, regiert vielleicht im Kommentarbereich seines eigenen Blogs mit eiserner Hand.
Irreführende Metaphern und falsche Hoffnungen auf einfache Lösungen haben den Vorteil, dass sie sich durch Nachdenken beheben lassen (manchmal). Andere Auslöser für Streitigkeiten liegen in der Funktionsweise des menschlichen Gehirns begründet und stehen einer Verständigung daher viel hartnäckiger im Weg. Wir neigen zu allen möglichen Denkfehlern: Wir schlussfolgern aus viel zu kleinen Stichproben, glauben am liebsten das, was unsere Freunde glauben, und neigen dazu, all das nicht wahr- oder nicht ernst zu nehmen, was uns schlecht in den Kram passt. Wir sind grundsätzlich vergesslich, und noch viel vergesslicher, wenn es darum geht, dass wir in der Vergangenheit unrecht hatten[4], zudem fallen wir bereitwillig auf falsche Informationen herein, wenn sie uns nur gut aussehen lassen.
Das ist ein winziger Ausschnitt aus den zwei langen Listen «List of cognitive biases» und «List of fallacies», in denen die englische Wikipedia gängige Selbsttäuschungen und Wahrnehmungsverzerrungen aufführt.[5] Dort sind an die 150 verschiedene Strategien verzeichnet, mit deren Hilfe das Gehirn Informationen ausblendet, ohne dass sein Besitzer es auch nur bemerkt. Im Prinzip ist das sinnvoll, denn das Gehirn ist ein vielbeschäftigtes Organ und muss Abkürzungen nehmen, wenn es nicht den ganzen Tag im Bett liegen und die Vor- und Nachteile des Aufstehens gründlich gegeneinander abwägen will. Aber das Verfahren hat auch Nachteile. Etwa den, dass die Argumente der Gegenseite dadurch schlechter aussehen, als sie in Wirklichkeit sind.
Am Anfang der Bewertung von Sachverhalten steht eine Intuition: die Angelegenheit fühlt sich richtig oder falsch an. Anschließend erst beginnt das Gehirn in seiner Argumentensammlung zu kramen und konstruiert eine strategische Beweisführung. Sie dient dazu, die intuitive, erste Bewertung vor anderen Menschen zu verteidigen und ihnen zu erklären, warum sie sich dem eigenen Urteil anschließen sollten. Der amerikanische Psychologe und Moralforscher Jonathan Haidt beschreibt den Vorgang in seinem Buch «The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion»: «Die moralische Intuition taucht automatisch und fast ohne Verzögerung auf, lange bevor das Nachdenken über moralische Fragen überhaupt beginnen kann, und diese ersten Intuitionen neigen dazu, die Ergebnisse des späteren Nachdenkens zu verdrängen. Wer davon ausgeht, dass wir über Moral nachdenken, um die Wahrheit herauszufinden, wird immer wieder frustriert feststellen, wie albern, voreingenommen und unlogisch andere reagieren, wenn sie die eigene Meinung nicht teilen. Aber wenn man moralisches Urteilen als Fähigkeit betrachtet, die wir Menschen entwickelt haben, um unsere soziale Agenda voranzubringen – unsere eigenen Handlungen zu rechtfertigen und unser Team zu verteidigen –, dann sieht die Welt gleich verständlicher aus. Befassen Sie sich mit den Intuitionen und nehmen Sie die moralischen Argumente nicht zu wörtlich. Es sind größtenteils nachträgliche, schnell aus dem Ärmel geschüttelte Konstruktionen, die einem oder mehreren strategischen Zielen dienen.»
Wer gebildet ist und Übung im Ausdenken von Argumenten hat, tappt noch sicherer in die Fallen der Irrationalität, weil er mühelos zahlreiche Begründungen für sein Bauchgefühl erfinden und selbst an sie glauben wird. Aber woher kommen diese Intuitionen? Weil bestimmte Moralkonzepte ebenso wie bestimmte Anforderungen des menschlichen Soziallebens in allen Kulturen existieren, vermutet Jonathan Haidt, das moralische Urteilsvermögen habe sich als eine Art ethische Zunge mit sechs Geschmacksrezeptoren herausgebildet.[6] Diese «Moral-Module» sind in allen Menschen angelegt und werden im Laufe des Lebens von verschiedenen Einflüssen und Erfahrungen verstärkt oder gehemmt. Das erste dieser Module ist das Bedürfnis, für andere zu sorgen und sie vor Schaden zu bewahren. Das zweite ist Fairness und Gerechtigkeit, das dritte Loyalität einer Familie, einer Gruppe oder einem Land gegenüber. Das vierte ist Respekt vor Traditionen und Autoritäten, das fünfte das Konzept der Reinheit oder Heiligkeit und das sechste Freiheit. In westlichen Ländern und dort vor allem auf der linken Seite des politischen Spektrums sind Fürsorge, Fairness und Freiheit wichtig, während Loyalität, Tradition und Reinheit keine große Rolle spielen. Konservative Wähler und die Bewohner vieler nicht-westlicher Länder, so Haidt, verteilen ihre Aufmerksamkeit gleichmäßiger auf alle sechs Werte, wodurch für jeden einzelnen Wert insgesamt weniger übrig bleibt. Die Einflüsse, die dazu führen, dass sich bestimmte Wertvorstellungen stärker ausprägen als andere, liegen in der eigenen Persönlichkeit, in der Erziehung, dem kulturellen Umfeld und den individuellen Erfahrungen.
Dem konservativen Diskussionsteilnehmer erscheint der Wert der Tradition genauso wenig begründungsbedürftig wie seinem libertären Gesprächspartner der Wert der Freiheit. Dass jedem die eigenen Wertvorstellungen selbstverständlich erscheinen, verlockt zum schlampigen Argumentieren. Zum einen hat man ohnehin wenig Einblick in die Entstehung der eigenen Präferenzen. Zum anderen liegt die Annahme nahe, dass sie dem Gesprächspartner doch ebenso intuitiv einleuchten müssten wie einem selbst, zumindest nach wenigen Worten wie im Gespräch mit gleichgesinnten Freunden. Beides ist nicht der Fall.
Stattdessen reden wir oft vollständig aneinander vorbei. Der eine findet: Was im Netz zu sehen sein dürfe, ließe sich vollständig durch wissenschaftliche Klärung der Frage erledigen, ob das Betrachten von Gewalt und Pornographie zu mehr Straftaten und sittlicher Verlotterung führe – alles andere sei Privatsache. Dem anderen verursachen solche Darstellungen ein grundsätzliches Unwohlsein in der Bewertungsregion, die Haidt mit Reinheit/Heiligkeit bezeichnet: Sie entwürdigen den menschlichen Körper, das Zusammenleben und die Idee der Liebe.
Es gibt laut Haidt keine Regel, nach der man herleiten könnte, welche der sechs Module in Wirklichkeit wichtiger sind als andere. Jeder hat seine eigenen Prioritäten. Die einen wollen lieber auf dem Land und die anderen lieber in der Stadt wohnen, ohne dass man sagen könnte, ob nun Stadt- oder Landleben die beste Lösung für alle Menschen ist. Es ist auch nicht «richtiger», alle sechs Werte gleich wichtig zu nehmen. Aber in Auseinandersetzungen hilft es, wenigstens zu ahnen, was im eigenen und im fremden Kopf vor sich geht. Ein Gesprächspartner, in dessen Wertesystem Freiheit die wichtigste Rolle spielt, ist taub für den argumentativen Ansatz, Freiheit sei nicht so wichtig wie zum Beispiel der Minderheitenschutz (Haidts Modul Nr. 1) oder das Einhalten bestehender Gesetze (Nr. 4), auch wenn diese Gesetze vielleicht mangelhaft sein mögen. Man wird sich in diesem Fall eventuell verständigen können, indem man diskutiert, ob und wann bestimmte Freiheiten die Freiheit anderer Menschen einschränken. Wer dem Diskussionspartner stattdessen erklärt, sein Ideal der Freiheit sei gar nicht so wichtig, kann ihn auch gleich mit dem Sandschäufelchen hauen. Die Aussichten, ihn so von der eigenen Meinung zu überzeugen, sind ungefähr gleich groß.
Wie also kann überhaupt so etwas wie ein Konsens gefunden werden, wenn es dem Standard unseres Denkens entspricht, die passenden Beweise erst nachträglich gemäß den eigenen Empfindungen zu organisieren? Um das herauszufinden, ist es hilfreich, dem Gehirn ein bisschen genauer bei der Arbeit zuzusehen: Menschen, die andere Meinungen vertreten, haben eventuell trotzdem recht, auch wenn es auf den ersten, zweiten und sogar dritten Blick noch gar nicht so aussieht. Es sieht deshalb nicht so aus, weil die andere Seite schlampige Argumente gebraucht (genau wie die eigene), aber vor allem sieht es nicht so aus, weil diverse Filter in unseren Köpfen hart daran arbeiten, die anderen Positionen in einem schlechten Licht darzustellen.
Konservative Internetkritiker sind nicht deshalb konservativ, weil sie eine unglückliche Kindheit hatten oder aus genetischen Gründen ängstlicher sind. Verteidiger eines ganz und gar freien und unzensierten Internets hängen ihrem komischen Glauben nicht aus Dummheit, Zynismus oder Naivität an. «Wir glauben, die andere Seite sei blind für Wahrheit, Vernunft, Wissenschaft und gesunden Menschenverstand», schreibt Jonathan Haidt, «aber tatsächlich ist jeder blind, wenn von seinen heiligen Themen die Rede ist». Eine konstruktivere Auseinandersetzung über die Themen dieses Buchs ist dann möglich, wenn alle Beteiligten zumindest versuchen, sich vorzustellen, dass es auch auf der anderen Seite intelligentes Leben gibt. Nein, ernsthaft.
Für Optimisten bedeutet das: Technik hat nicht nur technische Voraussetzungen und technische Folgen, sie hat auch soziale und ethische Aspekte. Nicht alle Veränderungen sind automatisch Verbesserungen. Es ist kein Verrat an der technikfreundlichen Position, die weniger erfreulichen Seiten der Digitalisierung zur Kenntnis zu nehmen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und respektvoll mit Skeptikern umzugehen. Selbst dann, wenn die Argumente dieser Skeptiker eher geringe Technikkenntnis verraten.
Für Skeptiker bedeutet es: Nicht alle von Technik geprägten Veränderungen sind automatisch Verschlechterungen. Und sie bestehen nicht nur daraus, dass etwas auf herzlose, mechanische Weise schneller, billiger oder einfacher wird. Es ist kein Verrat an der skeptischen Position, positive Folgen der Digitalisierung für das menschliche Zusammenleben zur Kenntnis zu nehmen und die Auseinandersetzung mit Optimisten zu suchen. Auch dann, wenn die Argumente dieser Optimisten naiv und ahistorisch erscheinen mögen.
Für beide Gruppen bedeutet es: Wenn Sie das Gefühl haben, die Folgen technischer Veränderungen früher als die meisten anderen Menschen zu erkennen, dann nutzen Sie diesen Vorsprung nicht dazu, ganztags Ihre große Weitsicht und die Beschränktheit der anderen zu verkünden. Schweigen Sie höflich oder machen Sie es wie der Verleger Tim O’Reilly und gründen Sie ein Unternehmen, das auf diesen Erkenntnissen basiert. Falls Sie eingeladen werden, Vorträge über dieses Unternehmen zu halten, sprechen Sie über Ihre eigenen erfolgreichen Entscheidungen und nicht über die Fehler derer, die es anders machen.
Beide Seiten würden davon profitieren, wenigstens ein oder zwei Standardwerke der jeweils anderen Auffassung von Technik zu lesen (siehe Kasten). Alle diese Bücher enthalten auch mittelmäßige und schlechte Argumente. Das ist kein Grund, das jeweilige Buch befriedigt über das schlechte theoretische Fundament der gegnerischen Position nach dem zweiten Kapitel aus der Hand zu legen. Kalkulieren Sie den Drang Ihres Gehirns ein, Ihnen andere Weltanschauungen in einem unvorteilhaften Licht darzustellen.
Oswald Spengler: «Der Mensch und die Technik» (1931)
Alvin Toffler: «Der Zukunftsschock» (1970)
Neil Postman: «Das Technopol: Die Macht der Technologien und die Entmündigung der Gesellschaft» (1992)
Hartmut Rosa: «Beschleunigung: Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne» (2005)
Lee Siegel: «Against the Machine: Being Human in the Era of the Electronic Mob» (2008, keine deutsche Übersetzung)
Frank Schirrmacher: «Payback: Warum wir im Internetzeitalter gezwungen sind zu tun, was wir nicht tun wollen, und wie wir die Kontrolle über unser Denken zurückgewinnen» (2009)
Mark Helprin: «Digital Barbarism: A Writer’s Manifesto» (2010, keine deutsche Übersetzung)
Jaron Lanier: «Gadget: Warum die Zukunft uns noch braucht» (2010)
Nicholas Carr: «Wer bin ich, wenn ich online bin … und was macht mein Gehirn solange? – Wie das Internet unser Denken verändert» (2010)
Evgeny Morozov: «The Net Delusion: How Not to Liberate The World» (2011, keine deutsche Übersetzung)
Erik Brynjolfsson und Andrew McAfee: «Race Against The Machine: How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the Economy» (2011, keine deutsche Übersetzung)
Robert Levine: «Free Ride. How the Internet is Destroying the Culture Business and How the Culture Business can Fight Back» (2011, keine deutsche Übersetzung)
Eli Pariser: «Filter Bubble: Wie wir im Internet entmündigt werden» (2012)
Nicholas Negroponte: «Total digital. Die Welt zwischen 0 und 1 oder Die Zukunft der Kommunikation» (1996)
Virginia Postrel: «The Future and its Enemies: The Growing Conflict Over Creativity, Enterprise, and Progress» (1999)
Kevin Kelly: «Der zweite Akt der Schöpfung. Natur und Technik im neuen Jahrtausend» (1999)
Lawrence Lessig: «Code und andere Gesetze des Cyberspace» (2001)
Steven Johnson: «Die neue Intelligenz: Warum wir durch Computerspiele und TV klüger werden» (2006)
Yochai Benkler: «The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom» (2007, keine deutsche Übersetzung)
Don Tapscott: «Wikinomics: Die Revolution im Netz» (2007)
James Surowiecki: «Die Weisheit der Vielen: Warum Gruppen klüger sind als Einzelne» (2007)
Chris Anderson: «Free – Kostenlos: Geschäftsmodelle für die Herausforderungen des Internets» (2009)
Clay Shirky: «Cognitive Surplus: How Technology Makes Consumers into Collaborators» (2010, keine deutsche Übersetzung)
Christian Heller: «Post Privacy: Prima leben ohne Privatsphäre» (2011)
Wenn Sie sich mit den möglichen Gegenpositionen vertraut gemacht haben, denken Sie an die alte Volksweisheit: Im Internet weiß niemand, dass Sie in Wirklichkeit gar kein Hund sind. Machen Sie davon Gebrauch und vertreten Sie ab und zu unter falschem Namen die Meinung der Gegenseite. Das hält das Gehirn gelenkig und macht Sie zu einem verständnisvolleren Diskussionsteilnehmer. Oder folgen Sie einem Vorschlag aus dem Blog «Overcoming Bias»: Stellen Sie sich vor, Sie könnten den drohenden Untergang der Welt nur abwenden, indem Sie in einem kurzen Vortrag eine Jury davon überzeugen, dass Ihre bisherige Meinung falsch, albern oder einseitig war. Je schlechter die Jury Ihre alte Meinung findet, desto wahrscheinlicher wird die Welt gerettet. Die gesamte Jury besteht aus früheren Versionen Ihrer selbst, also zum Beispiel der Person, die Sie vor einem Jahr waren.
Wie unterscheidet man bei eigenen und fremden Ansichten zwischen reinen Reflexen und ein bisschen besseren Argumenten? Ein allgemeiner Überblick, wie man nicht so gute Argumente schon an der Form erkennt, findet sich im Wikipedia-Eintrag «Typen von Argumenten». Er enthält weiterführende Links zu rhetorischen Finten wie der Scheinkausalität, dem Strohmannargument oder der nützlichen REDUCTIO AD HITLERUM: «Eine Ansicht wird nicht widerlegt durch die Tatsache, dass sie zufällig von Hitler geteilt worden ist.» Hier listen wir einige verständnishemmende Argumente auf, die in der Debatte um Technikfolgen besonders häufig auftauchen.
Als Skeptiker sollten Sie vorsichtig mit Argumenten hantieren, die davon handeln, dass niemand das Neue wirklich haben will oder dass es allenfalls von seltsamen Minderheiten begehrt wird. Dasselbe gilt für die Ankündigung, dass es nicht mehr lange so weitergehen kann wie bisher, weil eine endliche Ressource an ihr Ende gelangt und durch nichts zu ersetzen ist, oder dass eine Neuerung die menschlichen Denk-, Lese- und Schreibfähigkeiten zugrunde richtet. Als Optimist lassen Sie besser die Finger von Prophezeiungen, in denen neue Technologien durch verbesserte Kommunikation den Weltfrieden wahrscheinlicher machen, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit herstellen, müheloses Lernen ermöglichen, Rede- und Meinungsfreiheit garantieren, das Ende irgendeiner Knappheit herbeiführen oder dem Tod seinen Schrecken nehmen. Jede dieser Behauptungen ist vor Ihnen im Laufe der Jahrhunderte von vielen anderen Skeptikern und Optimisten vorgebracht worden und hat die Erkenntnis genauso wenig befördert, wie Ihre Version es tun wird. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Welt durch Technologien – ja, auch durch das Internet – weder besser noch schlechter, sondern bloß ANDERS wird.
Das «Alles wird schlechter / Alles wird besser»-Argument für Menschen mit Geschichtskenntnissen. Umberto Eco fragt: «Wie sollen wir diejenigen, die das Ende der Welt kommen sehen, davon überzeugen, dass andere, in der Vergangenheit, es auch schon so gesehen haben, und das in jeder Generation? Dass es sich um eine Art wiederkehrenden Traum handelt, wie zum Beispiel davon, dass uns die Zähne ausfallen oder wir nackt auf der Straße stehen? Nein, wird man antworten, diesmal ist es viel ernster.» Und so geschieht es auch, zum Beispiel in Joseph Weizenbaums «Macht der Computer»: «Aber wie jede Zeit dieselben Kassandrarufe vernommen hat, so hat auch jede Zeit gelernt, als wie wenig prophetisch sie sich stets herausstellen sollten. Es sind sehr viele Zivilisationen vernichtet worden, doch nie die ganze Menschheit. Aber diesmal ist es anders.» Es wird nicht helfen, in eine dritte Runde zu gehen und seinem Argument vorauszuschicken: «Ich weiß, meine Befürchtung ist ein alter Hut, und ich weiß, dass auch alle meine Vorgänger behauptet haben, diesmal sei es anders. Aber DIESMAL ist es WIRKLICH anders!» Vielleicht ist es diesmal wirklich anders. Aber durch den Gebrauch dieser Formel befördert man die Glaubwürdigkeit seiner Argumentation so sehr wie durch das Verteilen von Flugblättern in sechzehn Farben und zwölf Schriftarten, darunter Comic Sans.
«[E]ine Wiedervereinigung», schrieb der Historiker und Publizist Sebastian Haffner 1987, «in der beide deutsche Staaten, so wie sie nun einmal sind und geworden sind, zu einem funktionierendem Staat verschmolzen würden, ist nicht vorstellbar, nicht einmal theoretisch.» Ebenso erging es dem britischen Science-Fiction-Autor H. G. Wells 1901 mit dem U-Boot: «Ich kann meine Vorstellungskraft noch so sehr bemühen; sie weigert sich, mir ein Unterseeboot zu zeigen, das nicht seine Besatzung ersticken und kentern müsste». Der Regalbau-Unternehmer Jan Paschen wird im September 2011 im Börsenblatt des deutschen Buchhandels mit dem Satz zitiert: «Eine Welt ohne Bücher kann ich mir nicht vorstellen.» Die menschliche Vorstellungskraft klebt zu sehr an den eigenen Erfahrungen und den gegenwärtigen Verhältnissen. Und wenn der eigene Beruf wesentlich auf dem Nichteintreten des Unvorstellbaren beruht, ist sie sogar noch etwas unzuverlässiger als sonst. Argumente, die mit dieser Formel anfangen, machen immerhin kenntlich, dass es sich um eine rein subjektive Aussage handelt. Das ist aber auch ihr einziger Vorzug.
Nein. Ist es nicht. Rein theoretisch wäre es zwar möglich, dass Sie einen einfachen Ausweg entdeckt haben, der den bisherigen Diskussionsteilnehmern komplett entgangen ist. Wesentlich wahrscheinlicher ist aber, dass Sie noch zu wenig über das Thema wissen. Kein Problem, über das erwachsene Menschen länger als eine halbe Stunde diskutieren, hat eine einfache Lösung. Eine andere Möglichkeit: Ihre Lösung ist zwar wirklich ganz einfach, aber dafür umso schwieriger umzusetzen: «Man bräuchte Israel einfach nur zweimal! Dann hätten die Palästinenser und die Israelis ihr eigenes!»
Doch. Kann es doch. Dieses Argument bedeutet eigentlich «Ich möchte nicht, dass die Welt so eingerichtet ist, dass …». Die Welt kümmert sich aber nicht in perfekter Fürsorglichkeit um das, was ihre Bewohner sich wünschen. Die Urheber von Werken, die einige Menschen sehr glücklich machen, können davon nicht immer leben. Ein funktionierendes Rechtssystem garantiert selbst in Ländern, in denen man sich aktiv darum bemüht, nicht in allen Fällen das Ergebnis, das alle Beteiligten als gerecht empfinden. Und das sind noch die Zustände in den gut eingerichteten Ländern. Anderswo kann es passieren, dass man nachts aus dem Bett geholt und an die Wand gestellt wird. Man hat gerade noch Zeit, «Aber es kann doch nicht sein, dass …» zu sagen, dann wird man von einem auf mehrere hundert Meter pro Sekunde beschleunigten Metallstück darüber informiert, dass man gerade ein mäßig überzeugendes Argument gebraucht hat. Respekt vor dem, was alles SEIN KANN, führt zu größerer Achtung vor den gesellschaftlichen Leistungen, die hin und wieder trotzdem etwas einigermaßen Konstruktives geschehen lassen.
«EDV-Narren», so konnte man 1997 im Spiegel lesen, «genießen nicht nur den Kick beim Klick, sie sind durchweg tolerant, lebhaft und kommunikativ. Gestörte Geister hingegen finden sich vorzugsweise unter Elektronik-Muffeln. Einsame, gestresste und frustrierte Zeitgenossen neigen zum Misstrauen gegen die moderne Technik.» 1983 war am selben Ort das Gegenteil zu lesen gewesen: «Die Computer-Freaks sitzen nächtelang vor dem Bildschirm, haben kaum Kontakt zu ihrer Umwelt und lassen sich in Vorlesungen nur sporadisch blicken – entsprechend schlecht schneiden sie, obwohl häufig hochbegabt, bei den Examen ab. … Angezogen vom Computer würden vornehmlich introvertierte Naturen, meint Reynolds, ‹weil der Umgang mit dem Gerät keine sozialen Konflikte erwarten lässt›.» Die Weltanschauung oder Lebensweise anderer Menschen wird aber nicht dadurch falsch, dass diese Menschen einsam, gestresst, frustriert, introvertiert, ängstlich, schlecht frisiert, arm oder hässlich sind.
2. Das Internet ist ein rotes Auto
Wie Metaphern und ihre Geschwister Diskussionen erschweren
ich sage ja, das internet ist wie ein übergewichtiger männlicher gogo-tänzer in güldenen paillettenhotpants.
@hormonlotto, Twitter, 3. Mai 2010
Irgendwo im Hinterkopf, in der Nähe der Sehrinde, ist die Mustererkennung im Gehirn angesiedelt. Sie ermöglichte es zum Beispiel, einen Säbelzahntiger auch dann als solchen zu erkennen, wenn er zum größten Teil vom Steppengras verdeckt war. Dieser Vorgang ist nachvollziehbarerweise für den schadensfreien Fortbestand des Körpers um das Gehirn herum so wichtig, dass dieses ab und zu erheblich übertreibt und Muster auch dort hineininterpretiert, wo eigentlich keine sind. Besser, man rennt dreimal vor dem tigerartigen Schatten eines Busches weg als einmal nicht vor dem buschartigen Schatten eines Tigers. Das kann sogar zu einer regelrechten Mustersucht des Gehirns führen, der Pareidolie, bei der jede Wolkenformation aussieht wie der späte Elvis (was in diesem speziellen Fall aber auch ein bisschen am späten Elvis liegen könnte).
Die Fixierung auf die Wiedererkennung von Mustern ist keine rein visuelle Angelegenheit, sondern gilt eigentlich für alle Arten von Reizen. Manchmal konnte man den Säbelzahntiger nämlich nur hören. Eine beliebige Wahrnehmung wird mit der Erinnerung abgeglichen, das Gehirn ergänzt dann die restlichen Informationen. Das passiert weitgehend automatisch, was ein weiterer Evolutionsvorteil ist, denn Mustererkennung geschieht andauernd im Hintergrund. Glücklicherweise. Denn obwohl Säbelzahntiger ausstarben, bevor die Wissenschaft so richtig in Gang kam, sind die meisten Paläontologen überzeugt, dass diese gefährlichen Raubtiere sich selten vorher schriftlich ankündigten. Sondern überraschend gerade dann in die Szenerie platzten, wenn es eigentlich nicht so richtig passte.
Das ständige Wahrnehmungspuzzeln des Gehirns bewährte sich so sehr, dass es ein wenig umgebaut ins Standardrepertoire der menschlichen Informationsverarbeitung aufgenommen wurde: Es handelt sich um die Assoziation. Als sich schließlich die Sprache entwickelte, bahnte sich die Mustererkennung auch darin ihren Weg. Das Gehirn gleicht alle neuen Reize mit bereits bekannten ab. So entstand der sprachliche Vergleich. Das gerade erst entdeckte X ist so ähnlich wie das schon bekannte Y. Vermutlich war das die Geburtsstunde der bekanntesten und beliebtesten Sprachfigur überhaupt, der Metapher. Der gewaltige, anhaltende Erfolg der Metapher ist in ihrer großen Benutzerfreundlichkeit begründet: Mit leicht zugekniffenen Augen lässt sich praktisch alles Neue mit ein, zwei Vergleichen in Grund und Boden erklären. Die ersten nach Europa gelangten Papageien nannte man «indische Raben», obwohl sie weder Raben waren noch aus Indien kamen, Giraffen wurden im alten Rom wie auch in Deutschland als «Kameloparden» bezeichnet, weil sie safariungeübten Augen offenbar wie eine Mischung aus Kamel und Leopard erschienen, und das Flusspferd muss bis heute mit einem holpernd dahinverglichenen Namen zurechtkommen.
Auch für das Internet spielte die Metapher von Beginn an eine große Rolle. Ganze metaphorische Welten wurden bemüht, um in den neunziger Jahren diese neuartige, digital vernetzte Sphäre zu beschreiben. Die nautische Metaphorik zum Beispiel, die einen entscheidenden Schub bekam, als die Bibliothekarin Jean Armour Polly 1992 in der Juni-Ausgabe des Wilson Library Bulletin