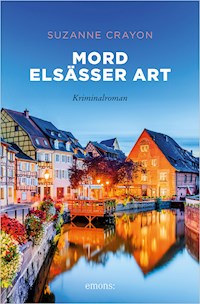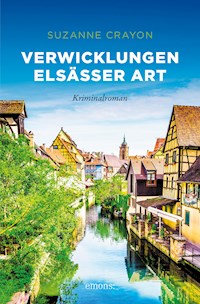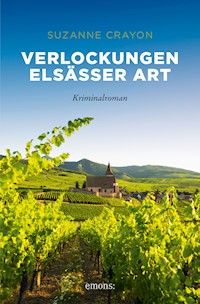
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Sehnsuchtsorte
- Sprache: Deutsch
Ein federleichter Elsass-Krimi Ein Elsässer Souvenirladenbesitzer, der auch mit heimischen Heilkräutern handelte, ist tot. Seine Leiche liegt hoch über dem idyllischen Städtchen Thann, direkt an der Ruine der mittelalterlichen Engelsburg. Doch das Opfer war nicht so harmlos, wie es zunächst scheint. Seine fragwürdigen Aktivitäten als »Heiler« machten den Mann nach Meinung von Ex-Commissaire Jean Paul Rapp zu einer perfekten Zielscheibe für einen Mord. Der offizielle Ermittler Rimbout denkt wieder einmal in eine ganz andere Richtung – doch Rapps Ehrgeiz ist geweckt, ihm seine eigene Theorie zu beweisen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Suzanne Crayon – ein deutsches Autorenduo – kennt, liebt und bereist das Elsass seit mehr als drei Jahrzehnten. Sie wird von manchen Störchen im Elsass bereits klappernd begrüßt und könnte für »Grumbeerkiechle« mit einem Gläschen Pinot blanc glatt einen Mord begehen.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2023 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: lookphotos/Daniel Schoenen Fotografie
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
Lektorat: Christiane Geldmacher, Textsyndikat, Bremberg
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-057-0
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Wenn man auf nichts mehr zählen kann, muss man mit allem rechnen.
Jules Renard, »Ideen, in Tinte getaucht«
Prélude
Thann, südliche VogesenDonnerstag, 29. September, später Abend
Didier Doudet begriff nicht, was geschehen war.
Etwas hatte ihn am Kopf getroffen, aber es war so schnell geschehen, dass er nicht hätte sagen können, was es gewesen war: ein Geschoss, ein umherirrender Gegenstand, eine Faust, ein Stein?
Eben noch hatte er aufrecht gestanden und in Richtung Westen geschaut, wo das Panorama der Hochvogesen unter einer nebligen Dunstglocke lag. Jetzt plötzlich kauerte er auf beiden Knien und stierte auf das uralte Mauerwerk des »Hexenauges«, den anscheinend alle Zeiten überdauernden Ruinenrest der Engelsburg. Wer wüsste besser darüber Bescheid als er selbst? Auf seinen Führungen rund um Thann oder am gewundenen Flusslauf der Thur entlang, manchmal sogar bis hinein in die Hochvogesen, ließ er die Geschichte der Engelsburg niemals aus. Auch wenn ihm das Zeug schon zum Hals herauskam, die Leute liebten es nun mal, davon zu hören. Und es schien, als würden die mittelalterlichen Geschichten den Kräutern, auf die er seine Kundschaft hinwies, erst die rechte Aura verleihen.
Doudet schüttelte sich wie ein Hund, um wieder zu sich zu kommen. Er musste sogar lachen, zumindest schien es ihm, als wäre er dazu noch in der Lage, während er zugleich alle Kräfte zusammennahm, um sich auf seine wackeligen Beine zu stellen und sich langsam wieder umzudrehen.
Das hier ist doch eine Farce, lächerlich, ridicule, Herrgott noch mal!, schrie er innerlich. Denn um es laut herauszubrüllen, war er bereits zu schwach. Wenigstens schaffte er es, die Zähne zu blecken, um seine ganze Verachtung zum Ausdruck zu bringen.
Doch seltsamerweise konnte er sein feindseliges Gegenüber nicht mehr erkennen, und mit einem tödlichen Erschrecken begriff er, dass er nicht mehr sehen konnte. Seine Augen blickten in einen Nebel, der nun auch in seinem Kopf herrschte, nicht mehr nur an dem Ort, an dem sie sich befanden, auf dem Schlossberg, hoch oben über Thann, direkt neben dem verfluchten Hexenauge.
Doch sein Gehör funktionierte noch! Wie aus einer märchenhaften Welt drang leises Rauschen an seine Ohren, das war die Thur, die unten an den Hängen vorbeiströmte. Er vernahm menschliche Stimmen – sehr schwach, von sehr weit her –, als kämen sie von Menschen, die unten in Thann einen letzten Abendspaziergang machten und sich dabei friedlich unterhielten. Und von Osten, von den Weinhängen des Rangen, meinte er die Geräusche von Erntefahrzeugen und die scharfen Stimmen der Erntehelfer zu hören, die sich gegenseitig etwas zuriefen.
Aber … konnte das sein? Erntefahrzeuge um diese Uhrzeit, bei solchem Wetter? Nein, unmöglich. Was für ein Unsinn! Ein absurdes keckerndes Lachen über diesen furchtbar dummen Spuk entstieg seiner Kehle.
Doch fast noch im selben Augenblick folgte das Déjà-vu: ein weiteres Geschoss, ein Stein, ein Stoß, zu schnell, um es zu erkennen oder ihm auszuweichen!
Sein Schädel schoss herum, diesmal zur anderen Seite, und riss seinen Körper mit.
Ein hervorstehender Bruchstein des Hexenauges war das Letzte, was Didier Doudet in seinem Leben, das gut ein halbes Jahrhundert gedauert hatte, noch erkennen sollte. Das unschöne Plopp-Geräusch, mit dem seine Schläfe an der Steinkante zerschellte, sollte er bereits nicht mehr hören.
1
Pfaffenhoffen, Freitag, 30. September
»Umgerechnet etwa ein Pfund Kartoffeln. Alors, das sollte reichen für zwei Personen«, murmelte Rapp vor sich hin. Dazu, laut Edgars Rezept: Zwiebeln, Knoblauch, Petersilie, Eier, Mehl, Salz, Pfeffer, Muskat und Öl natürlich.
Jean Paul Rapp stand um halb elf Uhr morgens in seiner Küche und starrte auf sein Handy, das auf der Anrichte neben dem Herd lag. Sein Sohn Edgar hatte ihm das Rezept für Galettes de Pommes de Terre, Kartoffelpuffer, geschickt. »Das schaffst selbst du, Papa, ohne dass es anbrennt«, hatte Edgar ihn zuvor am Telefon veralbert. Doch dem Jungen – Dieu, der war ja nun auch schon Mitte dreißig – war anscheinend nicht aufgefallen, dass dieses Rezept für zehn Gäste berechnet war.
Für Edgar, der in Paris zusammen mit seinem Mann Julien ein Restaurant mit Elsässer Spezialitäten führte, mochte das ja praktisch sein.
»Aber wenn man wie ich nur einen einzigen Gast einladen möchte, muss man jede Knoblauchzehe umrechnen!«, schimpfte er in Richtung seines Terrierrüden Honoré.
Sein alter Hund – Rapp weigerte sich inzwischen, die Jahre mitzuzählen – räkelte sich entspannt in dem flachen Weidenkorb vor dem Heizkörper und hörte den Chef de Cuisine wahrscheinlich wie aus weiter Ferne. Nur die leicht angehobene Braue über seinem linken Auge und ein dezentes Schnaufen deuteten an, dass er Rapps Ärger verständnisvoll zur Kenntnis genommen hatte und nun weiterdöste.
Honoré hatte recht, wurde Rapp klar, er sollte sich wieder einkriegen. Dies hier war nur ein Probelauf für den Abend, den er bald mit Sylvie zu verbringen hoffte, indem er sie zum Essen bei sich zu Hause einlud.
Vor längerer Zeit hatte er seine Nachbarin, die nur ein paar Straßen weiter in einem kleinen alten Fachwerkhaus in der Rue de Kaefferling wohnte, schon einmal eingeladen. Doch das war phänomenal schiefgegangen. Manchmal glaubte er, noch heute den ätzenden Geruch des völlig verbrannten Baeckeoffe von damals in seinem Ofen zu riechen. Und in der Zeit danach war es stets wie verhext gewesen, entweder sie hatten keine Zeit gefunden, sich zu zweit zum Essen zu verabreden, egal, ob privat oder im Restaurant, oder es hatte sich ungefragt ein ganzer Pétanque-Club dazugesellt. Und dann war Sylvie zu allem Überfluss völlig überraschend für ein Dreivierteljahr nach Lateinamerika verreist. Aus beruflichen Gründen. Sie arbeitete normalerweise als historische Botanikerin im Éco Musée, unweit von Mulhouse. Um Anregungen für die eigene Arbeit im Elsass zu finden, studierte sie die Bedingungen für Kartoffeln und Tomaten in Mexiko, dem ursprünglichen Anbaugebiet.
Schön für Sylvie. Nicht schön für ihn. Auch wenn er es als enormen Vertrauensbeweis auffasste, dass Sylvie ihm für diese lange Zeit die Versorgung ihres Katers Fou Fou anvertraut hatte. »Er mag dich, Jean Paul«, hatte sie ihm versichert, »und inzwischen mag er sogar Honoré.«
Nur dass Honoré den Kater nicht besonders mochte, so weit ging die Hundeliebe denn doch nicht, aber mit der Zeit war Fou Fou ihm halbwegs gleichgültig geworden.
Freundlicherweise hatte Sylvie Rapp aus Mexiko regelmäßig Nachrichten und sogar Fotos von sich geschickt. Das hatte ihn natürlich gefreut und getröstet, aber zugleich sein Verlangen nach ihr noch gesteigert. Etwas abgekühlt war seine Leidenschaft allerdings in den letzten zwei Monaten ihres Forschungsaufenthalts, als in ihren Mails und SMS immer häufiger der Name »Ramón« aufgetaucht war, eines mexikanischen Kollegen vor Ort, der leider zunehmend häufiger auch auf den Fotos zu sehen gewesen war, die sie Rapp geschickt hatte: ein verdammt gut erhaltener, ziemlich sportlich aussehender Mann Anfang fünfzig mit einem verteufelt charmant wirkenden Lächeln, das dieser Ramón offenbar anknipsen konnte, sobald die Handykamera auf ihn gerichtet war.
Sylvie war kürzlich nach Frankreich zurückgekehrt, und anfänglich hatte sie noch immer mit unüberhörbarer Begeisterung von Ramón gesprochen. Doch zum Glück hatte sich das inzwischen gelegt, und Rapp sonnte sich in dem Gefühl, dass er den fernen Konkurrenten als »Episode« betrachten durfte. Schwamm drüber, sagte er sich.
Er schaltete das Radio ein, das neben der Kaffeemaschine stand. Radio Alsace Libre brachte ein schönes Stück von Stéphane Grappelli, verriet die junge weibliche Stimme von Lizette, seiner Lieblingsmoderatorin. Dann holte er die Kartoffeln aus dem untersten Schubladenfach und setzte sich damit zum Schälen an den Küchentisch.
Seltsamerweise hatte Wätti, die Leiterin des Kochkurses in Rouffach, den er auf Edgars Anraten in den letzten Monaten besucht hatte, ihren Eleven nicht beigebracht, Galettes zuzubereiten. Edgars These, Wätti sei selbstverständlich davon ausgegangen, »jeder Idiot« könne Galettes de Pommes de Terre machen, war zwar unverschämt, aber womöglich zutreffend, musste Rapp sich eingestehen. Nicht auszuschließen, dass Edgar sogar deshalb Koch geworden war, weil sein Vater sich dabei schon immer ungeschickt angestellt hatte. Ein Bereich also, in dem Edgar, der beinahe von Kindesbeinen an leidenschaftlich gern gekocht hatte, ihm von Anfang an haushoch überlegen gewesen war. Oder, andere Möglichkeit, Edgar war Koch geworden, weil auch seine Mutter, Rapps Ex-Frau Isabelle, als Köchin ein Totalausfall gewesen war. Nicht weil sie kein Talent dazu besaß, sondern weil der Alkohol sie schon damals zunehmend daran gehindert hatte.
Grappelli legte noch ein letztes Geigensolo hin, dann war das Stück zu Ende, und Lizette leitete nahtlos zu den Nachrichten über. Radio Alsace Libre legte, wie der Name verriet, Wert auf seine Regionalität, daher wurden nur die allerwichtigsten Nachrichten aus aller Welt präsentiert, und danach folgte das Neueste aus der Region, selbst dann, wenn es im Grunde nichts Wichtiges aus dem Elsass und den angrenzenden Regionen in Deutschland und der Schweiz, mitunter auch aus Österreich, zu berichten gab.
Doch heute war das anders – ganz anders.
Rapp war sogleich wie elektrisiert, als schon in der ersten Lokalmeldung der Name seines Nachfolgers Rimbout fiel: »Thann«, verkündete Lizettes junge Stimme bereits mit einem dunklen Unterton den Ort des Geschehens. »Die Kriminalpolizei meldet soeben den Fund einer männlichen Leiche auf dem Schlossberg oberhalb der Stadt. Nach dem Aufklaren des Wetters heute früh, so Commissaire François Rimbout, Leiter des Districts Colmar-Rouffach, seien Touristen zu den Ruinen der Engelsburg oberhalb von Thann aufgebrochen und hätten dort unmittelbar neben dem berühmten Hexenauge den grausigen Fund gemacht. »Wir können noch nicht mit letzter Sicherheit sagen, ob es sich um ein Gewaltverbrechen handelt«, vernahm Rapp Rimbouts stets etwas schleppende Stimme. »Die Verletzungen am Kopf des Toten deuten aber darauf hin, dass möglicherweise ein Kampf, eine … eine …« Rimbout schien den Faden zu verlieren.
»Reiß dich zusammen, alter Junge!«, rief Rapp und hörte, wie Honoré in seinem Korb schnaufte.
»Nun, der Mann ist jedenfalls keines natürlichen Todes gestorben«, bekam Rimbout eben noch die Kurve. »Wir bitten daher die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise«, fuhr er nun wieder etwas souveräner fort, »insbesondere was die Beobachtung von möglicherweise gewaltbereiten oder alkoholisierten Personen am gestrigen Abend in der Nähe der Engelsburgruine betrifft.«
Lizette verlas die Telefonnummer des Commissariats in Rouffach, in dem auch Rapp bis vor ein paar Jahren noch als Leiter gearbeitet hatte. »Die Homepageadresse der Polizei und alle weiteren Informationen zu dem Thema findet ihr auf unserer Website RAL.fr«, verkündete sie abschließend, ehe sie zu weiteren Nachrichten aus der Region kam.
Rapp, das Schälmesser in der Rechten, eine Kartoffel in der Linken, hörte nicht mehr zu. Ausgerechnet Thann, dachte er. Rimbout war bei seinem Radiostatement sicher auch deshalb ins Schlingern geraten, weil er selbst in Thann wohnte, dem idyllischen Städtchen am Südrand der Vogesen, das gut dreißig Kilometer von Pfaffenhoffen entfernt lag. Jedes Kind kannte ihn dort. Allerdings nicht nur als Leiter des hiesigen Commissariats, sondern auch als leidgeprüften Vater seiner pubertierenden Zwillinge Jeanne und Richard, die zuletzt mit einigen verwegenen Aktionen auf sich aufmerksam gemacht hatten – unter anderem durch eine Spritztour in der Oldtimer-Dyane ihrer schrillen Tante Bernadette.
Rimbout würde daher bei diesem Fall, sollte er sich denn als Gewalttat herausstellen, unter besonderer Beobachtung der gesamten Thanner Bevölkerung stehen, so viel war sicher. Es würde ab sofort keinen Tag mehr geben, an dem man ihn nicht nach dem Stand der Ermittlungen fragte. Unglücklicherweise war Rimbout in Rouffach mit einem Mitarbeiter wie George Sulzer gesegnet, der zwar Kriminelle in rauen Mengen erlegte, aber nur in den Ballerspielen, denen er in den Büropausen seine ganze Leidenschaft und den Rest seines Gripses widmete.
Das Telefon klingelte. Rapp stieß einen Seufzer aus, legte das Schälmesser und die noch ungeschälte Kartoffel beiseite und schaltete das Radio ab, ehe er zum Hörer griff.
»Bonjour, Jean Paul, Isabelle hier!« Seine Ex klang aufgeregt, aber das war fast immer der Fall, wenn sie bei ihm anrief.
»Bonjour, Isa. Ça va, wie geht’s?«
Es waren beinahe nur noch Isabelle und mitunter Edgar, die sich via Festnetz bei ihm meldeten. Die meisten anderen, Freunde, Bekannte, Verwandte et cetera, riefen ihn auf dem Handy an. Isabelle und er dagegen hatten sich nach ihrer Trennung – vor vielen Jahren nun schon – darauf geeinigt, nicht auch noch ihre Handynummern auszutauschen. Und dabei sollte es bleiben.
»Ça va, ça va?«, rief sie verärgert. »Du hast gut reden, Jean Paul. Du hast nicht mit Entzugserscheinungen zu kämpfen wie ich!«
»Du klingst, als wäre ich nun auch noch für deine Entzugserscheinungen verantwortlich!« Nachdem sie ihn früher, wie er nicht vergessen hatte, in seiner aktiven Zeit als Commissariatsleiter, bereits für das Scheitern ihrer Ehe und infolgedessen für ihre Alkoholsucht verantwortlich gemacht hatte. Insbesondere seine durch den Beruf bedingte häufige Abwesenheit – »körperlich und vor allem geistig« – hatte sie ihm damals zum Vorwurf gemacht.
Vermutlich zu Recht.
»Weshalb rufst du an, Isa?«
»Ich möchte, dass du mir ein Medikament besorgst, Jean Paul.«
»Ein Medikament? Bei aller Liebe, Isabelle«, einer Liebe, die es zwischen ihnen schon lange nicht mehr gab, »aber dazu brauchst du doch nicht mich, sondern musst nur um die Ecke in die Apotheke gehen.«
Sie wohnte schließlich in Colmar, mitten im Stadtzentrum.
»Dieses Medikament bekomme ich eben nicht in der Apotheke, Jean Paul. Weder um die Ecke noch in einer anderen Apotheke.«
»Nicht?«
»Nein«, gab sie trotzig zurück. »Ich bekomme es von Didier, meinem Therapeuten aus Schœnwiller. Und du weißt, dass ich nicht Auto fahren kann. Wie soll ich nach Schœnwiller kommen?« Die Wahrheit war, dass die Polizei ihr den Führerschein entzogen hatte, wegen Alkohols am Steuer. »Didier«, fuhr sie fort, »bringt mir die Medizin persönlich vorbei, jeden zweiten Donnerstagmorgen im Monat, pünktlich um zehn. Er kommt vorbei, und ich nehme ›Engelsfarn‹ unter seiner Anleitung ein.«
»Engelsfarn?«
»Ja, so heißt das Medikament, eine Tinktur aus Naturkräutern, er stellt sie selbst her, wie ich dir schon einmal erklärt habe, aber du hörst ja nie zu, wenn ich was sage.«
»Du hast mir gesagt, dieser Didier sei dein Therapeut.«
»Ist er ja auch. Wir, Didier und ich, reden eine Weile, und anschließend geht es mir wieder besser. Na ja, nicht immer, aber …«
»Aber was, Isa?«
»Ach, das spielt im Grunde keine Rolle.«
»D’accord. Aber warum rufst du mich an, Isabelle? Heute, jetzt?«
»Wegen des Engelsfarns. Das sagte ich doch vorhin. Didier ist heute nicht zu mir gekommen. Ich kann ihn auch auf dem Festnetztelefon nicht erreichen. Ein Handy benutzt er ja nicht, aus Prinzip, sagt er, weil das ungesund sei. Die Strahlungen und so weiter. Aber ich brauche den Engelsfarn, er hilft mir gegen meine schlimmen Gedanken, die Depressionen, all das. Schon die Angst, ich könnte ihn heute nicht bekommen, macht mich ganz krank.«
»Hm.« Rapp knurrte ungehalten. Er hielt diesen Didier – Didier Doudet hieß er mit vollem Namen – für einen ausgemachten Scharlatan, der sich als Kräuterdoktor und Wunderheiler in einem anpries. »Wenn dir Doudets Kräutermix so wichtig ist, Isabelle, warum schickst du dann nicht deinen lieben Franck zu Doudet?« Schließlich war es Isabelles ewiger »Neuer«, Franck, gewesen, der den Kontakt zu diesem unseligen selbst ernannten Garanten für das seelische Wohlbefinden überhaupt erst hergestellt hatte. Schon diese Verbindung erschien Rapp verdächtig.
Isabelle druckste herum: »Weißt du, Franck, er … Alors, er ist beruflich unterwegs, seit einigen Tagen schon. Er holt neue Autos, also eigentlich alte Autos, Oldtimer, du weißt schon, von denen holt er eine ganze Lkw-Ladung voll aus … weiß nicht genau, Italien, glaube ich.«
»Aha, und ich dachte, dein Franck hätte mal etwas Neues in petto.«
Ihr Franck, mit dem sie nun schon einige Jahre liiert war, schien stets zur Unzeit anwesend oder unterwegs zu sein. Entweder musste er untertauchen, weil er dubiosen Leuten aus der Autoschieberbranche Geld schuldete, oder er war »auf Reisen« für andere zwielichtige Figuren, die ihm dann das Geld schuldig blieben. Behauptete er zumindest hinterher, wenn er Isabelle erklären musste, warum er bei ihr wohnte, ohne sich an der Miete zu beteiligen, und den Kühlschrank leer machte, ohne je von seinem eigenen Geld einzukaufen.
»Hör zu, Isabelle, ich will ehrlich zu dir sein«, sagte Rapp. »Ich hole dir jedes andere Medikament gegen Entzugserscheinungen oder Depressionen aus der Apotheke – was auch immer dein Arzt diagnostiziert und verschrieben hat.« Wobei er sich allerdings fragte, wie sie an Entzugserscheinungen leiden konnte, ohne zu entziehen. Denn sowohl er als auch Edgar hatten den Eindruck, dass ihr Trinken unter dem Einfluss von Doudet keineswegs abgenommen hatte. »Aber dieses ominöse Zeug, Engelsfarn oder wie immer es heißt, beschaffe ich dir nicht aus Schœnwiller. Das ist mein voller Ernst, Isa«, fügte er in scharfem Ton hinzu.
Zumal sie Doudet mit dem Geld bezahlte, das er ihr zuvor auf Anraten von Edgar gegeben hatte, damit sie sich therapieren lassen konnte. Wahrscheinlich hatten Franck und Doudet das Geld längst unter sich aufgeteilt.
»Ist das dein letztes Wort, Jean Paul?«, fragte sie hörbar gekränkt.
»Ja, Isa, das ist es. Ruf Edgar an, sprich mit ihm. Oder geh zu einem Arzt und lass dich zu einem wirklichen Therapeuten überweisen. Aber, bitte, Isabelle, tu jetzt eins nicht: Greif nicht zur Flasche.«
»Du zwingst mich dazu, Jean Paul. Du bist grausam zu mir, wie du es immer warst.«
»Ich bin ›grausam‹ zu …?« Er hörte ein Klicken in der Leitung.
Rapp starrte ungläubig noch einige Sekunden auf den Hörer in seiner Hand, dann legte auch er auf.
2
Eine Viertelstunde später hatte Rapp die Kartoffeln und Zwiebeln geschält und sich eben erst auf die Suche nach der Gemüsereibe gemacht, da klingelte es erneut. Diesmal auf seinem Handy. Auf dem Display las er den Namen Rimbout. Ihm fiel dessen Interview vorhin im Radio ein, und ihm schwante nichts Gutes.
»Bonjour, François«, begrüßte er ihn, »ça va, wie geht’s?«
»Bonjour, Jean Paul. Ah, wie soll’s einem schon gehen mit einem solchen Fall?«, stöhnte Rimbout. »Ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast?«
»Stell dir vor: durch dich, François! Hab dich eben erst im Radio gehört. Der neue Fall oben an der Engelsburgruine, richtig?«
»Ja, an der Ruine. In Thann, du verstehst, quasi direkt vor meiner Haustür. Die Leute erwarten natürlich von mir, dass ich den Fall schon gestern gelöst habe. Als müsste ich den Täter – oder die Täter, wer weiß? – persönlich kennen.«
Rapp musste lachen, auch wenn er den Druck, der aus Rimbouts Worten sprach, sehr gut nachvollziehen konnte.
»Ich nehme aber nicht an, dass du deswegen anrufst, François, oder?« Für gewöhnlich verbat sich Rimbout jede Einmischung seines Vorgängers Rapp in aktuelle Fälle. Ausnahmen bestätigten allerdings die Regel.
»Na, und ob ich dich wegen des Falls anrufe!«, widersprach Rimbout vehement. »Und weißt du, warum? Weil Isabelle meinte, ich solle mich an dich halten, du wüsstest Bescheid.«
»Moment mal, François.« Rapp war plötzlich ganz verwirrt. »Was hat Isabelle mit deinem neuen Fall zu tun? Und was soll das heißen, du sollst dich an mich wenden?«
»Sie hat es zu mir gesagt, als ich vorhin bei ihr angerufen habe. Davor war bei ihr ständig besetzt.«
»Sie hat unter anderem mit mir telefoniert, danach vermutlich mit Edgar«, klärte Rapp ihn auf. »Aber wieso wolltest du überhaupt mit ihr sprechen? Ich gehe mal davon aus, dass du nicht Isabelles Neuer bist.«
»Gott bewahre, nein!«, rief Rimbout geradezu erschrocken aus. »Ich … Nein, nein.« Der Satz, den er wahrscheinlich verschluckte, war: Ich habe schon genug Probleme! »Ich habe sie angerufen, weil ihr Name im Handykalender unseres Opfers aufgetaucht ist. Demnach wollte der Mann sich heute Vormittag mit Isabelle in Colmar treffen. Was natürlich nicht mehr möglich war, weil sein Tod laut Forensik schon gestern am späten Abend eingetreten ist.«
Rapp begriff inzwischen gar nichts mehr. »Stopp mal, François. Wir sprechen hier von deinem Mordopfer oben an der Engelsburgruine?«
»Falls es ein Mord war«, warf Rimbout ein. »Aber solange wir nichts ausschließen können, interessiert mich natürlich, ob und gegebenenfalls warum Isabelle sich heute früh mit dem Mann, dem Opfer, treffen wollte. Nur, Jean Paul, ich kam vorhin gar nicht dazu, ihr den Hintergrund zu erklären. Kaum hatte ich ihr gesagt, um wen genau es sich bei dem Opfer handelt, brach sie in, wie soll ich sagen, eine Art hysterisches Schreien aus und brüllte ins Telefon, das sei ganz unmöglich und ich solle mich an dich wenden, du wüsstest über alles Bescheid.«
Das Gegenteil war der Fall. Doch jetzt stieg eine Ahnung in Rapp auf: »Deine männliche Leiche dort oben am Schlossberg, sie heißt nicht zufällig – Doudet? Didier Doudet?«
»Genau, Didier Doudet aus Schœnwiller. Wir fanden sein Handy, es besteht kein Zweifel, dass er es ist. Hatte Isabelle also doch recht.«
»Recht womit?«
»Dass du darüber Bescheid weißt.«
»Zut alors – verdammt, François!«, protestierte Rapp so energisch, dass selbst Honoré den Kopf hob, wenn auch nicht allzu sehr. »Ich hatte bis zu deinem Anruf keine Ahnung, dass Doudet der Tote ist, von dem du im Radio gesprochen hast. Was mich nur wundert, ist, dass ihr ein Handy bei ihm gefunden habt.«
»Das hat Isabelle auch gesagt. Der Doudet, den sie kenne, habe gar kein Handy. Deshalb könne es sich bei dem Toten in Thann auch nicht um ihren Didier Doudet handeln. Der sei nämlich ihr Therapeut und kerngesund. Dass er heute früh nicht bei ihr erschienen sei, um ihr ein spezielles Medikament zu verabreichen, müsse andere Gründe haben. Ich solle sie gefälligst in Ruhe lassen und mich an dich wenden, wie gesagt, du wüsstest ebenso Bescheid über Doudet wie sie.« Rimbout ließ zwei Sekunden verstreichen, ehe er anfügte: »Isabelle ist noch ganz die Alte, wie?«
Rapp fiel keine passende Antwort darauf ein. Doch er konnte sich inzwischen die Dinge einigermaßen zusammenreimen. »Falls euer toter Doudet wirklich derjenige ist, den Isabelle bis vor Kurzem noch ganz lebendig kannte«, erklärte er, »dann hat der Mann sie angelogen, was das Handy betrifft. Was ihm übrigens ähnlich sehen würde. Da du mich schon fragst: Ich halte ihn für einen ausgemachten Betrüger, der nur im Sinn hatte, Isabelle das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber bestimmt nicht ihr allein, ich vermute, er hatte noch mehr Opfer in der Region.«
»Möglich«, sagte Rimbout. »In seinem Telefonverzeichnis stehen Dutzende Namen, wir überprüfen deren Nummern selbstverständlich alle. Aber Isabelles Name in seinem Handykalender fiel mir natürlich sofort auf.«
Rapp hörte da einen Unterton heraus, der ihm nicht gefiel. »Du verdächtigst sie doch nicht in irgendeiner Weise? Das wäre absurd, François, das weißt du.«
»Ich wollte nur sichergehen, dass es sich tatsächlich um Isabelle handelt, deshalb habe ich bei ihr angerufen. Routinearbeit, du kennst das doch.«
»Schon. Aber du wusstest doch vorher, dass Isabelles Verabredung mit Doudet heute früh gar nicht mehr stattgefunden haben konnte, weil der Mann laut forensischem Befund bereits gestern Abend tot war, wie du selbst gesagt hast, François.«
»Darum ging es mir auch gar nicht.«
»Worum dann?«
Rapp hörte ihn tief Luft holen. »Der Termin deutet doch an, dass Isabelle zu der Kundschaft zählte, mit der er direkten Kontakt pflegte, und das ganz aktuell. Jedenfalls schließe ich das daraus, dass er sie heute wie schon in den Wochen und Monaten zuvor privat besuchen wollte.«
»Nicht privat, François, sondern als ihr Therapeut!« Rapp bestand nun notgedrungen selbst auf der Bezeichnung, bei der ihm fast die Zunge abbrach, so absurd erschien ihm der Titel »Therapeut« für eine dubiose Figur wie Doudet.
»Wie dem auch sei«, lenkte Rimbout ein. »Wir prüfen eben alle Spuren.«
»Soll das heißen, du betrachtest Isabelle ernsthaft als Spur?«
»Jedenfalls muss ich sie befragen, das weißt du, Jean Paul. Das Opfer kann seinem Mörder an der Ruine dort oben natürlich auch zufällig begegnet sein. Vielleicht war Alkohol im Spiel, ein spontan eskalierter Streit, die Kopfverletzungen könnten darauf hindeuten.«
»Totschlag also?«
»Ja, das wäre eine Möglichkeit. Doudet muss darüber hinaus einen großen Kunden- und Bekanntenkreis gehabt haben. Er führte einen Laden in Schœnwiller. Den haben wir heute früh übrigens schon inspiziert. Dort gibt es eine Registratur mit Hunderten weiterer Namen, die wir noch auswerten müssen. Außerdem hat er Wandertouren in den Vogesen angeboten, quasi Lehrpfade zu bestimmten Heilkräutern, zu denen sich die Interessenten spontan einfinden konnten.«
»An diesen oder irgendwelchen anderen Touren hat aber Isabelle ganz gewiss nicht teilgenommen, François. Sie ist seit Monaten so krank, dass sie die Wohnung nur verlässt, um hundert Meter weiter in der Markthalle das Nötigste zum Leben einzukaufen.«
»Aber wohl auch ein wenig unnötigen Alkohol, wie? Als ich eben mit ihr telefonierte, legte sie nach jedem zweiten Satz eine Pause ein mit den Worten ›Moment, François, ich brauch noch ’nen Schluck‹.«
»Da siehst du, was dieser Doudet aus ihr gemacht hat.«
»Ich verstehe dich, Jean Paul. Und du weißt, ich mag Isabelle. Aber, pardon, wenn ich das sage, getrunken hat sie schon früher. Wie ein Loch mitunter.«
»Apropos, wie geht es denn deiner Familie?« Rapp war danach, zur Abwechslung den Spieß einmal umzudrehen. »Marianne, Jeanne und Richard, ça va?«
»Tja, ich will es mal so ausdrücken: Eigentlich wollten Marianne und ich in zwei Monaten auf die Malediven fliegen.«
»Aber?« Denn nach einem Aber hörte es sich an.
»Die Zwillinge sind neuerdings auf dem Ökotrip, oder wie soll ich sagen? Sie nennen es konsequent, ich nenne es: radikal.«
»Und was heißt das genau?«
»Das heißt zum Beispiel, dass Jeanne und Richard hinter unserem Rücken unseren Maledivenflug storniert haben.«
»Oha!«
»Ja. Mit der Begründung, dass wir Fußabdrücke wie Dinosaurier in unserer Ökobilanz hinterlassen würden, wenn sie uns nicht daran hinderten.«
Rapp musste lachen. »Klingt, als solltet ihr ihnen dankbar dafür sein.« Er mochte die Einfälle der Zwillinge. Das Leben ihrer Eltern wurde durch sie zwar nicht einfacher, aber in jedem Fall abwechslungsreich.
»Dankbar?«, kläffte Rimbout aufgebracht in den Hörer. »Wo kämen wir hin, wenn wir unseren Kindern das durchgehen ließen? Hast du eine Ahnung, Jean Paul, wie hoch allein die Stornogebühren für den Flug waren, den die beiden heimlich gecancelt haben?«
»Nun reg dich nicht auf, François. Ich bin sicher, ihr findet eine Lösung, du und Marianne.«
»Die Lösung heißt: Urlaub gestrichen. Wir haben nur noch Geld für Balkonien.«
»Ich dachte an Jeanne und Richard. Was sagt denn deine Frau dazu?«
»Marianne steht auf dem Standpunkt, die zwei sollten sich zur Strafe selbst eine Aufgabe suchen, irgendetwas Nützliches. Nur solle die Schule nicht wieder darunter leiden.«
Rimbout spielte auf eine soziale Strafe an, die die Zwillinge vor einer Weile vom Thanner Jugendgericht aufgebrummt bekommen hatten, weil sie eine Kiste mit Sekt, Crémant d’Alsace, hatten mitgehen lassen, die wie herrenlos vor einem Supermarkt abgestellt worden war. Sie sollten sich, so die Jugendrichterin, in der Thanner Obdachlosenarbeit für Clochards einsetzen. Das hatten sie getan, und zwar mit solchem Engagement, dass an Lernen für die Schule nicht mehr zu denken gewesen war. Wenn sich seitdem jemand für die Clochards in Thann einsetzte, dann waren es Jeanne und Richard Rimbout.
»Halt mich auf dem Laufenden, François«, sagte Rapp und meinte damit den neuen Fall ebenso wie die Zwillinge. »Aber jetzt musst du mich entschuldigen, ich mache Galettes.«
»Ah, Galettes, wunderbar!«, schwärmte Rimbout. »Achte darauf, dass du den Teig schön flach streichst, und dann ganz langsam kross braten.«
»Merci«, dankte Rapp ohne Schwung. Den Tipp hatte er schon von Edgar bekommen.
»Und wen beglückst du mit deinen Galettes, wenn ich fragen darf? Kenne ich die Dame?«
»Wie kommst du darauf, dass ich dabei eine Frau im Sinn habe?«
»Ich bin Polizist, non?«
»Der Genießer schwelgt und schweigt, wie du weißt, François.«
»Dann wünsche ich dir fröhliches Schweigen, Jean Paul!« Er klang ein wenig beleidigt.
»Salut, François.«
Rapp legte mit reichlich gemischten Gefühlen auf und dachte über das Gespräch nach. Er glaubte Rimbout, dass er Isabelle nicht ernsthaft als mögliche Täterin betrachtete. Aber Rimbout hatte recht, selbstverständlich musste er sie schon aus Routinegründen zu ihrem geplanten Termin mit Doudet heute Vormittag befragen. Damit ließ sich nicht mehr vermeiden, dass sie überhaupt in den Fall verwickelt war. Vorerst nur als Zeugin, doch das konnte sich ändern, wenn sich andere Spuren zerschlugen oder sich keine ernsthaften Tatverdächtigen aufdrängten. Damit stieg der Ermittlungsdruck, und selbst Rimbout wäre unter Umständen gezwungen, Isabelle in weiteren Vernehmungen strategisch unter Druck zu setzen.
Keine Frage, dass sie das zutiefst aufwühlen und ihren Griff zur Flasche noch beschleunigen würde. Rapp war ihr Schicksal trotz allem, was geschehen war, keineswegs gleichgültig. Immerhin war sie Edgars Mutter und seit knapp zwei Jahren grandmère von Maëlle, dem kleinen Mädchen, das Edgar und Julien adoptiert hatten.
Er legte das Handy zur Seite, um Isabelle via Festnetz selbst noch einmal anzurufen. Vielleicht gelang es ihm, sie ein wenig zu beruhigen. Doch sie ging nicht ran, er nahm sich vor, es später noch einmal zu versuchen.
Die Galettes waren fertig, nicht ganz so flach gestrichen, wie Edgar ihm geraten hatte, ihre Form erinnerte eher an Tennisbälle, aber außen waren sie schön kross – Rapp liebte das. Das gute Dutzend Kartoffelpuffer tat er in eine Schale, platzierte sie auf dem Tisch und legte sich dann feierlich zwei goldgelbbraune Prachtexemplare auf den Teller. Die Kostprobe fiel allerdings gemischt aus. Geschmacklich war er zufrieden, Salz, Pfeffer, Gewürze – bon, die Mischung stimmte. Aber im Kern, musste er sich eingestehen, war der Teig wohl noch nicht vollständig durchgebraten, das Ganze kam ihm etwas breiig vor. Doch jetzt war es einmal auf dem Teller und musste gegessen werden, entschied er, als wäre er seine eigene Mutter.
Honoré, der sich inzwischen aufgerappelt hatte und mit hungrigem Blick neben seinem Stuhl zu ihm aufschaute, bekam jedoch nichts von der kleinen Zwischenmahlzeit ab. Erstens aus Prinzip, denn der Hund sollte nicht betteln – tat es aber trotzdem immer wieder –, zweitens vertrug sein sensibler Terriermagen nur allergenfreies Futter.
Honorés Flocken hätte er vielleicht auch selbst besser zu sich genommen, dachte Rapp, als er aufstand, um den Tisch abzuräumen. Die zwei Galettes lagen schwer wie Pétanque-Kugeln in seinem Bauch. Zum Glück, sagte er sich, als er den leeren Teller in die Spülmaschine stellte, war dies ein Probelauf gewesen. Allein die Vorstellung, er hätte Sylvie seine halb garen Galettes-Kugeln vorgesetzt, ließ ihn erröten. Am besten, er verabredete sich vorerst noch für eine stressfreiere Aktivität mit ihr, statt sie gleich zum Essen zu sich einzuladen. Die Kunst, Galettes de Pommes de Terre zuzubereiten, brauchte wohl doch mehr als eine Übungseinheit.
Er versuchte noch einmal, Isabelle zu erreichen, aber vergeblich. Dann öffnete er ein Fenster und lehnte sich ein Stück hinaus, um die frische Luft einzuatmen. Über den scharlachroten Dächern des Maison de Michelberger, eines renovierten, jahrhundertealten Fachwerkbauernhauses, in dem sich neben einigen Ferienunterkünften auch seine Maisonnettewohnung befand, hatte der Himmel aufgeklart. Gestern den ganzen Tag und noch am Morgen hatten graue Wolken über den Weinbergen gehangen; doch sie waren weitergezogen und hatten sich wohl erst jenseits des Rheins auf deutscher Seite ausgeregnet.
Der Wind hatte über Nacht gedreht und strömte nun trocken und warm Richtung Osten. Deshalb waren jetzt auch wieder wie gewohnt die Erntefahrzeuge und Menschen unterwegs, wie Käfer und Ameisen schienen sie sich an den Hängen zu bewegen. Unter ihnen waren vermutlich auch Martin und Irène Michelberger, das Vermieterehepaar, das zu den größten Weinbauern in Pfaffenhoffen gehörte. Ihr Gewürztraminer, fand Rapp, war unübertroffen.
Er nahm sein Jackett von der Garderobe im Flur und leinte Honoré an. »Allez hopp, Monsieur! Zeit für die Mittagsrunde«, rief er ihm zu, doch sein Hund hatte längst verstanden und stand schon bereit.
Unten im Hof atmete Rapp noch einmal durch, die Luft war klar und frisch. Über die klobigen Pflastersteine hinweg erreichte er das Zwischengebäude, das früher einmal als Lagerhalle gedient hatte; auf dessen anderer Seite stand unter dem Carport seine Charleston-Ente, ein Deux-Chevaux-Sondermodell mit schwarz-roter Lackierung. Michelbergers grauer Renault Espace, der üblicherweise daneben parkte, war nicht zu sehen. Rapp hatte also richtig vermutet, sie arbeiteten im Weinberg.
»Allez hopp!«, wiederholte er und setzte Honoré auf die Rückbank, denn von Springen und Hüpfen konnte in seinem Hundealter nicht mehr die Rede sein.
3
Bis nach Thann waren es etwa dreißig Kilometer Richtung Süden, die Rapp über die Route nationale am nahe gelegenen Rouffach, später auch an Winzenheim vorbei, zurücklegte.
Über der Rheinebene spannte sich der wolkenlose Himmel wie eine blaue Leinwand. Nur über den Höhen der Vogesen jagten noch einzelne Wolken nach Westen wie davonstürmende Reiter in flatternden weißen Mänteln.
Während Honoré hinten döste und die Sonne durch die Frontscheibe blitzte, dachte Rapp über das nach, was er an diesem Vormittag überraschend aus gleich zwei Richtungen, zuerst von Isabelle, dann von Rimbout, erfahren hatte. War das nicht doch irgendwie typisch, fragte er sich, dass zwielichtige Typen wie dieser Doudet starben, wie sie gelebt hatten: unter äußerst dubiosen Umständen eben? Sicher, er hatte den Mann nicht persönlich gekannt, doch allein die Tatsache, dass Isabelles Franck diesen selbst ernannten Heiler in ihr Leben geschleust hatte, reichte ihm, um von Doudets zweifelhaften Eigenschaften überzeugt zu sein. Und Isabelles eher zu- statt abnehmende Alkoholsucht gaben ihm recht, fand er.
Als er an Winzenheim vorbeifuhr, sah er vom Seitenfenster aus die Abfahrt, die ziemlich direkt zur Garage Lautermann führte. Lautermann gehörte Rapps Meinung nach in dieselbe Kategorie wie Doudet. Und Franck. Niemand wusste genau, was sie neben ihrer offiziellen Tätigkeit – in Lautermanns Fall das Reparieren von Autos – noch so alles trieben. Doch dass sie ihre Finger in dunklen Geschäften hatten, ahnte man, sobald man in ihren Dunstkreis geriet. Davon konnte auch Güschti ein Lied singen, dem Lautermann in Winzenheim Konkurrenz machte, indem er der Kundschaft obszön unterbezahlte Angebote machte, nur um Güschti zu unterbieten.
Hinter Cernay erreichte Rapp über die RN 66 Vieux-Thann und schließlich Thann-Centre. In früheren Zeiten ein Zentrum der Textilindustrie, zählte das Städtchen heute zu den »schönsten Umwegen Frankreichs«, hatte Rapp irgendwo gelesen. An den südlichen Ausläufern der Vogesen gelegen, wurde es vom Rangen überragt, einem ebenso steilen wie wegen seiner ausgezeichneten Lage berühmten Weinberg, an dessen Fuß die tief in den Vogesen entspringende Thur lebhaft entlangsprudelte.
Ein Anziehungspunkt war Thann nicht zuletzt auch wegen Saint-Thiébault, der Stiftskirche für den heiligen Theobald, deren Bau zweihundert Jahre gedauert hatte und deren Portal mit seinen Hunderten Figuren und Szenen allein schon den Besuch des Städtchens lohnte. Auch wenn es an Größe von dem Münster in Strasbourg übertroffen wurde, war Saint-Thiébaults gotische Kirchturmspitze in Thann doch ebenfalls weithin zu sehen.
Rapp parkte den Wagen an der Place Joffre, direkt neben dem Münster, und spazierte mit Honoré über die belebte Rue Saint-Thiébault an Restaurants, Cafés und Teestuben vorbei zum Ufer der Thur. Von der mit Blumenkästen geschmückten Brücke aus warf er einen Blick nach Osten, zum Hexenturm hinüber, ehemals ein Eckturm des mittelalterlichen Wehrwalls der Stadt, mit seinem charakteristischen zwiebelförmigen Dach und den Schießscharten. Im Westen erhoben sich die Vogesen mit ihrem sattgrünen Waldbestand, und gegenüber, auf der anderen Flussseite, sah man wie derzeit überall in den Weinbergen die Erntearbeiter auch an den sonnenbeschienenen Hängen des Rangen. Der Weinberg war so steil, dass Erntefahrzeuge nicht zwischen den Rebreihen eingesetzt werden konnten, sondern nur auf breiteren Plateaus. Vis-à-vis blickte das Hexenauge, ein herabgestürzter Rest des Bergfrieds der Ruine, starr und steinern auf Stadt und Fluss herab.
Rapp überquerte die Brücke und begann über die Rue Marsilly den Aufstieg in mehreren Windungen um den Schlossberg hinauf bis zur Engelsburgruine. Es gab auch einen kurzen, steilen Aufstieg, doch den mochte er weder seinem alten Hund noch sich selbst zumuten.
Etwa auf halber Strecke kamen ihnen zwei Einsatzwagen der Gendarmerie entgegen; sie war in solchen Fällen für die ordnungsgemäße Sicherung des Tatorts zuständig. Nach guten zwanzig Minuten erreichten sie das Schlossbergplateau, auf dem die Burg im Mittelalter errichtet worden war. Später befand der »Sonnenkönig« Louis XIV. sie nicht mehr für notwendig und ließ sie niederreißen. Wer wollte, konnte seitdem auf den Ruinen stehend die atemberaubende Aussicht auf das Städtchen und den rauschenden Fluss am Fuß des Berges genießen; dabei den Blick nach Westen gerichtet, auf die bewaldeten Spitzen der Vogesen, und nach Osten über den weiten Korridor der Rheinebene hinweg bis zum Schwarzwald und, mit Glück, bis zu den Schweizer Alpen, über denen bei gutem Wetter die Mittagssonne glühte.
Außer dem »Hexenauge«, das wie ein gigantisches steinernes Wagenrad haushoch aufragte, waren nur noch wenige Reste der Burgruine vorhanden. Am heutigen Tag waren nicht einmal sie zugänglich für das gemeine Volk.
Vor dem herabgestürzten Bergfried war durch rot-weißes Flatterband ein breites Areal abgegrenzt worden, bewacht von einem beleibten älteren Gendarmen, der es sich, eine Zigarette rauchend, auf einem klobigen Ruinenrest gemütlich gemacht hatte.
Als der Gendarm aufblickte, sah er Rapp mit seinem Hund bis an die Absperrung herankommen, stand mühsam auf und rief ihm schon von Weitem zu: »Non, non, non, non, Monsieur! Kein Zugang heute, tut mir leid.«
Rapp musste lachen. Er erkannte in dem grauhaarigen Gendarmen, der ihm, den dicken Bauch voran, entgegenkam, Ives Robert, früher Mitglied im Pétanque-Club Vieux-Thann. Zu seiner aktiven Zeit, bevor Rapp sich durch einen Unfall eine irreparable Handverletzung zugezogen hatte, waren Ives und er sich in diversen Wettkämpfen zwischen den Ortsvereinen der Region oftmals über den Weg gelaufen. Sie waren beide in etwa gleich unbegabt in diesem Sport und hatten ihn wie die meisten anderen ausgeübt, um unter Menschen zu sein, sich nebenbei zu unterhalten und, in der Hauptsache, um sich zu entspannen, egal, wie weit die Kugeln am Ende von der kleinen Zielkugel, der cochonnet, entfernt landeten.
Jetzt erkannte auch Ives ihn. »Jean Paul!«, begrüßte er ihn schnaufend. »Was machst du hier oben?« Sie reichten sich über das Flatterband hinweg die Hände. »Ich dachte, du wärst längst in Pension?« Er sah Rapp mit seinem runden roten Gesicht freundlich blinzelnd an.
»Bin ich auch, Ives. Aber, du wirst es nicht glauben, François Rimbout rief mich heute früh an und … na ja, du verstehst, wir waren lange Kollegen und so weiter …«
»Mit anderen Worten, du sollst mal einen Blick auf die blutigen Details werfen, richtig?«, schloss Ives Robert aus dieser Andeutung ebenso naheliegend wie falsch.
Rapp zog nur vielsagend die Brauen hoch.
»Na, dann hinein mit euch in die gute Stube.« Ives Robert hielt für Rapp und seinen Hund das Band in die Höhe. »Die Spurensicherung war ja längst da, die Kollegen sind schon fort. Ich halte hier noch bis zum Feierabend die Stellung. Als Chef der Gendarmerie soll man ja mit gutem Beispiel zurückbleiben, oder?« Er lachte noch immer so herzhaft wie früher.
»Wusste gar nicht, dass du inzwischen die Truppe leitest, Ives«, sagte Rapp. »Meinen herzlichen Glückwunsch!«
»Merci bien.«
»Und das Pétanque, Ives? Bist du noch aktiv im Club?«, fragte Rapp, während sie sich dem Fundort der Leiche, offenbar am Hexenauge, näherten.
»Und wie! Ich feuere seit einiger Zeit aktiv meine Enkelkinder an, die im Club begonnen haben zu spielen, nach dem Vorbild ihres grandpère.« Er lachte wieder dröhnend. »Ansonsten nur noch privat, hier und da und dort, wie es sich gerade ergibt.«
»So wie ich«, sagte Rapp und beäugte bereits eine blutrote Stelle an einem der großen, aus der Thur stammenden Kieselsteine des Hexenauges, der deutlich hervorstand. Er deutete mit dem Kinn darauf. »Hier also, ja?«
»Hier lag er, ja. Touristen, die Sorte Frischluftfanatiker und Frühaufsteher, du verstehst, haben ihn heute in aller Herrgottsfrühe entdeckt. Ich habe die Leiche noch zu Gesicht bekommen, als wir anschließend den Tatort gesichert haben und die Forensiker ihn unter der Fuchtel hatten.«
»Und?«
»Ich sag dir, Jean Paul, der Mann sah aus, als hätte ihn eine Schlägerbande stundenlang in der Mangel gehabt. Beide Schläfen zerdellt wie ein alter Eimer, die Kinnlade auf halb acht und der Schädel insgesamt auf Punkt zwölf gestellt.«
»Sehr plastisch.«
»So etwas hast du noch nicht gesehen, Jean Paul. Also für mich sieht das eindeutig danach aus, dass der arme Mann das Pech hatte, auf eine Horde Schläger zu treffen. Alkoholisierte Jugendliche, wahrscheinlich von außerhalb, wird allgemein vermutet.«
»Wieso das?«
»Nicht nur ich, Jean Paul! Hab vorhin mit Gisèle, meiner Frau, gesprochen. Sie sagt, im Ort sind alle, mit denen sie spontan über die Sache geredet hat, der Meinung, dass so etwas Brutales keinem Menschen aus Thann zuzutrauen wäre.« Ives zuckte die Schultern, und sein Bauch zuckte quasi mit. »So ähnlich sehen das auch die Kollegen, mit denen ich bislang geredet habe: junge Touristen, die sich gestern Nacht hier oben betrunken und dann Streit gesucht haben, das wäre ein plausibles Szenario.«
Rapp kommentierte das nicht. Er betrachtete stattdessen die blutige Stelle an der Bruchsteinkante. Da Doudet hier folglich mit dem Kopf aufgeschlagen war, würde das zumindest die Verletzungen auf der einen Schädelseite erklären. Dann drehte er sich halb um die eigene Achse und inspizierte das von dichtem Gras, stellenweise auch von Gestrüpp und Sträuchern bewachsene Gelände, ehe er sich wieder an Ives Robert wandte.
»Habt ihr denn irgendwelche Hinweise auf eine solche Tätergruppe gefunden? Was ist mit Schnapsflaschen, zerbrochenem Glas et cetera?« Eine alkoholisierte Schlägertruppe müsste jede Menge Spuren hinterlassen haben.
Ives schüttelte den Kopf. »Nein, nichts. Der Platz wird ja immer ziemlich sauber gehalten von wegen Denkmalpflege. Die Spurensicherung hat deshalb auch die Papierkörbe drüben am Übergang zur Straße untersucht.«
»Aber besoffene Typen benehmen sich nicht wie die Denkmalpflege oder umweltbewusste Besuchergruppen. Sie räumen nicht brav ihre leeren Flaschen weg, auch nicht, wenn sie gerade einen Mann erschlagen haben.«
»Da magst du recht haben, Jean Paul«, räumte Ives Robert ein, er war kein Mann, der am Ende stets recht behalten wollte. »Rimbout selbst wird am besten wissen, ob die Spurensicherung etwas Auffälliges gefunden hat. Ich war in der Zeit ja mit dem Absichern des Tatorts beschäftigt. Du weißt, Rimbout will immer einen möglichst großen Zirkel um den Tatort abgesperrt haben. Gar nicht so leicht hier oben am Berg.«
Rapp nickte abwesend und ließ den Blick noch einmal über das Gelände schweifen. Dann wandte er sich wieder an Ives. »Wie war eigentlich das Wetter in Thann gestern Abend? Bei uns in Pfaffenhoffen war es den ganzen Tag und auch am Abend noch neblig. Ich weiß das, weil ich mit Monsieur hier noch Gassi gegangen bin.« Er deutete mit dem Kinn auf Honoré, der mit sichtlicher Wonne die würzigen Gerüche der Vogesenlandschaft durch die Hundenase einsog.
Ives musste lachen. »Wir haben’s genauso gemacht, Gisèle und ich. Waren mit Hippolyte, unserem Labrador, um elf noch mal draußen. Genau wie bei euch in Pfaffenhoffen war’s neblig und sogar leicht nieselnd. Ziemlich ekliges Wetter.«
»War das den ganzen Abend über so?«