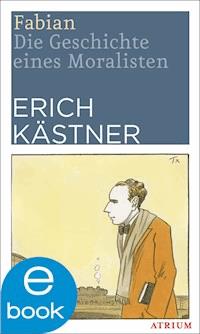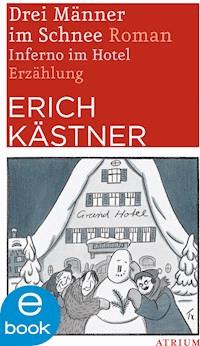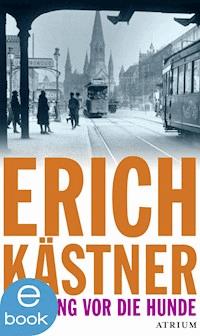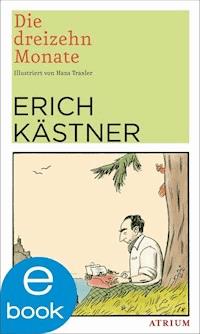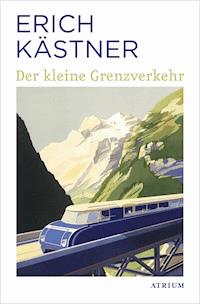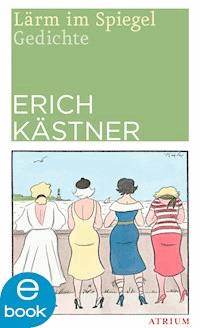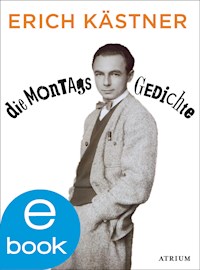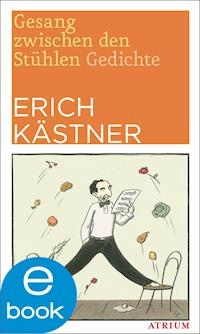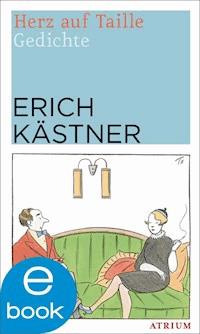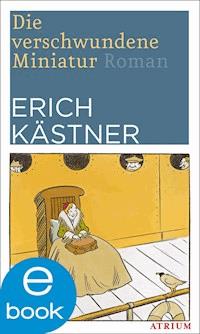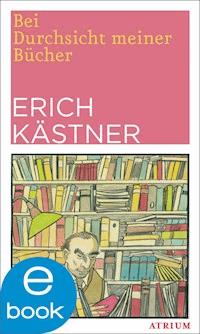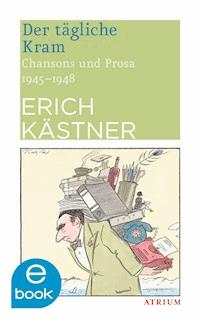Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn man sich einen Tag am Strand vorstellt, denkt man meist an Sonne, Faulenzen, Urlaub. Doch das muss nicht so sein, wie uns Erich Kastner in seinem Buch „Vermerke eines Verirrten“ eindrucksvoll zeigt. Zwar hält sich der Protagonist auch hier am Strand auf und zeichnet sich nicht unbedingt durch hektische Betriebsamkeit aus. Gleichwohl ist dies nicht mit einem kompletten Abschalten des Verstandes verbunden. Im Gegenteil bekommt er in seinen Träumen immer wieder Einblicke in die Wissenschafts- und Gesellschaftsentwicklung der letzten Jahrhunderte. So werden der Strandträumer und damit natürlich ebenso wir als Leser detailreich und fundiert, aber immer auch unterhaltsam über Kant, die String-Theorie, Einsteins-Relativitätstheorie oder über Johann Wolfgang von Goethe aufgeklärt. Darüber hinaus kommen humoristische Passagen wie der Dialog zwischen Business-Leuten, der den Charakter ihres inhaltslosen Phrasendreschens gnadenlos offenlegt, nicht zu kurz. Abgeschlossen wird das Ganze mit Zitaten aus Musils „Mann ohne Eigenschaften“. Das Buch richtet sich an alle Leser, die eingetretene Denkpfade verlassen wollen und mehr über die naturwissenschaftlichen, aber auch geistesgeschichtlichen Grundlagen unserer Zivilisation erfahren wollen. Auch fehlt es nicht an Erkenntnissen über das Weltall. Für Kastner besteht die Welt dabei vor allem aus chaotischen Elementen, was er mithilfe der Traumstruktur seiner Erzählung noch zu verdeutlichen versucht. Gleichwohl gelingt es dem Autor diese anspruchsvolle Thematik nicht nur trocken zu präsentieren. Vielmehr belohnt er den Leser immer wieder mit lustigen und geistreichen Bonmots und skurrilen Geschichten bzw. Dialogen für seine Aufmerksamkeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erich Kastner
Vermerke eines Verirrten
AUGUST VON GOETHE LITERATURVERLAG
FRANKFURT A.M. • LONDON
Die neue Literatur, die – in Erinnerung an die Zusammenarbeit Heinrich Heines und Annette von Droste-Hülshoffs mit der Herausgeberin Elise von Hohenhausen – ein Wagnis ist, steht im Mittelpunkt der Verlagsarbeit. Das Lektorat nimmt daher Manuskripte an, um deren Einsendung das gebildete Publikum gebeten wird.
©2018 FRANKFURTER LITERATURVERLAG
Ein Unternehmen der
FRANKFURTER VERLAGSGRUPPE
AKTIENGESELLSCHAFT
Mainstraße 143
D-63065 Offenbach
Tel. 069-40-894-0 ▪ Fax 069-40-894-194
E-Mail lektorat@frankfurter-literaturverlag.de
Medien- und Buchverlage
DR. VON HÄNSEL-HOHENHAUSEN
seit 1987
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.d-nb.de.
Websites der Verlagshäuser der
Frankfurter Verlagsgruppe:
www.frankfurter-verlagsgruppe.de
www.frankfurter-literaturverlag.de
www.frankfurter-taschenbuchverlag.de
www.publicbookmedia.de
www.august-goethe-von-literaturverlag.de
www.fouque-literaturverlag.de
www.weimarer-schiller-presse.de
www.deutsche-hochschulschriften.de
www.deutsche-bibliothek-der-wissenschaften.de
www.haensel-hohenhausen.de
www.prinz-von-hohenzollern-emden.de
Dieses Werk und alle seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.
Nachdruck, Speicherung, Sendung und Vervielfältigung in jeder Form, insbesondere Kopieren, Digitalisieren, Smoothing, Komprimierung, Konvertierung in andere Formate, Farbverfremdung sowie Bearbeitung und Übertragung des Werkes oder von Teilen desselben in andere Medien und Speicher sind ohne vorgehende schriftliche Zustimmung des Verlags unzulässig und werden auch strafrechtlich verfolgt.
Lektorat: Tobias Keil
ISBN 978-3-8372-2007-0
Für Eva – im Erinnern an meine Mutter Cäcilia & Bernd (auch an andere)
Vorweg
Der folgende Text muss dem Schreiber anonymerweise eingesagt worden sein. Er hat mit dem Einsagen – schon wechselseitig – als Schüler ausgiebigste Erfahrungen gemacht; echt gute Seilschaften gab’s damals. Hinsichtlich der Einsagequelle scheint ihm ein gewisser Verdacht nicht von der Hand weisbar: Sollte ein Hauch von Entschuldigung mit diesem Freundschaftsdienst nicht irdischen Ursprungs verbunden sein, so nähme er diesen mit einer Träne im Auge liebend gern an.
Schon aus dem 1. Absatz ist sicher zu entnehmen, dass die Ich-Form dem folgenden Text höchst unangemessen wäre. Allgemeinere Vorbehalte gegen die Wörter „ich“, „selbst“, „bewusst“, „Bewusstsein“ und die üblichen charakteristischen Kategorien aus deutschem Bildungsgut spielen allerdings auch eine Rolle – basta.
Die annähernde Namensgleichheit mit einem berühmten Schriftsteller ist für das Aufgeschriebene nicht von Belang – die Nazihorde und den Krieg hatte jener – wem auch immer zu danken – arg gebeutelt, aber nicht gebrochen, überlebt, jedoch muss der mit dem ähnlichen Namen gestehen, dass er beim Aufsuchen einer Straße im Stadtplan von München erst glaubte, eine „Erich-Kastner-Straße“ gefunden zu haben; beim sehr genauen Hinsehen entdeckte er aber doch die beiden Pünktchen fürs „ä“ unter dem blauen Strich einer Buslinie, die in dieser Straße verläuft.
Es gibt ungezählte schöne Strände auf der Erde, die bevorzugten des mal mehr, mal weniger rotweinseligen Strandgastes liegen am Mittelmeer: auf den Inseln der Ägäis, in Spanien nur wenige, einer auf Mallorca, nicht zuletzt bei Savonna am ligurischen und in Grado am adriatischen Teil des Mittelmeeres.
Inhaltsverzeichnis
Vorweg
Strandsandgewisper
Saramagos Terrorparabel
Kant und die Feigheit
Die Goethespirale
Hemingways Fehlschluss
Attacke auf Sophismen
Dinnerfight
Astronautensein – Nichtsein
Eine furchtbare Gleichung
Absturz ins Relative
Uhren ticken oben anders
Spezielles über Kegel
Gerade im Gekrümmten
Jünger bleiben im All
Modelluniversen zuhauf
Im Bann der „Dunklen Materie“
Der „Urknall“ als Schöpfung
Sternenschicksale
Quantenmechanische Existenzsorgen
All diese Kräfte und Teilchen
Symmetriedogmen
Sternenschicksale
Von kosmischen „Wurmlöchern“
Sturzflüge ins „Schwarze Loch“
Teilchentänze
Apokalypsenfieber
Expansive Restfragen
Das Prinzip Mensch
Inflationsblasen
Geschichten – Geschichten
Zeitpfeil – Hin und Her
Raumzeitvarianten en masse
„Zeitreiselatein“
„Teilchenmixantispin“
Eine Kraft, die alles schafft?
Das Superding „String“
Dimensionsinflation
„Stringente“ Parallelen
Bilderzauber
Verschwimmende Rosen
Erträumte Irrlichter
„Ensemblemix“
Grausliche Wachheit
Natur aufbessern
„Kostenknallerei“
Scheidungsgroll
Klimatischer Dämmer
Sonniges
Noch am Meer
Zum „Undwort“
„Sex in public“
Betteleifrust
„Poliziologie“
„Multisymbolkulti“
Ein übler Scherz.
Wohnen statt hausen
Von Staats wegen
Deutschland ahoi
Schon zuhause
Strandsandgewisper
Man sitzt, grob geschätzt, mit einer einstelligen Millionenzahl Hingucker(innen), Vor-, Nach- und Umdenker, Tagträumer – Spinner – in den auch herinnen wärmenden Strahlen unseres Zentralgestirns am Strand und schaut blinzelnd auf die Meeresoberfläche, die – leicht bewegt – das Sonnenlicht in zahllosen Blitzen reflektiert. Nichts Besonderes, aber doch ein geläufiger Beweis für das uns Menschen umgebende und enthaltende Chaos.
Wie das? Haben wir nicht gelernt, Beobachtungen zu benennen, zu ordnen, festzuhalten, zu ergründen? Sind wir nicht handelndes Subjekt fähig, der Natur unsere Maßstäbe anzulegen, ihre Kräfte zu zähmen, ihre mineralischen, pflanzlichen und tierischen Schätze zu nutzen, je intensiver, desto gewinnbringender?
Gemach. Insoweit wir unterscheiden, messen und zählen können, ja. Wie steht es aber mit den Blitzen des reflektierten Sonnenlichts? Hat sein Unvermögen, diese zu zählen, nur mit der eingeschränkten Aufnahmefähigkeit des blinzelnden Strandgastes zu tun? Vordergründig durchaus plausibel, denn er muss ja seine Augen trotz Sonnenbrille zu ihrem Schutz immer wieder für Sekundenbruchteile schließen. Außerdem wechseln die Blitze so schnell ihre Reflexionspunkte und Intensität, dass auch bei einer Begrenzung des Blickfeldes auf einem minimierten Ausschnitt die menschliche Wahrnehmungs- und Verarbeitungskapazität immer überfordert sein wird. Die Meeresoberfläche kennt keinen Ruhestand. Es gibt eben keine absolute Windstille und ebenso wenig absolute Strömungslosigkeit im Meer.
Sind aber nicht für solche und ähnliche Problemchen elektronische Wahrnehmungs- und Aufzeichnungsgeräte, Registrier- und Analyseprogramme für Hochleistungscomputer entwickelt worden? Digital funktioniert doch einfach alles. Ist deren Reaktionsgeschwindigkeit nicht millionenfach größer als die des menschlichen Auges? Unbestreitbar, trotzdem aber nicht ausreichend für das exakte Zählen von allen Reflexionsblitzen der Meeresoberfläche im Blickfeld eines Augenpaares in einem bestimmten Zeitraum. Mit deren Überlagerungen käme die Forschung auch digitalelektronisch nicht zurecht, und es sieht weiter nicht danach aus, als ob dies bei der sich abzeichnenden Potenzierung der Rechenoperationen im Nanosekundenbereich je erreicht werden könnte. Warum sollte es angestrebt werden, wo doch ein Nutzen nicht erkennbar ist? Für die Kursbestimmung aufliegender Raketen sind ja die aktuellen Rechnergeschwindigkeiten durchaus ausreichend, wenn sich keine Funktionsfehlerchen oder Computerviren einschleichen. An einem schönen Strand sitzend kann/darf man darüber doch mal rein spielerisch sinnieren.
Die kleinen Wellen spülen unterdessen Sand auf den Strand und zu einem großen Anteil wieder zurück ins Meer. Auf Körnchengröße – 0,06 bis 2 Millimeter – geschliffenes Gestein, irgendwo von hohen Wellen aus Felsküsten gebrochen, wie man weiß. Der Wind vermag nur Körnchen bis 0,08 Millimeter Größe zu verwehen. Die Schleifarbeit wird hauptsächlich vom Meer geleistet. Um Quarzkörper zu halbieren, braucht es 100 bis 300 Kilometer Transportstrecke. Diese haben wegen ihrer großen Härte den bedeutendsten Anteil an den Sandstränden und erzeugen deren zwischen Eierschalenweiß und kräftigem Gelb changierende Farbe. Andere Mineralien werden leichter zu Mehl – unter 0,06 Millimeter Korngröße – zermahlen, schweben im Meer oder werden vom Wind über die Kontinente verteilt. Korallenkörnchen verleihen – verliehen wird man wegen der Ausbleichung wohl bald sagen müssen – dem Strand hellweiße bis rosarote Farbtönungen; eisenbraune bis tiefrote, fast schwarz glänzende Vulkanstrände, wenn sie vom Meerwasser umspült werden. An Ostseestränden können Bernsteinkörnchen und an der Nordwestküste Südafrikas sogar Diamantsplitter dem Sand beigemischt sein, jedoch beide nicht in geldwerten Mengen.
Nordafrikanische Wahrsager sollen noch heute den Sand als Orakel benutzen, indem sie mit Daumen und Zeigefinger Lochreihen hineindrücken und behaupten, daraus die Zukunft ablesen zu können.
Verrechnet mit der gegenwärtigen Weltbevölkerung verbraucht jeder Mensch während seiner Lebenszeit 460 Tonnen Sand und Kies – solche Strände mit einer Körnergröße von über 2 Millimetern sind ja nicht besonders beliebt – eine Menge, die neben dem Feinsand für die Zahnpasta auch die sehr spezifischen Mischungen für den hochwertigen Beton von Raketensilos und Bunkern enthält, ein Aufwand, der nach der Meinung vieler Militärs und Politiker nicht hoch genug angesetzt werden kann.
Wie auch immer – die Meeresströmungen und von den Winden erregten Wellen bewirken, wohin Sand abgetragen und geschwemmt wird. Über ungefähre Schätzungen ist bisher niemand hinausgekommen, und Voraussagen verbieten sich bei der Unsicherheit der Klimaprognosen von selbst – ein chaotischer Zustand, auch was die so simpel anmutende Unterlage anbetrifft, auf der man sich gerade wieder ein wenig ausstreckt. Die flachen Wellen laufen, wie man leicht sehen kann, nie in einer geraden Linie auf den Sand zu. Die Küstenlänge Italiens wird in Atlanten, auch in Reiseprospekten mit über 7000 Kilometern angegeben – genauere Angaben differieren deutlich. Dass sie sich ständig verändert – sich ständig verändern muss –, kann man von seinem Platz am Strand aus auf wenigen Metern beobachten. Die Höhe der Auf- und Abspülung des Sandes wechselt unentwegt. An Felsküsten finden diese Veränderungen in unvergleichlich längeren Zeiträumen statt, doch auch dort ist zusätzlich zur Abtragung von Fels durch die Brandungsbrecher eine ständige Bewegung, ausgelöst durch die Verschiebung der Erdkrustenschollen, im Gange und nachweisbar. Mit elektronischen Mitteln – Vermessungsmarken in den meeresnächsten Null-Höhenpunkten können von Satelliten abgetastet werden etc. – kann die Küstenlinie immer neu kartographiert werden, aber über eine sehr vage Augenblicksgültigkeit kommt auch das bestausgestattete Vermessungsamt nicht hinaus. Einer eingehenden Beschäftigung mit diesem Problem sitzt man am Strand natürlich besonders abgeneigt gegenüber, aber in Ermangelung angenehmer Abwechslungen schaut man eben der andauernden, unregelmäßigen Änderung der italienischen Küstenlänge zu, wohl wissend, dass es sich nicht um besonders wichtige Beobachtungen handelt. Fürs Hinsehen und Nachdenken gibt’s halt keine zuverlässigen Bremsen – Schlafen, brachiale und krankheitsbedingte ausgenommen –, man kann dann ganz leicht die Grenzen zum Verirrten verletzen. Chaotische Zustände im Gehirn eines Menschen gelten allgemein als Krankheit, das Chaos kann sich aber auch in durchaus rationale Verhaltensweisen einschleichen und darinnen einnisten – am italienischen Strand, wie anderswo auch; bei hoch gestellten Entscheidern mutmaßt man es des Öfteren.
Kaum vermeidbar, dass einem die Fische und anderes Wassergetier angesichts des Meeres in den Sinn kommen, solange noch Restbestände sich darin erhalten haben. Es sind ja an Stränden meist irgendwelche Markierungsbojen verankert, um anzuzeigen, wie weit Nichtschwimmer sich hinauswagen dürfen oder wo Fischer in der Hoffnung auf einen überraschenden Fang ihre Netze ausgeworfen haben. Landmarken sind auch vorhanden, und seien es nur Sonnenschirme anderer – meist zu vieler – mehr oder weniger störender Strandgäste. Man kann sich leicht Begrenzungslinien zwischen diesen verschiedenen Eckpunkten vorstellen. Könnte man jedenfalls, und schon drängt sich die Mutmaßung über die Anzahl der Fische – einschließlich der kleinsten – in dem eingegrenzten Meeresraum dazwischen. Man hat schon einige Mühe damit, diesen Bereich im intellektuellen Eigenspeicher manifest zu erhalten, wobei die Begrenzungslinie zwischen Meer und Strand – man erinnert sich an zuvor Bedachtes – sowieso eine fließende ist und sich irgendwie bereits wieder nicht im grünen, sondern im chaotischen Bereich der elektrischen Impulse befindet. Lauter überraschende Flossenschläge, nach links, rechts, nach oben oder unten steuernd, oft mehrfach in dieselbe Richtung, manchmal blitzschnell hintereinander, dann wieder in größeren Zeitabständen. Wer wollte es unternehmen, aus dieser im Aquarium oder durch die Taucherbrille in klarem Wasser leicht beobachtbaren Bewegungsvielfalt rationale Ableitungen oder gar statistische Erhebungen dingfest zu machen? Klar, es sind Nervenreize, die Flossenschläge auslösen, von instinktiv gespürter Gefahr, von Lichtintensitätsschwankungen, von Strömungsimpulsen oder einfach von kleinsten Abweichungen des Hormonspiegels, vielleicht nur von kaum messbaren Differenzen der Wassertemperatur beeinflusst. Einen schlüssigen Vers wird sich darauf auch intensivste Forschung nicht machen können, sollte auch der letzte Genombuchstabe jeder Fischart einmal entziffert sein. Diese Bewegungsvielfalt wird für die menschliche Beobachtungs- und Analysierungskapazität chaotisch bleiben müssen. Von Krebsen, Muscheln, Korallen, dem Plankton überhaupt einmal ganz abgesehen.
Zählbar sind die Lebewesen in dem vorgestellten Meeresabschnitt aber schon, muss man an dieser Stelle der Strandgedanken einwerfen. Entlang der virtuellen Begrenzungslinien müssten doch nur in Nanosekundenschnelle Schotten ins Wasser abgelassen werden, die noch einige Zentimeter tief in den Sand am Meeresgrund eindringen. Aber diese Weise könnte eine begrenzte und definierbare Gesamtheit, der auf einen bestimmten Zeitpunkt bezogenen Ausschnitt des kreatürlichen Lebens im Meer beobachtet werden. Vielleicht würden dabei einige, trotz der Hinweise auf eigene Gefahr wegen der herabfallenden Schotten, Badende mit erfasst werden, was eventuell gewisse Rückschlüsse auf das Zusammenleben von Mensch und Fischen im Lebenselement der letzteren erlauben würde.
Gefehlt. Den Zeitpunkt an sich gibt es im von uns erfahrbaren Lauf der Zeit eben nicht. Abgesehen von der Möglichkeit, ja der Wahrscheinlichkeit, dass die ins Meer eintauchenden Schotten ein Fisch oder ein viel kleineres Lebewesen zerteilen würde, wodurch die Frage der Zuordnung – drinnen oder draußen – aufgeworfen würde, wird es nie, auch nicht mit allerkleinsten Annäherungsschritten, möglich sein, einen bestimmten Zeitpunkt festzuhalten; er wird immer bereits vergangen sein. Muss ein Beobachter natürlicher Vorgänge sich überhaupt abhängig machen von einem bestimmten Zeitpunkt? Wissenschaftlich gesehen nicht, denn Verhaltensweisen und Reaktionen von Lebewesen verbrauchen ja Zeit, um es einmal banal betriebswirtschaftlich auszudrücken, haben vielfach einen bestimmbaren Rhythmus und messbare Intensität. Wurden und werden nicht immer diffizilere Versuchsanordnungen entwickelt, um Nachweis und Präzision der beobachteten Vorgänge in ungeahnte Differenzierungen zu steigern? Das Einbringen von Fischen in Aquarien und von so vielen anderen Tieren in Käfigen sind nur die geläufigsten Methoden, und viele haben ja auch ihren Spaß daran und zahlen eine Menge Geld dafür, worüber man sicher auch in anderen Zusammenhängen in Nachdenklichkeit verfallen könnte.
Warum nur kommt man am Strand so leicht in Versuchung, sich nicht mit praktischen Betrachtungen zufriedenzugeben, warum gerade hier dieses Insistieren auf Beobachtungen zu ideellen Zeitpunkten und in theoretischen Versuchsanordnungen? Weiß der Teufel warum, wahrscheinlich aber hat man einfach eine Art Ahnung, dass nur so dem Menschen die Erkenntnis über das universelle Chaos in seiner Umwelt sich vermitteln könnte.
Wie denn? Wir sollen in chaotischen Umständen leben? Ist nicht solider Verlass auf die Natur, auf Tag und Nacht, Sommer und Winter in regelmäßigem Wechsel, auf die Gezeiten des Meeres, auf Ernten – bessere und schlechtere –, dort wo Menschen gesät und gepflanzt haben, darauf, dass Sonnenschein und Regen sich einigermaßen ausgleichen, um das Mittelmeer herum und auch auf deutschem Boden eine gewisse Lebensqualität ermöglichen – am italienischen Strand kann man bei diesem Werbewort aller Werbewörter besonders süffisant grinsen. Die wesentlichen Abläufe sind doch in der Natur ganz ordentlich geregelt. So wird es schon bleiben, und man reihte sich ja so gerne in den Optimisten-Chor. Ein paar Stürme mehr, vielleicht auch heftige – Blitz, Donner, Hagel gab’s schon immer – und hier längere Trockenperioden, dort mehr Überschwemmungen; wenn nur die Meteorologen das Wetter etwas genauer für Städte und Landkreise voraussagen könnten. Durchschnittstemperaturerhöhung, Abschmelzen der Gletscher und der polaren Eiskappen, verbunden mit einem beträchtlichen Ansteigen des Meeresspiegels; alles muss erst einmal langfristig beobachtet werden. Einfachste Überlegungen, ob nicht das Verbrennen von Energiereserven, in natürlichen Prozessen über Hunderte von Millionen Jahren gebildet, dann in 200 bis 300 Jahren verfeuert, gravierendste Auswirkungen auf das Erdklima haben muss, werden zumindest öffentlich gar nicht erst angestellt. Seit vier bis fünf Millionen Jahren gibt es schließlich menschliche Vorfahren. Sie haben sich den verschiedensten Klimaperioden angepasst, Gliedmaßen, Gehirn, Gebiss, Werkzeuge, Wirtschaft, Häuser, Straßen, Flugzeuge, Computer und jetzt auch noch den Transrapid bis zur heutigen Perfektion entwickelt – wo bleibt da noch Raum fürs Chaotische? Wird schon irgendwie werden, glaubt man ergeben den Politikern zwischen fröhlich im Sand lärmenden Kindern.
Mit dem Abendwind sind die Wellen höher und bewegter geworden und lassen einen gedanklich noch weit zurückplätschern. Milliarden Jahre zurück, als der Erdball sich einigermaßen abgekühlt und der Millionen Jahre dauernde Regen aufgehört hatte, mag es ähnlich gewesen sein. Sandstrände sind allerdings für diese Periode der Erdgeschichte noch sehr unwahrscheinlich, es fehlte einfach an Sedimenten. Im Wasser hatten sich bereits einzellige Lebewesen gebildet und wurden wieder und wieder von den Wellen aufs Trockene geworfen. Eine dieser Mikroben – bald waren es im sich entwickelnden Erdklima unzählige – gewöhnte sich daran, Sauerstoff aus der Luft aufzunehmen und mit aufgesaugten Nahrungsstoffen zu oxydieren, einen geregelten Stoffwechsel aus den chemischen Umsetzungen zu entwickeln, wahrscheinlich immer noch pendelnd zwischen Meer und Land. Die Zellteilung begann aus welchem Grund auch immer, verschiedene Zellen der Organismen übernahmen differenzierte Aufgaben, spezielle Nervenzellen lernten auf Umweltreize zu reagieren, die Sinnesorgane bildeten sich im Prozess positiv und negativ verlaufender Reaktionen aus. Immer wieder gab es auch verheerende kosmische, vulkanische, klimabedingte Katastrophen. Eine chaotische Entwicklung? Nein, eine natürliche und erklärbare, schloss Darwin aus seinen Beobachtungen und hat die meisten Biologen und Verhaltensforscher noch immer auf seiner Seite, die anpassungs- und widerstandsfähigere Spezies habe sich immer durchgesetzt, was zumindest im Falle der Dinos einigermaßen zweifelhaft erscheint. Irgendwie – gäbe es einen Plan, müsste er für immer unlesbar bleiben – ist der Mensch zu dem geworden, wozu er heute fähig ist. Kraftvoll und schwach, gesellschaftsorientiert und einsam, risikobereit und vorsichtig in der Wahrnehmung seines Vorteils, vernunftbegabt und tollwütig zugleich, jedenfalls nicht mehr animalischen Instinkten ausgeliefert. Zukünftige Regelmäßigkeiten erkennend, seines Todes gewiss, kommende Katastrophen ahnungsvoll befürchtend. Auslöser und Opfer von apokalyptischen Verbrechen, fähig zur Ermordung ganzer Völker aus einsichtslosem Hass. Von angeborener Friedfertigkeit keine, von erlernter kaum eine Spur – auch am jetzt leerer und ruhig werdenden Strand bleibt hintergründiges Chaos im Erinnerungs- und Vorstellungsvermögen gegenwärtig.
Niemand kann endlos ruhig sitzen oder liegen, selbst indische Fakire kennen ihr Limit, und im Guinness-Buch der Rekorde sind beim Pfahlsitzen begrenzt Körperbewegungen und naturnotwendige Verrichtungen zugelassen. So zieht man seine Beine ebenfalls an oder streckt sie aus, stützt sich mit den Händen ab beim Aufrichten oder versucht spielerisch Schleifspuren im Sand – das Kind im Strandgast will auch beachtet sein –, schon wieder kommt man mit Chaotischem in Berührung. Ist der Sand sehr feucht, bleiben die Spuren und Abdrücke recht stabil und präzise ausgeprägt, wenn mehr oder weniger trocken, rutscht viel Sand in diese nach, und es dauert einige Zeit, bis die Oberfläche wieder zur Ruhe kommt. Mitnichten, zur Ruhe kommt diese überhaupt nicht. Niemand hat je zu messen versucht, wie lange der Einfluss der Bewegungsimpulse eines Strandgastes andauert und in welchem Umkreis diese noch wirksam sind. Auf mehrere Kriterien war man schon gestoßen: Korngröße, mineralische Beschaffenheit, Schleifalter des Sandes – gerade eben ging’s um seine Feuchte –, dann ist Strandsand ja alles andere als homogen, sondern eine fast nicht analysierbare Mixtur, und absolute Ruhe tritt nie ein am Meer und wenn nur kleinste Wellen ein Sandkorn an andere stoßen lassen. Unmöglich, an alle Einflussfaktoren zu denken, welche beim simplen und sichtbaren Nachrutschen von Sand in einer spielerisch gezogenen Spur eine Rolle spielen.
Seit einiger Zeit befassen sich Naturwissenschaftler – vornehmlich Physiker, aber auch Chemiker und Pharmakologen – intensiv mit den Eigenschaften der granulösen, sprich körnigen Materie. Experimentell schütteln sie Kügelchen verschiedenster Größen im Millimeterbereich und Gewichte in Grammbruchteilen – mit differenten spezifischen Gewichten, versteht sich – in unterschiedlichen Frequenzbereichen, sprich Stoßfolgen, um herauszufinden, welche Geschwindigkeitsverteilung sich unter den „tanzenden“ Kügelchen ergibt. Gefilmt mit einer Hochgeschwindigkeitskamera, sollen die experimentellen Ergebnisse eine Charakterisierung dieses so genannten „Kugelgases“ mittels eines einzigen Parameters, sprich einer Bestimmungsgröße, ermöglichen, auch als Temperatur der granulösen Materie bezeichnet.
Dadurch könnten Vorhersagen deutlich vereinfacht werden, wie sich unterschiedliche Pulvertypen beim Mischen verhalten, was insbesondere für die Arzneimittelherstellung von besonderer Bedeutung ist. Man kann nur ehrfurchtsvoll den Kopf schütteln am Strand.
Well, im kontrollierten Experiment können Wissenschaftler zahllose typische Regelmäßigkeiten beobachten, welche in mathematische Gleichungen gefasst die Formulierung von Hypothesen und Naturgesetzen, das heißt von systematischen Vorgängen in der Natur, ermöglichen. Aber für die Erklärung der Bewegungen im Strandsand sollte man von diesen Erkenntnissen nicht allzu viel erwarten. Sind doch darin auch noch Humusteilchen, verdickte Öl-Klümpchen, lebende und tote Kleintiere enthalten, von menschlichen Hinterlassenschaften ganz zu schweigen. All das hat aber mit der Impulsausbreitung nach den Bewegungen eines Strandgastes zu tun. Garantiert sind nirgendwo Punkte für Sensoren auszumachen, denkt man, wo im Sand nicht die Spur eines Bewegungsimpulses mehr nachgewiesen werden kann; neben denen des Meerwassers durchwandern ja auch seismische, von den Verschiebungen in der Erdkruste ausgelöste Wellen den Strand. Hier kommt man den Schwierigkeiten der Erdbebenvorhersage schon ganz nahe und sollte gedanklich verharren, denn es wird einem dann doch zu chaotisch.
Man schüttelt den Sand von den Händen, streift die verbliebenen Körner mit dem Handtuch ab und erinnert sich an Hände anderer Menschen, die nach Unfällen teilweise oder fast ganz bewegungsunfähig waren. Ärztliche Kunst hat in stundenlanger, operativer Anstrengung diese Hände wieder beweglich und brauchbar gemacht – das Geschick und die Ausdauer von Physiotherapeuten sollen hierbei nicht übersehen werden. Anderen Ärzten gelingt es mit Medikamenten, deren Abstimmung immer genauer reguliert wird, rhythmisch gestörte Herzschläge so zu beeinflussen, dass ihren Patienten wieder ganz normal zumute wird. Auch dem Krebs ist der Mensch durch medizinische Forschung und Therapie nicht mehr hilflos ausgeliefert, und die Folgen von Katastrophen im Gehirn werden durch ärztliches Können und den Einsatz von einfach genial konstruierten Apparaten gemildert. Trotz dieser Erfolge – einem Laien müssen sie den Atem verschlagen und jede Art von sarkastischer Bemerkung hinsichtlich des erforderlichen Aufwands hierfür – wird man beim mehr oder weniger entspannten Strandaufenthalt den Gedanken nicht los, dass es sich auch beim eigenen Körper um einen Organismus im Dauerzustand chaotischer Rätselhaftigkeit handelt.
Schon der Versuch, den Finger einer Hand zu bewegen, ohne dass die anderen in irgendeiner Weise darauf reagieren, wird nicht gelingen. Wie Pianisten die Fertigkeit erwerben, ihre Finger so zu beherrschen, dass diese im richtigen Moment immer die richtige Taste treffen, muss mit magischer Konzentrationsfähigkeit zur Ausschaltung aller störenden Muskelreaktionen zusammenhängen, denn diese sozusagen lebenslänglich zu verbannen, ist nicht möglich, genauso wenig wie man Blinzeln der Augenlider zwar eine Weile verhindern, aber nie von Dauer vermeiden kann. Auch Artisten auf dem Hochseil oder am Trapez, die auf eine perfekte Kontrolle ihrer Bewegungsabläufe lebensnotwendig angewiesen sind und tagtägliche Anstrengungen für deren perfektes Funktionieren auswenden müssen, werden nicht beabsichtigte Reaktionen unbeanspruchter Muskeln, und sei es nur ein durch die enorme Anspannung verursachtes leichtes Zittern des Halses, nie ganz ausschließen können – ein Blick durchs Fernglas wird auch Zweifelnde überzeugen. Wer Leistungssport betreibt oder es damit versucht hat, wird nicht zu den Zweiflern gehören. Beim Arzt lernt man, dass es den absolut regelmäßigen Puls auch im Ruhestand nicht gibt. Was hat dies denn mit Chaos zu tun?, mag manch einer einwenden, es beweist nur, dass wir das System Körper nicht vollständig verstehen und es daher auch nicht beliebig regulieren können. Nein, sagt man zu sich mit trotzigem Blick aufs Wasser, mein Körper ist kein System, und blickt wieder rundum, ob jemand das Selbstgespräch mitgehört hat. Menschen sind mit ihrer Fähigkeit, Werkzeuge zu gebrauchen, Gleiches, Ähnliches sowie Verschiedenartiges begrifflich zu ordnen und nach einheitlichen Kategorien zu analysieren, schon sehr weit eingedrungen in die Geheimnisse der uns umgebenden und einschließenden Natur, diese aber wird sich gegen vollständiges Verstehen immer wehren.
Da haben Forscher doch bereits bei einer Fliege ein Gen entdeckt, dessen natürliche Mutation eine doppelte Lebenszeit derselben bei kaum reduzierter körperlicher Aktivität trotz reduziertem Stoffwechsel ermöglicht. Die Forschungen in dieser Richtung werden weitergehen, um auch im menschlichen Erbgut dieses Gen dingfest zu machen, denn die Aussicht eventuell das 4. Jahrtausend selbst zu erleben wird für die kommenden Generationen immer verführerischer werden. Die identische Reproduktion von Mutter- oder Vatertieren ist ja mit dem Klonen von Schafen und Hühnern bereits gelungen.
Auch am Strand kann man ja eine bereits angetrunkene Flasche akzeptablen Rotweins bei sich haben und sich nach einem weiteren Rundumblick einen Schluck genehmigen – allein beim Eindringen des Wortes Klonen in simple Nachdenklichkeit kann einem ja schon übel werden. Einen lebenden Organismus als ein System zu begreifen, dessen Produktion mit gegen null gehenden Abweichungen unbegrenzt wiederholbar gemacht werden soll, grenzt, abgesehen von allen in größerer Höhe angesiedelten Bedenken, an Naivität, um nicht zu sagen, an Dummheit. Welche Instanz will sich anmaßen, zu entscheiden, wohin die Auswirkungen gentechnischer Manipulationen kommende Generationen reisen lassen werden? Möglicherweise wird die 3. Generation geklonter Schafe bereits einen Großteil ihrer natürlichen Widerstandskraft gegen Infektionen verloren haben. Organismen haben sich in für den menschlichen Verstand schier unfassbaren Zeiträumen entwickelt, und trotz der Ausbildung höchst differenzierter Organe sind sie noch immer Teil des natürlichen Chaos auf der Erde. Sich darin besser auszukennen, war schon seit den ersten Ausflügen aus dem Inneren Afrikas das Bestreben menschlicher Neugier, niemand kennt bis heute die Rangfolge der Wahrscheinlichkeit für hieraus resultierende Mutationen der Evolution, und jetzt wollen sich Forscher in diesen Prozess einmischen, zu Wettbewerbern untereinander, ja, mit der Natur werden. „Winner“ und „Loser“ müssen offenbar auch auf diesem „Kriegsschauplatz“ ermittelt werden; die Trickmenge ist für den Laien sowieso unüberschaubar.
Absurd, denkt man, wohin soll diese Reise gehen, während der Tag langsam, aber sicher zu Ende geht. Sicher ist erst einmal, dass man sich nach längerem Liegen und manchem Schluck aus der immer wieder versteckten Flasche anständigen Rotweins noch etwas bewegen sollte. Es gibt nichts Gesünderes als Bewegung, sagt im Einvernehmen mit vielen ihrer Kollegen Dr. Marianne Koch, an die sich bestimmt noch viele der über 40 Jahre Alten vornehmlich wegen ihres feinen Lächelns in vielen Filmen erinnern – zum Animationsgrinsen verkommen in heutigen Gesichtern von frech-fröhlichen Moderatorinnen –, das sie im „Heiteren Berufe-Raten“ mit Robert Lemke nicht aufsetzen musste, weil es ihrer natürlichen Freundlichkeit entsprach. Vielleicht Schnee von gestern, aber noch immer gegenwärtig, wenn man sich am Strand Erinnerungen hingibt, nein, ausliefert, nein, sich hinein vergräbt – nochmals nein – einfach, solange man sich eben erinnern kann.
Doch schön, wenn die Wassertemperatur fast an 25 Grad herankommt. Schwimmbewegungen sind ja so was von leicht und angenehm im salzigen Mittelmeerwasser, den Mund würde man sich aber besser immer zukleben. Wenn die Wellen nicht zu hoch sind, geht’s auch ohne Taucherbrille. Wie weit hinaus diesmal?, fragt man sich, mühsam daran gewöhnt, fast nichts mehr zu übertreiben. Vielleicht 100 Meter, jedenfalls nicht über 200. Beinkrämpfe können einen auch im wärmsten Wasser erwischen. Ertrinken ist nicht cool, als reale Möglichkeit unwillentlich erfahren, mag man nicht noch einmal zu lange unten bleiben müssen. Außerdem sollte man am Strand immer sein „Häufchen“ mit den fünf bis sechs Sachen im Auge behalten können, Uhr und Portemonnaie – natürlich in einer Plastiktüte eingegraben –, Handtuch und Pulli, der zudem noch die halb leere Flasche mit dem halbwegs anständigen Rotwein verdeckt, leider keine Zigaretten mehr mit dazugehörigem Feuerzeug.
Selten ist man tagsüber, auch nicht kurz vor Sonnenuntergang, allein am Strand und – ein Schuft, wer Schlechtes dabei denkt – auch nicht im Wasser. Da schwimmt doch so ein Pedalo weit draußen, bewegt sich ziemlich heftig hin und her, dreht noch mehr in die eine, mal in die Gegenrichtung; mit den flacher gewordenen Wellen keinesfalls synchron, und niemand ist auf den beiden Sitzen hinter den Pedalen zu sehen. Da gibt es nicht viel zu raten. Man muss nur warten, bis sich das Heck in die eigene Blickrichtung dreht, so die von seitlichen Borden eingefasste kleine Liegefläche sichtbar werden lässt. Da liegen die beiden – Frau und Mann, noch sehr jung sie, er ganz deutlich älter – keine Sekunde auslassend ohne Bewegung ihrer Glieder, sich wieder und wieder verspannend oder voneinander lösend, dabei immer wieder mit einer Hand – entweder sie oder er – am Sitzgestänge, um nicht ins Wasser zu rutschen. Bikini und Badehose sind längst abgestreift, was zusammengehört, ist sozusagen auch schon zusammengewachsen. Ihre Schreie sind auch in 50 Meter Entfernung gut hörbar. Man dreht sich doch besser in die Rückenlage und blickt zum Abendhimmel hinauf.
Was man nicht hätte sehen sollen, aber doch eine Weile angeschaut hat – auch noch weiter hört –, ist wiederum nichts anderes als ein chaotischer Vorgang. Anzahl und Dauer der Küsse, der Berührungen, der Ver- und Entspannungen – auf dem Pedalo zudem überlagert durch zugegeben nur niedrige Wellen – Intensität und eventuelle Wiederholungen der orgastischen Phase, der Ablauf selbst und seine Dauer entziehen sich der Kontrolle der Beteiligten, der mehr oder weniger freiwilligen Beobachter sowieso, externe Störungen einmal vernachlässigt, ebenso wie vorgespielter und gefilmter Sex. Wissenschaftler mögen noch so genau analysieren, welche chemischen und hormonellen Vorgänge hierbei ablaufen, sie mögen alle möglichen Substanzen identifizieren und eventuell sogar synthetisieren, die Komplexität des Geschlechtsverkehrs, seine rationalen und emotionalen Komplikationen, die ganze Entwicklungsgeschichte der Paarung wird immer ein Rätsel bleiben müssen, selbst im Reagenzglas entscheiden letztlich unbekannte Faktoren und Abläufe über Erfolg oder Misserfolg einer Befruchtung. Eben ein Chaos, diese Millionen von Jahre schon andauernde, unermüdliche und unergründliche Evolution der aktuellen Individualitäten.
Genug vom Sex, es gibt für einen „Toten“, in Rückenlage dahindümpelnden „Mann“ – Frauen sind nicht ausgeschlossen, aber die Sprachevolution hat nun einmal diese Bezeichnung vorgezogen – im Salzwasser, Wasserbett oder Luftmatratze sind ein Nichts dagegen, ja noch einen wunderschönen Sonnenuntergang zu beobachten. Es könnte einem selbst in Rückenlage schwindlig werden beim vergeblichen Versuch, diese Formen- und Farbenvielfalt zu erfassen. Die von Osten her aufziehenden Wolken sind in zahllosen Höhenlagen geschichtet, ganz oben dünnste Schleier wie auseinandergezogene Watte, nach unten hin erst schmalere, dann breitere Streifen, als hätte jemand ein unendlich großes Betttuch zerrissen, und dem „toten Mann“ näher, eine nach Osten dichter und dunkler werdende Wolkendecke oder genauer beobachtet, eine enger und enger werdende Folge von Wolkenwalzen. Ein Poet würde man jetzt gerne sein, um sich eine abgehobenere Beschreibung dieser Erscheinungsvielfalt ausdenken zu können. Wenn man gar singen könnte – nicht vorstellbar. Für den eher prosaischen Beobachter festzumachen, ist ein in seinem Blickfeld erscheinendes Formen- und Farbenchaos, feinste Strukturen neben und teilweise vermischt mit fast homogenen Flächen, unzählige Abstufungen des Farbspektrums vom hellsten Gelb über grelles Orange in sattes Rot, und wo reflektiertes Licht von den höchsten, den Schleierwolkenschichten auf die unteren, dichteren Wolken fällt und diese noch leicht durchdringt, wird deren Grauton mit Lasuren in kaum unterscheidbaren Nuancen von grün bis dunkelblau, ja violett, überzogen. Erddrehung und Winde – in den verschiedenen Höhen treiben sie die Wolken in teilweise gegenläufige Richtungen – verursachen einen ständigen Wechsel bei, wie an ungefähr eineinhalb Billionen Abenden zuvor, ständig abnehmender Lichtintensität. Ist diese abendliche Erscheinung des Sonnenuntergangs für sich schon schier unfassbar, umso mehr die Vorstellung, dass sie sich im Laufe der Erdgeschichte nie deckungsgleich wiederholt hat und sich nach menschlichem Ermessen – mehr kann niemand darüber aussagen – auch nicht wiederholen wird.
Nun befindet man sich aber noch in der Abenddämmerung, und es ist sicher noch nicht die Zeit für so abgrundtiefe Überlegungen, außerdem kühlt die Luft merklich ab, was es ratsam macht, rasch zum Strand zurückzuschwimmen. Das vorhin beobachtete Pedalo ist längst außer Sicht- und Hörweite. Die Luft fühlt sich nach dem Abtrocknen wieder viel angenehmer an. Da die Sonne bereits unter dem Horizont steht, arbeiten sie drüben in Amerika schon heftig, halten vielleicht gerade in der einen Hand ihr Lunchpaket und schieben mit der anderen die Maus hin und her oder hetzen beim Autofahren mit Handys ihre Aktien her und hin. Sei’s drum, jedenfalls kann man in der recht brutal einfallenden Dunkelheit ohne große Umstände die Hosen wechseln, sich wieder hinsetzen, Portemonnaie und Uhr ausgraben und zur Willensstärkung für kommende Entscheidungszwänge einen Schluck des doch ziemlich warm gewordenen Roten trinken.
Übermorgen geht die Arbeiterei wieder los. Jetzt nach Hause fahren, fragt man sich. Dann wird es viele Monate, vielleicht ein ganzes Jahr dauern, bis man wieder am Strand liegen, eine ganze Nacht lang mit den Geräuschen des Meeres allein sein wird. Aber morgen wird man mit Hinz und Kunz als einer von beiden auf der Autobahn sein. Muss zum teuren Super noch diese elenden Mautgebühren hinblättern. Nachts fährt’s sich viel angenehmer auf leeren Straßen. Reinste Schönfärberei, das, klärt man sich auf. Manchmal blendet dich einer derart mit dem Fernlicht, dass du nur hoffen kannst, es möge hinter dem Rambo einigermaßen geradeaus weitergehen. Glatt ein Fall für ’nen Münzwurf – so dunkel ist’s noch nicht, dass man Bild und Zahl nicht mehr unterscheiden könnte. Bild für’s Fahren, Zahl für’s Bleiben. Schön hoch werfen, man sollte sich auch als Single nicht in die Tasche lügen. Zu hoch geworfen, die Münze landet im Sand, was nicht zählt – Regeln sind auch am einsam gewordenen Strand – einzuhalten. Der zweite Wurf landet auf dem Handrücken. Zahl oben, Bleiben ist angesagt. Das wird eine lange Nacht werden, vielleicht zu lange vor der Rückfahrt. So what. Hungergefühle regen sich – noch immer die eindeutigsten Infos des Hormonhaushalts. Man muss auch noch mal nach dem Wagen schau’n, der schon unter einer Laterne stehen sollte. Die findet sich, alle Utensilien liegen sowieso im Kofferraum. Eine Pizzeria findet sich auch. Uno pizza carciofo – per favore – zum Mitnehmen. Am Strand schmeckt’s einfach prima. Mit Sand kriegt man das Klebrige an den Händen ganz gut weg. Noch ein dosierter Schluck aus der Rotweinflasche. Es ist stockdunkel inzwischen, die dichte Wolkendecke lässt keinen einzigen Sternenstrahl durch.
Die Farbe schwarz – nach verbindlicher Sprachkonvention die totale Abwesenheit von Farben, die dem menschlichen Auge in einem lichtlosen Raum erscheint – hat der geniale portugiesische Dichter Josö Saramago, erinnert man sich, warum auch immer ängstlich, in seinem Roman „Die Stadt der Blinden“ gegen Weiß eingetauscht. Lebt auf dem schönen Lanzarote, dieser Mann, und schreibt ein Buch, das einem 391 Seiten lang den Hals zuschnürt. Das ist nicht fair.
Saramagos Terrorparabel
Ein Wagen fährt an einer Kreuzung nicht an, alle anderen hupen, ein junger Mann geht hin, fragt den Fahrer, warum er stehen bleibt, der antwortet nur, er sehe nur noch weiß, nichts außer einer weißen Wand. Befragt, nennt er seine Adresse. Der junge Mann führt ihn mit Hilfe anderer um das Auto herum zum Beifahrersitz, fährt den Erblindeten nach Hause und stiehlt seine Schlüssel. Nach einer äußerst nervösen Fahrt in Richtung seiner eigenen Wohnung hält der Dieb in einer Seitenstraße, will den restlichen Weg zu Fuß gehen und erblindet auch nach nicht einmal 30 Schritten. Alle trifft dasselbe Schicksal, nur die Frau des Augenarztes, der den ersten Blinden zu behandeln versucht hatte, bleibt verschont. Als sie sieht, was von den Behörden gegen die mit Blindheit Geschlagenen unternommen wird, täuscht diese Frau ihre eigene Erblindung vor, was ihr nicht besonders schwerfällt als langjähriger Assistentin ihres Mannes, um bei ihm bleiben zu können. Sie begleitet den Hilflosen bei seiner Internierung in einem ehemaligen Irrenhaus, erleidet mit ihm den Terror der aus panischer Angst oder lustvoller Gemeinheit immer barbarischer vorgehenden und schließlich auch schießenden Bewacher – nach und nach erblindet die gesamte Bevölkerung der Stadt und wird in leere Schulen und Fabriken abtransportiert – erlebt Gewaltorgien, genährt aus den entfesselten Trieben der Internierten bei der Verteilung der immer knapperen und verdorbenen Lebensmittel, riecht bestialischen Gestank menschlicher Ausscheidungen, hört die geilen Schreie der sich unverdrossen Paarenden, muss sich sogar Vergewaltigern erwehren.
Auch unter Blinden gibt es maßlose Bosheit, vermutet Saramago. Einige zu allem Bereite haben sich bereits organisiert, um alle anderen zu terrorisieren, rauben die jeweils noch am wenigsten verdorbenen Lebensmittel, die von den Bewachern nur noch vor den Häusern in Kisten abgestellt werden. Auch unter diesen erblindet eine immer größer und größer werdende Zahl, die wenigen freiwilligen Helfer caritativer Organisationen werden so wenig verschont wie die zur Abregelung der Internierungszonen eingesetzten Soldaten. Ein erblindeter Oberst erschießt sich sofort.
Schließlich setzt eine Frau mit einem eingeschmuggelten Feuerzeug die Irrenanstalt in Brand und verbrennt bei dieser Wahnsinnstat. Diejenigen Blinden, deren Kräfte noch ausreichen, trampeln über am Boden liegende lebende und schon tote Menschen hinweg in Richtung des vermuteten Ausgangs. Mit der immer noch ihre eigene Erblindung vortäuschenden Frau des Augenarztes finden sie den Weg ins Freie und erwarten alle den sicheren Tod im Kugelhagel der Bewacher. Aber es fällt kein einziger Schuss. Die Bewacher sind verschwunden, erblindet oder nicht, jedenfalls abtransportiert. Die allein Sehende führt ihre blinden Mitmenschen zurück in die Freiheit, nachdem sie diesen ihr erhaltenes Sehvermögen bewiesen hat. Gemeinsam suchen sie die verlassenen Wohnungen auf, um noch Essbares zu finden; was sie jedoch entdecken, sind andere Blinde, die sich in Hinterhöfen versteckt hatten, und eine im unsagbar schmutzigen und stinkenden Chaos versunkene Stadt. Als sie aufs Neue verzweifelt überlegen, ob man in diesem Chaos als Blinder überhaupt noch weiterleben kann, bemerkt der zuerst erblindete Mann, wie das Weiß hinter seinen geschlossenen Augenlidern sich in Schwarz verwandelt. Er öffnet sie, bemerkt Helligkeitsunterschiede und übertönt mit dem Schrei, er könne wieder sehen, die Stimme der den Blinden vorlesenden Frau des Augenarztes. Nach und nach folgen die Freudenschreie der anderen, schließlich schlafen sie immer noch ungläubig, aber glücklich ein.
Am kommenden Morgen schaut die nicht erblindete Arztfrau in den Himmel und erblickt nur reines Weiß. Jetzt bin ich an der Reihe, schießt es ihr durch den Kopf, aber Josö Saramago erspart dem Leser dieses Ausmaß an Grausamkeit, lässt sie den Kopf wieder senken, die Dächer sehen und begreifen, dass ihr und der anderen Leben weitergehen wird.
Eine der großartigsten Parabeln der Weltliteratur, weiß man am nachtdunklen Strand.
Leicht fällt man über dieses und anderes ins Grübeln beim Blick in den nicht vorhandenen Himmel. Ist alles noch vorhanden, was man am vergangenen Tag an natürlichen oder von Menschenhand geschaffenen Objekten gesehen hat? „Tanzen die Gegenstände in meinem Zimmer Samba, nachdem ich es verlassen habe?“, fragte einst einigermaßen spöttisch der hoffende Philosoph Ernst Bloch. In der totalen Dunkelheit lässt sich die Frage schon gar nicht beantworten; der Sand, auf dem man liegt, muss – auch unsichtbar – vorhanden sein. Basta!
Kant und die Feigheit
Haben Raum und Zeit eine absolute Existenz oder sind diese nur leere Formen, unter denen wir die Dinge anschauen, wollte Emmanuel Kant durch konzentriertestes Nachdenken einst ausfindig machen und schränkte darob die Erkenntnisfähigkeit des menschlichen Verstandes radikal ein, indem er alles Absolute dessen Anschauung entzog und diese auf eine Welt von Erscheinungen beschränkte, die nur verständlich wird durch Kategorien wie Kausalität, Einheit und Vielfalt. Über die letztliche Gültigkeit dieser Erscheinungen könne der Mensch nichts aussagen, er würde sonst in einen unauflösbaren Widerspruch verwickelt, den zwischen Denken und Spekulieren nämlich. Transzendental können nur Erkenntnisse sein, die sich mit der Art und Weise unseres Erkennens in einer Welt von Erscheinungen befassen, sofern diese a priori, also von Erfahrung und Wahrnehmung unabhängig, überhaupt möglich seien. Das menschliche Streben nach dem wahrnehmungslos Gültigen, quasi Abschließenden, weist Kant den Ideen, nicht dem Verstand, sondern der Sphäre des Vernünftigen zu, macht diese sozusagen zu Vernunftbegriffen mit ausschließlich regulativer Bedeutung für die Beurteilung unserer Erfahrungen. Höchste, aber rein theoretische Ideen wie Welt, Seele und Gott, rationale Erkenntnisse, sprich konkrete Wahrnehmungen derselben, müssen uns, a priori wiederum, verwehrt bleiben, Beweise, wie sie die so genannte rationale Psychologie für eine unsterbliche Seele erbracht haben wollte, eingeschlossen.
Ganz und gar unsichtbar bleibt die Welt am Strand nach wie vor, aber nicht lautlos. Ein Hund bellt in der Ferne. Dann noch ein anderer, noch zwei, immer mehr werden es. Das Gebell kommt näher – vielleicht 100, vielleicht auch nur 50 Meter. Ein Mann schreit dazwischen, unverständlich, klar, für einen, der kein Italienisch kann. Die Meute scheint jemanden zu hetzen. Jetzt schreit auch eine Frau, ein nicht so seltenes Wort, dass man es nicht schon einmal bei einem sichtbaren Vorfall gehört hätte und verstehen würde. „Aiuto“, „Aiuto“. Hilferufe. Spitze Angstschreie folgen, während die Hundemeute lauter und lauter bellt und knurrt. Die Hilferufe werden leiser. Nach Minuten fällt ein Schuss, ein Aufjaulen noch, dann wird es ruhig bis auf ein leises Gemurmel mehrerer, offenbar aufgeregter Stimmen, dann ertönt die Sirene eines Polizei- oder Rettungswagens.
Man liegt immer noch einigermaßen starr am Strand. Nach Kant gibt es die reine praktische Vernunft, unmittelbar bestimmt durch ein moralisches Gesetz, und verknüpft mit diesem, den in der theoretischen Sphäre angesiedelten und aus diesem Grund transzendentalen Begriff der Willensfreiheit. Auf dieses Fundament gründete er sein sittliches Grundgesetz, demnach der Mensch stets so handeln sollte, dass die Maxime seines Handelns jederzeit – jederzeit, erinnert man sich genau – zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte. Sein so genannter kategorischer Imperativ also. Für ihn war die Idee eines Macht habenden Gesetzgebers unverzichtbar fürs menschliche Zusammenleben, gerade hat man, in der stockdunklen Nacht am italienischen Strand liegend, sehr konkret auf diese Grundidee gepfiffen. Hätte man aber etwas ausrichten können, ohne Stock oder Ähnliches und mit den nackten Beinen den Hundebissen ausgesetzt. Ein Hilfsversuch wäre ein aussichtsloses Unterfangen gewesen, mit größter Wahrscheinlichkeit – nein, ganz sicher – hätte ein Eingreifen unter diesen Umständen der Frau nicht geholfen. Der andere hatte wenigstens eine Pistole oder sogar eine Flinte zur Hand, redet man weiter auf sich ein. Nein, der Kantsche Anspruch kann nicht in ein Gesetz gegossen werden – so reden sie doch auf hoher politischer Ebene – Ideen sollte man auf noch höherer Ebene schweben lassen.
Konkret betrachtet geht’s schlicht ums Verkriechen in einer halt nicht ganz ungefährlichen Situation. Eine Frau hat um Hilfe geschrien, und man ist im Schutz der Dunkelheit liegen geblieben, kein anderes Wort kommt dafür in Frage als Feigheit – basta. Man hat, wie ein wütender Hund, vor dem erhobenen Stock den Schwanz eingezogen, da hilft kein Rückbesinnen auf noch so hehre Gedanken, um eigene Handlungen vor sich selbst und anderen achtbarer aussehen zu lassen, nützlich sollte man sich machen, wo immer und wie auch immer es geht, häufiger an Ameisen denken, die sich Körperchen an Körperchen gepresst in den Eingang ihres Baus legen, wenn Wasser einzudringen droht.
Die Frau des Augenarztes – von Josö Saramago gewiss als Leitfigur der Zeit gesehen – kann ihre Angst überwinden und auf jeden Vorteil verzichten. Sie erfährt das Schicksal der Erblindung bei ihrem Mann und vielen anderen, handelt, wie Abermillionen nicht handeln könnten. Um sie herum nur Chaos, aber sie verhält sich absolut unchaotisch, so als wüsste sie felsenfest, dass selbst dieses Unmaß an menschlichem Leid und menschlicher Niedertracht überwunden werden kann. Niemandem macht sie sich untertan oder nützlich, sie will nur nützlich für andere sein. Muss man sie sich nicht als von einer höheren Macht geleitet vorstellen? Der Dichter stellt diese Frage nicht, zu Recht nicht. Es würde ihre Einsicht, dass jeder ein Recht auf Leben hat, und ihren Mut, dafür einzustehen, nur schmälern.
Man kann sich die Frage nicht mehr ersparen, wie sich ein ausgemachter Feigling, wäre er eine Generation früher auf der Erde aufgetaucht, verhalten hätte, genauer gesagt als Deutscher, nicht an der Gnade der späten Geburt Beteiligter. Ein Wort aus Kohlmund, das dümmer sich vorzustellen äußerst schwerfällt, brummt man vor sich hin in der schwarzen Nacht am Strand. Hätte Kant einem damals einen Fingerzeig geben können? Wäre man angewidert von dieser Abschaumgestalt Hitler, aus Festungshaft baldigst von Kumpanen im Staatsapparat mit besten Wünschen entlassen und Herr über die Stammtische geworden, von der so genannten guten Gesellschaft freundlichst aufgenommen, von höheren Münchner Damen angehimmelt, dann nach jahrelangem, feigem Straßenterror in geheimer Wahl mit einer parlamentarischen Mehrheit ausgestattet Reichskanzler geworden, mutig genug gewesen, zu widerstehen? Hätte man nachgefragt, was mit allen diesen Menschen geschehen sollte, denen ein gelber Stern auf der Brust verordnet worden war – hoheitlich und somit rechtens, wie auch mit dem Philosophen Kant im Munde sehr viele sich rechtfertigen –, bis jene nach und nach alle aus den Straßen verschwanden, einfach so abtransportiert wurden? Zu wenige nur, auch die Eltern gehörten zu diesen, gestanden sich ein, dass deutsche Untiere für die ungeheuren Grausamkeiten verantwortlich waren, von denen wissen konnte, wer wissen wollte und dass der totale Krieg zu Recht das eigene Volk mit ins gewollte Chaos stürzen würde: Zum selbst verleugnenden Widerstand waren auch sie fast ausnahmslos nicht fähig. Nicht so wie Georg Elser, der mutige Maurer, sein Leben einsetzte, um Hitler im Hofbräuhaus, wo der Massenmörder aller Massenmörder wieder bejubelt werden sollte, in die Luft zu sprengen oder die Geschwister Sophie und Hans Scholl das ihre, als sie mit Flugblättern ihre drögen Kommilitonen und Professoren zum Widerstand aufrütteln wollten im Innenhof der Münchner Universität; alle anderen Frauen und Männer, ebenfalls ermordet als so genannte Staatsfeinde, sollten, wie diese Namen, von den späteren Deutschen nie vergessen werden, um des eigenen Verstandes willen. Könnte man sich im Nachhinein wirklich wünschen, die Atombombe, erfunden als perfektes Mordinstrument, wäre einige Jahre früher über dem eigenen Land explodiert, hätte wenigstens den millionenfachen Mord an Unschuldigen verhindert? Wären nicht auch die Eltern, Verwandte, Freunde, später verehrte und bewunderte Menschen Geliebte dann nicht auch dieser Höllenmaschine ausgeliefert worden? Eine Auflösung dieses chaotischen inneren Widerspruchs durch einen konkreten Hinweis des so großen und zugleich demütigen Philosophen der Aufklärung würde noch heute dankbar angenommen werden.
Eine ganz banale und doch immer wieder faszinierende Ablenkung wird auch im totalen Dunkel mit Winken begrüßt. Ein hell erleuchtetes Kreuzfahrtschiff erscheint hinter den die Bucht begrenzenden Felsen; man erinnert sich an den Sonnenuntergang und das Glühen ihres oberen Randes dort sehr genau. Nicht schon wieder die Assoziation eines Geisterschiffs, fordert eine innere Stimme sehr nachdrücklich. Da fährt ein Schiff, viele Decks hoch, in Hunderte von Kabinen unterteilt, dazu getäfelte Restaurants, schimmernde Cafeterien, ein Kapitän, der sich jetzt sicher nicht auf der Brücke befindet, eine hoffentlich auch für den Seenotfall ausgebildete und ausgerüstete Mannschaft und garantiert einige Friseure, genauen Kurs auf ein bestimmtes Ziel haltend, sei es Venedig, Bari, Athen, Iraklion, Alexandria, Palermo, Malaga, Barcelona, Monte Carlo, Nizza, Neapel, vielleicht auch Genua – diese Städtenamen bombardieren einen regelrecht – mit mehr oder weniger lebendigen Menschen, die zumeist schon die größere Wegstrecke des Lebens hinter sich haben.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: