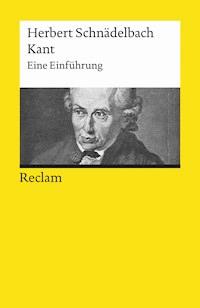8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclam Grundwissen Philosophie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Was ist Vernunft? Die Vorstellung von dieser besonderen Ausstattung und Fähigkeit des Menschen hat sich im Laufe der Zeit grundlegend geändert. Herbert Schnädelbach zeichnet den Wandel des Vernunftbegriffs nach. Text aus der Reihe "Grundwissen Philosophie" mit Seitenzählung der gedruckten Ausgabe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 203
Ähnliche
Grundwissen Philosophie
Vernunft
von Herbert Schnädelbach
Philipp Reclam jun. Stuttgart
Wissenschaftlicher Beirat der Reihe Grundwissen Philosophie:Prof. Dr. Hartmut BöhmeProf. Dr. Detlef HorsterProf. Dr. Geert KeilProf. Dr. Ekkehard MartensProf. Dr. Barbara NaumannProf. Dr. Herbert SchnädelbachProf. Dr. Ralf Schnell
Alle Rechte vorbehalten© 2007, 2012 Philipp Reclam jun. GmbH & Co., StuttgartReihengestaltung Grundwissen Philosophie: Gabriele BurdeGesamtherstellung: Reclam, DitzingenMade in Germany 2012ISBN 978-3-15-960106-9ISBN der Buchausgabe 978-3-15-020317-0
www.reclam.de
Inhalt
Einleitung
Kritik der Alltagsvernunft. Zur Entstehung der spekulativen Vernunft bei den Griechen
Kritik der spekulativen Vernunft. Zur Entstehung der kritischen Vernunft
Der sophistische Angriff auf die Spekulation
Aporien der spekulativen Vernunft
Kritische Vernunft
Die Kritik der kritischen Vernunft. Zur Entstehung der funktionalen Vernunft
Hegel und die Idee der absoluten Vernunft
Schopenhauer und die Dezentrierung der Vernunft
Funktionale Vernunft
»Die eine Vernunft und die vielen Rationalitäten«
Vernunft und Gesellschaft
Sprachliche Vernunft
Historisch-hermeneutische Vernunft
Rationalität
Einheit der Vernunft?
Anmerkungen
Siglen und zitierte Literatur
Kommentierte Bibliografie
Schlüsselbegriffe
Meinen Geschwistern
[7]Einleitung
»Der Mensch ist ein vernünftig Wesen,/wer das behauptet, ist nie Mensch gewesen«, so Moliere. (Zit. nach Gosepath 1992, 3) Wir sind sicher keine reinen Vernunftwesen, aber dass wir im Prinzip vernünftig sein können, bestreitet wohl niemand, und wir erwarten dies auch von anderen und von uns selbst. Was meinen wir mit ›Vernunft‹, ›vernünftig‹? Es war eine Zeit lang Mode, die Vernunft für alles Schlimme in der Welt verantwortlich zu machen und zur Korrektur an das »Andere der Vernunft« zu erinnern. Die Zeiten dieser radikalen Vernunftkritik, die merkwürdigerweise selbst doch auch vernünftig sein wollte, sind jetzt vorüber, und wir haben gelernt, dass wir als Tiergattung Homo sapiens sapiens auf diesem Planeten nur dann eine Chance haben, wenn wir Vernunft annehmen und mit der Natur- und Selbstzerstörung aufhören. Aber was ist das, das wir da annehmen sollten?
Das deutsche Wort ›Vernunft‹ wurde erst im späten Mittelalter zum philosophischen Terminus, und dem gingen griechische und lateinische Ausdrücke vorher, deren Bedeutungen bis auf die Anfänge der Philosophie zurückverweisen. Heute klingt es allzu metaphysisch, so als sei die Vernunft eine besondere Instanz oder ein geistiges Subjekt, während doch in Wahrheit nur Vernünftigkeit als die Fähigkeit gemeint ist, auf eine bestimmte Art und Weise zu denken und zu handeln. Dann aber sagt man lieber gleich ›Rationalität‹, denn das klingt wissenschaftlich und modern. Und doch ist dieser Ausdruck geeignet, an das zu erinnern, was unsere lateinische Philosophietradition seit Cicero dem Menschen als sein Besonderes zugesprochen hatte – die rationalitas des animal rationale. Gegen das molièresche Missverständnis hatte schon Immanuel Kant (1724–1804) vorgeschlagen, besser vom animal rationabile, also dem vernunftbegabten oder [8] vernunftfähigen Lebewesen, zu sprechen (Anthr A 315), aber so war die rationalitas immer gemeint gewesen. So geht es beim Nachdenken über die Vernunft offenbar um das, was unser Spezifikum im Umkreis des Lebendigen ausmacht, und das ist sehr Verschiedenes: Denken, Überlegen, Erkennen, Vermuten, Überlegen, Berechnen, Kalkulieren, Begründen, Beweisen, Rätsellösen und nicht zuletzt Sprechen, denn das animal rationale entspricht dem aristotelischen zóon lógon échon, also dem Lebewesen, das den lógos hat, wobei ›lógos‹ zugleich Vernunft und Sprache bedeutet.
›Vernunft‹ ist in Wahrheit ein Plural, oder besser ein Kollektivsingular, solange wir an der substantivischen Redeweise festhalten, und deswegen lässt sich die Frage, was jenes Wort bedeutet, nicht mit einer einfachen Definition beantworten. Definitionen werden allzu gern von Philosophen erwartet, wobei meist übersehen wird, dass Definitionen nicht am Anfang, sondern bestenfalls am Ende einer Theorie gegeben werden können, denn brauchbare Definitionen wie auch die Begriffe, die sie definieren, sind in Wahrheit Abkürzungen oder Konzentrate von Theorien. Aber auch eine Vernunfttheorie, als deren Extrakt ein tragfähiger Vernunftbegriff möglich wäre, kann man nicht einfach entwerfen, ohne zuvor zu ermitteln, in welchen Kontexten das Vernunftvokabular vorkommt und wie es dort gebraucht wird. In einem philosophischen Buch ist es legitim, sich auf die philosophischen Kontexte zu konzentrieren, und da zeigt sich, dass es nicht genügt, nur auf die Gegenwart einzugehen. Tatsächlich hat sich das Nachdenken über die Vernunft seit den Anfängen der Philosophie beträchtlich gewandelt, so dass es unmöglich ist, den Vernunftbegriff zu explizieren, ohne auf den Wandel dieses Nachdenkens einzugehen. Dass Begriffe generell nichts anderes sind als die Regeln, gemäß denen die Begriffswörter gebraucht werden, gilt auch für den Vernunftbegriff, und so wird man den Veränderungen in diesem Feld nur dadurch gerecht, dass man die jeweiligen Gebrauchsweisen beschreibt, die Knotenpunkte ihres [9] Wandels identifiziert und ihren inneren Zusammenhang rekonstruiert. Da dies alles nicht nach einem vorausgesetzten Plan oder einer inneren Logik erfolgte, weil es von zahlreichen kontingenten Faktoren abhing, kann man das Ganze nur zu erzählen versuchen. All das aber, was man erzählen muss, damit man es verstehen kann, ist Geschichte, und in diesem Sinn sind bei der Vernunft Begriffsexplikation und Begriffsgeschichte untrennbar.
Dass Begriffe sich wandeln, ist uns ganz vertraut; die Bedeutungen von ›Materie‹, ›Leben‹, ›Bewegung‹ oder ›Natur‹ etwa haben sich seit den Anfängen verändert, und in diesem Bereich kämen wir nicht auf die Idee zu sagen, vor 5000 Jahren sei das damit Gemeinte etwas ganz anderes gewesen als heute, es sei denn, wir sagten mit dem Scherz Lichtenbergs: »Damals, als die Seele noch unsterblich war« (Lichtenberg 280). Aber wie ist es beim Begriff ›Vernunft‹? Können wir wirklich sagen, die menschliche Vernunft sei immer ein und dieselbe gewesen, und nur die Auffassungen von ihr hätten sich geändert? So etwas gilt nur für Naturbegriffe, während wir bei den Begriffen, mit denen wir uns auf uns selbst beziehen und interpretieren – und die wir ›Kulturbegriffe‹ nennen sollten – mit einer Rückkopplung zwischen Begriff und Gegenstand rechnen müssen. Es ist zu vermuten, dass zwischen einer Veränderung der Selbstauslegung des Menschen und einer realen kulturellen Veränderung ein Zusammenhang besteht; demgegenüber wäre es absurd zu behaupten, die Veränderung der Naturwissenschaft von Aristoteles über Newton zu Einstein sei selbst ein Naturereignis gewesen. Dass ›Vernunft‹ zu den Kulturbegriffen gehört, kann man daran erkennen, dass die Menschen aus ihren natürlichen Fähigkeiten kulturell sehr viel Verschiedenes gemacht haben; und es wohl nicht die begrifflichen Festsetzungen der Philosophen gewesen sind, die das bewirkten, sondern umgekehrt: Es waren die verschiedenen Wandlungen der Kultur selbst, die den historischen Wandel des Vernunftbegriffs herbeiführten, denn die kulturellen [10] Veränderungen betrafen ja auch die Bedingungen, unter denen die Menschen versuchten, sich ihrer rationalen Vermögen zu versichern. Man muss nicht bestreiten, dass der begriffliche Wandel auch auf die Kultur zurückwirkte, aber deren Wandel auf das Begriffliche zurückführen zu wollen wäre historischer Idealismus.
Auf Beispiele für den inneren Zusammenhang zwischen Begriffs- und Kulturgeschichte im Themenbereich ›Vernunft‹ wird später genauer eingegangen; sie sollen hier aber zumindest genannt werden. Der berühmte Übergang »vom Mythos zum Logos« (Nestle) war keine bloße »Geistesgeschichte«, vielmehr bliebe die Entstehung der spekulativen Vernunft bei den Griechen unverständlich, ginge man nicht auf die hellenische Sozialgeschichte des 6. und 5. Jahrhunderts v. Chr. ein. Die terminologische Differenz zwischen theoretischer und praktischer Vernunft bei gleichzeitiger Unterscheidung zwischen den Vermögen des Handelns und des Herstellens bei Aristoteles reflektiert die Besonderheit der griechischen Demokratie und wäre in despotischen Herrschaftssystemen politisch funktionslos. Das Fehlen des Arbeitsbegriffs in der praktischen Philosophie der Antike steht für die durchgängige Geringschätzung des Arbeitens als einer Tätigkeit, die eines freien Mannes unwürdig ist; darin zeigt sich das Ethos einer patriarchalen Sklavenhaltergesellschaft. Auf die Zusammenhänge zwischen dem subjektiven und kritischen Vernunftbegriff der neuzeitlichen Aufklärungsbewegung und dem sozialen und politischen Aufstieg des Bürgertums ist immer wieder hingewiesen worden. Schließlich weisen die verschiedenen Rationalitäten der Moderne alle Merkmale der rationalistischen Modernisierung auf, die unsere Gegenwart bestimmen. Wenn wir somit davon ausgehen, dass der Wandel des Vernunftbegriffs nicht unabhängig von einer Kulturgeschichte der Vernunft selbst zu verstehen ist, wäre eine wirklich befriedigende Geschichte des Vernunftbegriffs in Wahrheit ein interdisziplinäres Projekt. Als Philosophen aber müssen wir uns klarmachen, dass [11] wir keine Kulturhistoriker sind und nur über die Begriffsgeschichte verfügen; gleichwohl sollten wir stets versuchen, sie auf die Kulturgeschichte hin transparent zu machen – soweit uns das möglich ist.
Begriffsgeschichte ist Begriffsexplikation in diachroner Perspektive. Es kann also nicht um eine Abfolge von Definitionen von ›Vernunft‹ gehen, sondern nur um die Darstellung der sich wandelnden Verwendungsweisen der Begriffswörter, die zum Umfeld des Vernunftkonzepts gehören; auf begrenztem Raum ist das nur skizzenhaft möglich. Um welche Begriffswörter es sich dabei handelt, zeigt ein Blick auf die einschlägigen Wortfelder. Im Deutschen dominieren die Ausdrücke ›Vernunft‹ und ›Verstand‹, wenn man einmal von Fremdwörtern wie ›Intellekt‹ oder ›Rationalität‹ absieht, freilich erscheinen sie erst nach 1300 als Übersetzungen von ›intellectus‹ und ›ratio‹, und sie werden dann sogar noch einmal vertauscht, so dass schließlich bei Kant ›Verstand‹ für ›intellectus‹ und ›Vernunft‹ für ›ratio‹ steht. Schopenhauer versuchte später, dies wieder rückgängig zu machen, aber ohne bleibenden Erfolg. ›Intellectus‹ und ›ratio‹ vertreten seit Cicero bei den lateinischen Philosophen die griechischen Ausdrücke ›noûs‹ und ›diánoia‹. Im Deutschen kommt ›Vernunft‹ von ›vernehmen‹ und ›Verstand‹ von ›verstehen‹, aber das hilft uns nicht weiter, wie überhaupt das Philosophieren aus der Etymologie meist zu irreführenden Resultaten führt. Die »vernehmende Vernunft« war seit der Romantik ein Kontrast- und Kampfbegriff gegen das Rationalitätskonzept der Aufklärung mit seinen Ansprüchen auf individuelle Autonomie und wissenschaftliche Naturbeherrschung, und es wurde in ähnlicher Intention von Martin Heidegger (1889–1976) wieder aufgegriffen. Die terminologische Festlegung von ›Verstand‹ erfolgte in unserer Tradition durch Kant, aber sie hat nur entfernt etwas mit dem Verstehen zu tun. Der Verstand ist ihm zufolge das Vermögen zu urteilen und dann auch etwas zu erklären, und wenn einem etwas erklärt wurde, kann man es dann auch verstehen; mit [12] dem Sprach-, Text- und Sinnverstehen, das wir in der Regel mit dem Verstehensbegriff verbinden und das die historischen und hermeneutischen sogenannten »Geisteswissenschaften« als ihr methodologisches Fundament ansehen, hat der philosophische Terminus ›Verstand‹ nichts zu tun. So sind wir zunächst auf die griechischen Wortfelder verwiesen. Dabei ist zu beachten, dass die frühen Philosophen, wenn sie über das nachdachten, was wir mit dem Bereichsbegriff ›Vernunft‹ meinen, über keine anderen Begriffe verfügten als die, die sie der griechischen Umgangssprache entnehmen konnten. Ihr Sprachgebrauch in diesem Feld war meist wenig eindeutig, und terminologische Festlegungen erfolgten erst relativ spät. Die beiden wichtigsten Wortfelder sind die um die Ausdrücke ›lógos‹ und ›noûs‹. (Vgl. zum Folgenden: Schadewaldt 162 ff.)
In den Wörterbüchern finden wir für ›lógos‹: Wort, Rede, Sprache, Sinn, Begriff, Gedanke, Denkvermögen, Vernunft. Das Grundverb ›légo‹ hat zwei Bedeutungen, nämlich erstens »sammeln, versammeln« (vgl. lat. legere – lesen) und zweitens »sagen, nennen, reden«. In Abgrenzung von ähnlichen Wörtern für Sprache, Wort, Rede etc. wird deutlich, dass lógos strukturell zu verstehen ist. Wenn Aristoteles den Menschen als »zôon lógon échon« bezeichnet (Pol 1253a 9 f.), das heißt als das Lebewesen, das den lógos besitzt, dann ist dies zugleich mit Vernunft und Sprache zu übersetzen. So ist der lógos dasjenige, was die Stimme (phoné) formt und so strukturiert, dass sie etwas Verständliches hervorbringen kann. Ausgehend von homerischen Wendungen hebt Wolfgang Schadewaldt das Sammeln, Auslesen, Gruppieren, Zählen (logízesthai – berechnen, erwägen) als Hintergrundsbedeutung hervor, verweist dann auf die lateinische Übersetzung durch ratio (von reor, ratus sum – rechnen, berechnen) und kommt zu dem Ergebnis: »Kurz gesagt, die Grundbedeutung des Wortes auch im geistigen Bereich ist herzuleiten von jener Bedeutung im Bereich des einfachen Tuns und ist somit ein geistiges Rechnen.« (Schadewaldt 185)
[13] Zu ›noûs‹ (ursprünglich ›nóos‹) gehören das Verb ›noeîn‹, dann auch ›nóësis‹ und ›nóëma‹, was meist mit ›Denken‹, ›Denkvermögen‹ und ›Gedanke‹ übersetzt wird, aber dann handelt es sich schon um philosophische Termini. Bei Homer bezieht sich das noeîn auf das Vermögen, etwas zu spüren und zu bemerken, aber immer auf ein Ganzes bezogen. Immer dominiert dabei der Gesichtssinn, und hier liegt auch die sprachgeschichtliche Wurzel der Tatsache, dass die griechischen Ausdrücke für das Erkennen in der Regel dem Begriffsfeld ›Sehen‹ entnommen sind; noch Platon beschreibt den noûs als das Auge der Seele. (Vgl. Resp 508 c/d) Die Differenz zwischen Denken und Wahrnehmen musste in der Philosophie erst stabilisiert werden; so kritisiert Aristoteles die »Alten«, weil sie nicht zwischen Denken (noeîn) und sinnlicher Wahrnehmung (aisthánesthai) unterschieden hätten. (De an 427a 20 ff.) Eine wichtige Abwandlung im Wortfeld des ›noeîn‹ ist die ›diánoia‹ – wörtlich die Fähigkeit des Durchdenkens (dianoeîsthai) oder schrittweisen Durchgehens gedanklicher Einzelbestimmungen. Bei Platon und Aristoteles sind mit den beiden Ausdrücken zwei verschiedene Grundfunktionen des Denkens gemeint; ›noûs‹ bezeichnet das Vermögen, etwas Geistiges wie in einem Blick als Ganzes zu erfassen, während die diánoia auf das Nacheinander des Denkprozesses verwiesen ist. Dieses Nebeneinander des noëtischen und dianoëtischen Denkens (vgl. Oehler), das in der lateinisch geprägten Terminologie mit dem Unterschied zwischen dem intuitiven (lat. intueor, intuitus sum – hinschauen, anschauen) und dem diskursiven (lat. discurro – durchlaufen, durchgehen) Denken wiedergegeben wird, bestimmte die gesamte Geschichte des Nachdenkens über die Vernunft bis in die Gegenwart.
So wird sich die Geschichte des Vernunftbegriffs vor allem am Wandel der Verwendungsweisen von ›lógos‹ und ›noûs‹ und ihrer lateinischen und deutschen Entsprechungen zu orientieren haben. Eine ganze Reihe weiterer Begriffe wäre einzubeziehen, wie etwa die ›phrónesis‹ (lat. [14]providentia), also die ›Klugheit‹, die bei Kant als das Vermögen der Urteilskraft zwischen Verstand und Vernunft wiederkehrt. Die Vielfalt, mit der man in einer vollständigen Vernunftgeschichte zu rechnen hätte, darf als ein Hinweis darauf gelten, dass ›Vernunft/Rationalität‹ kein einfacher Singular ist, sondern eine Familienähnlichkeit menschlicher Fähigkeiten bezeichnet; es handelt sich offenbar um ein offenes Konzept, das keine abschließende Systematisierung erlaubt.
Dieser Versuch, den Sammelbegriff ›Vernunft‹ mit begriffsgeschichtlichen Mitteln zu explizieren, folgt einer leitenden These: dass nämlich die Geschichte des Vernunftbegriffs wesentlich eine Geschichte der Kritik des Vernunftbegriffs gewesen ist. Das bedeutet, dass alle wesentlichen Veränderungen, Erweiterungen und Ergänzungen in diesem Feld durch kritische Einwände erzwungen wurden, die sich im vernünftigen Nachdenken der Vernunft über sich selbst nicht mehr abweisen ließen. Mit dem Versuch, dies mit historischem Material zu belegen, soll die grundsätzliche These erhärtet werden, dass Vernunft und Kritik zusammengehören, dass also die Vernunft in ihrem Wesenskern kritisch ist und dass unkritische Vernunft auf faktische Unvernunft hinausläuft. Genau dies war ja auch die These Kants, in dessen Projekt der Ausdruck ›Kritik der Vernunft‹ ein Genitivus subiectivus und obiectivus ist. Es geht um Kritik der Vernunft durch die Vernunft selbst, und nur dadurch beweist sie ihre Vernünftigkeit. So wird dann auch verständlich, warum die Geschichte des Vernunftbegriffs als Geschichte der Kritik des Vernunftbegriffs immer auch eine Geschichte des Wandels der Vernunft selbst war, denn der Wandel des Begriffs, den sich die Vernunft von sich macht, kann sie selbst nicht unverändert lassen.
[15]Kritik der Alltagsvernunft Zur Entstehung der spekulativen Vernunft bei den Griechen
Dass die Philosophen weltfremd seien, ist als höhnischer Vorwurf so alt wie die Philosophie selbst. Ihre Geschichte lassen wir seit jeher mit Thales (ca. 624 – 546 v. Chr.) beginnen, und von ihm gibt Platon eine damals verbreitete Anekdote wieder: »Als er einmal, um die Sterne zu betrachten, nach oben schaute und dabei in einen Brunnen fiel, soll ihn eine schlagfertige und tüchtige thrakische Magd mit den Worten verspottet haben, dass er zwar darauf aus sei zu wissen, was am Himmel vor sich gehe, ihm aber verborgen bleibe, was in seiner Nähe und vor seinen Füßen liege.« Und Platon fügt hinzu: »Derselbe Spott gilt für alle, die ganz in der Philosophie leben.« (Theait 174a f.) Das ganze Ausmaß dieser Verhöhnung wird deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Thales ein hochangesehener und politisch wie ökonomisch sehr erfolgreicher Bürger Milets war, den das Altertum später zu den sieben Weisen zählte, während die thrakische Magd als Fremde und Sklavin sich auf der untersten Stufe der sozialen Rangordnung befand. Man kann hier von der Urszene der abendländischen Philosophie oder von ihrem Gründungsmythos sprechen (vgl. Blumenberg 1987), denn in der Tat entsteht sie durch eine radikale Abwendung von den Plausibilitäten des Alltags und den unmittelbar erfassbaren Evidenzen der sinnlichen Erfahrungswelt. Wenn die thrakische Magd sich darüber amüsiert, dass sich jemand von dem abwendet, was bei Helligkeit klar vor seinen Füßen liegt, und sich im Dunkeln für die Sterne interessiert, markiert das den Kontrast, der Platon zufolge den wahren Philosophen ausmacht und ihn zugleich lächerlich werden lässt; wortreich schildert er dessen Gleichgültigkeit gegenüber all dem, was der gesunde Menschenverstand in [16] seiner Lebenswelt wichtig findet: »Und von all diesem weiß er nicht einmal, dass er es nicht weiß. Denn er hält sich davon nicht etwa seines guten Rufes wegen fern, sondern tatsächlich befindet sich allein sein Körper in dieser Polis und hält sich dort als Fremder auf. Sein Denken aber hält dies alles für unbedeutend und nichtig; verächtlich schweift es überall umher, misst, wie Pindar sagt, alle ›Tiefen der Erde‹ und was auf ihr ist, betrachtet ›über dem Himmel‹ die Sterne und erforscht überall jegliche Natur aller Dinge, die es insgesamt gibt, ohne sich auf irgendetwas Naheliegendes einzulassen.« (Theait 173d f.)
Dass sich die Welt des Alltags und die des Philosophen zueinander wie Tag und Nacht verhalten, ist nicht erst Platons Überzeugung gewesen. Schon lange vor ihm lehrten die frühen Naturphilosophen, dass man, um im Bilde des Dichters Pindar (ca. 522 – 446 v. Chr.) zu bleiben, die Erdoberfläche verlassen, in die Tiefen der Erde hinabsteigen und sich über den Himmel zu den Sternen erheben müsse, um »jegliche Natur aller Dinge, die es insgesamt gibt«, erforschen zu können; man darf sich dabei nicht auf »irgendetwas Naheliegendes«, auf das Vertraute und Gewohnte einlassen. Ihre Frage war in der Tat: »Was ist die ›Natur‹ (phýsis) aller Dinge?«, und um das beantworten zu können, kann man nicht bei den Dingen selbst und ihrer Beschreibung stehen bleiben. Wir verstehen heute eine solche Frage als die nach dem Wesen der Dinge, auch nach dem Grund ihres Daseins und Soseins, und dafür prägten die ersten Philosophen, die man wegen ihrer Untersuchung der phýsis besser ›Physiologen‹ nennen oder zumindest als Naturphilosophen bezeichnen sollte, das Wort ›arché‹, was zugleich ›Anfang‹, ›der Erste sein‹ und ›Herrschaft‹ bedeutet. Als Thales die »Natur aller Dinge, die es insgesamt gibt«, als das Wasser bestimmte, meinte er damit das, was zuerst war, aus dem alles, was ist, besteht und das alles bestimmt. Das Wort ›arché‹ ist in Wahrheit eine Metapher aus der politischen Sprache (vgl. ›Anarchie – Herrschaftslosigkeit‹), die bei den Griechen [17] für die Überzeugung steht, dass das Ältere das Würdigere und deswegen zur Herrschaft bestimmt sei; daher die große Bedeutung der Genealogie der Herrschenden, deren Legitimität unmittelbar mit der göttlichen Abstammung verknüpft war.
Dass alles, was ist, in Wahrheit aus Wasser sei und vom Wasser als dem Urgrund seines Daseins bestimmt werde, ist zunächst völlig unplausibel und nicht nur für thrakische Mägde ein rechter Grund zum Lachen. Wir wissen nicht genau, wie Thales das gemeint hat, aber ganz abwegig ist es nicht, wenn man an die verschiedenen Aggregatzustände des Wassers denkt oder daran, dass es ohne Wasser kein Leben gibt, denn Thales verstand die Erde offenbar als ein großes Lebewesen. Aristoteles vermutet, Thales habe wie seine Zeitgenossen gemeint, die Erde schwimme auf dem Weltmeer, und darum sei das Wasser die arché. (Met 983b 20 ff.) Wenn dann die Nachfolger des Thales die arché anders fassten – Anaximander (ca. 611 – 546 v. Chr.) als das Unendliche (ápeiron – das Unbegrenzte, Unendliche, deswegen Unbestimmte) und Anaximenes (gest. 525 v. Chr.) als die Luft (áer) –, so gingen sie stets den Weg des Denkens, der von dem, was auf der Hand liegt, wegführt zu dem, was allem zugrunde und deswegen nicht auf der Hand liegt. Mit großem zeitlichem Abstand beschreibt Aristoteles dies so: »Von denen, die zuerst philosophiert haben, haben die meisten geglaubt, dass es nur stoffliche Urgründe der Dinge gebe. Denn woraus alle Dinge bestehen, woraus sie ursprünglich entstehen und worein sie letztlich vergehen, indem die Substanz (ousía – auch ›Wesen‹) zwar bestehen bleibt, aber in ihren Zuständen wechselt, das erklären sie für das Element und den Urgrund (arché) der Dinge, und daher glauben sie, dass weder etwas [aus dem Nichts] entstehe noch [in das Nichts] vergehe, in der Meinung, dass eine solche Substanz (phýsis) immer erhalten bleibt.« (Met 983b 6 ff.) Deutlich ist, dass für all diese frühen Denker die Erforschung der arché als der phýsis aller Dinge die Abkehr von den Plausibilitäten [18] der Welt, wie wir sie mit unseren Sinnen erfassen, erfordert. Dabei folgen sie ihrer Grundüberzeugung, dass das, wovon alles in der Welt in seinem Entstehen, seiner Veränderung und in seinem Vergehen abhängt, nicht selbst entstanden, veränderlich und vergänglich sein kann; darin setzt sich der uralte Glaube an die Ewigkeit der Götter in neuer Gestalt fort. Unsere Alltagserfahrung aber kennt nur Veränderliches und Vergängliches, und deswegen verlangt die entstehende Philosophie einen entschlossenen Perspektivenwechsel, der sie vom gesunden Menschenverstand weit wegführt.
Den Spott der thrakischen Magd und das Kopfschütteln der Zeitgenossen haben die ersten großen Philosophen ihnen als blanke Verachtung zurückgegeben. Heraklit (ca. 540 – 480 v. Chr.) sagt: »Für diesen (meinen) lógos, der ewig ist, kommen die Menschen nicht zum Verständnis, weder bevor sie ihn hörten noch sobald sie ihn gehört haben. Denn obwohl alles nach diesem lógos geschieht, gleichen sie doch solchen, die [frei übersetzt] keine Ahnung haben [. . .]« (Fr. 1) Heraklit meint mit ›lógos‹ nicht einfach seine Rede, sondern das, was sie bedeutet und präsentieren will – das ewige Weltgesetz, nach dem »alles geschieht«. Diesen lógos, der ihm zufolge das wahre Göttliche ist, identifiziert er mit dem Feuer (im Sinne des Feuerhauchs), und so bleibt auch er bei einer stofflichen Deutung der arché. Versteht Heraklit das Ewige und Unveränderliche als den Grund und das Gesetz des Veränderlichen und Vergänglichen unserer Alltagswelt, in der »alles fließt«, weil es ständig vom Kampf (pólemos) der Gegensätze bestimmt ist, so geht sein großer Kontrahent Parmenides (um 515 – 445 v. Chr.) noch einen Schritt weiter und bestreitet, dass es jenes Veränderliche und Vergängliche überhaupt gibt. Sein erster Lehrsatz lautet: »IST ist, und NICHT-IST ist nicht.« (Fr. 4) Das bedeutet: Was in irgendeiner Form ein »nicht«, eine Negation enthält oder voraussetzt, kann nicht wirklich »sein«, denn dass Nichtsein »ist«, ist unmöglich. (Vgl. Fr. 6) So kann es in Wahrheit keine Qualitätsunterschiede geben, denn was rot ist, ist zugleich [19] nicht grün; nichts, was wirklich »ist«, kann entstehen oder vergehen, dann das bedeutet einen Übergang vom Nichtsein ins Sein oder umgekehrt, und erst recht kann sich das wahre Seiende nicht verändern oder gar bewegen, weil dann auch im Hinblick auf seinen Zustand oder seine Lage im Raum ein »nicht« ins Spiel käme. Das alles ist zwar vollständig unplausibel, aber nach Parmenides allein wahr, und wer das nicht glaubt und dem Augenschein folgt, gehört zu den »nichtswissenden, doppelköpfigen Sterblichen«, die »stumm und blind dahintreiben, blöde glotzend und ohne Urteil« (Fr. 6).
Von Parmenides ist ein Rätselwort überliefert, dessen Deutung bis heute kontrovers ist: »Denn dasselbe ist Denken (noeîn) und Sein (eînai).« (Fr. 5) Es ist schwer zu verstehen, wie man Denken und Sein so miteinander identifizieren könnte, aber man kommt diesem Gedanken wohl am nächsten, wenn man ihn als die Behauptung versteht, dass das, was in Wahrheit »ist« – also das Ewige und Unveränderliche –, dasjenige sei, was nur mit dem Denken erfasst werden könne; so lautete die These dann »Sein ist dasselbe wie Gedachtsein«. Im Griechischen bedeutete ›noeîn‹ ja noch nicht Denken in dem uns vertrauten terminologischen Sinn, sondern ein am Modell des Sehens orientiertes Bemerken von etwas als etwas. Das noeîn des Parmenides aber schränkt dieses Bemerken ganz strikt auf den nichtsinnlichen Bereich ein, und es wird somit zur Urform dessen, was sehr viel später als spekulative Vernunft bezeichnet wurde. Während ›Spekulation‹ heute vor allem mit der Börse assoziiert oder im abfälligen Sinn von »Das und das ist reine Spekulation« benutzt wird, galt sie bis zu Hegel als das höchste Vernunftvermögen und meinte Betrachtung (lat. speculor – umherspähen, beobachten) des Wahren mit dem »Auge des Geistes«, wie Platon sagt. Spekulativ war somit die Vernunft, die Geistiges, nur im Denken Erfassbares, zu erfassen vermag, wobei ›Denken (noeîn)‹ in genauer Analogie zur sinnlichen Wahrnehmung verstanden wurde – eben als ein höheres, nichtsinnliches [20] Wahrnehmungsvermögen. Noch Kant definiert: »Eine theoretische Erkenntnis ist spekulativ, wenn sie auf einen Gegenstand oder solche Begriffe von einem Gegenstande geht, wozu man in keiner [sinnlichen] Erfahrung gelangen kann« (KrV 662); dabei bedeutet ›theoretisch‹ seinem ursprünglichen Wortsinn nach nichts anderes als die Haltung des noeîn, nämlich schauend, anschauend, betrachtend. So begründete Parmenides durch seine Radikalisierung der Kritik der Alltagsvernunft das noëtische oder intuitive Vernunftkonzept, das seitdem in wechselnden Deutungen durch die gesamte Philosophiegeschichte hindurch bis in unsere Gegenwart tradiert und immer wieder als das Organon wahrer Vernunfterkenntnis verteidigt wurde.
Die Entstehung der spekulativen Vernunft bei den Griechen bedeutete zugleich den Übergang »vom Mythos zum Logos« (Nestle). Hinter dieser griffigen Formel verbergen sich erhebliche Schwierigkeiten, wenn man sie auf ihren genauen Sinn befragt. In der altgriechischen Umgangssprache bedeuteten ›mŷthos‹ und ›lógos‹