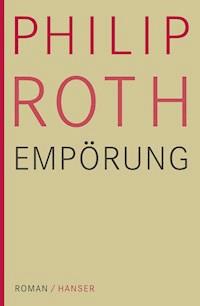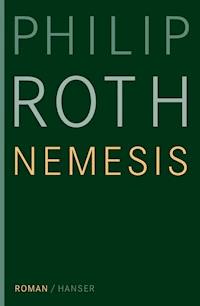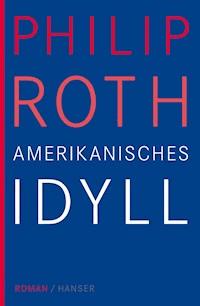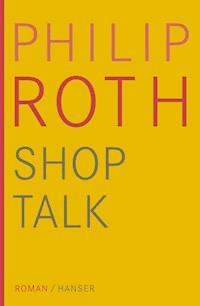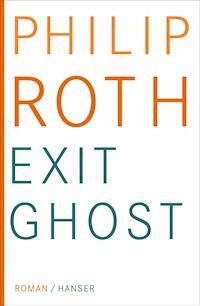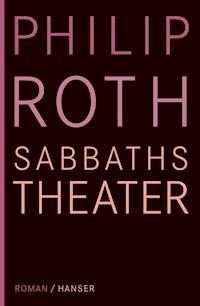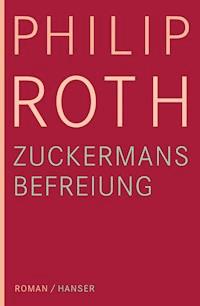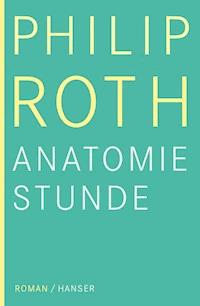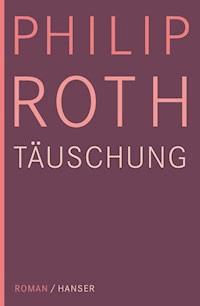Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Amerika 1940. Charles Lindbergh, Fliegerheld und Faschistenfreund, verbucht bei den Präsidentschaftswahlen einen erdrutschartigen Sieg über Franklin D. Roosevelt. Unter den amerikanischen Juden breiten sich Furcht und Schrecken aus – auch bei der Familie Roth in Newark. Aus der Sicht des 8-jährigen Philip schildert der Autor, was passiert wäre, wenn ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 706
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Hanser E-Book
Philip Roth
Verschwörung gegen Amerika
Roman
Aus dem Amerikanischen von Werner Schmitz
Carl Hanser Verlag
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2004 unter dem Titel
The Plot Against America bei Houghton Mifflin in New York.
Die Übersetzung wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
ISBN 978-3-446-25131-1
© Philip Roth 2004
Alle Rechte der deutschen Ausgabe:
© Carl Hanser Verlag München Wien 2005/2015
Umschlag: © Peter-Andreas Hassiepen
Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Leutkirch
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen
finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Inhalt
1Juni 1940 – Oktober 1940Wählt Lindbergh oder wählt den Krieg
2November 1940 – Juni 1941Jüdisches Großmaul
3Juni 1941 – Dezember 1941Christenverfolgung
4Januar 1942 – Februar 1942Der Stumpf
5März 1942 – Juni 1942Nie zuvor
6Mai 1942 – Juni 1942Ihr Land
7Juni 1942 – Oktober 1942Die Winchell-Krawalle
8Oktober 1942Schlimme Zeiten
9Oktober 1942Ständig in Angst
Nachbemerkung
Hinweis an den Leser
Kurzbiographien der wichtigsten historischen Gestalten
Andere historische Gestalten in diesem Roman
Dokumentation
Für S.F.R.
1Juni 1940 – Oktober 1940Wählt Lindbergh oder wählt den Krieg
Angst beherrscht diese Erinnerungen, eine ständige Angst. Natürlich hat jede Kindheit ihre Schrecken, doch ich frage mich, ob ich als Kind nicht weniger Angst gehabt hätte, wenn Lindbergh nicht Präsident gewesen oder ich nicht das Kind von Juden gewesen wäre.
Als im Juni 1940 die schockierende Nachricht kam – Charles A. Lindbergh, Amerikas internationaler Held der Luftfahrt, war vom Parteitag der Republikaner in Philadelphia als Präsidentschaftskandidat nominiert worden –, war mein Vater neununddreißig; als Versicherungsvertreter mit Grundschulabschluß verdiente er knapp unter fünfzig Dollar die Woche; das reichte, um die wichtigsten Rechnungen pünktlich zu bezahlen, für mehr aber auch kaum. Meine Mutter – die sich zur Lehrerin ausbilden lassen wollte, aber nicht konnte, weil es zu teuer war, die seit ihrem Highschool-Abschluß als Sekretärin gearbeitet und zu Hause gewohnt hatte, der wir verdankten, daß wir uns in der schlimmsten Phase der Depression nicht wie arme Leute vorkamen, indem sie den Lohn, den mein Vater ihr jeden Freitag ablieferte, so effizient einteilte, wie sie auch den Haushalt führte – war sechsunddreißig. Mein Bruder Sandy, ein Siebtkläßler mit erstaunlichem Zeichentalent, war zwölf, und ich, ein Drittkläßler, der bereits eine Klasse übersprungen hatte – und ein angehender Briefmarkensammler, inspiriert wie Millionen andere Kinder von Präsident Roosevelt, dem obersten Philatelisten des Landes –, war sieben.
Wir lebten in einer Wohnung im ersten Stock eines kleinen Zweieinhalbfamilienhauses, wie die anderen Häuser in dieser von Bäumen gesäumten Straße ein Holzbau mit einer Eingangstreppe aus rotem Backstein, darüber ein Giebeldach und davor ein winziger, mit einer niedrigen Hecke abgezäunter Vorgarten. Weequahic war kurz nach dem Ersten Weltkrieg auf Ackerflächen am unerschlossenen Südwestrand von Newark gebaut worden, ein halbes Dutzend Straßen dort hatte man majestätisch nach siegreichen Marinekommandanten im Spanisch-Amerikanischen Krieg benannt, und das örtliche Filmtheater hieß nach FDRs Vetter fünften Grades – und dem sechsundzwanzigsten Präsidenten des Landes – das Roosevelt. Unsere Straße, die Summit Avenue, lag oben auf einem Hügel, eine für eine Hafenstadt gar nicht geringe Erhebung, knapp dreißig Meter über dem Niveau der Salzsümpfe im Norden und Osten der Stadt und der noch weiter östlich vom Flughafen gelegenen Bucht, deren Wasser sich um die Öllager auf der Bayonne-Halbinsel schmiegten und sich dort mit der New York Bay vereinigten, um an der Freiheitsstatue vorbei in den Atlantik zu strömen. Wenn wir aus unserem Schlafzimmer hinten heraus nach Westen sahen, ging der Blick manchmal bis zur dunklen Baumlinie der Watchungs, einer niedrigen Bergkette, an deren Saum sich riesige Anwesen und wohlhabende, dünnbesiedelte Vorstädte befanden: der äußerste Rand der bekannten Welt – und acht Meilen von unserem Haus entfernt. Einen Block weiter südlich begann die Arbeitersiedlung Hillside, in der vorwiegend Nichtjuden wohnten. Die Grenze zu Hillside war auch die zu Union County, einem ganz und gar anderen New Jersey.
Wir waren 1940 eine glückliche Familie. Meine Eltern waren kontaktfreudige, gastfreundliche Leute und hatten einen ausgewählten Freundeskreis aus Kollegen meines Vaters und den Frauen, die zusammen mit meiner Mutter bei der Organisation des Eltern-Lehrer-Ausschusses an der neuen Chancellor Avenue School mitgewirkt hatten, der Schule, die mein Bruder und ich besuchten. Alle waren Juden. Die Männer aus dem Viertel waren entweder selbständige Geschäftsleute – die Inhaber des Süßwarenladens, des Lebensmittelgeschäfts, des Juweliergeschäfts, des Kleidergeschäfts, des Möbelladens, der Tankstelle oder der Feinkosthandlung, die Eigentümer kleiner Werkstätten drüben an der Newark-Irvington-Linie, selbständige Klempner, Elektriker, Anstreicher und Heizungsbauer – oder Klinkenputzer wie mein Vater, die täglich von Haus zu Haus zogen und ihre Artikel auf Provisionsbasis verkauften. Die jüdischen Ärzte und Anwälte und erfolgreichen Kaufleute, denen die großen Geschäfte in der Innenstadt gehörten, lebten in Einfamilienhäusern am Osthang des Chancellor-Avenue-Hügels, näher am Weequahic Park, einem über hundert Hektar großen Landschaftsgarten, der mit seinen Rasenflächen und Waldstücken, mit Ruderteich, Golfplatz und Trabrennbahn die Grenze bildete zwischen Weequahic und den Fabriken und Hafenanlagen entlang der Route 27 und dem Viadukt der Pennsylvania Railroad östlich davon und dem eben erst gebauten Flughafen östlich davon und dem äußersten Rand Amerikas östlich davon – den Lagerhäusern und Kais an der Newark Bay, wo Fracht aus der ganzen Welt gelöscht wurde. Am westlichen Ende des Viertels, in unserem parklosen Ende lebte der eine oder andere Lehrer oder Apotheker, ansonsten aber gab es nur wenige Akademiker und ganz sicher keine der reichen Unternehmer- und Fabrikantenfamilien in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Die Männer arbeiteten fünfzig, sechzig, ja siebzig oder mehr Stunden die Woche; die Frauen arbeiteten ununterbrochen und mit wenig Unterstützung durch arbeitssparende Geräte, sie machten die Wäsche, bügelten Hemden, stopften Socken, wendeten Kragen, nähten Knöpfe an, motteten Wollsachen ein, polierten Möbel, fegten und wischten Fußböden, putzten Fenster, schrubbten Waschbecken, Wannen, Toiletten und Herde, staubsaugten, pflegten Kranke, gingen einkaufen, bereiteten die Mahlzeiten zu, versorgten Verwandte, räumten Schränke und Schubladen auf, beaufsichtigten Anstreicher und alle anderen, die im Haus etwas reparierten, planten religiöse Feiern, bezahlten Rechnungen und führten die Familienbücher und kümmerten sich bei alldem gleichzeitig um Gesundheit, Kleidung, Sauberkeit, Ausbildung, Ernährung, Benehmen, Geburtstage, Disziplin und Moral ihrer Kinder. Einige wenige Frauen arbeiteten mit den Männern in ihren Geschäften an den nahe gelegenen Einkaufsstraßen, und nach der Schule und an Samstagen halfen auch die älteren Kinder mit, lieferten Bestellungen aus, kümmerten sich um die Vorräte und putzten.
Arbeit kennzeichnete und charakterisierte für mich unsere Nachbarn weitaus deutlicher als Religion. Niemand in der Nachbarschaft trug einen Bart oder Kleidung im antiquierten Stil der Alten Welt, niemand trug eine Kippa, weder im Freien noch in den Häusern, durch die ich regelmäßig mit meinen Kindheitsfreunden zog. Die Erwachsenen hielten sich nicht mehr nach außen erkennbar an die frommen Vorschriften, falls sie sich überhaupt noch ernsthaft daran hielten, und abgesehen von älteren Geschäftsinhabern wie dem Schneider oder dem koscheren Metzger – und den kränklichen oder klapprigen Großeltern, die der Not gehorchend bei ihren erwachsenen Nachkommen wohnten – sprach fast niemand bei uns mit Akzent. 1940 sprachen jüdische Eltern und ihre Kinder im südwestlichen Winkel der größten Stadt von New Jersey miteinander in einem amerikanischen Englisch, das eher der Sprache in Altoona oder Binghamton glich als den Dialekten, die auf der anderen Seite des Hudson von unseren jüdischen Brüdern und Schwestern in den fünf Bezirken gesprochen wurden. Hebräische Schrift war auf dem Schaufenster des Metzgers und über den Portalen der kleinen Synagogen in unserem Viertel zu sehen, im übrigen jedoch sah man nirgendwo (es sei denn auf dem Friedhof) das Alphabet des Gebetbuchs, sondern nur die vertrauten Buchstaben der Landessprache, die von praktisch jedermann für alle erdenklichen Zwecke, erhabene und niedrige, unausgesetzt verwendet wurde. Am Zeitungsstand vor dem Süßwarenladen an der Ecke wurde die Racing Form zehnmal soviel verkauft wie der Forvertz, die jiddische Tageszeitung.
Israel existierte noch nicht, sechs Millionen europäische Juden hatten noch nicht aufgehört zu existieren, und was das ferne Palästina (unter britischem Mandat, seit die siegreichen Alliierten 1918 die letzten entlegenen Provinzen des ehemaligen Osmanischen Reiches aufgelöst hatten) mit uns zu tun haben sollte, war mir ein Rätsel. Wenn alle paar Monate ein Fremder, der einen Bart trug und niemals ohne Hut gesehen wurde, nach Einbruch der Dunkelheit bei uns vorsprach und in gebrochenem Englisch um eine Spende für ein nationales Heimatland der Juden in Palästina bat, begriff ich, der ich kein ahnungsloses Kind war, nie so recht, was er da eigentlich vor unserer Haustür zu suchen hatte. Meine Eltern gaben dann mir oder Sandy ein paar Münzen, die wir in seine Sammelbüchse werfen sollten, ein Geschenk, wie mir immer schien, das allein aus Freundlichkeit gegeben wurde, um nicht die Gefühle eines alten Mannes zu verletzen, dem es zeit seines Lebens offenbar nicht in den Kopf wollte, daß wir bereits seit drei Generationen ein Heimatland besaßen. Jeden Morgen in der Schule schwor ich unserem Heimatland die Treue. Auf Schulversammlungen sang ich mit meinen Klassenkameraden von seinen Herrlichkeiten. Eifrig beging ich seine nationalen Feiertage, ohne groß darüber nachzudenken, was das Feuerwerk zum 4. Juli oder der Truthahn zu Thanksgiving oder die Baseball-Veranstaltungen am Decoration Day eigentlich mit mir zu tun hatten. Unser Heimatland war Amerika.
Dann nominierten die Republikaner Lindbergh, und alles wurde anders.
Ein knappes Jahrzehnt lang wurde Lindbergh in unserem Viertel genausosehr als Held verehrt wie überall anders. Die Landung nach seinem dreiunddreißigeinhalbstündigen Nonstop-Alleinflug mit dem winzigen Eindecker Spirit of St. Louis von Long Island nach Paris fand zufällig an jenem Tag im Frühling 1927 statt, an dem meine Mutter feststellte, daß sie mit meinem älteren Bruder schwanger war. Daraus ergab sich, daß der junge Flieger, dessen Wagemut Amerika und die Welt begeistert hatte und dessen Leistung für die Zukunft unvorstellbare Fortschritte in der Luftfahrt verhieß, einen besonderen Platz in der Galerie der Familienanekdoten einnahm, die die erste zusammenhängende Mythologie eines Kindes zu bilden pflegen. Das Rätsel der Schwangerschaft und das Heldentum Lindberghs – daß dies beides zugleich eintraf, erhob meine Mutter geradezu in den Rang einer Göttin, deren erstes Kind durch nichts Geringeres als eine globale Verkündigung prophezeit worden war. Später hielt Sandy diesen Augenblick in einer Zeichnung fest, die das Zusammentreffen der beiden glorreichen Ereignisse veranschaulichte. Die Zeichnung – angefertigt mit neun Jahren und mit einem unbeabsichtigten Beigeschmack von sowjetischer Plakatkunst – zeigt unsere Mutter Meilen von unserem Haus entfernt inmitten einer jubelnden Menge an der Kreuzung Broad und Market. Eine schlanke junge Frau von dreiundzwanzig Jahren mit dunklem Haar und einem Lächeln, das reine, kraftvolle Freude ausdrückt, steht sie dort überraschenderweise ohne Begleitung in ihrer mit Blümchen bedruckten Küchenschürze an der Kreuzung der zwei belebtesten Durchfahrtsstraßen der Stadt, eine Hand breit auf der Schürze gespreizt, dort wo ihre Hüfte noch trügerisch mädchenhaft ist, während die andere gen Himmel weist, wo die Spirit of St. Louis genau in dem Moment über Newark hinwegfliegt, in dem ihr bewußt wird, daß sie durch ein Bravourstück, das für einen Sterblichen keinen geringeren Triumph darstellt als das Lindberghs, Sanford Roth empfangen hat.
Sandy war vier und ich, Philip, war noch nicht geboren, als im März 1932 Charles und Anne Morrow Lindberghs eigenes erstgeborenes Kind, ein Junge, dessen Geburt zwanzig Monate zuvor die ganze Nation in einen Freudentaumel versetzt hatte, aus dem abgelegenen neuen Haus seiner Eltern im ländlichen Hopewell, New Jersey, entführt wurde. Zehn Wochen später wurde in einem wenige Meilen entfernten Wald die verwesende Leiche des Babys durch Zufall gefunden. Das Baby war entweder ermordet oder ohne Vorsatz getötet worden, nachdem man es aus seiner Wiege gerissen und in der Dunkelheit, noch in seinen Schlafsachen, durch ein Fenster des im ersten Stock gelegenen Kinderzimmers und eine behelfsmäßige Leiter hinunter ins Freie getragen hatte, während das Kindermädchen und die Mutter in einem anderen Teil des Hauses ihren gewöhnlichen abendlichen Beschäftigungen nachgingen. Als im Februar 1935 in Flemington, New Jersey, der Prozeß wegen Entführung und Mordes mit der Verurteilung Bruno Hauptmanns – eines fünfunddreißigjährigen vorbestraften Deutschen, der mit seiner deutschen Frau in der Bronx lebte – zu Ende ging, hatte sich in die Begeisterung über die Kühnheit des ersten Transatlantikfliegers ein Mitleid gemischt, das ihn zu einem Märtyrer machte, wie nur Lincoln es vor ihm gewesen war.
Nach dem Prozeß verließen die Lindberghs Amerika in der Hoffnung, ein zeitweiliges Leben im Ausland könne nicht nur einem neuen Lindbergh-Baby Schutz bieten, sondern auch ihnen selbst wieder zu etwas mehr Privatleben verhelfen. Die Familie zog in ein kleines Dorf in England, von wo aus Lindbergh als Privatperson einige Reisen nach Nazideutschland unternahm, was ihn für die Mehrheit der amerikanischen Juden zum Schurken machte. Bei seinen fünf Besuchen, in deren Verlauf er sich aus erster Hand ein Bild vom Ausmaß der deutschen Kriegsvorbereitungen machen konnte, wurde er demonstrativ von Reichsmarschall Göring empfangen und im Namen des Führers feierlich ausgezeichnet, äußerte ganz offen seine Hochachtung für Hitler und bezeichnete Deutschland als »die interessanteste Nation der Welt« und den Führer als »großen Mann«. Und all dieses Interesse und all diese Bewunderung, nachdem Hitlers Rassengesetze von 1935 den Juden Deutschlands ihre bürgerlichen, gesellschaftlichen und Eigentumsrechte abgesprochen, ihnen die Staatsbürgerschaft genommen und Mischehen mit Ariern verboten hatten.
Als ich 1938 zur Schule kam, war Lindbergh ein Name, der bei uns zu Hause die gleiche Empörung auslöste wie die sonntäglichen Rundfunkansprachen von Father Coughlin, einem Priester aus der Gegend von Detroit, der eine rechtsradikale Wochenzeitschrift namens Social Justice herausgab und dessen antisemitischen Ausfälle in den schweren Zeiten des Landes bei vielen seiner Zuhörer auf fruchtbaren Boden fielen. Im November 1938 – in dem Jahr, das für die europäischen Juden das dunkelste und unheilvollste seit achtzehn Jahrhunderten war – inszenierten die Nazis in ganz Deutschland die »Kristallnacht«, das schlimmste Pogrom in der Geschichte der Moderne: Synagogen wurden in Brand gesteckt, Häuser und Geschäfte von Juden zerstört und – noch im Laufe dieser Nacht, die eine ungeheuerliche Zukunft prophezeite – Tausende von Juden mit Gewalt aus ihren Wohnungen geholt und in Konzentrationslager abtransportiert. Als man Lindbergh nahelegte, er solle als Reaktion auf diese nie dagewesene, von einem Staat an seinen eigenen Bürgern begangene Barbarei in Erwägung ziehen, den ihm im Namen des Führers von Reichsmarschall Göring verliehenen, mit vier Hakenkreuzen geschmückten Deutschen Adlerorden zurückzugeben, lehnte er dies mit der Begründung ab, die öffentliche Rückgabe dieser hohen Auszeichnung würde »eine unnötige Beleidigung« der Naziführerschaft darstellen.
Lindbergh war der erste lebende berühmte Amerikaner, den ich hassen lernte – so wie Präsident Roosevelt der erste lebende berühmte Amerikaner war, den man mich lieben lehrte –, und als die Republikaner ihn 1940 zum Gegenkandidaten Roosevelts nominierten, erschütterte dies wie nichts zuvor das umfassende Gefühl persönlicher Sicherheit, das ich als amerikanisches Kind amerikanischer Eltern auf einer amerikanischen Schule in einer amerikanischen Stadt in einem Amerika, das mit der Welt in Frieden lebte, immer für etwas Selbstverständliches gehalten hatte.
Die einzige vergleichbare Bedrohung war dreizehn Monate zuvor gekommen, als mein Vater, weil er als Vertreter der Newarker Filiale von Metropolitan Life auch in der schlimmsten Phase der Depression immer gute Verkaufszahlen erzielt hatte, befördert werden sollte; man bot ihm den Posten des für die Vertreter der Firma zuständigen zweiten Geschäftsführers in der sechs Meilen von unserem Haus entfernten Filiale Union an, einer Stadt, von der ich nur wußte, daß es dort ein Autokino gab, wo Filme auch bei Regen gezeigt wurden, und natürlich wurde erwartet, daß mein Vater, wenn er die Stelle haben wollte, mit seiner Familie dorthin ziehen würde. Als zweiter Geschäftsführer konnte mein Vater schon bald fünfundsiebzig Dollar die Woche und nach wenigen Jahren glatt hundert Dollar die Woche verdienen, was 1939 für eine Familie mit unseren Aussichten ein Vermögen war. Und da es in Union dank der Depression Einfamilienhäuser zu Tiefstpreisen von wenigen tausend Dollar zu kaufen gab, wäre er in die Lage versetzt worden, ein ehrgeiziges Ziel zu erreichen, das er seit der Zeit, da er bettelarm in einer Newarker Mietwohnung aufgewachsen war, immer gehegt hatte: ein amerikanischer Hausbesitzer zu werden. »Besitzerstolz« war ein Lieblingswort meines Vaters; für einen Mann seiner Herkunft verkörperte es eine Vorstellung, so real wie das tägliche Brot, eine Vorstellung, die nichts mit sozialem Wettbewerb oder Prestigekonsum zu tun hatte, sondern mit seinem Ansehen als Mann und Ernährer.
Der einzige Nachteil war, daß mein Vater, weil Union wie Hillside von nichtjüdischen Arbeitern bewohnt wurde, dort sehr wahrscheinlich der einzige Jude in einem Büro mit fünfunddreißig Angestellten, meine Mutter die einzige Jüdin in unserer Straße und Sandy und ich die einzigen jüdischen Kinder in unserer Schule sein würden.
An dem Samstag, nachdem man meinem Vater die Beförderung angeboten hatte – eine Beförderung, die vor allem geeignet war, das Bedürfnis einer von der Depression gebeutelten Familie nach einem Minimum an finanzieller Sicherheit zu stillen –, brachen wir vier nach dem Mittagessen auf, um uns in Union umzusehen. Kaum aber waren wir dort und schauten uns, durch die Straßen der Wohnbezirke fahrend, die einstöckigen Häuser an – die nicht ganz genau gleich aussahen, doch hatte jedes eine überdachte Vorderveranda, einen gemähten Rasen, ein paar Sträucher und eine befestigte Einfahrt, die zu einer Garage für ein Auto führte, sehr bescheidene Häuser, aber immer noch geräumiger als unsere Wohnung mit den zwei Schlafzimmern und sehr an die kleinen weißen Häuser erinnernd, die man aus Filmen über das kleinstädtische, bodenständige Amerika kennt –, kaum waren wir dort, trat wie nicht anders zu erwarten an die Stelle unserer naiven Begeisterung über den Aufstieg unserer Familie in die Klasse der Hausbesitzer die Sorge darüber, wie weit die christliche Nächstenliebe sich wohl erstrecken mochte. Als mein Vater fragte: »Was meinst du, Bess?«, reagierte meine normalerweise energische Mutter mit einem Enthusiasmus, den selbst ein Kind als vorgetäuscht erkannte. Und so jung ich damals war, ahnte ich auch, warum. Weil sie dachte: »Unser Haus wird das sein, ›wo die Juden wohnen‹. Wieder das gleiche wie in Elizabeth.«
In Elizabeth, New Jersey, war meine Mutter in einer Wohnung über dem Lebensmittelladen ihres Vaters aufgewachsen; die Hafenstadt, etwa ein Viertel so groß wie Newark, wurde damals von irischen Arbeitern und deren politischen Vertretern und dem enggefügten Gemeindeleben beherrscht, in dessen Mittelpunkt die zahlreichen Kirchen der Stadt standen; daß sie als Mädchen in Elizabeth direkt schlecht behandelt worden sei, hatte ich zwar nie aus ihrem Mund vernommen, aber erst nachdem sie geheiratet hatte und in das neue jüdische Viertel von Newark gezogen war, fand sie zu jenem Selbstvertrauen, das es ihr ermöglichte, zuerst Sprecherin des Eltern-Lehrer-Ausschusses zu werden, dann dessen stellvertretende Vorsitzende mit der Aufgabe, einen Mütterclub für den Kindergarten zu organisieren, und schließlich erste Vorsitzende, als die sie, nachdem sie in Trenton eine Tagung über Kinderlähmung besucht hatte, den Vorschlag machte, alljährlich am 30. Januar – Präsident Roosevelts Geburtstag – einen Ball zu veranstalten, auf dem Spenden gesammelt werden sollten, ein Vorschlag, der von den meisten Newarker Schulen aufgegriffen wurde. Im Frühjahr 1939 wirkte sie bereits im zweiten Jahr erfolgreich als Vorsitzende mit fortschrittlichen Ideen – unter anderem unterstützte sie einen jungen Gesellschaftskundelehrer, der darauf versessen war, in der Chancellor Avenue School die sogenannte »visuelle Pädagogik« einzuführen – und sah sich nun mit der Vorstellung konfrontiert, alles zu verlieren, was sie bis jetzt als Hausfrau und Mutter in der Summit Avenue erreicht hatte. Sollten wir das Glück haben und in eins der Häuser in den Straßen von Union ziehen können, die wir jetzt im schönsten Frühjahrsschmuck zu sehen bekamen, würde sie auf die Stufe zurückfallen, auf der sie als Tochter eines jüdischen Einwanderers im irisch-katholischen Elizabeth aufgewachsen war, und, was noch schlimmer war, Sandy und ich wären gezwungen, ebenso wie sie mit den Beschränkungen aufzuwachsen, denen man als Außenseiter ausgesetzt war.
So gedrückt die Stimmung meiner Mutter war, gab mein Vater sich alle Mühe, uns bei Laune zu halten; er wies darauf hin, wie sauber und gepflegt hier alles aussehe, erinnerte Sandy und mich daran, daß wir zwei, wenn wir in einem dieser Häuser wohnten, nicht mehr ein kleines Schlafzimmer und einen einzigen Schrank miteinander zu teilen hätten, und erklärte uns die Vorteile, die es mit sich brächte, wenn man statt Miete zu zahlen eine Hypothek abzuzahlen hätte, ein Grundkurs in Ökonomie, der ein jähes Ende fand, als mein Vater vor einer roten Ampel halten mußte, neben der sich, eine Ecke der Kreuzung beherrschend, eine große Schankwirtschaft unter freiem Himmel befand. Im Schatten dichtbelaubter Bäume standen dort grüne Picknicktische, zwischen denen, mit Flaschen, Gläsern und Tellern beladene Tabletts balancierend, Kellner in bortenbesetzten weißen Jacken umhereilten, und jeder Tisch war an diesem sonnigen Wochenendnachmittag mit Männern aller Altersstufen besetzt, die Zigaretten, Pfeifen und Zigarren rauchten und in tiefen Zügen aus großen Humpen und Steingutkrügen tranken. Und Musik gab es auch – ein stämmiger kleiner Mann in kurzen Hosen und Kniestrümpfen und einem Hut mit einer langen Feder dran spielte Akkordeon.
»Diese Schweine!« sagte mein Vater. »Faschistenschweine!« Dann wurde die Ampel grün, und wir fuhren schweigend weiter, um uns das Bürogebäude anzusehen, wo er die Chance bekommen sollte, mehr als fünfzig Dollar die Woche zu verdienen.
Es war mein Bruder, der mir, als wir an diesem Abend zu Bett gingen, erklärte, warum mein Vater die Beherrschung verloren und vor seinen Kindern so lautstark geflucht hatte: diese anheimelnde Gastwirtschaft unter freiem Himmel, die wir vorhin mitten in der Stadt gesehen hätten, nenne man Biergarten, und Biergärten hätten mit dem Deutsch-Amerikanischen Bund zu tun, und der Deutsch-Amerikanische Bund habe mit Hitler zu tun, und Hitler, als hätte ich das nicht längst gewußt, sei der Mann, der die Juden verfolge.
Berauscht von Antisemitismus. So stellte ich mir die Männer vor, die da in ihrem Biergarten so fröhlich gezecht hatten – wie alle Nazis überall, einen Humpen Antisemitismus nach dem anderen in sich reinschüttend, als söffen sie das Allheilmittel.
Mein Vater mußte sich einen Vormittag freinehmen, um die Zentrale drüben in New York aufzusuchen – das riesenhafte Gebäude, dessen höchster Turm von einem Signallicht gekrönt wurde, das die Firma stolz als »Das Licht, das niemals ausgeht« bezeichnete – und seinen Chef davon zu informieren, daß er die ersehnte Beförderung nicht annehmen könne.
»Das ist meine Schuld«, verkündete meine Mutter, als er beim Essen zu erzählen anfing, was sich im achtzehnten Stock der Madison Avenue 1 abgespielt hatte.
»Niemand ist schuld«, sagte mein Vater. »Ich habe dir vorher erklärt, was ich ihm sagen würde, und genau das habe ich ihm gesagt. Punkt. Wir ziehen nicht nach Union, Kinder. Wir bleiben hier.«
»Was hat er getan?« fragte meine Mutter.
»Er hat mir zugehört.«
»Und dann?« fragte sie.
»Ist er aufgestanden und hat mir die Hand gegeben.«
»Und er hat nichts gesagt?«
»Er hat gesagt: ›Viel Glück, Roth.‹«
»Er war wütend auf dich.«
»Hatcher ist ein Gentleman der alten Schule. Ein Goi. Über eins achtzig groß. Sieht aus wie ein Filmstar. Sechzig Jahre alt und bei bester Gesundheit. Das sind die Leute, die das Sagen haben, Bess – die verschwenden ihre Zeit nicht damit, auf einen wie mich wütend zu sein.«
»Und was jetzt?« fragte sie und deutete damit an, daß, was auch immer sich aus seinem Gespräch mit Hatcher ergeben mochte, jedenfalls nichts Gutes, sondern nur etwas Schlimmes sein konnte. Und ich glaubte zu verstehen, warum. Knie dich rein, dann kannst du alles – mit diesem Grundsatz hatten unsere Eltern uns erzogen. Beim Essen schärfte mein Vater seinen jungen Söhnen immer wieder ein: »Wenn euch jemand fragt: ›Kannst du das? Kommst du mit dieser Arbeit zurecht?‹, dann müßt ihr sagen: ›Ganz bestimmt.‹ Bis sie herausfinden, daß ihr es doch nicht könnt, habt ihr bereits genug gelernt und könnt den Job behalten. Und wer weiß, vielleicht stellt es sich im nachhinein als die Chance eines Lebens heraus.« Aber drüben in New York hatte er nichts dergleichen getan.
»Was hat der Boss gesagt?« fragte sie ihn. Boss, so nannten wir vier Sam Peterfreund, den Leiter der Newarker Filiale. In jenen Zeiten – als man mit inoffiziellen Quotenregelungen dafür sorgte, daß möglichst wenige Juden an Colleges und Fachschulen kamen; als aufgrund der von niemandem in Frage gestellten Diskriminierung Juden in den großen Unternehmen keine nennenswerten Beförderungschancen hatten; als Juden unter dem Vorwand strenger Vorschriften die Mitgliedschaft in Tausenden gesellschaftlichen Organisationen und kommunalen Einrichtungen verwehrt wurde – war Peterfreund einer der ersten der kleinen Handvoll Juden, die bei Metropolitan Life jemals eine leitende Stellung hatten einnehmen dürfen. »Er hat dich dafür vorgeschlagen«, sagte meine Mutter. »Was muß er jetzt denken?«
»Weißt du, was er zu mir gesagt hat, als ich zu ihm kam? Weißt du, was er mir von der Filiale in Union erzählt hat? Da wimmelt es von Säufern. Er hat meine Entscheidung nicht im voraus beeinflussen wollen. Er wollte sich mir nicht in den Weg stellen, falls ich dorthin wechseln wollte. Die Vertreter dort, sagt er, arbeiten vormittags zwei Stunden und treiben sich dann bis zum Abend in Kneipen oder Schlimmerem herum. Und da sollte ich hin, ich, der neue Jude, der große neue Judenboss, auf den die Gojim nur gewartet haben, daß er sie zur Arbeit antreibt; und da sollte ich hin und sie vom Kneipenboden aufsammeln. Da sollte ich hin und sie an ihre Pflichten gegenüber ihren Frauen und Kindern erinnern. Ah, wie sie mich für diesen Liebesdienst geliebt hätten, Kinder. Ihr könnt euch vorstellen, wie sie mich hinter meinem Rücken genannt hätten. Nein, wo ich jetzt bin, geht’s mir besser. Uns allen.«
»Aber können sie dich nicht rausschmeißen, weil du ihnen einen Korb gegeben hast?«
»Schatz, ich habe getan, was ich getan habe. Und damit Schluß.«
Sie glaubte ihm freilich nicht, daß der Boss das so gesagt hatte; sie glaubte, er habe sich das ausgedacht, um sie davon abzubringen, sich Vorwürfe zu machen, weil sie mit den Kindern nicht in eine Christenstadt ziehen wollte, wo der Deutsch-Amerikanische Bund sein Unwesen trieb, und ihm damit die Chance seines Lebens zunichte gemacht hatte.
Im April 1939 kehrten die Lindberghs nach Amerika zurück und ließen sich dort endgültig nieder. Wenige Monate später, im September, fiel Hitler, nachdem er bereits Österreich annektiert und die Tschechoslowakei überrannt hatte, in Polen ein, woraufhin Frankreich und Großbritannien Deutschland den Krieg erklärten. Lindbergh, inzwischen als Colonel im Army Air Corps aktiv, reiste im Auftrag der US-Regierung im ganzen Land umher, um für die Entwicklung der amerikanischen Luftfahrt und die Ausweitung und Modernisierung der Luftwaffe zu werben. Als Hitler nacheinander Dänemark, Norwegen, Holland und Belgien besetzte und Frankreich an den Rand der Niederlage brachte und der zweite große europäische Krieg des Jahrhunderts bereits voll im Gange war, machte der Luftwaffen-Colonel sich zum Idol der Isolationisten – und zum Feind Roosevelts –, indem er seinen Auftrag um das Ziel erweiterte, Amerika davon abzubringen, sich in den Krieg hineinziehen zu lassen und den Briten oder Franzosen in irgendeiner Form Hilfe anzubieten. Die Animosität zwischen ihm und Roosevelt war auch so schon stark gewesen, jetzt jedoch, da er vor großen Versammlungen, im Rundfunk und in populären Zeitschriften öffentlich erklärte, der Präsident führe das Land mit Friedensversprechungen in die Irre, während er insgeheim den Eintritt in die bewaffnete Auseinandersetzung propagiere und plane, begann man in Kreisen der Republikaner Lindbergh als den Mann zu rühmen, der das Zeug besitze, zu verhindern, daß »der Kriegstreiber im Weißen Haus« eine dritte Amtszeit bekomme.
Je mehr Roosevelt den Kongreß unter Druck setzte, das Waffenembargo aufzuheben und von der strikt neutralen Haltung des Landes Abstand zu nehmen, damit nicht auch noch die Briten geschlagen würden, desto unverblümter wurde Lindbergh in seinen Äußerungen, bis er schließlich in Des Moines vor einem Saal voller begeisterter Anhänger jene berühmte Rundfunkansprache hielt, in der er als eine der »wichtigsten Gruppen, die dieses Land in den Krieg treiben wollen« eine Gruppe nannte, die weniger als drei Prozent der Bevölkerung ausmachte und von ihm abwechselnd »das jüdische Volk« und »die jüdische Rasse« genannt wurde.
»Niemand, der ehrlich ist und Weitblick besitzt«, sagte Lindbergh, »kann angesichts ihrer auf Krieg ausgerichteten Politik hier und jetzt die Gefahren übersehen, die eine solche Politik sowohl für sie selbst als auch für uns mit sich bringt.« Und bemerkenswert freimütig fügte er hinzu:
Einige wenige weitblickende Juden haben dies erkannt und sprechen sich gegen eine Intervention aus. Die Mehrheit hingegen nicht … Wir können ihnen nicht vorwerfen, daß ihnen am Herzen liegt, was sie für ihre eigenen Interessen halten, aber auch uns müssen die unseren am Herzen liegen. Wir können nicht zulassen, daß die natürlichen Leidenschaften und Vorurteile anderer Völker unser Land in die Vernichtung führen.
Tags darauf wurden Lindberghs Anschuldigungen, die sein Publikum in Iowa zu Beifallsstürmen veranlaßt hatten, von allen möglichen Seiten aufs heftigste bestritten: von liberalen Journalisten, von Roosevelts Pressesprecher, von Vertretern und Organisationen der Juden und sogar von Leuten aus den Reihen der republikanischen Partei, unter anderem von dem New Yorker Bezirksstaatsanwalt Dewey und dem Wall-Street-Anwalt Wendell Wilkie, die beide als mögliche Präsidentschaftskandidaten galten. Demokratische Kabinettsmitglieder wie Innenminister Harold Ickes äußerten so scharfe Kritik, daß Lindbergh lieber auf seinen Posten als Colonel der Reserve verzichtete, als weiterhin unter FDR als seinem obersten Kommandanten zu dienen. Aber das einflußreiche America First Committee, das den Kampf gegen den Kriegseintritt anführte, unterstützte ihn weiterhin, und er blieb der populärste Verfechter einer neutralen Haltung. Viele Anhänger dieser Organisation hegten keinen Zweifel (auch nicht angesichts der Tatsachen) an Lindberghs Behauptung, »die größte Gefahr für unser Land« gehe »vom Einfluß der Juden auf unsere Filmindustrie, unsere Presse, unseren Rundfunk und unsere Regierung« aus. Als Lindbergh stolz von »unserem Erbe europäischen Blutes« schrieb, als er vor »Schwächung durch fremde Rassen« und dem »Eindringen minderwertigen Blutes« warnte (Phrasen, die in seinen Tagebüchern aus jener Zeit zu finden sind), gab er private Überzeugungen wieder, die sowohl von einer breiten Basis innerhalb des America First Committee als auch von einer fanatischen Wählerschaft geteilt wurden, die noch größer war, als ein Jude wie mein Vater mit seinem erbitterten Haß auf alles Antisemitische – oder meine Mutter mit ihrem tief eingewurzelten Mißtrauen gegen die Christen – es sich jemals vorstellen konnte: undenkbar, daß dergleichen überall in Amerika gedacht wurde.
Der republikanische Parteitag 1940. Als mein Bruder und ich an diesem Abend – Donnerstag, der 27. Juni – schlafen gingen, lief in unserem Wohnzimmer das Radio, und unsere Eltern und unser älterer Vetter Alvin saßen dort und hörten sich die Live-Übertragung aus Philadelphia an. Nach sechs Wahlgängen hatten die Republikaner immer noch keinen Kandidaten aufgestellt. Ein Delegierter sollte noch Lindbergh vorschlagen, aber der weilte auf einer geheimen Sitzung in einer Fabrik im Mittleren Westen, um an der Planung eines neuen Kampfflugzeugs mitzuwirken, und konnte daher nicht selbst anwesend sein und wurde auch gar nicht erwartet. Als Sandy und ich zu Bett gingen, war der Parteitag immer noch gespalten zwischen Dewey, Wilkie und zwei mächtigen republikanischen Senatoren, Vandenberg aus Michigan und Taft aus Ohio, und es sah nicht danach aus, als könnten Parteibonzen wie der ehemalige Präsident Hoover, den Roosevelts überwältigender Sieg 1932 aus dem Amt gefegt hatte, oder Gouverneur Alf Landon, den Roosevelt vier Jahre später beim größten Erdrutschsieg der Geschichte gar noch schmählicher geschlagen hatte, in absehbarer Zeit eine Lösung im Hinterzimmer ausklüngeln.
Es war der erste schwüle Abend in diesem Sommer, die Fenster in allen Zimmern standen offen, und Sandy und ich konnten, ob wir wollten oder nicht, auch noch im Bett die Übertragung weiterverfolgen, und zwar sowohl aus dem Radio in unserem eigenen Wohnzimmer als auch aus dem Radio in der Wohnung unter uns und – da die Häuser lediglich durch enge Gassen, kaum breit genug für ein Auto, voneinander getrennt waren – den Radios unserer Nachbarn zur Linken und zur Rechten und gegenüber. Das war lange vor der Zeit, als Fenster-Klimaanlagen in tropischen Nächten die Geräusche der Nachbarschaft übertönten, und so bekam der ganze Block von Keer bis Chancellor die Sendung mit – ein Block, in dem kein einziger Republikaner lebte, weder in den gut dreißig Zweieinhalbfamilienhäusern noch in dem neuen kleinen Mietshaus an der Kreuzung Chancellor Avenue. In Straßen wie der unseren wählten die Juden stramm demokratisch, solange FDR die Kandidatenliste anführte.
Aber wir waren noch Kinder und schliefen trotzdem ein, und wahrscheinlich wären wir erst am Morgen wieder aufgewacht, wäre nicht um 3.18 Uhr in der Nacht – die Republikaner hatten auch im zwanzigsten Wahlgang noch keine Entscheidung herbeiführen können – ganz und gar unerwartet Lindbergh in den Saal gekommen. Der schlanke, große, gutaussehende Held, ein geschmeidiger, athletischer Mann von nicht einmal vierzig Jahren, trat, erst wenige Minuten zuvor mit seinem Privatflugzeug in Philadelphia gelandet, noch in seiner Fliegermontur vor die Versammlung, und sein Anblick wirkte auf die erschöpften Delegierten wie eine Erlösung und versetzte sie in solche Begeisterung, daß sie von den Sitzen sprangen und volle dreißig Minuten lang »Lindy! Lindy! Lindy!« skandierten, ohne daß der Vorsitzende sie auch nur einmal zur Ordnung rief. Die erfolgreiche Aufführung dieses spontanen pseudoreligiösen Schauspiels ging auf die Machenschaften des Senators Gerald P. Nye aus North Dakota zurück, eines rechtsradikalen Isolationisten, der nun Charles A. Lindbergh aus Little Falls, Minnesota, als Kandidaten vorschlug, worauf zwei der reaktionärsten Kongreßabgeordneten – Thorkelson aus Montana und Mundt aus South Dakota – die Nominierung unterstützten, und exakt um vier Uhr morgens, am Freitag, dem 28. Juni, kürte der republikanische Parteitag per Akklamation jenen Eiferer zum Präsidentschaftskandidaten, der in einer landesweit ausgestrahlten Rundfunkansprache die Juden als »andere Völker« angeprangert hatte, die sich ihren enormen »Einfluß« zunutze machten, um »unser Land in die Vernichtung zu führen«, statt uns wahrheitsgemäß als kleine Minderheit von Bürgern darzustellen, die den christlichen Landsleuten zahlenmäßig weit unterlegen waren, im großen und ganzen durch religiöse Vorurteile vom Streben nach Macht abgehalten wurden und den Grundsätzen der amerikanischen Demokratie ganz gewiß nicht weniger treu waren als ein Bewunderer Adolf Hitlers.
»Nein!« war das Wort, das uns weckte, »Nein!« brüllte aus jedem Haus im Block eine Männerstimme. Das kann nicht sein. Nein. Nicht zum Präsidenten der Vereinigten Staaten.
Binnen Sekunden saßen mein Bruder und ich wieder im Kreis der Familie am Radio, und keinem fiel es ein, uns ins Bett zurückzuschicken. So heiß es war, hatte meine sittsame Mutter einen Morgenmantel über ihr dünnes Nachthemd gezogen – auch sie hatte geschlafen und war von dem Lärm geweckt worden –, und jetzt saß sie neben meinem Vater auf dem Sofa und hielt sich die Finger vor den Mund, als müßte sie sich gleich erbrechen. Unterdessen schritt mein Vetter Alvin, den es nicht mehr auf seinem Platz gehalten hatte, in dem sechs mal vier Meter großen Zimmer auf und ab mit der Entschlossenheit eines Rächers, der die ganze Stadt absucht, um seinen schlimmsten Feind zu erledigen.
Der Zorn jener Nacht war ein echtes Schmiedefeuer, ein Hochofen, der einen aufnimmt und verbiegt wie Stahl. Und er legte sich nicht – nicht, solange Lindbergh schweigend auf dem Podium in Philadelphia stand und sich wieder einmal als Erlöser der Nation feiern ließ, und auch nicht, als er mit seiner Rede die Nominierung durch die Partei und damit den Auftrag annahm, Amerika aus dem europäischen Krieg herauszuhalten. Mit Entsetzen warteten wir nur noch darauf, daß er seine boshafte Verleumdung der Juden vor dem Parteitag wiederholte, aber daß er das nicht tat, änderte nichts an der Stimmung, die gegen fünf Uhr morgens jede einzelne Familie aus unserem Block auf die Straße jagte. Ganze Familien, die man bis dahin nur in Straßenkleidung gekannt hatte, ließen sich in Pyjamas und Nachthemden unter ihren Bademänteln blicken und liefen in Pantoffeln durch die Morgendämmerung, als hätte ein Erdbeben sie aus ihren Häusern getrieben. Aber der größte Schock für ein Kind war der Zorn, der Zorn von Männern, die ich als unbeschwerte Kiebitzer oder wortkarge, pflichtbewußte Brotverdiener kannte, die den ganzen Tag Abflußrohre reinigten oder Heizkessel warteten oder pfundweise Äpfel verkauften und abends in die Zeitung schauten und Radio hörten und im Wohnzimmer auf dem Sessel einschliefen, einfache Leute, bei denen es sich zufällig um Juden handelte und die jetzt unter Mißachtung aller Anstandsregeln lauthals fluchend auf der Straße herumrannten: mit einem Schlag wieder in den elenden Kampf geworfen, von dem sie ihre Familien durch die vom Schicksal glücklich gefügte Auswanderung der Generation davor endgültig befreit glaubten.
Ich hätte darin, daß Lindbergh die Juden in seiner Dankesrede nicht erwähnte, ein gutes Omen gesehen, einen Hinweis darauf, daß ihn der Aufschrei, der ihn zum Verzicht auf seinen Dienst bei der Luftwaffe bewegt hatte, zur Mäßigung gebracht hatte, oder daß er seit Des Moines zu einer anderen Meinung gelangt war, oder daß er uns schon vergessen hatte, oder daß er insgeheim ganz genau wußte, wie unverbrüchlich wir Amerika verpflichtet waren – daß wir, da mochte Irland den Iren und Polen den Polen und Italien den Italienern noch immer viel bedeuten, keinerlei Verpflichtung, weder gefühlsmäßig noch sonstwie, gegenüber den Ländern der Alten Welt empfanden, in denen wir niemals willkommen gewesen waren und in die zurückzukehren wir nicht die geringste Absicht hatten. Hätte ich damals die Bedeutung dieses Augenblicks in Worte fassen können, dann wäre etwa dies dabei herausgekommen. Aber die Männer auf der Straße sahen das anders. Daß Lindbergh die Juden nicht erwähnt hatte, war für sie ein Trick und sonst gar nichts, der Beginn eines Wahlkampfs voller Täuschungsmanöver, die uns zum Schweigen bringen und hinters Licht führen sollten. »Hitler in Amerika!« riefen die Nachbarn. »Faschismus in Amerika! SA in Amerika!« Nachdem sie die ganze Nacht nicht geschlafen hatten, hielten diese fassungslosen älteren Leute jetzt alles für möglich und sprachen auch alles aus, bevor sie dann wieder in ihre Häuser gingen (wo überall noch die Radios plärrten), die Männer, weil sie sich rasieren und anziehen, eine Tasse Kaffee trinken und zur Arbeit gehen mußten, die Frauen, weil sie die Kinder ankleiden, ihnen das Essen richten und sie für den Tag zurechtmachen mußten.
Roosevelts gleichgültige Reaktion auf die Tatsache, daß kein Senator vom Format eines Taft, kein Staatsanwalt von der Bissigkeit eines Dewey und kein Topanwalt von der Verschlagenheit und Attraktivität eines Wilkie gegen ihn antreten sollte, sondern bloß Lindbergh, machte den Menschen wieder Mut. Um vier Uhr morgens geweckt und über die neue Entwicklung in Kenntnis gesetzt, soll er, in seinem Bett im Weißen Haus sitzend, die prophetischen Worte gesprochen haben: »Wenn das hier vorbei ist, wird der junge Mann bereuen, daß er in die Politik gegangen ist – und daß er jemals fliegen gelernt hat.« Worauf er sofort wieder einschlief – so jedenfalls wollte es die Geschichte, die uns am nächsten Tag so großen Trost gewährte. Nachts auf der Straße, als die Leute nichts anderes als die Bedrohung zu sehen vermochten, die diese offenkundig ungerechte Brüskierung für unsere Sicherheit darstellte, hatten sie seltsamerweise nicht daran gedacht, welch einen mächtigen Beschützer gegen Unterdrückung sie in Roosevelt hatten. Die absolut überraschende Nominierung Lindberghs hatte in den Leuten ein atavistisches Gefühl der Schutzlosigkeit geweckt, das mehr mit Kischinew und den Pogromen von 1903 zu tun hatte als mit den Verhältnissen in New Jersey siebenunddreißig Jahre später, und so vergaßen sie in diesem Augenblick, was Roosevelt bereits alles für sie getan hatte: er hatte Felix Frankfurter an den Obersten Gerichtshof berufen, Henry Morgenthau zu seinem Finanzminister und den Bankier Bernard Baruch zu seinem persönlichen Berater gemacht; und dann gab es Mrs. Roosevelt und Ickes und den Landwirtschaftsminister Wallace, von denen man ebenso wie vom Präsidenten selbst wußte, daß sie Freunde der Juden waren. Es gab Roosevelt, und es gab die Verfassung der USA, es gab die Bill of Rights, und es gab die Zeitungen, die freie Presse Amerikas. Sogar die republikanische Newark Evening News erinnerte ihre Leser in einem Leitartikel an die Rede von Des Moines und äußerte unverhohlen Zweifel daran, ob es klug gewesen sei, Lindbergh zu nominieren; und PM, die neue linke New Yorker Boulevardzeitung, die nur fünf Cent kostete und die mein Vater seit einiger Zeit zusammen mit der Newark News von der Arbeit nach Hause brachte – und deren Motto lautete: »PM ist gegen alle, die andere herumstoßen« –, attackierte die Republikaner nicht nur in einem langatmigen Leitartikel, sondern auch in Artikeln und Kolumnen auf nahezu jeder ihrer zweiunddreißig Seiten, sogar im Sportteil, wo Tom Meany und Joe Cummiskey in ihren Kommentaren über Lindbergh herzogen. Auf der Titelseite brachte die Zeitung ein großes Foto von Lindberghs Naziorden, und in der Bildbeilage, die angeblich immer Fotos zeigte, die von anderen Zeitungen unterdrückt wurden – kontroverse Fotos von lynchenden Mobs und aneinandergeketteten Strafgefangenen, von keulenschwingenden Streikbrechern und unmenschlichen Bedingungen in amerikanischen Zuchthäusern –, gab es seitenweise Bilder von der Reise des republikanischen Kandidaten durch Nazideutschland 1938, die in einem ganzseitigen Foto gipfelten, das ihn, den berüchtigten Orden um den Hals, beim Händeschütteln mit Hermann Göring zeigt, dem zweithöchsten Naziführer nach Hitler.
Am Sonntag abend mußten wir bis zu Walter Winchells Auftritt um neun die Programme diverser Komiker über uns ergehen lassen. Als er dann schließlich kam und sagte, was wir uns von ihm erhofft hatten, und es auch so verächtlich sagte, wie wir es von ihm hatten hören wollen, brandete bei uns in der Gasse ein solcher Beifall auf, als säße der berühmte Journalist nicht in einem Rundfunkstudio auf der anderen Seite des Hudson, des breiten Grenzstroms, sondern hier bei uns, streitlustig in unserer Mitte, die Krawatte gelockert, den Kragen aufgeknöpft, den grauen Filzhut nach hinten geschoben: als zöge er am Küchentisch unseres Nachbarn, das Mikrofon auf dem Wachstuch, gegen Lindbergh vom Leder.
Es war der letzte Abend im Juni 1940. Nach einem heißen Tag war es so weit abgekühlt, daß man behaglich im Haus sitzen konnte, ohne zu schwitzen, aber als Winchell sich um Viertel nach neun von seinen Zuhörern verabschiedete, drängte es unsere Eltern, den schönen Abend mit uns im Freien zu genießen. Eigentlich wollten wir nur bis zur Ecke und wieder zurück – und dann wären mein Bruder und ich schlafen gegangen –, aber es war schon fast Mitternacht, als wir ins Bett kamen, und an Schlaf war da nicht mehr zu denken, so überwältigt waren wir Kinder von der Begeisterung unserer Eltern. Da Winchells furchtlose Kampfeslust auch alle unsere Nachbarn aus den Häusern getrieben hatte, endete, was für uns als fröhlicher kleiner Abendspaziergang begonnen hatte, als spontane Straßenparty für jedermann. Die Männer schleppten Liegestühle aus den Garagen und stellten sie in den Gassen auf, die Frauen brachten Krüge mit Limonade, die kleineren Kinder rannten ausgelassen von Haus zu Haus, die größeren saßen lachend und plaudernd ein wenig abseits, und das alles, weil Amerikas bekanntester Jude nach Albert Einstein diesem Lindbergh den Krieg erklärt hatte.
Immerhin war es Winchell, der in seiner Kolumne die berühmten drei Pünktchen zwischen den einzelnen, auf dürftigen Fakten beruhenden Sensationsmeldungen eingeführt und diese damit wie durch Zauberhand aufgewertet hatte, und es war Winchell, der so ziemlich als erster auf die Idee gekommen war, die leichtgläubigen Massen mit Schrotladungen anzüglichen Tratschs zu bombardieren – wodurch mancher Ruf ruiniert und manch Prominenter kompromittiert und manche Karriere im Showbusiness befördert oder beendet wurde. Seine Kolumne war die einzige, die in Hunderten von Zeitungen in ganz Amerika nachgedruckt wurde, und seine sonntagabendliche Viertelstunde war die beliebteste Nachrichtensendung des Landes: Winchells Stakkato und sein aggressiver Zynismus ließen jede Meldung als sensationelle Enthüllung erscheinen. Wir bewunderten ihn als furchtlosen Außenseiter und listigen Insider; er war mit J. Edgar Hoover, dem Chef des FBI, befreundet, hatte einen Gangster wie Frank Castello zum Nachbarn, gehörte zum engeren Kreis um Roosevelt und wurde manchmal sogar ins Weiße Haus eingeladen, um den Präsidenten bei einem Drink zu unterhalten – der ausgebuffte Straßenkämpfer und abgebrühte Lebemann, den seine Feinde fürchteten und der auf unserer Seite war. In Manhattan als Walter Winschel (alias Weinschel) geboren, arbeitete er sich vom New Yorker Vaudeville-Tänzer zum Broadway-Kolumnisten empor, der viel Geld damit verdiente, daß er die Leidenschaften der geschmacklosesten unter den neuen Käseblättern in Worte faßte, hatte jedoch seit dem Aufstieg Hitlers und lange bevor irgend jemand sonst in der Presse den Weitblick und die Wut besaß, sich mit ihnen anzulegen, die Faschisten und Antisemiten zu seinen Hauptfeinden erklärt. Er hatte für die Anhänger des Deutsch-Amerikanischen Bundes den Namen »Ratzis« erfunden und ihren Anführer Fritz Kuhn als ausländischen Spion verketzert, und jetzt – nach Roosevelts Scherz, nach dem Leitartikel der Newark News und der gründlichen Abreibung in PM – brauchte Walter Winchell seinen dreißig Millionen Hörern am Sonntag abend nur Lindberghs »nazifreundliche Haltung« zu erklären und Lindberghs Präsidentschaftskandidatur als die größte Bedrohung zu bezeichnen, die die amerikanische Demokratie jemals erlebt habe, und schon sahen die Familien in der kleinen Summit Avenue alle wieder aus wie Amerikaner, die sich der Vitalität und guten Laune einer behüteten, freien, beschützten Bürgerschaft erfreuten, statt wie entflohene Insassen eines Irrenhauses im Nachthemd auf die Straße zu stürzen.
Mein Bruder war in der ganzen Nachbarschaft dafür bekannt, daß er »alles« zeichnen konnte – ein Fahrrad, einen Baum, einen Hund, einen Stuhl, eine Comicfigur wie Li’l Abner –, aber in letzter Zeit galt sein Interesse echten Gesichtern. Ständig versammelten sich Kinder um ihn herum, wenn er nach der Schule mit seinem großen Spiralblock und seinem Druckbleistift irgendwo Aufstellung nahm, um Leute auf der Straße zu zeichnen. Und jedesmal ging das Geschrei der Zuschauer los: »Mal den, mal die, mal mich«, und Sandy folgte dieser Aufforderung, wenn auch nur, damit sie ihm nicht weiter in die Ohren schrien. Und während seine Hand vor sich hin arbeitete, wanderte sein Blick auf und ab, auf und ab – und siehe da, plötzlich begann der Betreffende auf dem Papier zu leben. Wie geht der Trick, fragten sie ihn, wie hast du das gemacht – als hätte er tatsächlich getrickst oder durchgepaust oder gar Zauberkräfte walten lassen. Sandys Antwort auf solche lästigen Fragen war ein Achselzucken, ein Lächeln: der Trick dabei war, daß er der stille, ernste, zurückhaltende Junge war, der er war. Daß er überall Aufmerksamkeit auf sich zog, indem er jedes gewünschte Porträt anfertigte, hatte scheinbar keine Auswirkung auf das sachliche Wesen, das seine Stärke ausmachte, die angeborene Bescheidenheit, die ihm zu seiner Zähigkeit verhalf und von der er später zu seinem eigenen Schaden Abstand nahm.
Zu Hause kopierte er nicht mehr Illustrationen aus Collier’s oder Fotos aus Look, sondern fertigte Studien nach einem Anatomielehrbuch für Künstler an. Das Buch hatte er bei einem Plakatwettbewerb für Schüler zum Arbor Day, zum Tag des Baumes, gewonnen; dazu gab es eine von der Parkverwaltung initiierte Baumpflanzungsaktion im ganzen Stadtgebiet. Es hatte sogar eine Feier gegeben, bei der ihm ein Mr. Bannwart, der Leiter der Abteilung für schattenspendende Bäume, die Hand geschüttelt hatte. Der Entwurf seines siegreichen Plakats basierte auf einer Briefmarke aus meiner Sammlung, einer 2-Cent-Marke zur Erinnerung an den sechzigsten Arbor Day. Die Marke schien mir besonders schön, weil dort an den schmalen senkrechten weißen Rändern jeweils ein schlanker Baum stand, dessen Äste sich oben zu einer Laube wölbten – und bis die Marke in meinen Besitz gelangte und ich sie mir unterm Vergrößerungsglas genauer ansehen konnte, war mir gar nicht bewußt gewesen, daß das englische Wort arbor nicht nur Baum, sondern auch Laube bedeutete. (Die kleine Lupe – zusammen mit einem Album für zweitausendfünfhundert Briefmarken, einer Briefmarkenpinzette, einem Perforationsmesser, gummierten Falzen und einer schwarzen Gummischale, mit deren Hilfe man Wasserzeichen besser erkennen konnte – war ein Geschenk meiner Eltern zu meinem siebten Geburtstag gewesen. Für weitere zehn Cent hatten sie mir auch ein kleines Buch von etwa neunzig Seiten gekauft, das Handbuch des Briefmarkensammlers, wo ich unter der Überschrift »Wie man eine Briefmarkensammlung anfängt« fasziniert den folgenden Satz gelesen hatte: »In alten Geschäftsunterlagen oder Privatkorrespondenzen finden sich häufig Briefmarken aus längst nicht mehr aufgelegten Serien, die von großem Wert sein können; wenn Sie also Freunde haben, die in alten Häusern wohnen und auf ihren Dachböden Material dieser Art gelagert haben, versuchen Sie an die alten frankierten Umschläge und Packpapiere heranzukommen.« Wir hatten keinen Dachboden, niemand von unseren Freunden, die in Mietwohnungen lebten, hatten Dachböden, aber unter den Dächern der Einfamilienhäuser in Union hatte es Dachböden gegeben – von meinem Platz hinten im Auto hatte ich, als wir an jenem schrecklichen Sonntag ein Jahr zuvor dort herumgefahren waren, die kleinen Dachbodenfenster an den Giebeln dieser Häuser gesehen, und daher konnte ich, als wir am Nachmittag nach Hause zurückkamen, an nichts anderes denken als an all die alten frankierten Umschläge und die Prägestempel auf den vorfrankierten Zeitungsversandhüllen, die auf diesen Dachböden lagern mußten, und daß ich jetzt keine Chance hätte, daran »heranzukommen«, weil ich ein Jude war.)
Noch größeren Reiz übte die Gedenkmarke zum Arbor Day auf mich aus, weil darauf nicht das Porträt irgendeiner berühmten Persönlichkeit oder irgendein bedeutendes Bauwerk abgebildet war, sondern eine menschliche Tätigkeit – eine Tätigkeit, die überdies von Kindern ausgeübt wurde: in der Mitte der Briefmarke sieht man einen Jungen und ein Mädchen, zehn oder elf Jahre alt, einen kleinen Baum pflanzen; der Junge gräbt mir einem Spaten, während das Mädchen den Baum, eine Hand an dem dünnen Stamm, über dem Loch festhält. Auf Sandys Plakat haben die beiden die Plätze getauscht, der Junge ist nicht mehr Linkshänder, sondern Rechtshänder, statt Kniehosen trägt er lange Hosen, und mit einem Fuß drückt er den Spaten in die Erde. Außerdem ist auf dem Plakat ein drittes Kind, ein Junge etwa in meinem Alter, der jetzt die Kniehosen anhat. Er steht seitlich hinter dem Schößling mit einer Gießkanne in der Hand – so wie ich in meiner besten Schulhose und Kniestrümpfen Sandy Modell gestanden hatte. Dieses zusätzliche Kind ging auf eine Anregung meiner Mutter zurück: erstens unterschied sich Sandys Werk so von dem Motiv der Arbor-Day-Marke – und war damit gegen den Vorwurf des »Plagiats« geschützt –, und zweitens verlieh es dem Plakat einen gesellschaftlichen Gehalt, indem es auf ein Thema hinwies, das 1940 keineswegs alltäglich war, weder auf Plakaten noch irgendwo anders, und das den Juroren aus Gründen des »guten Geschmacks« ohne weiteres als nicht akzeptabel hätte erscheinen können.
Das dritte Kind war nämlich ein Neger, und auf die Idee, daß er mit aufs Bild kommen sollte, war meine Mutter – abgesehen von dem Wunsch, ihren Kindern die bürgerliche Tugend der Toleranz beizubringen – durch eine andere Marke aus meiner Sammlung gebracht worden, eine brandneue 10-Cent-Marke aus der »Erzieher-Serie«, fünf Briefmarken, die ich für insgesamt einundzwanzig Cent auf der Post erworben und den ganzen März über von meinen wöchentlich fünf Cent Taschengeld abbezahlt hatte. Unter dem jeweiligen Porträt war auf jeder dieser Marken eine Lampe zu sehen, die von der amerikanischen Post als »Lampe des Wissens« bezeichnet wurde, für mich jedoch Aladins Lampe war, weil ich dabei an Tausendundeine Nacht denken mußte, an Aladin mit seiner Wunderlampe und dem Zauberring und den beiden Dschinns, die ihm jeden Wunsch erfüllten. Was ich selbst mir von einem Dschinn gewünscht hätte, waren die begehrtesten aller amerikanischen Briefmarken: erstens die berühmte 24-Cent-Luftpostmarke von 1918 mit dem spiegelbildlich verkehrt herum gedruckten Flugzeug, der Flying Jenny der Luftwaffe, die angeblich 3400 Dollar wert war; und dann die drei bekannten Marken, die zur Weltausstellung 1901 in Buffalo erschienen waren, ebenfalls seitenverkehrte Fehldrucke und jede einzelne über tausend Dollar wert.
Auf der grünen 1-Cent-Marke der Erzieher-Serie war oberhalb der Lampe des Wissens Horace Mann abgebildet; auf der roten 2-Cent-Marke Mark Hopkins; auf der violetten 3-Cent-Marke Charles W. Eliot; auf der blauen 4-Cent-Marke Frances E. Willard; auf der braunen 10-Cent-Marke Booker T. Washington, der erste Neger, der auf einer amerikanischen Briefmarke zu sehen war. Ich weiß noch, wie ich, nachdem ich Booker T. Washington in mein Album geklebt und meiner Mutter den jetzt vollständigen Satz gezeigt hatte, sie fragte: »Meinst du, es wird auch mal einen Juden auf einer Briefmarke geben?«, worauf sie antwortete: »Wahrscheinlich – eines Tages, ja. Hoffe ich jedenfalls.« Tatsächlich vergingen bis dahin noch sechsundzwanzig Jahre, und es mußte schon ein Einstein kommen, um das zu bewirken.
Sandy sparte seine fünfundzwanzig Cent Taschengeld – und die kleinen Beträge, die er fürs Schneeschaufeln, Laubharken und Waschen unseres Autos bekam –, und wenn er genug zusammenhatte, fuhr er mit dem Rad zu dem Schreibwarenladen in der Clinton Avenue, der auch Malereibedarf führte, und kaufte sich im Lauf der Monate zunächst einen Kohlestift, dann Sandpapier zum Spitzen des Stifts, dann Kohlepapier, dann das kleine Metallröhrchen, in das er blies, um den feinen Nebel aus Fixiermittel aufzutragen, damit die Kohle nicht verschmieren konnte. Er besaß große Bildhalteklemmen, ein Zeichenbrett, gelbe Ticonderoga-Stifte, Radiergummis, Skizzenblöcke, Entwurfspapier – Gerätschaften, die er in einem Lebensmittelkarton unten in unserem Kleiderschrank aufbewahrte und die meine Mutter, wenn sie saubermachte, nicht durcheinanderbringen durfte. Seine strenge Sorgfalt (von unserer Mutter geerbt) und seine atemberaubende Beharrlichkeit (von unserem Vater geerbt) dienten nur dazu, meine Ehrfurcht vor einem älteren Bruder zu steigern, der nach jedermanns Meinung zu Höherem berufen war, während die meisten Jungen in seinem Alter nicht einmal den Eindruck machten, als seien sie dazu berufen, mit anderen Menschen an einem Tisch zu essen. Ich war damals das gute Kind, zu Hause und in der Schule gehorsam – mein Eigensinn noch großenteils brachliegend, der aggressive Ausbruch sollte erst später kommen –, alles in allem noch zu jung, um das Potential meiner eigenen Wut erkennen zu können. Und nirgends war ich nachgiebiger als ihm gegenüber.
Zu seinem zwölften Geburtstag hatte Sandy ein großes, flaches schwarzes Portfolio aus fester Pappe und mit Stoffrücken bekommen, das am oberen Rand zwei Bänder hatte, die er mit einer Schleife zuband, um die darin liegenden Blätter zu sichern. Das Portfolio maß etwa sechzig mal fünfundvierzig Zentimeter und war zu groß für die Schubladen in unserer Kommode, und es paßte auch nicht aufrecht in den vollgestopften Kleiderschrank, den wir uns teilten. Er durfte es – zusammen mit den Skizzenblöcken – unter seinem Bett aufbewahren, und er hob darin die Zeichnungen auf, die er für seine besten hielt, angefangen mit seinem kompositorischen Meisterwerk von 1936, dem ehrgeizigen Bild, auf dem unsere Mutter auf die nach Paris fliegende Spirit of St. Louis in den Himmel zeigt. Sandy besaß mehrere große Porträts des Luftfahrthelden, sowohl Bleistift- als auch Kohlezeichnungen, und auch die lagerten in seinem Portfolio. Sie gehörten zu einer Serie prominenter Amerikaner, die er zusammenstellte und die sich vornehmlich auf jene lebenden Persönlichkeiten konzentrierte, die von unseren Eltern am meisten verehrt wurden, zum Beispiel Präsident Roosevelt und seine Frau, der New Yorker Bürgermeister Fiorello La Guardia, John L. Lewis, der Vorsitzende der United Mine Workers, und die Schriftstellerin Pearl Buck, die 1938 den Nobelpreis bekommen hatte und deren Bildnis er vom Umschlag eines ihrer Bestseller abmalte. Einige Zeichnungen in dem Portfolio stellten Familienmitglieder dar, und von diesen zeigten mindestens die Hälfte unsere Großmutter väterlicherseits, die als einzige von unseren Großeltern noch lebte und sonntags, wenn mein Onkel Monty sie zu uns zu Besuch brachte, Sandy manchmal Modell saß. Unterm Diktat des Wörtchens »ehrwürdig« zeichnete er getreulich jede Runzel in ihrem Gesicht und jeden Knoten an ihren arthritischen Fingern, während sie, unsere kleine, aber zähe Großmutter – so pflichtbewußt, wie sie ihr Leben lang Fußböden geschrubbt und das Essen für eine neunköpfige Familie auf einem Kohleherd zubereitet hatte – in der Küche saß und »posierte«.
Als wir beide, wenige Tage nach der Winchell-Sendung, einmal allein im Haus waren, zog Sandy das Portfolio unter seinem Bett hervor und trug es ins Eßzimmer. Dort legte er es auf den Tisch (an dem sonst nur der Boss bewirtet oder besondere Familienfeiern abgehalten wurden), klappte es auf, nahm vorsichtig die Lindbergh-Porträts von den jeweils zum Schutz dazwischengelegten Bögen Transparentpapiers und legte sie nebeneinander auf der Tischplatte aus. Auf dem ersten trug Lindbergh seine lederne Fliegermütze, deren lose Riemen ihm über die Ohren hingen; auf dem zweiten verschwand die Mütze halb hinter der großen, schweren Fliegerbrille, die er sich in die Stirn hochgeschoben hatte; auf dem dritten war er barhäuptig, nur sein unbeugsam in die Ferne gerichteter Blick kennzeichnete ihn als Piloten. Den Wert dieses Mannes zu ermessen, wie Sandy ihn dargestellt hatte, war nicht schwierig. Ein männlicher Held. Ein mutiger Abenteurer. Ein Naturbursche von gigantischer Kraft und Rechtschaffenheit, gepaart mit enormer Milde. Alles andere als ein furchterregender Schurke oder eine Bedrohung für die Menschheit.
»Er wird Präsident«, sagte Sandy. »Alvin sagt, Lindbergh gewinnt die Wahl.«
Das verwirrte und erschreckte mich so sehr, daß ich so tat, als habe er einen Scherz gemacht, und lachte.
»Alvin will nach Kanada und in die kanadische Armee eintreten«, sagte er. »Er will an der Seite der Briten gegen Hitler kämpfen.«
»Aber Roosevelt ist doch nicht zu schlagen«, sagte ich.
»Von Lindbergh schon. Amerika wird faschistisch.«
Dann standen wir bloß da, gebannt und eingeschüchtert von den drei Porträts. Nie zuvor war es mir als solcher Nachteil erschienen, sieben Jahre alt zu sein.
»Erzähl keinem, daß ich die habe«, sagte er.
»Aber Mom und Dad haben sie doch schon gesehen«, sagte ich. »Alle haben sie gesehen. Alle.«
»Ich hab ihnen erzählt, ich hätte sie zerrissen.«
Einen ehrlicheren Menschen als meinen Bruder gab es nicht. Er war nicht still, weil er geheimnistuerisch oder hinterhältig war, sondern weil er niemals schlimme Sachen anstellte und daher nie etwas zu verbergen hatte. Jetzt aber hatte etwas von außerhalb den Sinn dieser Zeichnungen verändert, sie zu etwas gemacht, was sie gar nicht waren, und deshalb hatte er unseren Eltern erzählt, er habe sie zerrissen, und das hatte ihn zu etwas gemacht, was er gar nicht war.
»Und wenn sie sie finden?« sagte ich.
»Wie denn?« fragte er.
»Weiß nicht.«
»Siehst du«, sagte er. »Du weißt es nicht. Halt nur deine kleine Klappe, dann findet niemand was.«
Ich fügte mich seinem Wunsch aus verschiedenen Gründen, unter anderem wegen der drittältesten amerikanischen Briefmarke in meinem Album – die ich unmöglich zerreißen und wegwerfen konnte –, einer 10-Cent-Luftpostmarke von 1927 zum Gedenken an Lindberghs Transatlantikflug. Die Marke war blau und mehr als doppelt so breit wie hoch, und ihr Hauptmotiv, die Spirit of St. Louis auf ihrem Flug über den Ozean, hatte Sandy das Vorbild für das Flugzeug auf der Zeichnung zur Verherrlichung seiner Empfängnis geliefert. Am linken Rand der Briefmarke sieht man die Küstenlinie von Nordamerika, der Name »New York« ragt in den Atlantik hinein; am rechten Rand die Küstenlinien von Irland, Großbritannien und Frankreich, das Wort »Paris« am Ende eines gepunkteten Bogens, der die Flugroute zwischen den beiden Städten markiert. Am oberen Rand, unmittelbar unter den fetten weißen Buchstaben UNITED STATES POSTAGE, steht LINDBERGH – AIR MAIL in etwas kleinerer Type, aber mit Sicherheit noch groß genug, daß ein mit guten Augen ausgestatteter Siebenjähriger es lesen kann. Die Marke wurde in Scotts Standard Postage Stamp Catalogue bereits mit zwanzig Cent bewertet, und ich erkannte sofort, ihr Wert würde noch weiter ansteigen (und zwar so schnell, daß sie bald das Wertvollste wäre, was ich besaß), wenn Alvin recht hatte und es zum Schlimmsten kam.
In den langen Ferienmonaten spielten wir auf dem Bürgersteig ein neues Spiel; es hieß »Ich erkläre Krieg«, und man brauchte dazu einen billigen Gummiball und ein Stück Kreide. Mit der Kreide zog man einen Kreis von ungefähr anderthalb Metern Durchmesser, teilte ihn in so viele Tortenstücke wie Spieler auf und schrieb in jedes den Namen eines der fremden Länder, die in diesem Jahr ständig in den Nachrichten genannt wurden. Als nächstes wählte jeder Spieler »sein« Land und stellte sich so hin, daß er mit einem Fuß innerhalb und mit einem Fuß außerhalb des Kreises stand, damit er, wenn es soweit war, möglichst schnell fliehen konnte. Unterdessen hielt ein zuvor bestimmter Spieler den Ball hoch in die Luft und sprach langsam und mit drohendem Tonfall die Worte: »Ich – erkläre – Krieg – dem – Land –« Und erst nach einer spannungsgeladenen Pause schleuderte er den Ball zu Boden und schrie dabei »Deutschland!« oder »Japan!« oder »Holland!« oder »Italien!« oder »Belgien!« oder »England!« oder »China!« – manchmal sogar »Amerika!« –, und alle rannten weg, außer dem einen, dem der Überraschungsangriff gegolten hatte. Der mußte den hochspringenden Ball möglichst schnell auffangen und »Halt!« rufen. Alle anderen, die sich gegen ihn verbündet hatten, erstarrten darauf mitten in der Bewegung, und der Vertreter des überfallenen Landes ging zum Gegenangriff über und versuchte die Aggressoren einen nach dem anderen auszuschalten, indem er so fest er konnte mit dem Ball nach ihnen warf, zuerst nach denen in seiner Nähe, um sodann mit jedem mörderischen Wurf weiter vorzurücken.
Wir spielten dieses Spiel unaufhörlich. Bis es regnete und die Namen der Länder zeitweilig fortgespült wurden, mußten die Leute entweder darauf treten oder darüber hinwegsteigen, wenn sie durch unsere Straße kamen. In unserem Viertel gab es damals sonst keine nennenswerten Graffiti, nur dieses eine, die Reste der Hieroglyphen unserer schlichten Straßenspiele. Ziemlich harmlos, und dennoch brachte es einige Mütter auf die Palme, die unser Geschrei stundenlang durch die offenen Fenster mit anhören mußten. »Könnt ihr nicht was anderes machen? Könnt ihr nicht ein anderes Spiel finden?« Aber das konnten wir eben nicht – Krieg erklären, das war alles, woran auch wir nur denken konnten.
Am 18. Juli 1940 wurde FDR von den Demokraten auf ihrem Parteitag in Chicago schon im ersten Wahlgang mit überwältigender Mehrheit für eine dritte Amtszeit nominiert. Wir hörten seine Dankesrede im Radio; er sprach mit jener Souveränität, die für die Angehörigen der Oberschicht typisch ist und die nun seit fast acht Jahren Millionen gewöhnlicher Familien wie der unseren Mut gemacht hatte, in diesen elenden Zeiten die Hoffnung nicht aufzugeben. Sein Vortrag strahlte einen Anstand aus, der, so fremd er uns war, nicht nur unsere Ängste beschwichtigte, sondern unserer Familie eine geradezu historische Bedeutung verlieh, unser Leben von höchster Stelle mit dem seinen und mit dem der ganzen Nation verband, als er uns in unserem Wohnzimmer als seine »Mitbürger« ansprach. Daß Amerikaner Lindbergh wählen könnten – daß Amerikaner irgend jemanden