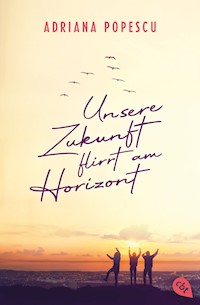7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf dem Weg nach Berlin bleibt die Reisebuchlektorin Pippa am Stuttgarter Flughafen hängen – und das ausgerechnet über die Feiertage! In der überfüllten Wartehalle lernt sie den ebenfalls gestrandeten Lukas aus Hamburg kennen, und schon bald erwärmt sein frecher Charme ihr chronisch gebrochenes Herz. Dann passiert es: Bevor Pippa es verhindern kann, hat sie sich versehentlich verliebt. Doch wohin geht die Reise für die beiden? Heute noch? Oder erst morgen? Denn der nächste Abflug kommt bestimmt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Paps, weil du auch ohne Superman-Cape mein Held bist
und bleibst – immer
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen überarbeiteten und erweiterten Taschenbuchausgabe
1. Auflage 2014
ISBN 978-3-492-96816-4
© Piper Verlag GmbH, München 2014 Covermotiv: Mediabureau Di Stefano, Berlin, unter Verwendung der Abbildungen von plainpicture/Imagesource, Harishmarnad/Dreamstime, Victor Watts/Alamy, Bayberry/123 RF, Hadel Productions/iStockphoto Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Prolog
Zuerst warte ich noch auf das Klingeln meines Weckers. Oder den Signalton meines Handys. Auf irgendein Geräusch, das mich aus dem Schlaf und diesem grausamen Albtraum reißt. Aber der Weckruf bleibt aus, mein Handy liegt stumm auf meinem Schreibtisch eine Bürotür weiter und ich stehe noch immer wie versteinert im Eingang des Kopierraums und kann meinen Augen nicht trauen. Die Blätter in meiner Hand fühlen sich unglaublich schwer an, als könnte ich sie kaum zwischen den Fingern halten.
Benny sieht mich überrascht über die Schulter hinweg an. Seine Haare sind leicht zerzaust, seine Hose ist um seine Fußgelenke gerutscht und ich sehe, wie blass seine Haut im grellen Neonröhrenlicht wirkt. Sein blanker Hintern erinnert an eine Schale mit Frischkäse. Um diese Blässe schlingen sich zwei wunderbar gebräunte und wahrscheinlich epilierte Frauenbeine, die selbst jetzt, an einem kalten Dezemberabend, sonniges Karibikfeeling verbreiten. Hinter Bennys Schulter taucht das rotwangige Gesicht von Theresa, der Schlampe aus der Kartografie, auf.
»Pippa! Wie bist du hier reingekommen?«
»Durch die Tür. Soll ich es noch mal vorführen?«
Meine Stimme klingt fremd in meinen Ohren, aber es muss meine sein, denn ich spüre, wie sich meine Lippen bewegen.
»Kannst du nicht anklopfen?«
Nicht anklopfen? Wer klopft denn bitte an, bevor er den Kopierraum betritt? Ich arbeite jetzt seit über zwei Jahren in dieser Redaktion und noch nie habe ich angeklopft. Gut, bisher habe ich hier auch noch nie ein Pärchen beim Geschlechtsverkehr erwischt und ganz sicher habe ich meinen Freund noch nie beim Geschlechtsverkehr mit der Schlampe aus der Kartografie erwischt. Benny, mein Freund und Theresas Geliebter, wie es scheint, hält es noch immer nicht für nötig, etwas zu sagen. Also sage ich etwas.
»Vergiss nicht, die Brennpaste für das Fondue heute Abend zu kaufen.«
Dann gehe ich.
Benny hat die Brennpaste nicht gekauft, aber sein ganzes Zeug abgeholt. Vier Mal musste er die Treppen rauf und runter, weil sich in den vier Jahren, die unsere Beziehung gehalten hat, eben unglaublich viel Müll ansammelt: CDs, DVDs, seine Skiausrüstung, die jedes Jahr auf dem Feldberg im Schwarzwald zum Einsatz kam, seine Stereoanlage und natürlich die vollautomatische Kaffeemaschine, die den weltbesten Cappuccino macht.
Alles nimmt er mit, weil er einfach nicht sagen könne, wann und ob er jemals wieder einziehen wolle. Die ganze Zeit habe ich dabei zugesehen, wie der Mann, der mich eigentlich irgendwann in der Zukunft vielleicht hätte heiraten können, immer mehr Erinnerungen an uns aus der Wohnung schleppt. Er wisse selber nicht so recht, was los sei, aber wir würden irgendwie nicht mehr funktionieren und er brauche diese Pause wirklich. Nicht von der Frauenwelt, nur von mir.
Selbst nach wiederholtem und sehr angestrengtem Nachdenken habe ich noch immer keine Antwort auf die Frage, wann wir uns verloren oder – wie es immer so schön formuliert wird – entliebt haben.
Also bekam Benny seine Pause. In dieser Pause tat Theresa dann weiterhin das, was sie, wie ich später erfahren habe, schon das letzte halbe Jahr getan hatte: seine Spielwiese für sexuelle Abenteuer sein und ihren Hintern auf dem Kopierer platt drücken. Natürlich habe ich anfangs nichts gesagt, denn ich war mir noch sicher, dass Benny jeden Moment wieder bei mir auf der Matte stehen würde. Heißt es nicht »Was man liebt, muss man loslassen, damit es von alleine zu einem zurückkommt«?
Bei Benny hat das allerdings nicht ganz so gut funktioniert. Zu Weihnachten habe ich mir gewünscht, dass er zu mir zurückkommt, auch an Silvester und Ostern. Zu meinem Geburtstag im August habe ich es mir übrigens noch immer gewünscht und zu Nikolaus. Vielleicht sollte ich es dieses Weihnachten endlich mal mit einem einfacheren Wunsch versuchen: einem fliegenden Pony.
Schnee, so weit das Auge reicht. Als hätte sich die Stadt eine weiße Daunendecke über den Kopf gezogen. Nur die Lichter, die wie Sterne in den Abend hineinfunkeln, lassen darauf schließen, dass dieser Teil der Welt noch bevölkert ist.
I’m dreaming of a white Christmas … Schön und gut, aber ich heiße nicht Bing Crosby und träume auch nicht von weißen Weihnachten. Ich träume ohnehin sehr selten und wenn, dann kann ich mich kaum an den Traum und die wirren Zusammenhänge erinnern. Eigentlich nie. Selbst als meine beste Freundin mir einen Traumfänger aus ihrem USA-Urlaub mitgebracht hat, stellte sich keine Besserung ein. Können wir traumlosen Schläfer uns also nicht von solchen Songs distanzieren?
Ich gebe es in der Öffentlichkeit zwar nicht zu, aber ich bin eher so ein »Last Christmas«-Typ. Ich denke lieber an letztes Jahr zurück und wundere mich darüber, welchen Typen ich da im Vollsuff geküsst habe, weil mir klar wurde, dass Benny nicht unter dem Weihnachtsbaum liegen würde. Ich trinke nämlich genauso selten wie ich träume, also fast nie. Deswegen fiel mir die Einschätzung auch ungemein schwer, wie viel von dem Cuba Libre wohl zu viel sein würde. Das ist, als ob man mich fragt: »Schätze doch mal, wie alt ich bin.« Da habe ich eine Trefferquote von 100Prozent – und zwar für eine Blamage! Manche Partner meiner engsten Freundinnen haben schon wochenlang kein Wort mehr mit mir gesprochen, weil die vorsichtige Antwort »42?« ungefähr zwölf Jahre am richtigen Ergebnis vorbeiging. Ich kann auch Entfernungen nicht besonders gut schätzen. Das erklärt, wieso ich mich bei den Bundesjugendspielen um mindestens zwei Ehrenurkunden betrogen fühle. »Das müssen einfach mehr als 15Meter gewesen sein.« Von meinem Standpunkt aus flog der Ball damals mindestens 30Meter weit! Würde ich jetzt mal schätzen.
Aber ausgerechnet jetzt, da ich schätze, dass ich heute keine große Chance mehr auf einen Flieger nach Berlin habe, ausgerechnet jetzt, da meine gesamte Familie dort auf mich und meine Geschenke wartet, scheint sich das Blatt zu wenden und ich werde zu einer grandiosen Schätzerin. Vielen Dank auch, liebes Schicksal. Manchmal wünschte ich wirklich, mein Schicksalsbeauftragter hätte eine E-Mail-Adresse, damit ich meine Beschwerden direkt an ihn senden könnte. Wieso schätze ich meinen Kontostand am Ende des Monats nie richtig ein? Dann muss ich wieder das Notfall-Sparschwein plündern, um dem Sushi-Lieferanten den Betrag bar auszuzahlen, weil mein Konto mal wieder überzogen ist. Ich schätze, mein Schicksalsbeauftragter macht das einfach gerne mit mir. Vermutlich wollte er mal Drehbuchautor für eine mittelmäßige deutsche Soap werden – und jetzt tobt er sich eben in meinem Leben aus. Schönen Dank!
Als meine Mutter mir vor zwei Monaten eröffnet hat, dass sogar mein Bruder wieder mit seiner Frau – ich nenne sie liebevoll »das Tier« – nach Berlin kommen würde, habe ich mir nichts sehnlicher gewünscht, als an Weihnachten einfach krank im Bett zu liegen und eine geniale Ausrede für meine Absage zu haben, aber man gewöhnt sich ja schließlich an alles, sogar an die hoch ansteckende Weihnachtsstimmung überall. Startschuss sind dabei die ersten Nikoläuse und Lebkuchen in den Supermärkten so kurz nach Ostern. Außerdem kommt mit dem Duft nach frisch gefallenem Schnee, süßem Glühwein und heißen Maroni auch die Erinnerung an das Highlight jedes Weihnachtsabends zurück: der Rehbraten meiner Mutter, das beste Festessen der Welt. So habe ich mich irgendwann also doch mit dem Gedanken abgefunden, neben der Frau mit der Figur eines Profiboxers zu sitzen und mir derbe Witze samt fester Schläge auf den Rücken antun zu müssen – und zwar immer dann, wenn sie einen ihrer Witze übermäßig gut findet. Also immer. Was aber viel schlimmer ist: Ganz nebenbei verschwindet auch noch der Löwenanteil des guten Rehbratens, den meine Mutter mit viel Liebe zubereitet hat, auf ihrem Teller. Vor einigen Jahren wusste sie nicht einmal, dass man Rehe essen kann, und zeigte ernsthaft beunruhigende Wissenslücken im Fachbereich Biologie auf: »Rehe …«, ich zitiere sie hier wörtlich, »… das sind doch diese Pferde mit Geweih«. Der niedliche Versuch meines Bruders, es am Beispiel von Bambi etwas zu verdeutlichen, scheiterte kläglich.
Wie dem auch sei, jetzt stehe ich jedenfalls am Weihnachtsnachmittag hier auf dem Stuttgarter Flughafen und wünsche mir nichts sehnlicher, als bei meiner Familie zu sein. Aber daraus wird wohl nichts. Könnte ich jetzt vielleicht doch lieber die Telefonnummer meines Schicksalsbeauftragten haben? Dem würde ich nämlich mal meine Meinung ins Ohr schreien und dann um einiges entspannter wieder auflegen. Wobei … Bei meinem Glück würde ich stattdessen wahrscheinlich über eine Dreiviertelstunde in der Warteschleife und bei Musik von Helene Fischer hängen bleiben.
Ich hatte schon ein mieses Gefühl, als mein Chef vor zwei Wochen in mein Büro gestürmt kam und mir mitteilte, dass ich diesmal die Delegation aus China zu einer Stadtrundfahrt durch Stuttgart begrüßen dürfe. Freiburg wäre ja noch okay gewesen, aber nein, da die Verlagszentrale in Stuttgart sitzt, wurde die ganze Aktion in die Landeshauptstadt verlegt. Ich kenne mich in Stuttgart nicht besonders gut aus, aber den Weihnachtsmarkt am Schlossplatz würde sogar ich finden.
»Pippa, es wird Zeit, Ihnen endlich mehr zuzutrauen!«
Pippa, das bin ich: Philippa Wunsch, neunundzwanzig Jahre alt, Redakteurin für Reiseführer. Ich arbeite seit vier Jahren für die deutsche Zweigstelle einer chinesischen Verlagsgruppe und noch nie durfte ich irgendeine Aufgabe übernehmen, die den Besuch von unseren Arbeitgebern betraf. Für gewöhnlich wurde mein Kollege Hannes geschickt, der kein Wort Chinesisch spricht und dessen Englisch in etwa so gut ist wie mein Schätzvermögen. Ich nehme an, ich habe mich klar ausgedrückt. Dafür hat Hannes seit einem halben Jahr eine neue Freundin und die ist, wie sollte es auch anders sein, die Liebe seines Lebens. Dieses Weihnachten feiern sie in der Sonne, an einem weißen Strand mit kristallklarem Wasser und einem exotischen Cocktail direkt aus einer Kokosnuss.
»Alle anderen haben ja Familie oder Partner«, fuhr mein Chef fort, als er von mir keine spontanen Widerworte zu hören bekam. »Die können an Weihnachten nicht weg, aber ich dachte, Sie als Single machen das bestimmt gerne.«
Er musste mich ja nicht bei jeder Gelegenheit an meinen Familienstand – ledig – erinnern, ich wusste auch so, dass Benny nicht mehr da war. Also bin ich, die auserwählte »Single-Dame ohne feste Bindung, Kinder oder Haustiere«, mit dem Zug von Freiburg nach Stuttgart gefahren, wo ich die Herrschaften aus Fernost zwei Tage lang durch die liebevoll geschmückte Schwabenmetropole geleitete und dabei viel Lob und sogar Anerkennung abbekam.
Während die chinesischen Anzugträger allerdings schon heute Morgen abgereist sind und inzwischen sicherlich bereits in London die Weihnachtsmärkte unsicher machen, sitze ich hier in Stuttgart fest, seit Stunden, und die Flocken vor den großen Glasfenstern werden immer größer und dicker. So sieht es also aus, wenn Frau Holle mal zeigt, was sie so kann. Offenbar hat sie heute einen extrem großzügigen Tag, was Schneeflocken angeht, denn nichts geht mehr, zumindest wird das hier gemunkelt, und auch meine Frage, ob ich vielleicht mit dem Zug nach Freiburg in meine kuschelige Einzimmerwohnung kommen könnte, wurde von einer unfreundlichen Dame am Flugschalter mit dieser Auskunft beantwortet: »Auf den Schienen sieht es noch schlimmer aus.«
Also sitze ich hier auf meiner Reisetasche in der Wartehalle, weil Bing Crosby einer überambitionierten Frau Holle die Flausen in den Kopf gesetzt hat, dass wir alle von weißen Weihnachten träumen und es daher an einem Tag wie diesem schneien muss. Wenn ich ein paar ungestörte Minuten mit Frau Holle hätte, würde ich gerne mal ein paar Worte mit ihr wechseln. So von Single-Frau zu Single-Frau. Bei einem Glas Glühwein würde ich sie dann davon überzeugen, dass es Zeit wird, in Rente zu gehen oder uns ausgerechnet an den Reisetagen um Weihnachten herum eine kleine Pause gönnen könnte. Denn mal ehrlich: Schneeweiße Weihnachten sind doch vollkommen überbewertet. Die Leute in wärmeren Gefilden können doch auch sehr gut darauf verzichten. Wie viele Menschen wohl auf den Kontinenten der südlichen Hemisphäre leben? Ich schätze mal, so … Nein, besser nicht, aber es sind bestimmt viele und die feiern alle am Strand in kurzen Hosen und mit einem kühlen Bier in der Hand. Wie um alles in der Welt kann dann ein Song über Schnee an Weihnachten ein Welthit werden?
Wenigstens teile ich das tragische Schicksal, hier für eine hoffentlich sehr kleine Weile festzusitzen, mit einer ganzen Menge anderer Menschen. Zahllose Gestrandete bevölkern die Wartehalle, fluchen und schimpfen, ebenso wie ich. Hektisch ziehen Familien von einem Schalter zum nächsten, Kinder weinen, Paare streiten sich, Manager versuchen die Flugbegleiterinnen abzuchecken. Fast alles wie immer, wäre da nicht die weiße Daunendecke, die uns alle am Weiterkommen hindert.
Ich sitze ruhig auf meiner großen Reisetasche, während mein Blick auf die Anzeigetafel über unseren Köpfen geheftet ist, aber es verändert sich nichts. Noch gebe ich allerdings die Hoffnung auf ein kleines Weihnachtswunder nicht auf. Selten habe ich mir so sehr gewünscht, ein Jedi-Ritter zu sein. Für alle, die mich jetzt auslachen wollen, sei gesagt: In Neuseeland haben sich 70000 Menschen zum Jediismus bekannt. Dort ist es inzwischen als Religion anerkannt. Ha! Da könnte die Macht jetzt doch auch mit mir sein. Konzentriert starre ich auf die Anzeigetafel und versuche, mit der Macht meiner Gedanken einen baldigen Abflug meiner Maschine nach Berlin zu erzwingen. Aus dem ärgerlichen »Flug gestrichen. Flight cancelled« müsste nur eine Flugzeit werden. Ich zwinge die Fallblätter der Anzeigetafel, sich meinem Willen zu beugen. Mit aller Kraft und Macht. Ohne Erfolg. Spitze. Da braucht man einmal die Hilfe einer fiktiven Science-Fiction-Kraft und wird im Stich gelassen. Nur Obi-Wan Kenobi kann mich jetzt noch retten, denn die Dame hinter dem Schalter ist ganz sicher kein Jedi. Sie war recht deutlich, als sie sagte, im Moment sähe es schlecht aus, später könnten aber vielleicht noch einige Flüge rausgehen. Meinen hat sie dabei nicht genannt. Ich solle mich gedulden. So lange hier nichts passiert, könne ich mir ja irgendwo ein Brötchen und einen Kaffee holen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir beides herzaubern kann, ist – vor allem nach meinem gescheiterten Jedi-Experiment – gering. Denn es gibt da ein kleines, beziehungsweise ein sehr schweres Problem. Ich bin eine Frau. Auf Reisen. Ja, wir Frauen packen eben nun mal zu viel ein. Viel zu viel, um genau zu sein, und irgendwie habe ich es mir – ohne es wirklich zu merken – zur Aufgabe gemacht, die Reißfestigkeit dieser schönen großen Reisetasche einer anerkannten Sportfirma zu testen. Bis zum Limit. Beim Versuch, die Tasche über meine Schulter zu wuchten und erhobenen Hauptes zu gehen, nachdem die Dame am Schalter all meine Hoffnungen auf ein Fest im Kreise meiner Familie zunichtegemacht hat, habe ich einen Teil meiner Mission erfüllt und den Verlust des Tragegurts bedauern müssen. Nach den Feiertagen werde ich ein Beschwerdeschreiben an besagte Firma schicken. Wer denkt sich schon eine Tasche mit nur einem Tragegurt aus?
Wenn ich jetzt also aufstehen und diese Tasche mit mir nehmen will, brauche ich einen starken Mann oder einen Gepäckwagen – oder beides. Fälschlicherweise habe ich, als ich am Flughafen angekommen bin, noch angenommen, dieses Jahr wäre mir zum Abschied freundlich gesinnt. Deswegen habe ich auf einen Gepäckwagen verzichtet und bin direkt zum Flugschalter gegangen, wo ich meine schwere Reisetasche loswerden wollte. Ich habe ja nicht ahnen können, dass daraus nichts werden würde und dass sich außerdem die Tragebeziehung zwischen der Tasche und mir so sehr intensiviert. Beim darauf folgenden Versuch, doch noch einen Gepäckwagen zu bekommen, habe ich dann schnell festgestellt, dass es sich auf diesem Flughafen offensichtlich um ein sehr begehrtes Objekt handelt. Alle waren vergriffen – fast so schnell wie die Tickets zur letzten Stadion-Tour von Take That mit Robbie Williams. Woher sollte ich auch wissen, dass ich so viel Zeit hier verbringen würde? Und mich dabei auch noch bewegen muss! Jetzt habe ich jedenfalls eine überpackte Reisetasche ohne Träger, keinen Gepäckwagen und das dringende Bedürfnis nach einem Erfrischungsgetränk und etwas Süßem.
Wieso packen wir Frauen nur so viel ein? Klar, Sie wissen schon, man weiß ja nie, was passieren wird – deswegen ist es immer besser, für alle möglichen und unmöglichen Zwischenfälle Massen an Klamotten in der Tasche zu haben. Aber ich habe es übertrieben. Ich gebe es zu. In solchen Momenten wie jetzt wünsche ich mir nichts mehr, als nur einen Kulturbeutel tragen zu müssen. So wie die Männer. Was packen die schon groß ein? Zwei Unterhosen – wenn wir Glück haben! – und eine Zahnbürste. Klar, sie sehen in den Klamotten von gestern ja auch am Tag darauf noch unverschämt sexy aus, denken sie, während es bei uns Frauen schon fast als Hygienemangel angesehen wird, wenn wir am nächsten Tag den gleichen Lippenstift auftragen wollen.
Während ich auf meiner viel zu großen Reisetasche festsitze und finster vor mich hin starre, sammelt sich langsam, aber sicher immer mehr Wut in meinem Bauch. Mein Schicksalsbeauftragter hat Glück, dass er jetzt nicht vor mir steht. Was hat er sich nur dabei gedacht, den heutigen Tag auf mich loszulassen? Erwartet er für dieses Drama eine Emmy-Nominierung?
Mein Tag hat heute um fünf Uhr morgens angefangen. Das ist die Zeit, zu der ich mich für gewöhnlich gerade mal von der einen auf die andere Seite drehe, wenn ich mich überhaupt bewege. Mein Frühstück bestand aus einem »Coffee to go«, den ich aus Versehen fast zu einem »Coffee on the floor« gemacht hätte, weil ich etwas zu spät dran war und meine Bahn zum Flughafen noch erwischen musste. Rennen an sich gehört schon nicht zu meinen liebsten körperlichen Betätigungen, Rennen mit einer viel zu schweren Reisetasche über der Schulter und einem heißen Kaffee in der Hand ist ungefähr so, als würde man Usain Bolt eines der Weather Girls auf den Rücken schnallen und dann sagen: »So, brich jetzt mal den Weltrekord, mein Guter.« Das Ergebnis des bisherigen Tages? Ich sitze hier fest, hungrig und einsam, zwischen gestrandeten Fluggästen, und ich muss meinen Eltern gleich noch sagen, dass sie mein Zimmer in Berlin an meinen Bruder und das Tier vergeben können. Während alle den Pferd-mit-Geweih-Braten meiner Mutter genießen dürfen, werde ich in Stuttgart sein – alleine. Wieso? Weil es immer noch schneit.
Ich hasse Weihnachten.
Ich sitze da und beobachte, wie sich die Wartehalle langsam füllt und die Gesichtsausdrücke der anderen hier Gestrandeten immer verzweifelter werden. Es ist fast schon tröstend zu sehen, dass ich in so einem Moment nicht alleine bin. Aber warum drücken sie sich alle zeitgleich vor den wenigen Telefonzellen herum? Das Bild der aufgebrachten Menschen, die sich mir gegenüber um die kleinen Zellen drängeln, in der Hoffnung, den gnadenlosen Kampf um die Hörer zu gewinnen, erinnert mich an eine Schlachtenszene aus Spartacus. Allerdings mit weniger Blut. Im Zeitalter der iPhones sollte man doch annehmen, dass Telefonzellen ausgestorben sind und höchstens noch den Kids der 90er-Jahre ein Begriff sein dürften. Also jemandem wie mir. Ich wühle jedenfalls lieber kurz in meiner dicken Jacke und ziehe mein iPhone aus der Tasche. Ja, liebe Leute, auch wenn ich in den 80er-Jahren geboren bin, kann ich dennoch ein Touchscreen-Handy bedienen. Fast ein bisschen überheblich und mit großer Geste beginne ich, die Nummer meiner Eltern zu wählen … Was? Kein Empfang? Das muss ein schlechter Scherz sein. Aber dann begreife ich plötzlich, warum all diese Menschen, die wahrscheinlich ebenfalls über ein Smartphone verfügen, hier sind – und nicht ihr zigarettenpäckchengroßes Handy ans Ohr halten.
Ich stehe seufzend auf, nehme meine Tasche am Gurt, denn der Träger hat sich an einer Seite der Tasche tapfer festgehalten, und ziehe sie mit aller Kraft hinter mir her, während ich auf die wartende Menschentraube zugehe, um mich einzureihen. Immerhin muss ich meine Mutter anrufen.
Ich warte jetzt schon seit zehn Minuten und bin noch keinen Schritt weitergekommen. Warum dauert das so lange? Will sich denn keiner bei Telefonaten mit der Verwandtschaft an Weihnachten kurz halten? Sonst haben wir es doch auch immer so irre eilig.
»Verzeihung.«
Ein junger Kerl mit Hut schiebt sich an mir vorbei und rempelt mich dabei an. Ja, bin ich denn in den letzten paar Sekunden plötzlich unsichtbar geworden? Ich sehe ihm wütend hinterher, während er einfach langsam weitergeht. So ein … junger Mann, der eine federleicht aussehende Sporttasche auf einem Gepäckwagen vor sich her schiebt. Hey, dieser Wagen sollte mir gehören! Mir und meiner kaputten Riesenreisetasche! Nicht diesem Kerl … mit dem ganz süßen Hintern, wie mir gerade auffällt. Doch er schlendert einfach weiter. Da erst wird mir bewusst, dass er eine braune Feincordjacke mit falschem Fell am Kragen trägt. Mein Kryptonit, denn sofort werden Erinnerungen an meinen Jugendschwarm wach: Jordan Catalano, gespielt von Jared Leto, in der unverwechselbaren TV-Serie »Willkommen im Leben«. Zugegeben, Jordan war nicht der Hellste, trug die Haare meist etwas zu lang und wirkte immer leicht abwesend, aber er hatte strahlend blaue Augen und irgendetwas an sich, das bei mir schwere Herzrhythmusstörungen verursachte. Wie gefesselt saß ich vor dem Fernseher und habe mit der weiblichen Hauptfigur Angela Chase gelitten, gelacht und geweint, als ihr Schwarm, der wunderbare Jordan, lieber mit ihrer besten Freundin ins Bett gestiegen ist. Es war brutal. Aber daraus habe ich fürs Leben gelernt: Männer wie dieser Jordan sind die Falschen, trotzdem verlieben wir Frauen uns immer wieder in sie, als ob wir vergessen hätten, wie weh es beim letzten Mal getan hat. Männer in Cordjacken mit falschem Fell – das aussieht, als hätte ein Teddybär dafür sein Leben lassen müssen – sind gefährlich.
Da bleibt der Gepäckwagen-Kerl plötzlich stehen und sucht etwas in seiner Jackentasche. Vermutlich sein superschickes iPhone. Hat ihm noch niemand gesagt, dass wir hier alle keinen Empfang haben? Doch statt eines Handys wühlt er ein kleines Plastikfläschen hervor, nimmt die Brille ab und – nein! O nein. Das ist nur eine Fata Morgana. Es ist nur Einbildung. Muss an der Unterzuckerung liegen. Doch auch das schnelle Blinzeln verändert das Bild, das ich gerade sehe, kein Stück. Der Cordjacken-Gepäckwagen-Catalano-Verschnitt hebt das kleine Fläschchen übers Gesicht und tröpfelt sich … Augentropfen … ins Auge. Spinn ich denn? Das hat Jordan Catalano in der Serie auch immer getan und ich war mit meinen vierzehn Jahren der festen Überzeugung, es wäre mit Abstand das Sexyste, was Jungs auf einem Schulflur tun können. Okay, jetzt bin ich älter und reifer und stehe auf keinen Schulfluren mehr herum und … finde es trotzdem nicht minder sexy. Unterzuckerung! Ohne Zweifel! Da ich außer Warten aber nichts anderes zu tun habe, betrachte ich den Kerl mal etwas genauer. Seine Jeans wird von einem Gürtel über der Hüfte gehalten. Ein Glück: Er ist also wenigstens keiner dieser Spinner, die meinen, mit einer Extraportion Coolness ausgestattet zu sein, weil sie ihre spindeldürren Beine in Skinnyjeans quetschen. Er trägt seine Jeans mit einer natürlichen Coolness, außerdem einen schwarzen Hut, wie ihn viele »Kreative« dieser Tage tragen. So einer ist er also: Marke »Hipster«. Bestimmt macht er irgendwas mit Medien, hat über fünftausend Freunde bei Facebook und einen beliebten Vlog auf YouTube. Die meisten meiner Freundinnen würden für einen Typen wie ihn alles stehen und liegen lassen. Aber ich habe höhere Ziele als seine dämliche Telefonnummer. Ich! Will! Diesen! Gepäckwagen!
Kurz spiele ich mit dem Gedanken, ihn mit meiner Reisetasche k. o. zu schlagen, um dann mit seinem Gepäckwagen Fahrerflucht zu begehen – aber abgesehen davon, dass ich meine Tasche keine zwei Meter tragen, geschweige denn irgendwohin schleudern könnte, tut sich plötzlich etwas an den Telefonzellen und die äußerste Menschenschlange, an deren bitterem Ende ich mich befinde, macht ein paar große Schritte nach vorne. Sehr gut. Ich stehe jetzt viel näher an den Telefonzellen und bin plötzlich von vier Familien umgeben, von denen einige so aussehen, als hätte ich sie schon mal in einer RTL2-Reality-Show gesehen, aber ich verkneife mir die Nachfrage und betrachte lieber das Exemplar direkt vor mir. Eine Großfamilie. Fünf Kinder, eine wohlbeleibte Mutter und ein dürrer Vater, der sich hinter einem Laternenpfahl verstecken könnte. Die Kinder sehen aus wie die perfekte Mischung der beiden. Von wem sie das Benehmen haben, kann ich allerdings nicht auf Anhieb sagen. Einer der beiden dürren Jungs tritt dem einen dicken Mädchen ans Schienbein. Es schreit auf und aus Solidarität schreit das andere gleich mit. Die Mutter packt den Jungen, der Vater packt das Mädchen und beide werden möglichst weit voneinander weggezogen, so als wären sie im Ring und müssten in getrennte Ecken. Ruhiger wird es deswegen nicht, ganz im Gegenteil. Jetzt schreit auch der ganz kleine dicke Junge – und in unterschiedlichen Stimmlagen, aber in der gleichen Lautstärke, höre ich Sprüche wie: »Er hat angefangen!«, »Sie hat mich zuerst getreten!« und »Seid jetzt still, sonst setzt es was!«
Einige der Menschen drehen sich nur kurz zu uns und schütteln die Köpfe. Wie? Was? Denken die etwa, ich gehöre dazu? Unauffällig mache ich einen kleinen Schritt zur Seite und nehme Abstand von dem schreienden Grüppchen. Sofort wird diese Aktion mit einem wütenden Blick der Mutter quittiert. Wie kann die erwachsene Tochter es wagen, sich jetzt von ihrer Familie zu distanzieren? Ich trete lieber wieder näher an sie heran, weil ich genau weiß: Wenn ich jetzt etwas sage, dann »setzt es was«. Bing Crosby sollte mir jetzt wirklich nicht über den Weg laufen …
Was ist das? Ein Mann in einem schwarzen Mantel schiebt sich aus der Zelle direkt rechts vor mir und hält mir lächelnd die Tür auf. Mir. Nicht der Familie, die noch immer damit beschäftigt ist, die beiden Ringkämpfer voneinander fernzuhalten. Ohne lang nachzudenken, husche ich an ihm vorbei ins Innere, überlasse meine schwere Reisetasche kurz dem Schicksal und ziehe die Tür so schnell zu, als wäre sie aus Panzerglas und könnte mich selbst vor der wütenden Attacke einer Zombie-Horde schützen. Dann schenke ich dem Mann im Mantel noch einen dankbaren Blick durch die Scheibe. Er nickt mir grinsend zurück und schultert seine Laptop-Tasche, als würde sie nichts wiegen. Unmöglich kann er alles, was er braucht, in dieser Tasche unterbringen. Ha. Jetzt erklärt sich auch der schwarze Mantel. Er muss ein Zauberer sein, auf der Durchreise nach Las Vegas, denn ohne Magie kann ich mir das nicht erklären. Er ist leider ein bisschen zu alt, sonst hätte ich ihn zu einem Kaffee eingeladen … Da sehe ich es und zucke kurz zusammen. Die dicke Mutter wirft mir – ihrer neuen Ziehtochter – einen vernichtenden Blick zu, aber ich drehe mich schnell weg und wühle meinen Geldbeutel aus meiner Handtasche, in der ich ohne Probleme eine ganze Flüchtlingsfamilie durch die Sicherheitskontrolle schmuggeln könnte.
Wie gut, dass ich ab und zu auf meine Mutter – also meine richtige Mutter – höre und mein Kleingeld zusammenhalte. Das führt natürlich dazu, dass mein Geldbeutel so schwer wird, dass er als Waffe durchgehen könnte, aber wenigstens habe ich jetzt ausreichend Münzen, um ein Telefonat mit meiner Familie zu führen. Bisher habe ich nicht verstanden, wieso meine Mutter immer der Meinung war, es würde nicht schaden, wenn ich stets ein bisschen Geld für die Telefonzelle dabeihätte – jetzt verstehe ich es.
Als Kind der 80er-Jahre weiß ich, wie man Münztelefone benutzt, und werfe einige Euromünzen in den dafür vorgesehenen Schlitz. Ich wähle die Nummer meiner Eltern in Berlin und warte, während der kleine, dicke Junge der Großfamilie seine Nase gegen die Scheibe meiner Telefonzelle drückt – dabei verteilt er eine ordentliche Portion Rotz auf der Scheibe. O Bing, gnade dir Gott!
Schon nach dem dritten Klingeln nimmt meine Mutter ab und ich kann den weinerlichen Unterton in meiner Stimme nicht verbergen. Am liebsten würde ich heulen, aber ich bringe die Worte tapfer und ganz ohne Tränen über die Lippen.
»Mama? Ich bin noch in Stuttgart.«
»Wer ist da?«
»Pippa. Deine Tochter.«
Ich frage mich, wie oft Frauen bei meiner Mutter anrufen und sie »Mama« nennen. Soweit ich weiß, gibt es außer mir und meinem Bruder, der zwar längere Haare, aber dafür eine tiefere Stimme hat als ich, keine weiteren Kinder.
»Ah, Pippa. Wie geht es dir? Wo bist du?«
Lassen Sie sich nicht täuschen, die Verbindung ist hervorragend, aber vermutlich löst meine Mutter, während ich einen panischen Anruf voller Verzweiflung tätige, eines dieser Sudoku-Rätsel. Oder ein Kreuzworträtsel. Oder sie liest Videotext. Meine Mutter ist ein Paradebeispiel für Multitasking. Nur leider hört sie dann nicht mehr zu.
Ich verdrehe einen Moment die Augen und sehe dann, wie der Junge der Großfamilie die Zunge an das Glas der Telefonzelle drückt. Nett. Das gibt bestimmt eine hübsche Entzündung der Mundschleimhaut.
»Ich bin noch in Stuttgart und ich habe hier keinen Empfang, also stehe ich in einer Telefonzelle. Es schneit, ich komme nicht weg.«
»Ja, in Berlin schneit es auch.«
Wunderbar. Das ist besonders aufmunternd. Meine Mutter ist ein wahres Motivationstalent.
»Tja. Ich weiß nicht, wann es hier weitergeht.«
»Um sieben gibt es Essen.«
»Deshalb rufe ich ja an.«
»Dein Bruder ist schon da.«
Spitze. Der kann ja auch zu Fuß zu meinen Eltern laufen oder den Wagen nehmen und muss nicht seine Flugangst mit grenzlegalen Medikamenten in den Griff kriegen, um über den Wolken dank einer Panikattacke nicht eine Stewardess zu Boden zu reißen.
»Mama, alle Flüge wurden gestrichen.«
Die Pause auf diesen von mir höchst dramatisch vorgetragenen Satz dauert mir etwas zu lange.
»Mama?«
»Ja, sag mal, ein Wort mit sechs Buchstaben. Einschlafmittel. Zweiter Buchstabe ein V. Hast du eine Ahnung?«
»Mama, ich sitze in Stuttgart fest. Könntest du das Kreuzworträtsel mal eben zur Seite legen?«
»Sicher, natürlich. Also, wann kommst du? Sollen wir auf dich warten?«
Ja, das sollen sie, mich vermissen sollen sie auch und Dinge sagen wie »Weihnachten ohne Pippa? Nein, das ist einfach nicht das Gleiche«. Okay, es würde schon reichen, wenn sie mir eine Portion Braten zur Seite legen. Obwohl er aufgewärmt nicht mehr so gut schmeckt. Kann man Weihnachten nicht verschieben? Wäre die Queen krank, würde ganz England nicht feiern, oder? Okay, ich bin gerade nur eine Drama-Queen, aber zählt das nicht auch ein bisschen?
»Mama, ich glaube echt nicht, dass ich das schaffe.«
»Aber, dann sehen wir uns ja gar nicht.«
Jetzt klingt sie doch etwas geknickt und es tut beinahe gut zu hören, wie ihre Stimme für einen kurzen Moment zumindest einen gewissen Unmut annimmt.
»Hast du gelesen, dass dieser Justin Bieber wieder ein neues Tattoo will?«
»Mama. Liest du Videotext?!«
Ertapptes Schweigen. Ha! Hab ich’s doch gewusst!
»Pippa, egal wann du hier ankommst, wir erwarten dich mit offenen Armen. Ich lege dir ein bisschen Essen in den Kühlschrank.«