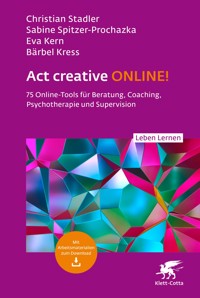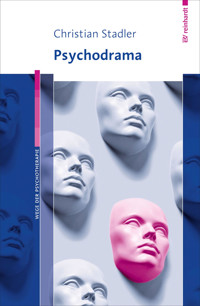31,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Leben Lernen
- Sprache: Deutsch
Der Einfluss psychischer Störungen auf das Familiensystem - Das Buch geht auf alle relevanten Störungen sowohl auf Seiten der Eltern als auch auf der der Kinder ein - Mit Informationen zu Hilfsangeboten für betroffene Familien »Etwas ist seltsam bei uns, aber ich kann nicht genau sagen, was ...«, so beschreiben sowohl Eltern als auch Kinder häufig die Beziehungsqualität, die vorherrscht, wenn ein oder beide Elternteile an einer psychischen Störung leiden. Oft entwickeln dann auch die Kinder dieser Familien eine krankheitswertig Symptomatik. Das Buch geht auf alle relevanten Störungsformen ein und beleuchtet in Praxisbeispielen sowohl die Sicht der Eltern als auch die der Kinder und Jugendlichen auf den familiären Alltag. Konsequent anwendungsbezogen zeigen die Autoren, wie die therapeutische Arbeit ein tieferes Verständnis der Familienmitglieder füreinander fördert und damit das Zusammenleben und die Lebensqualität aller verbessert. Ein besonderes Augenmerk liegt auf Themen der transgenerationalen Weitergabe von Belastungen. Schließlich möchte das Buch auch dafür sensibilisieren, dass gerade im System Familie die Zusammenarbeit mit anderen Helfersystemen zum Erfolg führen kann. Dieses Buch richtet sich an: BeraterInnen und TherapeutInnen, die mit Kindern, Familien und allgemein mit Menschen, die an einer psychischen Störung leiden, arbeiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Christian Stadler, Andrea Meents
Verstörende Beziehungen
Psychische Erkrankungen in Familien
Klett-Cotta
Zu diesem Buch
»Etwas ist seltsam bei uns, aber ich kann nicht genau sagen, was …«, so beschreiben sowohl Eltern als auch Kinder häufig die Beziehungsqualität, die vorherrscht, wenn ein oder beide Elternteile an einer psychischen Störung leiden. Oft entwickeln dann auch die Kinder dieser Familien eine krankheitswertige Symptomatik. Das Buch geht auf alle relevanten Störungsformen ein und beleuchtet in Praxisbeispielen sowohl die Sicht der Eltern als auch die der Kinder und Jugendlichen auf den familiären Alltag. Konsequent anwendungsbezogen zeigen die Autor*innen, wie die therapeutische Arbeit ein tieferes Verständnis der Familienmitglieder füreinander fördert und damit das Zusammenleben und die Lebensqualität aller verbessert. Ein besonderes Augenmerk liegt auf Themen der transgenerationalen Weitergabe von Belastungen. Schließlich möchte das Buch auch dafür sensibilisieren, dass gerade im System Familie die Zusammenarbeit mit anderen Helfersystemen zum Erfolg führen kann.
Die Reihe »Leben Lernen« stellt auf wissenschaftlicher Grundlage Ansätze und Erfahrungen moderner Psychotherapien und Beratungsformen vor; sie wendet sich an die Fachleute aus den helfenden Berufen, an psychologisch Interessierte und an alle nach Lösung ihrer Probleme Suchenden.
Alle Bücher aus der Reihe ›Leben Lernen‹ finden Sie unter: www.klett-cotta.de/lebenlernen
Impressum
Leben Lernen 325
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2021 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Jutta Herden
unter Verwendung einer Abbildung von © iStock/eli_asenova
Gesetzt von Eberl & Kœsel Studio GmbH, Altusried-Krugzell
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-89263-5
E-Book: ISBN 978-3-608-11691-5
PDF-E-Book: ISBN 978-3-608-20525-1
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1
Einleitung
Kapitel 2
Störung und psychische Krankheit in Familien
2.1 Abhängigkeit und substanzgebundene Sucht
Reflexion der Rollen
2.2 Strukturelle oder Persönlichkeitsstörungen
Reflexion der Rollen
2.3 Depression
Reflexion der Rollen
2.4 Schizophrenie
Reflexion der Rollen
2.5 Angst
Reflexion der Rollen
2.6 Posttraumatische Belastungsstörung
Reflexion der Rollen
Kapitel 3
Kindliche Entwicklung, Bedürfnisse und Bindung und ihr Einfluss auf Verhalten und Gefühle
3.1 Psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen
3.2 Risikofaktoren für Kinder psychisch kranker Eltern
3.3 Normale Entwicklung über die Lebensspanne: Was verstehen wir darunter?
Das Konzept der psychosozialen Krise von Erikson
3.4 Bindungserfahrungen und ihre Bedeutung für die Lebensspanne
Bindung – der Kreis der Sicherheit
Bindungsentwicklung und -verhalten der ersten Lebensmonate
Bindungsverhalten im Kleinkindalter
Bindungsverhalten im Schulalter
Bindungsverhalten in der Adoleszenz
3.5 Das konsistenztheoretische Modell: Grundbedürfnisse des Menschen
3.6 Abnorme psychosoziale Einflüsse in der Eltern-Kind-Beziehung als Risikofaktor für die Entstehung psychischer Störungen beim Kind
Abnorme intrafamiliäre Beziehungen
Psychische Störung, abweichendes Verhalten oder Behinderung in der Familie
Abnorme Erziehungsbedingungen
Kapitel 4
Internalisierende Störungen von Kindern und Jugendlichen mit psychisch kranken Eltern
4.1 Einleitung: Internalisierende und externalisierende Störungen
4.2 Internalisierende Störungen von Kindern und Jugendlichen mit psychisch kranken Eltern
4.3 Depressive Störungen
Theoretischer Hintergrund: Depressionen bei Kindern und Jugendlichen
Analyse der Familiensituation unter dem Blickwinkel der Entwicklungsstufen
Analyse der Familiensituation unter dem Blickwinkel der Grundbedürfnisse
Vorhandene abnorme psychosoziale Einflüsse auf die Eltern-Kind-Beziehung
Zusammenfassung des Hilfebedarfs und der Interventionen für die Familie mit Fokus auf das Kind
4.4 Emotionale Störung des Kindesalters und Enuresis nocturna
Theoretischer Hintergrund
Analyse der Familiensituation unter dem Blickwinkel der Entwicklungsstufen
Analyse der Familiensituation unter dem Blickwinkel der Grundbedürfnisse
Vorhandene abnorme psychosoziale Einflüsse auf die Eltern-Kind-Beziehung
Zusammenfassung des Hilfebedarfs und der Interventionen für die Familie mit dem Fokus auf das Kind
Kapitel 5
Externalisierende Störungen von Kindern und Jugendlichen mit psychisch kranken Eltern
5.1 Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens
Theoretischer Hintergrund
Analyse der Familiensituation unter dem Blickwinkel der Entwicklungsstufen
Analyse der Familiensituation unter dem Blickwinkel der Grundbedürfnisse
Vorhandene abnorme psychosoziale Einflüsse auf die Eltern-Kind-Beziehung
Zusammenfassung des Hilfebedarfs und der Interventionen für die Familie mit Fokus auf das Kind
5.2 Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen
Theoretischer Hintergrund
Analyse der Familiensituation unter dem Blickwinkel der Entwicklungsstufen
Analyse der Familiensituation unter dem Blickwinkel der Grundbedürfnisse
Vorhandene abnorme psychosoziale Einflüsse auf die Eltern-Kind-Beziehung
Zusammenfassung des Hilfebedarfs und der Interventionen für die Familie mit Fokus auf das Kind
5.3 Schlussbetrachtung über psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit psychisch kranken Eltern
Kapitel 6
Dysfunktionale Eltern-Kind-Beziehungen
6.1 Beziehungsqualität, Interaktion und Affektregulation
6.2 Vernachlässigung und Mangelerfahrung
6.3 Emotionaler und körperlicher Missbrauch
6.4 Parentifizierung
6.5 Mangelnde haltgebende Funktion von Eltern
6.6 Mangelndes Erziehungsverhalten der Eltern
Kapitel 7
Hilfen und Maßnahmen für Familienmitglieder
7.1 Stationäre Einrichtungen
Stationäre Einrichtungen für betroffene Erwachsene
Akutpsychiatrie und stationäre Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
7.2 Tageskliniken
7.3 Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Familien
7.4 Beratungsstellen für psychische Gesundheit
7.5 Beratungsstellen für Trennung, Scheidung und Familienmediation
7.6 Maßnahmen bei Kindeswohlgefährdung und zum Kinderschutz
Koordinierender Kinderschutz und Frühe Hilfen
Jugendamt
Stationäre Kinder- und Jugendschutzstellen
Kurzzeitpflege für Kinder und Jugendliche
Einrichtungen für Kinder, Jugendliche oder Mütter mit Kindern
Familienpflege/Vollzeitpflege
7.7 Praxen für Psychiatrie und Pädiatrie
Niedergelassene Psychiater*innen für Erwachsene
Niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiater*innen
Sozialpädiatrische Zentren oder Praxen
7.8 Ambulante Psychotherapie
Praxen für Psychotherapie für Erwachsene
Ambulante Psychotherapie für Kinder und Jugendliche
7.9 Selbsthilfegruppen
7.10 Angehörigengruppen
Kapitel 8
Die Mehrgenerationenperspektive auf Familiendynamiken mit psychisch kranken Angehörigen
Kapitel 9
Resilienter Verarbeitungsstil: Mit der inneren Widerstandskraft den Anforderungen des Lebens entgegentreten
9.1 Was ist Resilienz?
9.2 Resiliente Kinder und Jugendliche: Schutzfaktoren
9.3 Förderung von Resilienz durch Eltern, Lehrer*innen und Erzieher*innen
Kapitel 10
Hilfeangebote
10.1 Hilfe für Betroffene
10.2 Bücher und Filme
Themenbezogene Fachbücher
Themenbezogene Bücher für Kinder und Jugendliche und Eltern
Diagnostik von Familienbeziehungen
Romane
Psychologische Kinderbücher
Filme
Literatur
Vorwort
Wer therapeutisch mit Kindern und Jugendlichen, ihren Eltern sowie den ganzen Familien arbeitet, weiß, dass die wenigsten Störungsbilder, die innerhalb von Familien auftreten, ohne einen Blick auf die häufig komplexen familiendynamischen Zusammenhänge verstanden werden können.
Familiäre Verflechtungen können sowohl Ursache auftretender Symptome als auch aufrechterhaltende Faktoren sein. Sie können Wirkort der hauptsächlichen Symptombelastung bei Kindern und Jugendlichen und zugleich Ressource zur Überwindung noch unbewältigter Entwicklungsaufgaben sein. Sie machen den Kontext verstehbar, in den eine psychische Erkrankung eingebettet ist, und sie sind in vielen Fällen der Schlüssel zur Auflösung der Symptomatik. Eine erfolgreiche Therapie gelingt bei Kindern und Jugendlichen selten ohne eine intensive Eltern- und Familienarbeit. Bei den Eltern stößt man wiederum nicht selten auf weitere psychische Belastungen auf Eltern- oder Geschwisterebene, die wiederum verwoben sind mit solchen darüber liegender Generationen.
Gerade frühe Bindungserfahrungen mit den primären Bezugspersonen und deren Fähigkeit, die Gefühle und Bedürfnisse des Säuglings oder Kleinkinds feinfühlig wahrzunehmen, zu halten, zurückzuspiegeln und v. a. angemessen auf sie einzugehen, haben aus dem heutigen entwicklungspsychologischen Verständnis heraus einen eklatanten Einfluss auf die gesamte weitere Entwicklung eines Kindes. Der Umgang von Eltern mit Entwicklungsaufgaben, insbesondere Ablösungsprozessen (z. B. Trennungssituationen bei Kindergarten- und Schulbesuch), trägt wesentlich dazu bei, ob es Kindern – auch noch im Erwachsenenalter – gelingt, diese zu meistern. Die physische und psychische Anwesenheit von beiden Elternteilen spielt in der Regel eine tragende Rolle. Insbesondere physisch abwesende Väter haben in den vergangenen Jahrzehnten eine zentrale Rolle in vielen Familienkonstellationen eingenommen. Und auch eigene psychische Belastungen von Elternteilen, welche diese daran hindern können, für ihre Kinder emotional erreichbar zu sein und in unterstützender und wertschätzender Weise Anteil an ihrer Entwicklung zu nehmen, spielen im therapeutischen Alltag mit belasteten Kindern und Jugendlichen immer wieder eine bedeutsame Rolle.
Die Interaktion der Kinder mit den Eltern ist es, die es ihnen ermöglicht, grundlegende Fähigkeiten in den Bereichen Bindungsverhalten, Emotionsregulation, Impulssteuerung und soziale Kommunikation zu entwickeln. Die hier gelernten Muster können als Schablone für späteres Verhalten in anderen sozialen Kontexten (Kindergarten, Schule, Freundschaften) verstanden werden und sich letztlich dort als problematisch erweisen.
Insbesondere die in den letzten Jahrzehnten zunehmend besser verstandene transgenerationale Weitergabe von Bindungsverhalten sowie der Umgang mit Konflikten und familieneigenen Themen (z. B. Traumatisierungen oder psychischen Erkrankungen in der Familie) lässt erahnen, wie hartnäckig sich familiäre Muster über Generationen hinweg halten und wie therapeutische Lösungsversuche an diesen unsichtbaren übergeordneten Themen scheitern können.
Dieses Buch gibt auf besondere Art und Weise Einblick in alle diese bedeutsamen Dimensionen der therapeutischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Eltern sowie den gesamten Familien. Es beschreibt praxisnah und zugleich theoretisch fundiert, feinfühlig und detailliert anhand von zahlreichen Beispielen, welche Auswirkungen familiäre Bindungs-, Affektregulations- und Kommunikationsmuster, insbesondere im Kontext psychischer Erkrankungen der Eltern, auf die Symptomatik und den Therapieerfolg in der Arbeit mit Patient*innen in der Kindergeneration haben. Und es zeigt auf, wie fein verwoben die einzelnen Ebenen miteinander sind und wie ihre Einbeziehung zu einem nachhaltigen therapeutischen Gelingen beitragen kann. Das Buch will nicht anklagen oder beschuldigen, sondern auf die Komplexität und Interdependenz familialer Systeme beim Thema psychischer Erkrankung aufmerksam machen. Es will sensibilisieren und Impulse geben statt mit dem Finger auf Familienmitglieder zu zeigen. Denn: unter der Situation leiden alle.
Jana Escher
Wiesbaden, im Juni 2021
Kapitel 1
Einleitung
»Etwas ist seltsam mit unserer Familie, aber ich kann nicht genau sagen, was …« So beschreiben sowohl Eltern als auch Kinder häufig die Beziehungsqualität, die vorherrscht, wenn ein oder beide Elternteile an einer psychischen Erkrankung oder Störung leiden. Es entsteht häufig eine lebenslange Bindung von beiden Seiten, die sich aber meist nicht gut anfühlt und kaum regulieren, geschweige denn angemessen weiterentwickeln oder lösen lässt. Betroffene Kinder fühlen sich ihren Eltern(teilen) verpflichtet, können sich nicht gut abgrenzen und erleben sich auch noch im Erwachsenenalter defizitär, weil sie aus einer dysfunktionalen Familie stammen. Betroffene Elternteile werden neben ihren psychischen Schwierigkeiten oder Störungen durch Scham- und Schuldgefühle umgetrieben, können aus Angst meist schwer Hilfe für ihre Familie und Kinder annehmen und lassen ihre Kinder selbst im Erwachsenenalter nicht gerne ihrer Wege ziehen. Aus diesen und anderen Gründen treten betroffene Familien erst dann mit dem Helfersystem in Kontakt, wenn die Not schon sehr groß ist und es zum Beispiel um Fremdunterbringung von Kindern geht. Auch die angehörigen Elternteile erleben sich zwischen den Stühlen, verhalten sich zum Teil co-abhängig und versuchen, die Defizite des betroffenen Elternteils zu kompensieren, im ungünstigen Fall wenden sie sich vom »Problem« ab. Die bekannte US-amerikanische Familienserie Taras Welten (2009) gibt einen Einblick in die täglichen Kämpfe, die eine Familie mit einer Mutter, die an einer dissoziativen Identitätsstörung leidet, zu durchlaufen hat. Manchmal gelingt ein offener, situationsadäquater und sogar humorvoller Umgang, manchmal ist die Belastung für das Gesamtsystem enorm hoch.
Das ökologische Modell von Bronfenbrenner (1981) zeigt, wie eine psychische Störung in einen Gesamtkontext eingebettet ist (Abbildung 1). Danach müssen die Auswirkungen von Störungen und Erkrankungen eines oder beider Elternteile immer eingebettet in einen Gesamtkontext betrachtet werden.
Abbildung 1: Störungen im ökologischen Kontext (nach Bronfenbrenner 1981)
Wir wollen in diesem Buch aus dem ökologischen Modell einen Ausschnitt herausgreifen, nämlich die Frage, welchen Einfluss eine psychische Störung innerhalb des Systems Mehrgenerationenfamilie auf das System der Gegenwartsfamilie und besonders auf die Kinder ausübt (Abbildung 2). Dies kann selbstverständlich nicht pauschal beschrieben werden, sondern ist abhängig von den jeweiligen Störungen und auch von den Persönlichkeitsmerkmalen der betroffenen Menschen sowie von deren Netzwerken, Netzwerkqualitäten und Ressourcen.
Abbildung 2: Störung, Familie und Mehrgenerationenperspektive
In der klinischen familienpsychologischen Literatur werden vier Risikofaktoren für die psychische Gesundheit von Kindern in Familien genannt (Bodenmann 2016, S. 25):
psychische Störungen der Eltern,
elterliche Sensitivität,
elterliches Erziehungsverhalten,
Partnerschaftsstörungen.
All diese Faktoren haben einen Einfluss auf die gesunde Entwicklung der Kinder, manche direkt, andere indirekt. Alle sind aber streng genommen nicht voneinander zu trennen, sie beeinflussen sich jeweils wechselseitig. Bodenmann (2016) zeigt dies beispielsweise für den Zusammenhang von Partnerschaft und Wohlbefinden beziehungsweise psychischer Störung. Liegen deutliche Partnerschaftsstörungen vor, haben sie einen wesentlichen Einfluss auf das Wohlbefinden der Kinder.
Partnerschaftsstörungen können zu mangelnder Sensitivität der Eltern führen, aber sie beeinflussen in aller Regel auch das Erziehungsverhalten. Kinder, die Zeugen elterlicher Auseinandersetzungen geworden sind, können durch diese Situationen direkt traumatisiert werden. Indirekt sind die Kinder betroffen, da eine bidirektionale Wechselwirkung von Partnerschaftsqualität und psychischer Störung vorliegt.
Auch das Konzept der »We-Disease« (Kayser et al. 2007) betont den Aspekt, dass eine schwere Krankheit oder psychische Störung eines Partners einen deutlichen Einfluss auf beide PartnerInnen hat (Interdependenz). Es liegt nahe, den Begriff der We-Disease auf das gesamte Familiensystem auszuweiten; eine psychische Störung eines Elternteils hat einen Einfluss auf alle in der Familie, nicht nur auf das Elternpaar. Dabei geht es nicht um Schuldzuweisungen, sondern vielmehr darum, ein Verständnis für die »zirkuläre Kausalität« (von Schlippe & Schweitzer 2007, S. 90) zu erzeugen. Das Modell geht davon aus, dass Teile eines Systems wechselseitig aufeinander einwirken.
Allgemein gibt es zahlreiche Stressoren für die psychische Stabilität und Gesundheit von Kindern. Dazu gehören:
Umzüge,
schwere Störung oder Erkrankung eines Elternteils oder beider Eltern (somatisch und psychisch),
Tod eines Elternteils,
Behinderung eines Elternteils,
Arbeitslosigkeit eines Elternteils,
Inhaftierung eines Elternteils,
Migration eines Elternteils.
Innerhalb der Familien wirken sich nicht nur Störungen auf die Kinder aus, dort werden selbstverständlich auch viele Ressourcen erworben.
Das Thema negativen elterlichen Einflusses auf die psychische Stabilität und Gesundheit der Kinder kam auf, als psychisch auffällige oder kranke Kinder und deren familiäre Lebenssituationen untersucht wurden. Bevor die »Familienbrille« aufgesetzt wurde, gerieten in der Denktradition der frühen Freud’schen Psychoanalyse vor allem die Mütter in den Blick, denen eine Schuld an den Störungen ihrer Kinder zugewiesen wurde. Die schizophrenogene Mutter (Fromm-Reichmann 1948; s. Kapitel 2) befreite die psychischen Erkrankungen, vor allem die Schizophrenie, zwar aus den deterministischen Fesseln der Biologie und der Unbehandelbarkeit, aber sie stand noch ganz in der Tradition der Suche nach Schuldigen.
Winnicotts Ansatz der good enough mother (2002) nahm zwar etwas Druck von den Schultern der Mütter, blieb aber immer noch auf sie als zentrale Personen fixiert. Die Mütter mussten nun nicht mehr perfekt sein, damit ihre Kinder gut gediehen, sondern nur noch gut genug. Auch die aus der frühen systemischen Familienpsychologie abgeleitete Double-Bind-Hypothese1 (Bateson et al. 1956) schwächte die psychiatrischen Biologismen; Krankheit wurde verstehbar und blieb nicht länger nur genetisches Schicksal, die Verantwortung aber wurde den Eltern, und auch hier besonders den Müttern, zugewiesen. Wird in einer Familie falsch kommuniziert, wird das Kind krank. Ein logischer weiterer Schritt war die Sicht auf das Kind als »Indexpatient« aus der Systemtheorie: Nicht das Kind ist krank, sondern das System Familie, aber das Kind zeigt dem System seine Schwachstelle. Mittlerweile haben sich sowohl das bio-psycho-soziale Modell als auch ein Modell der wechselseitigen Interdependenzen durchgesetzt.
Pedersen und Revenson haben mit ihrem familienökologischen Modell (2005) die Zusammenhänge in einem Schaubild verdeutlicht (Abbildung 3).
Abbildung 3: Familienökologisches Modell (Pedersen und Revenson 2005, S. 405)
Erst seit der zusätzlichen Einbeziehung der transgenerationalen Perspektive (siehe Kapitel 8) hat auch die Schuldfrage etwas an Dynamik verloren, und seit dank feministischer Impulse auch die Väter als relevante Elternteile wahrgenommen werden und ihre Familienrollen einnehmen, wird deutlich, dass bei Vorliegen einer psychischen Erkrankung alle leiden und betroffen sind und daher Hilfe brauchen. Es ist nun in einem umfassenden Sinne eine We-Disease-Thematik geworden.
Wir wollen zunächst einen Blick auf einige Zahlen werfen, die den Zusammenhang elterlicher und kindlicher Störungen betreffen (vgl. Bodenmann 2016, S. 85–101). In Deutschland leben rund drei Millionen Kinder mit einem psychisch erkrankten Elternteil zusammen, häufig sind jedoch beide Elternteile beeinträchtigt. Blickt man auf die erwachsenen Patient*innen in Behandlung, so stellt man fest, dass zwischen 12 und 30 Prozent Eltern minderjähriger Kinder sind (Grube & Dorn 2007), circa ein Drittel der Kinder leben mit ihren belasteten Eltern zusammen in einem Haushalt (Lenz 2005).
Zwischen 8 und 14 Prozent der Kinder mit psychiatrischen Diagnosen haben Eltern mit einer psychischen Diagnose (Schone & Wagenblass 2002; Pederson & Revenson 2005). Bei Kindern von psychotischen Eltern finden sich häufig psychopathologische Symptome (Mattejat 1998). Unterhalb der Schwelle psychischer Erkrankungen oder Störungen der Kinder gibt es einen negativen Zusammenhang zwischen psychischen Störungen der Eltern (Sucht, Schizophrenie, affektive, somatoforme, Persönlichkeits- und Belastungsstörungen) und der Lebensqualität der Kinder, ihrem Wohlbefinden und der familiären und schulischen Performance (Wiegand-Grefe et al. 2010).
Eine diagnostizierte psychische Störung eines Elternteils oder beider Eltern ist statistisch gesehen ein großer Risikofaktor für psychische Störungen bei ihren Kindern. Das Risiko, eine psychische Störung zu entwickeln, liegt bei den Kindern um das Drei- bis Vierfache höher als in der Normalbevölkerung.
Dabei muss unterschieden werden zwischen einem allgemeinen und einem spezifischen Erkrankungsrisiko der Kinder psychisch kranker Eltern (Plass & Wiegand-Grefe 2012). Das allgemeine Risiko besagt, dass die Belastung zu einer Störung bei den Kindern führen kann, das spezifische, dass bei den Kindern dieselben Störungen auftreten wie bei dem erkrankten Elternteil.
Ein Beispiel für ein spezifisches Erkrankungsrisiko liefert Mattejat (1998). Er unterscheidet die Lebenszeitprävalenz einer schizophrenen Erkrankung der Kinder von einem Prozent bei psychisch gesunden Eltern zu 10 bis 15 Prozent bei einem schizophren erkrankten Elternteil, zu 40 Prozent Wahrscheinlichkeit, wenn beide Eltern an einer psychotischen Erkrankung leiden. Dies ist natürlich nicht alles Biologie, sondern hat mit verschiedenen Faktoren zu tun. Es besteht eine erhöhte Vulnerabilität, es herrscht in der Regel ein anderer Interaktionsstil vor (Stichwort expressed emotions2), es bestehen häufig zusätzliche soziale Belastungsfaktoren.
Eine psychische Erkrankung eines Elternteils, wie z. B. eine Depression, kann dazu führen, dass krankheitsbedingt ein geringeres Interesse am Kind besteht, dass die Sensibiltät reduziert ist, dass das Erziehungsverhalten inkonsistenter ist oder grundsätzlich harscher oder nachgiebiger und dass geringere Sozial- und Problemlösekompetenzen bei dem betroffenen Elternteil vorliegen (s. Kapitel 4 und 5).
Wenn eine Mutter unter einer psychischen Erkrankung leidet, fällt dies noch immer für die Kinder stärker ins Gewicht als wenn dies beim Vater der Fall ist. Das liegt daran, dass die Mütter deutlich mehr Zeit mit den Kindern verbringen als die Väter. Daher führen z. B. auch Depressionen der Mütter, auch wenn sie vor der Mutterschaft lagen, eher zu einer Beeinträchtigung der Eltern-Kind-Beziehung (Herr et al. 2007) als wenn die Väter oder Geschwister depressiv sind.
Auch bei den Angsterkrankungen gibt es ein erhöhtes spezifisches Risiko. Eltern von Kindern mit einer Angststörung haben zu 80 Prozent selbst auch eine Angststörung (Ginsburg & Schlossberg 2002). Ein anderer Befund sagt, dass Eltern von Kindern mit Angststörungen zwei- bis dreimal häufiger selbst Angststörungen haben als bei Kindern ohne diese Diagnose (Hughes et al. 2009). Elterliche Kontrolle kann als Prädiktor für eine Angststörung der Kinder dienen, da für die Kinder keine angemessene Autonomieentwicklung möglich ist. Ängstliche Mütter »zeigen mehr überbehütendes, kontrollierendes Erziehungsverhalten, weniger emotionale Wärme und eine geringere elterliche Sensitivität. Ängstliche Eltern unterstützen zudem die Vermeidungsreaktionen ihrer Kinder und tragen damit zur Chronifizierung der Angststörung des Kindes bei« (Bodenmann 2016, S. 96).
Nicht immer werden die Kinder von psychisch labilen oder kranken Eltern schnell auffällig:
»Das durch die elterliche psychische Störung erhöhte eigene Erkrankungsrisiko der Kinder zeigt sich in allen Altersstufen, besonders ausgeprägt jedoch in der frühen Kindheit und der Pubertät […], wobei es häufig auch zu Sleeping-Effekten kommen kann.« (Bodenmann 2016, S. 96) Die Störung taucht dann im Erwachsenenalter auf, besonders wenn die Kinder ihrerseits Eltern werden und sich dann ihr inneres emotionales System an die Belastungen der Kindheit erinnert. Wir werden im Kapitel 2 einige dieser Fälle beschreiben.
Zwei Faktoren sind besonders wichtig beim Thema psychische Erkrankung der Eltern und Auswirkungen auf die Kinder: Beziehungsqualität und Krankheitsbewältigung (Mattejat 1998). Die Beziehungsqualität ist unter dem Aspekt zu betrachten, ob sich sowohl das erkrankte Familienmitglied als auch die Angehörigen, dabei besonders natürlich die minderjährigen Kinder, »auf stabile, tragfähige und Sicherheit vermittelnde interpersonelle Beziehungen« (a. a. O., S. 70 f.) verlassen können. Die Krankheitsbewältigung fokussiert, inwieweit angemessene und ausreichende Möglichkeiten in der Familie vorliegen, sich mit der Krankheit auseinanderzusetzen und, wo nötig, Hilfen zu organisieren. Dies schließt auch psychoedukative Aspekte zum Verständnis und Umgang der psychischen Erkrankung in der Arbeit mit Eltern und Kindern ein.
Naturgemäß haben betroffene Elternteile, angehörige Elternteile und Kinder von betroffenen Elternteilen eine je unterschiedliche Perspektive auf die Situation.
Die Lage wird schlechter, wenn Eltern, Betroffene wie Angehörige, folgendes Verhalten zeigen (Mattejat 1998):
Über die Krankheit wird nicht gesprochen (Tabuisierung).
Die Erkrankung wird gänzlich verleugnet3 oder permanent als Grund für alles herangezogen und berücksichtigt.
Die Eltern leiden dauerhaft im Job und in der Familie unter einer Überforderung.
Betroffene, die sich sozial stark zurückziehen, sei es aus Scham, Schuldgefühlen, Furcht oder krankheitsbedingt, und solche, die sich andererseits sehr an andere bis hin zur kompletten Unselbständigkeit klammern, verschlechtern die Situation in der Familie. Angehörige dagegen tragen zu einer Abwärtsspirale bei, wenn sie entweder emotional negativ überreagieren, die Lage weiter katastrophisieren im Sinne der expressed emotions oder wenn sie sich – auf dem Gegenpol- ihrem Schicksal resigniert ergeben oder sich frustriert und enttäuscht zurückziehen.
Probleme, die für angehörige Kinder auftauchen können, sind die folgenden:
Sie haben das Gefühl oder dürfen nicht über die Erkrankung der Eltern sprechen. Wenn andere davon erführen, wäre es ein Verrat an der Familie.
Sie fühlen sich schuldig an der Erkrankung der Eltern, weil sie sich »schlecht« verhalten haben.
Sie fühlen sich orientierungslos, weil sie den Sachverhalt der Krankheit nicht einschätzen können.
Sie verlieren den Kontakt zu den Gleichaltrigen, weil sie sich schämen, niemand nach Hause mitbringen dürfen oder wollen.
Sie leiden unter einem Aufmerksamkeitsdefizit von Seiten der Eltern und Verwandten, da diese absorbiert sind von den Problemen des von der Krankheit betroffenen Elternteils.
Sie müssen viele zusätzliche Verpflichtungen in der Familie übernehmen und sind damit überlastet.
Sie übernehmen die Eltern- oder Verantwortungsrolle, da die Betroffenen diese nicht ausfüllen können (Parentifizierung).
Sie erleben, dass sie und ihre Familie von anderen beschämt werden.
Sie geraten in Loyalitätskonflikte, einerseits zwischen dem betroffenen und dem angehörigen Elternteil, andererseits zwischen der Familie und den externen Personen, vor denen bagatellisiert wird.
Es tauchen nicht alle Probleme bei allen und gleichzeitig und in gleichem Ausmaß auf, es handelt sich vielmehr um ein Erleben, das im Einzelfall eintreten kann. Die Störungen in Familien können nicht deterministisch beschrieben werden. Wie oben erwähnt, gibt es ein allgemeines und ein spezifisches Erkrankungsrisiko bei den Kindern. Kinder entwickeln auch andere Verarbeitungsstile, Störungen, die mit den Begriffen internalisierend und externalisierend klassifiziert werden können (siehe Kapitel 4 und 5). Auch kann etwa ein suchtkranker Vater dazu beitragen, dass sein Kind eine depressive Störung entwickelt, oder eine psychosekranke Mutter eine Angsterkrankung bei ihrem Kind triggern. Es können symmetrische Beziehungen in Familiensystemen entstehen (suchtkranker Vater und ein suchtkrankes Kind) oder komplementäre Beziehungen (psychosekranke Mutter und frühreifes, parentifiziertes Kind), oder es entstehen Konstellationen, die in ihrer Interdependenz gar nicht auf den ersten Blick erkennbar sind (depressive Großmutter und ängstliche Enkelin). Es sind viele Konstellationen möglich, die einen genauen, mehrere Perspektiven und Aspekte einnehmenden familiendiagnostischen Blick erfordern.
Darüber hinaus wissen wir heute aus der Resilienzforschung (Wickert & Meents 2020), dass selbst schwere familiäre Belastungssituationen nicht notwendigerweise zu Störungen bei den Kindern führen müssen (siehe auch Kapitel 9).
In diesem Buch können wir daher nur einige typische Konstellationen anführen, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben, sondern für das Thema sensibilisieren wollen.
Kapitel 2
Störung und psychische Krankheit in Familien
In diesem Kapitel werden wir zunächst einige psychische Störungen beschreiben und reflektieren, was die jeweilige Störung für die Eltern- und Familienrolle bedeuten kann. Als Nächstes wird der indirekt betroffene Elternteil, in einigen Fällen auch die Geschwister, in den Fokus genommen, und untersucht, welche Auswirkungen die Störung auf deren Eltern- bzw. Familienrolle haben kann. Es werden die Störungsbilder Abhängigkeitserkrankung, strukturelle oder Persönlichkeitsstörungen, affektive Störungen (hier besonders die Depression), Psychose oder Schizophrenie, die Angsterkrankungen sowie die posttraumatische Belastungsstörung behandelt.
2.1 Abhängigkeit und substanzgebundene Sucht
Abhängigkeits- und Suchterkrankungen haben unterschiedliche Gesichter, je nachdem, ob es sich um substanz- oder nichtsubstanzgebundene Süchte, um legale oder illegale Suchtmittel (Tabelle 1) handelt, und selbstverständlich spielt auch das Ausmaß des Suchtmittelgebrauchs eine große Rolle. Zentral bei allen Suchterkrankungen in Familien ist aber die Tatsache, dass der Suchtmittelkonsum im Rahmen einer Abhängigkeit eine größere Aufmerksamkeit erfährt als die Beziehungen zwischen den Familienangehörigen.
Tabelle 1: Klassifikation von Suchtmitteln
Sucht und Abhängigkeit
substanzgebunden
nicht substanzgebunden
legal
Alkohol, Nikotin, Medikamente (Schlaf-, Beruhigungs-, Schmerzmittel)
pathologisches Glücksspiel, Kaufsucht, Onlinesucht, Arbeitssucht, Sexsucht, Esssüchte
illegal
Drogen (Cannabis, Ecstasy, Kokain, Heroin, Amphetamine, Crystal Meth)
Verhaltenssüchte mit strafbarem Hintergrund wie z. B. Kinderpornografie
»Von einer Abhängigkeitserkrankung spricht man im klinischen Kontext, wenn drei der folgenden Kriterien innerhalb eines Jahres aufgetreten sind: ein starkes Verlangen (Craving) nach einer psychotrop wirksamen Substanz (Alkohol, Nikotin, Drogen, Tabletten etc.), Kontrollverlust bezüglich des Konsums, Toleranzentwicklung für den Wirkstoff (Gewöhnung und Dosissteigerung), Entzugssymptome, Einengung auf den Konsum bei Vernachlässigung anderer Aktivitäten und fortgesetzter Konsum trotz schädlicher Folgen.« (Bender & Stadler 2012, S. 117)
Dies kann übertragen werden auf die nichtsubstanzgebundenen Süchte wie pathologisches Glücksspiel, Online-, Kauf-, Arbeits-, Sport- und Sexsucht. Beinhalten diese Verhaltensweisen einen Kontrollverlust, einen übermäßigen Konsum oder wird das Verhalten fortgesetzt, obwohl daraus psychisch, physisch, existenziell oder sozial massive Probleme auftreten, wird auch hier von Abhängigkeit gesprochen.
In der ICD 10-Klassifikation finden sich die substanzgebundenen Süchte unter F10 bis F19, die Essstörungen unter F50 und das pathologische Glücksspiel unter F63.
Bei den substanzgebundenen Süchten wird jeweils unterschieden zwischen schädlichem Gebrauch und Abhängigkeit.
Wie sich eine chronische Alkoholabhängigkeit eines Elternteils auf ein mittlerweile längst schon erwachsenes Kind auswirken kann, zeigt folgendes Beispiel.
Fallbeispiel eines erwachsenen Sohnes einer chronisch alkoholkranken Mutter
Bernd ist Mitte dreißig und hat zusammen mit seiner Freundin eine zweijährige Tochter, auf die er sich sehr gefreut hat und deren Entwicklung er mit Stolz und Anteilnahme begleitet. Sie unternehmen viel gemeinsam und er ist ein stolzer Vater. Seine Freundin ist eine empathische und warmherzige Partnerin und Mutter. Es ist ihnen beiden wichtig, dass sie sich gleichberechtigt um ihre Tochter kümmern. Das klappt meist sehr gut, nur abends gibt es ein Problem. Wenn Bernd seine Tochter ins Bett bringt und diese nicht relativ zügig einschläft, bekommt er aus unerklärlichen Gründen massive Wutanfälle. Nach kurzer Zeit verspürt er den Drang laut loszuschreien, dass sie endlich schlafen soll. Er tut dies nicht, aber seine Spannung wächst ins Unermessliche, so dass früher oder später seine Freundin übernimmt. Bernd versteht nicht, was mit ihm los ist.
Er hat einen kreativen, aber stressigen Job, bei dem er viele Terminsachen zu erledigen hat. Aber auch in ruhigeren Phasen seines Arbeitslebens kommt es zu den abendlichen Spannungen.
Bernd ist der Sohn einer chronisch alkoholkranken Mutter, die seit seiner Kindheit mindestens dreimal die Woche total betrunken ist. Auch ihr Vater war Alkoholiker. Bernd selbst trinkt so gut wie keinen Alkohol. Als er einmal mit seiner Mutter über die Einschlafprobleme seiner Tochter spricht, erzählt sie ihm, dass sie ihn als vier Monate alten Säugling alleine in ein Zimmer gestellt und die ganze Nacht habe schreien lassen. Bernd hat auch andere unschöne Erinnerungen an seine Kindheit. Als Kindergartenkind ist er mit seiner Mutter und seinem Stiefvater immer mit einer für ihn seltsamen Clique in einen Bauwagen gegangen. Dort haben alle Unmengen Bier getrunken, sich in seiner Anwesenheit teilweise ausgezogen, »komische Spiele« gespielt und anzügliche Dinge gesprochen. Als er sechs Jahre alt war, sagte seine Mutter auf seine Bitte, abends zuhause zu bleiben: »Nur wegen dir bringe ich mich nicht um!«
Sein Stiefvater war gewalttätig, er hat seine Mutter gewürgt und ihn auch wiederholt geschlagen und malträtiert. Besonders wenn seine Mutter in einer Bar arbeitete und nächtelang nicht nach Hause kam, war sein Stiefvater außer Rand und Band.
Bei seiner Mutter musste Bernd schon als Kind, und auch heute noch, immer »checken«, wie ihre Stimmung ist. Dies hing meist davon ab, ob sie getrunken hatte oder nicht. Bernd wohnt mittlerweile 100 Kilometer von seiner Mutter entfernt. Manchmal ruft sie ihn betrunken mitten in der Nacht an und will mit ihm reden. Dabei geht es vor allem um ihr Elend, seit sich ihr letzter Freund suizidiert hat. Anderntags kann sie sich an nichts mehr erinnern, hat komplette Blackouts. An ihrem sechzigsten Geburtstag hat sie sich alkoholisiert auf der Straße vor einer Kneipe mit anderen geprügelt.
Für Bernd ist es heute ein Fortschritt, dass er, wenn seine Mutter betrunken am Telefon ist, sagen kann, dass sie am anderen Tag wieder anrufen soll, wenn sie nüchtern ist. Wenn er mit seiner Tochter zu seiner Mutter fährt und diese betrunken ist, fährt er unverrichteter Dinge zurück, da er nicht möchte, dass sie in diesem Zustand Kontakt mit seiner Tochter hat. Wut hat er vor allem auf den Stiefvater, von dem sich die Mutter getrennt hatte, als er 15 Jahre alt war. Gegenüber seiner Mutter spürt er keine wütenden Gefühle, um sie macht er sich Sorgen. Er schwankt zwischen der Idee, dass er sich um sie im Alter kümmern will, dafür brauche sie nichts zurückzulegen, auf der anderen Seite wünscht er sich, sie wäre nicht mehr da. An viele Situationen kann er sich nicht erinnern, und wenn das Gespräch auf die Versäumnisse der Mutter kommt, verteidigt er sie. Auch heute noch lässt er nichts auf sie kommen.
Im Fallbeispiel ist gut zu erkennen, wie Kinder suchtkranker Eltern versuchen, mit der Situation zurechtzukommen.
Besonders wenn die Kinder von klein auf mit suchtkrankem Verhalten zu tun haben, entwickeln sie meist keine Distanz zum dysfunktionalen Familiensystem. Das, was sie erleben, ist die Normalität, die zwar bestimmte Gefühle wie Angst, Traurigkeit und Schuldgefühle auslösen kann, aber es gibt kein Vergleichssystem außerhalb der Familie, das den Kindern verstehbar macht, dass ihr Alltag von der Sucht des kranken Elternteils geprägt ist. Dies ist einer der Gründe, warum Kinder auch noch im Erwachsenenalter das Familiensystem verteidigen. Es ist, was es ist: die Familie. Manchmal wird dies auch von dem betroffenen oder dem angehörigen Elternteil noch festgeschrieben: »Stell dich nicht so an!«, oder als explizite Schweigeaufforderung: »Wenn du das erzählst, glaubt dir eh keiner«, oder »Willst du, dass das Jugendamt dich ins Heim bringt oder deine Familie in den Dreck zieht?« Meist ist dies jedoch gar nicht nötig, denn Kinder fühlen sich ihrer Familie verpflichtet und sind in jungen Jahren auch existenziell auf sie angewiesen, egal wie schlimm sie sein mag. Dabei spielt sowohl der äußere Aspekt von Versorgung und Lebensgrundlagen des Kindes (Wohnen, Essen, Gesundheit, Kleidung, Bildung, Fürsorgepflichten) als auch der innere, also die innerpsychischen Bedürfnisse (Identität, Zugehörigkeit), eine Rolle. Dahinter steht das Gefühl des psychischen Mangels an Schutz, Gesehenwerden, sich geliebt Fühlen, zurück. Psychodynamisch findet bei den Kindern meist eine Identifikation mit dem Aggressor, also in diesem Fall mit der suchtkranken Person, statt. Das Kind identifiziert sich mit der suchtkranken Elternperson, obwohl sie unter ihr bzw. ihrem Verhalten leidet. Es handelt sich dabei um den Versuch, wenigstens einen kleinen Funken an Verbundenheit mit dem kranken Elternteil und Zugehörigkeit zum Familiensystem aufrechtzuerhalten. Als Kind spürt Bernd den inneren Konflikt zwischen dem Wunsch nach Verbundenheit, Liebe, Beziehung und der Wut, Verärgerung und Frustration, da er in der Beziehung regelmäßig zu wenig bekommt. Im Fallbeispiel zeigt sich dies in der Sorge (siehe Kapitel 6: Parentifizierung) um und in der starken Gebundenheit an seine alkoholkranke Mutter, sowie seiner verdrängten Wut auf diese. Er bewahrt sich die Beziehung zu seiner Mutter, indem er den suchtkranken Teil dissoziiert. Ein prominentes Beispiel ist die Familiensituation des expressionistischen Dichters Georg Trakl (1887–1914). Trakls Mutter war suchtmittel- bzw. medikamentenabhängig, Trakl entwickelte früh ebenfalls eine Suchterkrankung und unterhielt mit seiner vier Jahre jüngeren Schwester ein inzestuöses Geschwisterverhältnis. Beide suizidierten sich im jungen Erwachsenenalter im Abstand von drei Jahren.
Jedoch ist auch, wie im obigen Fallbeispiel beschrieben, die Verdrängung des traumatisierenden Erlebten, wie z. B. die Mutter im Rauschzustand war, typisch für Kinder von Suchtpatient*innen. Erwachsene Kinder suchtkranker Eltern haben häufig wenig bis keine Erinnerungen an die schlimmen Zeiten zuhause. Die Gefühle von Scham, Angst und Ausweglosigkeit, denen sie in der Kindheit und Jugend durch Vernachlässigung oder schädigendes Verhalten ausgesetzt waren, sind schwer auszuhalten, was den Prozess des Vergessens beschleunigt. Die Vergessensschranke wird dann durchbrochen, wenn im aktuellen Leben ein Trigger oder Auslöser das Verborgene an den Tag bringt, im Beispiel, als der Sohn selbst Vater wird und das Schlafverhalten seiner Tochter ihn emotional aus der Ruhe bringt. Es sind nicht immer eigene Kinder, die das Kindheitsthema aktualisieren, manchmal ist der Trigger eine Situation in einem ganz anderen Kontext, wie das folgende Beispiel zeigt.
Fallbeispiel einer jungen Frau, deren Mutter alkoholkrank war
Anna ist eine hübsche junge Frau Mitte zwanzig, freundlich und zuvorkommend. Sie ist die erwachsene Tochter einer alkoholkranken Mutter. Nach der Trennung der Eltern, Anna war gerade in der Pubertät, wuchs sie zusammen mit ihrer jüngeren Schwester bei der Mutter auf. Die Mutter war häufig stark betrunken, lag dann den ganzen Tag auf der Couch, rauchte und schaute fern bzw. schlief. Sie versuchte wieder einen Partner kennenzulernen, hatte häufig wechselnde Männerbesuche, aber eine neue stabile Partnerschaft erwuchs daraus nicht. Da die beiden Töchter auch in der Schule und bei Nachbarn durch ihr verwahrlostes Äußeres und ihr oppositionelles Verhalten auffielen, war das Jugendamt immer wieder zu Hausbesuchen da. Anna beschreibt, wie sie in diesen Fällen die Mutter schnell geduscht und angezogen, ihr einen Kaffee eingeflößt und sie zum Gespräch an den Tisch gesetzt hat. Sie hat ihre Mutter präsentabel gemacht. Immer wieder ist das Jugendamt unverrichteter Dinge gegangen, die beiden Mädchen blieben bei der Mutter. Anna war in dieser Phase auch auf Partys mit viel Alkohol unterwegs, aber sie passte dennoch auf ihre Mutter und auf ihre jüngere Schwester auf, so gut es ging. Sie lernte früh Verantwortung für andere zu übernehmen. Als Anna 18 Jahre alt ist, nimmt sich die Mutter das Leben. Anna findet sie tot auf der Couch vor, aber sie selbst funktioniert weiter. Anna ist von Beruf Arzthelferin. Als ihre Großmutter dement wird, unterstützt sie den Großvater bei der häuslichen Pflege seiner Frau drei Jahre lang bis zu deren Tod. Am Arbeitsplatz gibt es immer wieder Probleme, wenn sie mit Chef*innen zu tun hat, die ihre Verantwortung nicht genau nehmen oder fachliche Mängel überspielen. So wechselt sie zweimal die Stelle, bis sie einen freundlichen und engagierten Chef gefunden hat, der ihr viel Eigenverantwortung lässt. Als dessen Frau auch mit in die Praxis einsteigt und sie wegen Nichtigkeiten wiederholt zurechtweist, bekommt Anna Panikattacken und massive Schlafstörungen.
Obwohl die junge Frau aus dem Beispiel traumatisiert ist durch die Alkoholerkrankung ihrer Mutter und zusätzlich durch deren frühen Suizid, kann sie sich durch ihre Verantwortungsrolle stabil halten. Sie ist ein typisches Beispiel für eine parentifizierte Tochter, die, als in der Familie keiner mehr Verantwortung trägt, diese übernimmt und so trotz erschwerter Lebensbedingungen im Alltag funktionieren kann. Klassischerweise reagieren parentifizierte Kinder suchtkranker Eltern aber besonders allergisch auf Inkompetenz und Ungerechtigkeit in Führungspositionen. Sie mussten selbst in ihrer Familie früh lernen, kompetent zu sein, und haben dafür in der Regel einen hohen Preis bezahlt: den Verlust der Kinderrolle und damit ihrer Kindheit. Mit den suchtkranken Eltern konnte diese Rechnung nie beglichen werden, tauchen aber ähnliche Konstellationen im außerfamiliären Leben auf, z. B. in Form einer ungerechten oder fachlich nicht sattelfesten Chefin, wirkt die Übertragung in der Beziehung wie ein emotionaler Brandbeschleuniger. Alles, was an Wut, Trauer und Enttäuschung aufgestaut ist, findet vermeintlich einen sinnvollen Kanal. Diese Beziehungen sind oft schwer zu klären, da beide Seiten beteiligt sind: bei den parentifizierten Kindern liegt so etwas wie eine Allergie vor, aber diese bricht sich erst dadurch Bahn, wenn in der Realbeziehung bei den Chef*innen auch ein Problem vorliegt. Die »Allergie« der Parentifizierten führt dazu, dass sie jede Beziehung, die einer Eltern-Kind-Beziehung auch nur im Entferntesten ähnelt, also mit formaler Autorität zu tun hat, mit feinsten Antennen und Lupen daraufhin überprüfen, ob die hierarchische Beziehung auch gerechtfertigt ist.
Reflexion der Rollen
Suchterkrankung – der betroffene Elternteil
Menschen, die unter einer Sucht- und Abhängigkeitserkrankung leiden, ersetzen über kurz oder lang die Beziehungen zu Personen durch das Suchtmittel. Dies ist häufig der Fall, weil sie sich selbst aus ihren sozialen Bezügen zurückziehen aufgrund von Scham- und Schuldgefühlen und/oder aufgrund von Konflikten im sozialen Netzwerk, die durch die Sucht ausgelöst werden.
Blickt man auf das soziale Netzwerk suchtkranker Personen, fällt zunächst auf, dass es sich um wenige Kontakte handelt, die vor allem lose und unverbindlich, aber häufig funktional und konflikthaft sind. Was bedeuten diese Netzwerkcharakteristika? Wenige Kontakte sind eine bis zwei Personen, mit denen ein emotional wenig bedeutsamer Kontakt besteht. Entweder sind es Personen, mit denen gemeinsam getrunken, gekifft oder etwas anderes konsumiert wird, oder es handelt sich um die nahen Familienangehörigen, häufig Kinder und co-abhängige Partner*innen. Funktionale Kontakte sind solche, die im Zusammenhang mit dem Suchtmittelkonsum stehen, z. B. Kinder, die den Alkohol im Supermarkt besorgen oder Trinkkumpane in der Kneipe, die das süchtige Verhalten unterstützen oder teilen. Die konflikthaften Kontakte sind eher diejenigen, die sich gegen die Aufrechterhaltung der Sucht aussprechen und die betroffene Person vom Konsum abhalten wollen. Das sind meist Personen aus dem Arbeitsumfeld oder Familienangehörige, die unter der Suchterkrankung leiden.
Blickt man auf die inneren Rollen der suchtkranken Person, dominieren auf der Affektebene die Gefühle von Angst, Depression, Resignation, Euphorie, Scham und Schuld, je nach der augenblicklichen Phase im Abhängigkeitszyklus (siehe Abbildung 4). Die Gedanken kreisen um Abstinenzwünsche und Absichten, Ideen von einem gesunden Zustand, Bagatellisierung des Geschehens, Craving, Selbstvorwürfe und Verurteilungen, Trotzgedanken bis hin zur Selbstaufgabe und zu Todessehnsüchten. Die Wahrnehmung der unterschiedlichen Gefühle, Gedanken und Impulse hängt ab vom aktuellen Suchtmittelkonsum, d. h. vom Ausmaß der Betäubung.
Abbildung 4: Dynamik im Abhängigkeitszyklus
Blickt man auf die sozialen Beziehungen des betroffenen suchtkranken Elternteils, zeigen sich vor allem zwei emotionale Qualitäten: entweder die mangelnde Schwingungsfähigkeit im Kontakt oder die emotionale Übererregung. Dies hängt zum einen vom Suchtmittel ab, aber auch von der Grundpersönlichkeit des suchtkranken Menschen. Manche Menschen werden unter Alkoholeinfluss stumpf, andere übererregt. Ein Amphetamin- oder ein spielsüchtiger Mensch reagiert anders als eine cannabis- oder eine schmerzmittelabhängige Person. Aber egal, ob ein Zuviel oder Zuwenig an Schwingungsfähigkeit vorliegt, die Beziehung ist unter dem Einfluss des Suchtmittels dysfunktional. Da so viel im Leben der Betroffenen am Konsum des Suchtmittels orientiert ist, fällt ein Perspektivwechsel mit Familienangehörigen wie Partner*innen und Kindern schwer. Es herrscht ein großer Mangel an Empathie für andere, davon sind die eigenen Kinder mit ihren Wünschen und Bedürfnissen nicht ausgenommen.
Suchterkrankung – der angehörige Elternteil
Die Beziehung ist meist schwer belastet, was zu einer deutlich suchtbezogenen Reaktion in der Partnerschaft führt.
Partner*innen von suchtkranken Menschen zeigen verschiedene Reaktionen:
Entwicklung eines co-abhängigen Verhaltens (bagatellisieren, verharmlosen, beschönigen, unterstützen),
Entwicklung eines Verfolger- und Kontrollverhaltens in Bezug auf den suchtkranken Elternteil (schimpfen, Suchtmittel suchen und unterbinden),
Rückzug aus der Partnerschaft und/oder aus der Familie bis hin zu Trennung und Scheidung,
Flucht in die Arbeits- oder in die Elternrolle,
resignative und depressive Reaktionen sowie Selbstwertkrisen.
Auch die Elternrolle ist vom Suchtmittelkonsum der Partner*innen betroffen, wie wir dies ausführlich im Kapitel 5 anhand eines Kindes mit einer hyperkinetischen Störung zeigen werden. Durch die partnerschaftsbezogenen Reaktionen ist die Elternrolle damit indirekt mitbetroffen. Der Rückzug aus der Partnerschaft kann auch zu einem Rückzug aus der Familie werden (auch dies wird im oben genannten Fallbeispiel gezeigt). Angehörige versuchen sich außerhalb der Familie zu entlasten, verlagern ihre Aktivitäten weg von der belastenden Familie. Die Kinder werden so meist nicht ausreichend vor dem suchtkranken Elternteil und dessen Verhalten geschützt, da in der Regel auch die eigene Elternrolle nicht ausreichend wahrgenommen wird. Dies gilt auch für den mangelnden Schutz gegenüber externen negativen Einflüssen auf das Kind.
Die angehörigen Partner*innen wenden sich manchmal auch von den co-abhängigen Kindern ab, weil diese aus Loyalitätsgründen den suchtkranken Elternteil stützen. Allgemein fehlt auch hier der Perspektivwechsel in die Rolle der angehörigen Kinder und damit die Empathie für diese. Kurz: die Angehörigen sind oft so mit ihren eigenen Nöten beschäftigt, dass die Elternrolle in Vergessenheit gerät oder schwer beeinträchtigt ist.
Suchterkrankung – die angehörigen Kinder
Das spezifische Risiko für Kinder suchtkranker Eltern, selbst eine Suchterkrankung (Alkohol, Drogen, Essstörungen) zu entwickeln, ist sechsmal höher als bei gesunden Eltern (Zobel 2006). Sind die betroffenen Eltern wegen ihrer Suchterkrankung nicht in psychotherapeutischer Behandlung, finden sich bei den Kindern grundsätzlich mehr emotionale und externalisierende Probleme und Verarbeitungsstrategien. Sie sind resignierter und depressiver gestimmt und erleben häufig auch mehr Gewalt in der Familie. Sind beide Elternteile alkoholkrank, ist das Risiko für Kinder, selbst einen Drogenmissbrauch oder eine Drogenabhängigkeit zu entwickeln, um das Zehnfache bzw. das Siebzehnfache erhöht (Plass & Wiegand-Grefe 2012). Das bedeutet, dass sich für Kinder schwerwiegende eigene Störungsbilder ergeben können.
Aber auch schon vor einer eigenen Suchterkrankung sind psychische Fehlentwicklungen erkennbar. Kinder suchtkranker Eltern kommen, sobald sie die familiäre Situation reflektieren können, oft in starke Loyalitätskonflikte. Obwohl der nicht-suchtkranke Elternteil die Angehörigenposition mit den Kindern teilt, wird oft eine größere Nähe zum hilfsbedürftigen suchtkranken Elternteil gefühlt. Davor besteht in der Regel ein unbestimmtes Mangelgefühl: Mangel an konstanter emotionaler Zuwendung, Mangel an Wahrnehmung und Spiegelung eigener Bedürfnisse, Mangel an Fürsorge und Schutz, Mangel an Versteh- und Berechenbarkeit. Oft werden Kinder, die noch zuhause leben, auffällig. Sie zeigen ein Verhalten, das den Blick auf sie und ihre Not lenkt. Sie übernehmen damit die Indexrolle in der Familie. Dies hat zwei Konsequenzen: Zum einen wird das schwächste Familienmitglied, nämlich der suchtkranke Elternteil, geschont, er steht nicht im Fokus, zum anderen werden sie selbst wahrgenommen. Leider ist es meist so, dass die Indexpatient*innen nicht in ihrer Not gesehen werden, sondern mehr in ihrer störenden Verhaltensauffälligkeit.
Auch Gefühle von Scham und Schuld kommen bei angehörigen Kindern häufig vor. Sie fragen sich, ob sie etwas falsch gemacht haben, schämen sich zu sein, wie sie sind, und schämen sich gleichzeitig für ihre Familie und den suchtkranken Elternteil. Andere Kinder werden nicht nach Hause eingeladen, damit die Schmach nicht für andere sichtbar wird.
Kinder suchtkranker Eltern werden schnell erwachsen. Sie müssen die vernünftige, fürsorgliche Erwachsenenrolle übernehmen. Sie werden so parentifiziert, also zu Eltern für ihre eigenen Eltern, sowohl für den suchtkranken als auch häufig für den angehörigen Elternteil, der, wie oben beschrieben, mit der Situation überfordert ist. Sie können wenig Empathie für sich selbst entwickeln, weil sie nicht ausreichend in ihren Emotionen gehalten und gespiegelt werden und weil sie erleben, dass es immer um die anderen geht, die deutlich bedürftiger sind in ihrer Sucht.
Mit einer zeitlichen Verzögerung kommt meist eine große Wut auf den angehörigen Elternteil, da dieser nicht eingesprungen ist, nicht für Ruhe und Ordnung und Normalität gesorgt hat. »Der Papa war ja ständig betrunken, aber die Mama hätte doch … tun können« oder »die Mama war durch ihre Tabletten immer wie betäubt, aber der Papa war doch gesund und hätte …«, sind die Aussagen von erwachsenen Kindern eines suchtkranken Elternteils, wenn sie sich auf den Weg machen, ihre eigenen Gefühle zu spüren.
Umso dramatischer ist natürlich die Lage für die Kinder, wenn beide Eltern suchtkrank sind. Sie haben ein hohes Risiko, selbst in ein Suchtsystem einzusteigen, entweder aktiv als Betroffene oder passiv als Angehörige eines suchtkranken Partners.
Ein besonderes Problem kann bei mütterlichem Alkoholkonsum bereits während der Schwangerschaft entstehen. Das bei den Kindern hierdurch zu beobachtende fetale Alkoholsyndrom (FAS) kann zu körperlichen Beeinträchtigungen, Entwicklungs- und Intelligenzproblemen, psychischen Auffälligkeiten und zu deutlichen Beeinträchtigungen beim Schulbesuch in sozial-emotionaler und kognitiver Hinsicht führen.