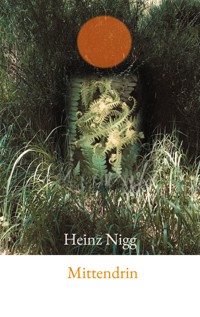Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In 'Video: Ich sehe!' erzählt der Schweizer Ethnologe, Aktivist und Kulturvermittler Heinz Nigg von seinem Werdegang, seinen Entdeckungsreisen in die Welt der Kunst und wie er Pionier und Mitstreiter der alternativen Videobewegung wurde. Es ist eine Collage von Erinnerungen, Briefstellen, Tagebucheinträgen, ethnografischen Feldnotizen und Auszügen aus Zeitungsartikeln, ergänzt durch Fotos und Dokumente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Ich las das Buch mit mancherlei Staunen und freute mich über die Begegnung mit diesem Lebensgang.«
Peter von Matt, Germanist und Schriftsteller
»Alles in allem kann der Autor von sich behaupten, die Start phase des Mediums Video wesentlich mitgeprägt zu haben. Das ist spannender Lesestoff, zumal er mit interessanten biografischen und zeitgeschichtlichen Informationen angereichert ist.«
Barbara Lukesch, Journalistin und Buchautorin
»Heinz Nigg lässt in seiner vielfältigen Collage auch kritische Fragen zu. Widersprüche gehören für ihn unabdingbar zum Leben. Er nimmt sie als permanente Herausforderung an. Heinz Nigg tut dies couragiert, engagiert und reflektiert. Sein Werk als Videopionier und forschender Beobachter zeugt davon.«
Ueli Mäder, Soziologe
Inhaltsverzeichnis
Aufbruch
Heranwachsen
Amerika
Wieder in Zürich
Reisetagebuch New York
Ankommen in London
Fotowerkstatt in Waterloo
Video in Notting Hill
Feldnotizen
Jugendunruhen in der Schweiz
Video für alle
Familie und Nachbarschaft
»Geben Sie jemand die Chance zu fabulieren, zu erzählen, was er sich vorstellen kann, seine Erfindungen erscheinen vorerst beliebig, ihre Mannigfaltigkeit unabsehbar; je länger wir ihm zuhören, umso erkennbarer wird das Erlebnismuster, das er umschreibt, und zwar unbewusst, denn er selbst kennt es nicht, bevor er fabuliert.«
Max Frisch
Aufbruch
Winter 1969/70. An der Uni Zürich bin ich für Geschichte eingeschrieben. Unruhig sitze ich im Kaffeehaus Odeon. Hier trifft sich Zürichs Kulturszene, linke Studis, der neue Zürcher Untergrund. Ich will weg von zu Hause, frei und unabhängig leben, studieren. In einer Zeitung sehe ich das Inserat für ein Zimmer in der Zürcher Altstadt. Wenig später ziehe ich mit meinen Habseligkeiten ein. Ein Bett, ein Schrank, ein winziger Tisch und ein gusseiserner Ofen: Das ist mein Mobiliar. In der nahen Universität verpflege ich mich. Ich mag die große Mensa mit den weiten Fenstern, mit Blick auf einen kleinen Park. Am Morgen ist es hier angenehm ruhig zum Frühstücken und Zeitunglesen. Auch am Mittag esse ich hier, oft zusammen mit anderen Studierenden, und am Abend gibts einen günstigen Mensa-Imbiss. Ich fühle mich privilegiert zu studieren, was ich will, meine Zeit nach Lust und Laune einzuteilen, auf dem Bett zu liegen und Hegels Phänomenologie des Geistes zu lesen. »Das kapiere ich schon«, denke ich. Scheitere, bin betrübt, raffe mich auf: Neues ausprobieren, mir leichtere Lektüre vornehmen. Mit Freunden und Kollegen diskutieren. Meine Neigungen, Fähigkeiten und Wünsche im Gleichgewicht halten. Fast jeden Abend bin ich in der Disco Polyfoyer. Tanzen. Freunde, Bekannte treffen. Wir wachsen zu einer Clique zusammen, machen Ausflüge, schwimmen und grillen am Katzensee. Dabei ist auch die 17-jährige Trix. Sie macht das Seminar für Lehrer*innen. Wir verlieben uns. Die erste Nacht mit einer Frau. Ich höre die Glocken des nahen Kirchturms schlagen, jede Viertelstunde. Ein Freund schenkt mir eine Portion Cannabis. Ich rauche, lege mich aufs Bett. Aus dem kleinen Kassetten-Tonbandgerät ertönt Suzanne von Leonard Cohen. Das mechanische Geräusch des Spulengeräts ist gleich intensiv wahrzunehmen wie die Musik. Ich schließe die Augen und sehe weiße Schafe auf einer Wiese weiden. Am Himmel ziehen schwarze Musiknoten vorbei. Ich öffne die Augen, betrachte den kleinen Gussofen mit seinen Rundungen. Mit Musik im Ohr und Glücksgefühlen im Bauch gehe ich in die Nacht hinaus. Die Häuser schimmern blau-rötlich. Ich spaziere zum Central-Platz, bleibe vor einer Telefonkabine stehen, öffne die Tür, greife zum Hörer, telefoniere mit Trix. Aufgeregt erzähle ich ihr von meinen neuen Wahrnehmungen und Empfindungen. Sie ist besorgt: »Das ist gefährlich!« Meine Antwort: »Es ist einfach wunderbar!« Ich lege auf, überquere den Platz, kehre zurück in die Kabine und telefoniere wieder mit Trix: »Alles okay!« Wir beenden unser Gespräch. Hellwach schlendere ich durch die Altstadt nach Hause. Im Winter trägt Trix einen bordeauxroten Mantel. Sie fährt einen kleinen Ciao-Töff, später eine Vespa. Zusammen machen wir an Pfingsten einen Ausflug zu unseren Hippie-Freunden im Tessin. Auf der Hinfahrt regnet es in Strömen. Wir übernachten in Maienfeld, Graubünden, bei Nana, meiner Großmutter. Anderntags fahren wir durch den langen San-Bernardino-Tunnel, nein, wir schweben! Mir gefällt die unkomplizierte Art von Trix, ihre Ausstrahlung, das schelmische Lachen, der liebevolle Blick. Sie ist überall dabei. Wir leben schnell, die Beziehung verändert sich, wird zu einem Auf und Ab. Nach wenigen Monaten trennen wir uns. Ich finde in Norwegen eine neue Liebe. Mache mit ihr eine Reise nach Tunesien. Diese Liebe verläuft im Sand. Ich kehre zurück. Wieder in Zürich. Wieder mit Trix. Wieder ein Paar.
Neben dem Studium male ich, für mich allein und zusammen mit einer Gruppe junger Kunstbegeisterter. In einem feuchten Keller arbeiten wir an großen Gemeinschaftsbildern auf Papier. Für unsere Malsessions erfinden wir einfache Kompositionsregeln. Wir malen bis tief in die Nacht. Im Raum nebenan übt eine Rock-Band – The Toy for Juliette. Eines Tages taucht ein junger Hippie bei uns auf. Es ist ein Malaysier chinesischer Herkunft, der über Land von Kuala Lumpur nach Europa gereist ist. Wir nehmen ihn auf, organisieren eine Unterkunft. Der Beginn einer langen Freundschaft. Ein dichtes Jahr. Ich verkehre in der Zürcher Jugendbewegung, die aus dem Globuskrawall 1968 entstanden ist, und in der Kunstszene.
Seit der Mittelschule begeistert mich die Kunst. Ich male, stelle aus, besuche Vernissagen, beteilige mich an Happenings. Uns alle beschäftigt nach 1968 eine wichtige Frage: Was ist Kunst und für wen machen wir sie? Der Einstieg ins Geschichtsstudium fällt mir leicht. Unter linken Studentinnen und Studenten ist die Arbeiterbewegung zentrales Thema. Hans-Jürg Fehr (später Nationalrat und Präsident der SP Schweiz) ist ein Mitstudent und sagt über die Stimmung am Historischen Seminar der Uni Zürich: »In der Basisgruppe Geschichte setzen wir uns als Ziel, die verkalkten Strukturen des Historischen Seminars der Uni Zürich aufzubrechen. Die Professoren langweilen uns. Wir wollen auf Inhalt und Methoden unseres Studiums Einfluss nehmen. Wir fordern die Schaffung von Tutorenstellen, sodass ältere Studierende eine Lehrfunktion für uns jüngere übernehmen können. Wir wollen die Geschichte der Arbeiter zum Thema von Forschung und Lehre machen.« So festgehalten in meinem Buch über die 68er. Über die Geschichte der Arbeiterbewegung in der Schweiz weiß ich schon einiges von Neni, meinem Großvater väterlicherseits. Er war Schlosser und ging nach der Lehre als Geselle auf Wanderschaft. In Köln kam er in linke Kreise, wurde Sozialist. Zurück in der Schweiz arbeitete er für die Rhätische Bahn in der Werkstatt in Landquart, Graubünden. Er war Gewerkschafter, Mitglied der SP und der »Naturfreunde«. Es heißt, er habe vermittelt beim Generalstreik von 1918 und so Schießereien in Landquart verhindert. Ich bin stolz auf die Arbeiterbewegung und ihre Kampftradition. Der Landesstreik von 1918 beweist: Die Arbeiterbewegung kann ihre Interessen wirksam verteidigen. Ich bin Mitglied einer autonomen Lesegruppe um Peter Niggli, den ich durch die Progressiven Mittelschüler (PMZ) kennengelernt habe. Wir treffen uns außerhalb der Uni, studieren den Band 1 von Das Kapital von Karl Marx. Wir erarbeiten uns die Grundbegriffe Produktivkraft, Produktionsverhältnisse, Mehrwert, Unter- und Überbau und beschäftigen uns mit Wirtschaftsgeschichte. Wir wollen den politischen und kulturellen Wandel in unserer Gesellschaft besser verstehen. Ich lerne, Forschungsfragen zu stellen und selbstständig zu bearbeiten. Und ich begegne Elisabeth Joris, Adrian Knöpfli, Heiner Spiess und anderen, die sich ebenfalls für wirtschaftshistorische Fragestellungen und das Studium von sozialen Bewegungen interessieren.
Heinz Nigg, Zürich 1970
Heranwachsen
Meine Mutter Anni Bernhard ist in einer ländlichen Umgebung aufgewachsen. Von ihrem Vater, einem Weinbauern in Maienfeld, Graubünden, hat sie den Blick für schöne Landschaften. Wenn wir am Sonntag als Familie rund um Zürich durch Wälder und Wiesen streifen, beschreibt sie, was sich ihr als schön, hässlich oder bemerkenswert präsentiert. Ein kleiner Hügel, der unerwartet aus herbstlichem Nebel auftaucht, kann ihr ein »Oh!« entlocken. Sie hält kurze Vorträge über Wind, Licht und Schatten. Sie mag es, wenn wir ihre Beobachtungen kommentieren. Mein Vater Max ist Sohn des bereits erwähnten Schlossers. Wir besuchen die Großeltern jeweils in den Ferien in Maienfeld. Neni ist oft in seiner Werkstatt anzutreffen, repariert alles Mögliche, ist erfinderisch. Mein Vater war das erste Kind im Dorf mit einer modernen Skibindung mit Zugspannung. Von meinem Neni entwickelt. Wenn Neni sich vor dem Spiegel in der Küche nass rasiert, singt er alte Lieder. Er ist Dirigent eines gemischten Chors und hat eine hohe, helle Stimme. Wieder zu Hause in Zürich, wenn ich in heißen Sommernächten den Schlaf nicht finde, singe ich laut vor mich hin: »Olé, olé, kauft Ananas / Olé, olé, aus Caracas« von Vico Torriani und von Caterina Valente: »Tipitipitipso, beim Calypso sind dann alle wieder froh – im schönen Mexiko!«
Mein Vater kann wunderbar dirigieren – wie einer, der Luftgitarre spielt. Wenn im Radio Orchestermusik läuft, lädt er uns Kinder zum Konzert ein. Mein ein Jahr älterer Bruder Ernst und ich sitzen auf dem Boden. Wir warten gespannt, bis Vater den Musikern das Zeichen zum Einsatz gibt. Vater trägt sein Haar mit Brillantine nach hinten gekämmt. Während des Dirigierens geraten sie ihm wild durcheinander, sodass er sie mit der jeweils frei werdenden Hand zu bändigen sucht.
Interessant ist die Herkunftsgeschichte der Familie meiner Mutter, der Familie Bernhard. Die Bernhards waren Religionsflüchtlinge aus dem katholischen Tirol in Österreich. Sie wollten sich 1727 im Städtchen Maienfeld niederlassen. Ihrem Gesuch wurde gegen ein Entgelt von 240 Gulden entsprochen. Sie konnten nun nicht mehr aus Maienfeld vertrieben werden. Von den meisten Bürgerrechten blieben sie jedoch ausgeschlossen. 1817 wird einem Bernhard endlich das volle Bürgerrecht zugesprochen. Dieser muss 1848, im Jahr der Gründung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, auch noch seinen Sohn einbürgern lassen. Dieser Sohn heißt Christian und ist mein Urgroßvater. Die Bernhards waren Bauern. Sie waren auch als Werkmeister für das Städtchen Maienfeld tätig und an der Begradigung des Rheins beteiligt.
Meine Mutter, ältestes Kind einer elfköpfigen Bauernfamilie, ist 20, als sie meinen Vater heiratet und mit ihm nach Zürich zieht, wo er als kaufmännischer Angestellter Arbeit gefunden hat. In ihrem neuen Zuhause ist sie nicht nur für die Buben und den Haushalt verantwortlich. Als gelernte Schneiderin arbeitet sie auch für verschiedene Modehäuser. Es ist Heimarbeit. Sie näht Damenkleider im Akkord. Sie werden ihr bereits zugeschnitten in Kartonschachteln nach Hause geliefert. Diese Arbeit verlangt Konzentration. Wenn Mutter an der Nähmaschine sitzt, klettern wir Knirpse auf den großen Nähhocker, umklammern ihre Achseln von hinten und schauen über ihre Schultern gebeugt zu, wie ihre Finger flink und geschickt den Stoff unter der Nadel mit dem Faden hin und her bewegen. Wir Buben stellen nach der Schule mit unserer Zeit an, was wir wollen. Wir streifen mit anderen Kindern in der Nachbarschaft herum, bauen Hütten im Wald, treiben Unfug. Einmal klingelt ein Polizist bei uns zu Hause an der Türe. Er ermahnt unsere Mutter, besser auf ihre Kinder aufzupassen. Wir hatten Streit mit einem Knaben aus der Nachbarschaft und im Zorn seinen Schlitten über einen Zaun geschmissen. Die Arbeit meines Vaters ist für uns Kinder weniger einsehbar. Er arbeitet als Vermieter bei einer Stiftung für preisgünstiges Wohnen. Dauernd läutet bei uns zu Hause das Telefon – auch während der Mittagszeit und dem Abendessen. Vater nimmt Wohnanfragen entgegen, spricht Kündigungen aus, sucht neue Mieter, lässt in Absprache mit seinem Chef und dem Architekten der Stiftung Wohnungen renovieren. Er ist auch für den Hausfrieden in den vielen Mehrfamilienhäusern der Stiftung besorgt.
Familie Nigg-Bernhard: Mutter Anni, Silvia, Heinz und Ernst
Vater Max, Ernst und Heinz
Frühjahr 1956. Mein erster Schultag. Vor uns steht die Lehrerin: Fräulein Weiss. In violetten Stöckelschuhen, in violettem Kleid, mit violetter Handtasche. »Zeichnet euren Schulweg«, ist die erste Aufgabe, die sie uns stellt. Anstatt des Schulwegs zeichne ich meine Mutter, wie sie mir aus der Wohnung nachwinkt. Das Spielen zu Hause in der Umgebung unseres Mehrfamilienhauses und in unserer Nachbarschaft mit Bäumen und Buschwerk zwischen den Blöcken interessiert mich mehr als die Schule. Mit meinem Trottinett (Tretroller) drehe ich endlos Runden in unserem Hinterhof. Ich bin mit Maxli zusammen, der im Haus vis-à-vis auch wie wir im vierten Stock wohnt. Wir bauen eine Seilbahn und schicken uns Post von Balkon zu Balkon. Manchmal besuche ich ihn. Maxli besitzt ein Terrarium mit Spinnen und zwei Blindschleichen, die er mir auf den Arm legt: »Nur keine Scheu!« Maxli ist handwerklich begabt. Ich entwickle die Ideen und er setzt sie mit mir um. Beim Bau einer Hütte gelingt es ihm, das Fenster so zu montieren, dass wir die Ankommenden – Freund und Feind – frühzeitig sehen und entsprechend begrüßen oder vertreiben können. Im nahe gelegenen bewaldeten Bachtobel erkunden wir eine alte Fabrik mit Sägedach. In der Fabrik werden Limonadegetränke hergestellt und in Flaschen mit bunten Etiketten abgefüllt. Im Auskunftsschalter in der Einfahrt zur Fabrik ist das Klirren der Flaschen auf dem Förderband zu hören. Die Luft ist erfüllt vom Duft des süßen Getränks. Die nette Empfangsdame schenkt uns Schirmmützen aus Karton mit dem Aufdruck des Logos der Firma: AGIS. Gleich um die Ecke der Fabrik geht es zur Bildhauerei Schoop. Der Künstler ist alt, dünn, drahtig und fröhlich. Die Eltern von Maxli kennen ihn. Im Vorhof der AGIS-Fabrik besitzt der Künstler am Rand einer Baumgruppe ein Freiluftatelier. Bei schönem Wetter arbeitet er hier an seinen Skulpturen. Aus Stein gehauene Tiere, Menschen, abstrakt-geometrische Formen. Er zeigt uns, wie man Steine schleift. Er gibt uns Aufträge. Stundenlang sitzen wir zu zweit an der nassen und dann wieder staubigen Arbeit. Künstler Schoop stellt auch Tonfiguren her und schenkt mir zwei kleine rot gebrannte laufende Entlein. Maxli ist mein liebster Freund. Später verlieren wir uns aus den Augen. Er wird Tierpräparator, lebt lange in Afrika und findet eine Anstellung im Zürcher Zoo. Mit der Holdener-Bande, benannt nach zwei Brüdern in unserer Nachbarschaft, richten wir im Keller eines Abbruchhauses eine Geisterbahn ein. Gegen Entgelt schieben wir unsere Kundschaft im selbstgebauten Wagen mit Kugelkopfrädern durch mehrere Kellergänge. Bis in den stockfinsteren Kühlraum der ehemaligen Metzgerei. Mit Getöse lassen wir die schwere Türe ins Schloss fallen, brechen in Höllengeschrei aus. Wir verdienen uns ein Vermögen! Wir vagabundieren am Ufer des Zürichsees, schlüpfen durch einen Gitterzaun auf das private Areal einer Kies- und Sandtransportfirma, vergnügen uns auf einem vertäuten Ruderboot, bringen es kräftig zum Schaukeln. Niemand kann schwimmen.
Ich wünsche mir sehnlichst, im Wald eine richtige Hütte zu bauen, abschließbar. Mein Vater sagt, dass ich dafür eine Bewilligung vom Forstamt brauche. Mutig gehe ich aufs städtische Amt. Frage mich zur zuständigen Person durch. Ich fülle ein Formular aus. Nach monatelangem Warten erhalte ich die Erlaubnis. Inzwischen habe ich mich neuen Abenteuern zugewandt.
In der dritten Klasse gründe ich mit Freunden einen Indianerclub. Es gibt Krieger ersten und zweiten Grades, einen Häuptling und einen Medizinmann. Ich produziere eine Zeitung für unseren Club, für jeden der sieben Indianer – leider ist keine Squaw dabei – ein von Hand gefertigtes Unikat. Die Zeitung lädt ein zur nächsten Indianerversammlung mit Statuten. Das Wort bringt mir mein Vater bei. Logo des Clubs: Tomahawk und Friedenspfeife, gekreuzt und mit Federschmuck. Auf der hintersten Seite ein Witz-Comic aus der deutschen Jugendzeitschrift Rasselbande.
Ich lese Biografien von Indianerhäuptlingen. Der Jugendschriftsteller Ernie Hearting – Pseudonym für den Basler Ernst Herzig – verfasst jedes Jahr einen historischen Roman. Das Leben der Indianerhäuptlinge Nordamerikas, verfasst in verständlicher Sprache. Ich bin regelmäßiger Besucher der Stadtbibliothek in unserer Nachbarschaft. Ich leihe mir alle Bücher von Hearting aus. »Für die reife Jugend«, vermerkt der Autor im Vorwort. Sehnsüchtig warte ich auf den nächsten Band. Unvergesslich ist mir die Biografie von Rollender Donner. Als Häuptling der Nez Percés, die in den Rocky Mountains von Idaho und Montana lebten, erklärt er 1877 den Truppen der Vereinigten Staaten den Krieg. Die Weißen hatten alle Verträge gebrochen. Gegen die Übermacht der Blauröcke konnten die Nez Percés jedoch nicht ankommen. Viele wurden niedergemetzelt oder starben an Hunger und Kälte. In der fünften Klasse erwacht in mir der Wunsch, Indianerforscher zu werden.
Bis zur sechsten Klasse bin ich Schüler bei Lehrer Weidmann. Er unterrichtet im Schulhaus Kartaus im schönen Seefeld-Quartier. Die Aussicht von Zimmer 7 im obersten Stock ist atemberaubend. Auf der einen Seite sieht man den Zürichsee mit Zimmerberg und Albis, gegen Süden die Glarner Berge, gegen Osten die Wiesen des Wein egg-Hügels. Herr Weidmann ist bereits pensioniert, hat aber nochmals einen Klassenzug übernommen. Es herrscht Lehrermangel. Ernst Weidmann, Sohn eines Gärtners, ist in der Nähe der Weinegg aufgewachsen. Sein Vater wiederum kommt von Glattfelden im Zürcher Unterland. Von dort stammen auch die Eltern des Schriftstellers Gottfried Keller. Weidmann verehrt den Dichter. Im Schulzimmer hängt dessen Porträt. Er spricht liebevoll von »Göpf« und trägt uns regelmäßig Gedichte von Keller vor. So auch das Abendlied:
Augen, meine lieben Fensterlein,
Gebt mir schon so lange holden Schein,
Lasset freundlich Bild um Bild herein:
Einmal werdet ihr verdunkelt sein!
Trinkt, o Augen, was die Wimper hält,
Von dem goldnen Überfluss der Welt!
Die Worte berühren mich, weil Herr Weidmann sie mit Gefühl vorträgt. Wir dürfen auch Gedichte rezitieren. Einmal schenkt er mir ein Buch mit der Widmung: »Dem lieben Heinz, weil er ein schönes Gedicht auch wieder schön aufgesagt hat.« So lässt er uns immer wieder Zeichen der Aufmerksamkeit und der Ermunterung zukommen. Weidmann versammelt oft die ganze Klasse – wir sind 35 Schülerinnen und Schüler – um sein Klavier. Wir üben Lieder aus dem kantonalen Gesangbuch ein. Auch ist Weidmann ein begnadeter Zeichner. Er bringt uns die Benimmregeln im Schulzimmer bei, indem er sie an die Wandtafel schreibt und mit Kreidezeichnungen illustriert. Die Mädchen müssen im Schulunterricht Schürzen tragen. Also zeichnet er zwei Mädchen, das eine mit Zopf, das andere mit lustiger Wuschelfrisur. Gekonnt versieht er die Mädchen mit Schürzen und zaubert ihnen bunte Blumensträuße in die Hände. Wir Knaben müssen höflich sein wie Gentlemen. Flugs zaubert er ein paar Buben an die Wandtafel, die einem alten Hausmütterchen den Wagen mit Brennholz ziehen. Gerne erzählt Herr Weidmann von früher, als die Jugendlichen aus dem Seefeld mit denen vom benachbarten Hirslanden-Quartier Streit hatten und sie mit langen Bohnenstangen bekämpften. Er bringt uns altes Zürichdeutsch bei. Zum Beispiel »Ambitzgi« für Ameisen oder »Bachbummele« für die Sumpfdotterblume. Mit Disziplin und Freude am Spielerischen fördert Lehrer Weidmann den Klassenzusammenhalt. Er teilt uns in Gruppen ein, die bestimmte Aufgaben übernehmen müssen. Wir lernen Klassenrat halten, wählen und abstimmen: Wer übernimmt welche Aufgaben und wohin geht unser nächster Ausflug? Nicht alle mögen den Weidmann, weil er auch streng und verletzend sein kann. Am letzten Schultag hören wir aufmerksam seinen Abschiedsworten zu. Er ermahnt uns, zusammenzuhalten und uns an das Positive unserer Schulzeit zu erinnern. Bis heute trifft sich unsere Klasse regelmäßig. Neulich sandte mir Margrit – zusammen mit Esti unermüdliche Organisatorin unserer Klassenzusammenkünfte – eine Notiz aus der Quartierzeitung Neumünster-Post zu. Herr Weidmann äußert sich darin anlässlich seines 80. Geburtstags über seinen Beruf als Lehrer: »Meine Schüler haben mir viel gegeben. Sie hielten mich bis zuletzt wach. Die Lehrmethoden scheinen sich geändert zu haben. Man will die Schule erneuern, gehaltvoller machen. Gut so. Man nehme es mir nicht übel, meine Meinung zu sagen: Erstens gebe ich zu, dass auch ich in der Schule eine Menge Fehler gemacht habe. Zweitens sehe ich ein, dass manches besser gemacht werden kann. Unsere Methode mag zuweilen altmodisch gewesen sein. Am Ende aber kommt es auf den Lehrer an. In erster Linie auf den Lehrer. Weniger als die Methode entscheidet der Mann und die Frau, die vor den Kindern steht. Kinder beobachten genau. Sie urteilen bald. Sie beurteilen das Vorbild.«
Aufwachsen mit Medien. Als Vierjähriger sitze ich im Wohnzimmer am Boden, vor mir die farbigen Bilder vom Wolf und den sieben Geißlein der Brüder Grimm. Ich erschrecke, als ich die große Doppelseite aufschlage und sehe, wie der zähnefletschende Wolf in das Haus der Geißlein einbricht. Ich bin froh, als sich das Kleinste rechtzeitig in der Wanduhr verstecken kann. Weitere Angstgeschichten finden sich im Kinderbuch Struwwelpeter. Eine handelt von einem Knaben, der Daumen lutscht. Da kommt der Schneidermeister ganz geschwind mit der großen Schere. Weg ist der Daumen! Vom Stumpf tropft Blut. Ich sehe mich an einem Sechseläuten-Umzug, als mich die vorbeiziehende Zunft der Schneider in Panik versetzt, weil die vorbeimarschierenden Zünfter mit riesigen Scheren den Zuschauern die Hüte vom Kopf holen. Wie ich da um meinen Lutschdaumen bange! In der Geschichte Heidi von Johanna Spyri muss die kleine Heldin von ihrer Alp und dem geliebten Alpöhi Abschied nehmen, in die Fremde gehen. Ins ferne Frankfurt. Mutter erzählt uns von Heidis Exil so eindrücklich, als habe sie die Geschichte selbst erlebt. Unsere Mutter wuchs tatsächlich im selben Dorf auf, wo Johanna Spyri die Geschichte angesiedelt hatte, im büdnerischen Maienfeld. Mit 16 ging sie selbst in die Fremde. Zu einer wohlhabenden Familie, bei der sie ihr Hauswirtschaftsjahr absolvieren musste. Und natürlich hatte sie Heimweh nach ihren geliebten Bergen.
In den ersten drei Schuljahren ist es mir oft langweilig. Bei Lehrerin Weiss müssen wir im Rechenunterricht immer wieder Kärtchen mit Birnen, Äpfeln oder roten Punkten zusammenzählen. Mein Blick schweift aus dem Fenster hin zu einem alten Haus mit schönen Ornamenten an der Fassade. Ein imposanter Dachgiebel. Ein Vogel fliegt auf. Einzig die wöchentlich stattfindende Vorlesestunde bringt Abwechslung in den Schulalltag. Die Lehrerin erzählt uns die Geschichte von den Turnachkindern. Den Winter verbringt die wohlhabende Familie in der Stadt Zürich. Im Sommer bewohnt sie ein Landhaus am See. Die Kinder erleben allerlei Abenteuer. Im Schilf bauen sie eine Hütte. Mit einem Ruderbötchen fahren sie hinaus auf den See. Sie werden vom Unwetter überrascht. Ihr Vater rettet sie.
Die Bibliothek in meinem Wohnviertel ist in einer schönen alten Villa untergebracht, an der Neumünster-Allee. Bei meinem ersten Besuch ist es mir mulmig zumute – Eintritt in eine unbekannte Welt. Mein Bruder zeigt mir, wie ich die Bibliothekskarte ausfüllen muss. Schon bald bin ich Vielleser. Ich liebe die Kinderabenteuer von Kathrene Pinkerton, die in der kanadischen Wildnis handeln. Am Silbersee. Auf der Fuchsinsel. Zu Hause lese ich auch Der letzte Mohikaner von J. F. Cooper, den schon mein Vater in seiner Jugend gelesen hatte und der bei uns im Bücherregal steht, neben den Romanen von Gottfried Keller, Conrad Ferdinand Meyer und Jeremias Gotthelf. Ich lese alle Romane von Karl May. Die Bibliothekarin ist freundlich und schaut mich lieb an. Über die Jahre ergrauen ihre Haare. Am liebsten lese ich am Sonntag in der Früh, wenn die Eltern noch schlafen. Ungestört tauchen mein Bruder und ich in die Welt der Bücher ein. Detektivgeschichten faszinieren mich. Zum Beispiel die dänische Jugendbuchserie Jan als Detektiv. Oder die verschiedenen Buchreihen der englischen Jugendkrimi-Autorin Enyd Blyton. Abenteuer-Serie. Fünf Freunde. Und so weiter. In unseren Ferien in Maienfeld spielen wir Kinder in einer Burgruine unsere eigenen Krimis. Am Abend beim Zubettgehen erzählen wir uns die neuen Episoden der Krimis, die wir gerade lesen. Oder wir erfinden spontan unsere eigenen Storys. Ein schönes dunkelbraunes Radio steht in unserem Wohnzimmer, ein deutscher Telefunken-Apparat. Vater schwärmt vom weichen und tiefen Ton. Er mag populären Unterhaltungssound der 30er Jahre und leichte klassische Musik. Am liebsten hört er Tango. Meine Mutter macht sich nicht viel aus Musik. Beim Nähen ist das Rattern der Maschine zu hören. Doch die ganze Familie sitzt gebannt vor dem Radio, wenn ein Straßenfeger ausgestrahlt wird. Beim Sciencefiction-Hörspiel Mein Name ist Paul Cox landen Außerirdische. Sie verbergen sich in der Erdkruste. Und da ist dieses schreckliche Geräusch wie von einem riesigen Drillbohrer! Die Ankunft der Fremdlinge! Wir rücken näher zusammen im gelben Schein der Wohnzimmerlampe.
Wir besitzen keinen Fernseher. Ich bin deshalb oft zu Besuch bei der Familie Iseli. Die Mutter eines Nachbarjungen ist für mich die amerikanische Fernsehmutter aus Lassie. Sie lacht. Sie ist hübsch. Sie serviert uns Sirup. Ich darf auf einem bequemen Fernsehsessel Platz nehmen. Ausser Lassie und Fury gucken wir Mike Nelsons Abenteuer unter Wasser und die Serie Sprung aus den Wolken. Die Kindersendungen im Fernsehen interessieren uns weniger. Die Hörspiele für Kinder im Radio hingegen schon. Sie sind spannend. Dann kaufen die Eltern den ersten Fernsehapparat. Damit wir zu Hause die Olympischen Spiele in Rom verfolgen können. Am ersten Abend schauen wir uns eine Theateraufführung von Romeo und Julia an. Die dramatische, intime Liebesgeschichte direkt vor unseren Augen lässt mich erröten.
Mein Bruder und ich verbringen viel Zeit vor dem TV. Sobald die Eltern am Sonntag Bekannte besuchen oder einen Ausflug unternehmen, ziehen wir die Vorhänge im Wohnzimmer zu. Wir starten unseren Fernsehmarathon mit Werner Höfers Internationalem Frühschoppen, eine politische Diskussionsrunde. Gefolgt von einem Wochenmagazin mit Reportagen aus aller Welt. Am frühen Nachmittag gibt es einen Spielfilm für Kinder und anschließend einen für Erwachsene. Gegen Abend steht meine Lieblingssendung Es darf gelacht werden von Werner Schwier auf dem Programm mit Stummfilmen aus der guten alten Kintopp-Zeit. Werner Schwier, der Moderator mit Melone, kündet mit Bierhumpen in der Hand und lauter Jahrmarktstimme die Filme an. Mit der freien Hand gibt er dem Kinooperateur jeweils das Zeichen zum Abspielen des nächsten Stummfilms. Die Filme werden von einem Pianospieler live vertont. Anschließend folgen die Sportsendungen. Nach dem Abendessen schaut sich die ganze Familie den Sonntagabend-Spielfilm an.
Radio bringt mich mit Weltpolitik in Berührung. 1956, während des Ungarn-Aufstandes, ich bin in der ersten Klasse, wird direkt aus Budapest berichtet. Korrespondenten kommentieren mit dramatischer Stimme – Geschützfeuer im Hintergrund – die Straßenkämpfe. Bürgerkrieg. Auf dem Schulhausplatz spielen wir russische Panzer. Als Aufständische greifen wir die Panzer mit Molotowcocktails an. Im Jahr 1961 bin ich zwölf Jahre alt, als in Jerusalem der Eichmann-Prozess stattfindet. Eichmann wird für den millionenfachen Mord an Juden zur Verantwortung gezogen und zum Tod verurteilt. In den Nachrichten des Schweizer Radios wird regelmäßig darüber berichtet. Zum ersten Mal erfahre ich, dass vor nicht langer Zeit nicht weit weg von meinem Zuhause Konzentrations- und Vernichtungslager existierten. Ich bin geschockt, als ich von den Gaskammern erfahre. Und wie die Opfer zu Leichenbergen aufgetürmt wurden. Auf dem Schulweg erzähle ich meinen Freundinnen und Freunden, was ich im Radio gehört und in der Zeitung gelesen habe. Dieses mediale Ereignis prägt sich mir ein. Mit 14 lese ich den auf wahren Begebenheiten beruhenden Roman Mila 18 von Leon Uris über den jüdischen Aufstand im Warschauer Ghetto.
Mit dem Eintritt in die Oberrealschule Zürich ändern sich meine Lesegewohnheiten. Ich lese weniger Belletristik. Ich büffle Schulstoff, um mithalten zu können. Der Unterricht an dieser Knabenschule mit mathematischnaturwissenschaftlicher Ausrichtung ist streng. Als Ausgleich zum Notenstress treffe ich mich in der Freizeit regelmäßig mit meinen Schulfreunden Dieter und Roland. Wir besuchen Tanzveranstaltungen in den neuen Beat-Schuppen, sind Fans von Musik der Beatbands aus England. Während der Schulferien arbeite ich als Express-Fahrradbote für die Post. Mit dem Lohn leiste ich mir ein Transistorradio, eingebaut in ein kleines cremefarbenes Plastikgehäuse. Ich höre auf dem französischen Langwellensender Europe 1 Stars wie Antoine und Johnny Hallyday. Oder Françoise Hardy mit ihrem Hit Tous les garçons et toutes les filles se promènent dans les rues. In Mode sind Hemden mit Blumenmuster. Ich kaufe halbhohe Wildlederschuhe. Desert-Boots. Und rote Socken. Meine Mutter näht mir schwarze Twisthosen. Unten sind sie breit und fallen über die Schuhe. Dazu ein geeignetes dunkles Jackett. Mit Tigermuster. Um den Hemdkragen binde ich mir eine schwarze Bolo Tie. Wie die Teddy-Boys. Am Samstagabend gehen wir zu dritt ins Teen-Meet. Das ist eine Disco für Mittelschüler und für uns junge Männer die einzige Gelegenheit zu tanzen und Girls zu treffen. Im Zürcher Volkshaus sehen wir unsere erste Live-Band. »Casey Jones & the Governors«. 1965 stürmen sie mit dem Titel Don’t Ha Ha die Hitparaden.
Dieter, Roland und ich wohnen in verschiedenen Stadtteilen. Wir treffen uns meistens bei Dieter im Seefeld. Er besitzt ein elegantes kleines Motorrad, Marke Cilo. Mit Stoßdämpfern in der Vordergabel. Im Winter sitzt er auf seinem Mofa warm eingepackt in eine gefütterte amerikanische Armeejacke. Mit seinem Bruder, der an der ETH Elektroingenieur studiert, teilt er ein großes Zimmer. Der Bruder hat ein Vierspur-Tonbandgerät mit neuer Rock-und Popmusik. Er nimmt sie vom Radio auf. Ich habe noch nie ein solches Tonaufzeichnungsgerät gesehen. Zu Hause haben wir nur Radio und Fernsehen. Das Spulentonbandgerät ist ein technisches Wunderwerk. Man kann mit Tasten und Knöpfen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten vorwärts und rückwärts spulen. Von einer Spur zur anderen wechseln. Ich höre zum ersten Mal Mr. Tambourine Man von Bob Dylan. Im Zimmer der beiden Brüder steht ein Aquarium. Dessen violette Beleuchtung gibt dem Raum eine geheimnisvolle Aura. Wir rauchen Filterzigaretten. Sie werden uns von Dieters Bruder spendiert. Eine Zigarette pro Person und Treffen. Roland, der Dritte im Bunde, ist zwei Jahre älter als ich. Er wiederholte die Klasse und hat Mühe, dem Unterricht zu folgen. Auch ich bewege mich im unteren Notenbereich. Dieter ist ein ausgezeichneter Schüler. Er hat Stil, wirkt vornehm zurückhaltend. Er ist nie langweilig. Wir besuchen gern den Zeichenunterricht. Eines Tages führt uns Lehrer Faesi in die Plein-air-Malerei ein. Im Freien zeichnen und malen, und zwar in der Altstadt von Zürich. Wir lieben diese kleinen Expeditionen in das einzige malerische Quartier von Zürich. Wir sitzen auf Klappstühlen in engen Gassen. Mit Blick auf die nahe Limmat. Wir stellen Fassaden der Altstadthäuser perspektivisch dar. Dann färben wir die Skizzen bunt ein. Zürich sieht nun aus wie eine mediterrane Hafenstadt. Ernst Faesi ist ein ausgezeichneter Lehrer. Am Schluss der Malübungen decken wir uns an einem Marktstand mit Äpfeln, Birnen und Orangen ein. Bei diesen Pausen überrascht uns Dieter mit seinen Ansichten über das Leben. Er redet leise und leidenschaftlich. Er meint, dass es darauf ankomme, die Welt zu reflektieren. Sich auch als Erwachsener immer wieder Auszeiten fürs Malen zu nehmen. Daran sollen wir denken, wenn wir später als Architekten oder Geschäftsleute durchs Leben ziehen. Dieter unterbricht seine Reden manchmal mit einem abrupten Handzeichen. Wie wenn er uns zum Innehalten bewegen möchte. Einmal sagt er mit dringlichem Unterton: Auf »Kontemplation und ruhiges Schauen und Betrachten« kommt es an im Leben. Ohne »Muße« werden wir Menschen zu Maschinen. Dieter spricht mich an. Er gibt mir Halt. Befreit mich von meinen Ängsten, in der Schule zu versagen.
Faesi vermittelt uns auch Stilkunde. Wir lernen durch ihn impressionistische Malerei kennen. Vor allem Monet und Seurat haben es mir angetan. Zusammen mit Freunden aus meiner Klasse nehmen wir mit Mädchen der Frauenbildungsschule Kontakt auf. Wir organisieren ein gemeinsames Tanzfest. Einen sogenannten Fez. Wir gründen mit den Mädchen einen Kunstclub. Der Zeichenlehrer der Mädchen, Herr Portmann, besucht mit uns das Zürcher Kunsthaus. Er führt uns in die Bildbetrachtung ein. Direkt vor den Bildern der großen Namen des Impressionismus. Auch vor den Bildern von Kandinsky, Klee, August Macke, Franz Marc, Max Ernst, Picasso, Braque und Léger. Was ist eine Diagonale?, fragt er uns. Wie ergänzen sich Farben? Was ist eine Linie? Was bedeutet die Balance von Formen und Farben in einem Bild? Danach besuchen wir jeweils ein Restaurant. Im ersten Stock vom Zürcher Schauspielhaus. An einem großen weiß gedeckten Tisch flirten wir in gediegener und anregender Atmosphäre, diskutieren über Kunst.
Ich male. Ich kaufe mehrere Tuben Acrylfarbe, arbeite auf verschiedenen Bildträgern: Holz, Leinwand und Papier. An der Oberrealschule findet jedes Jahr ein Zeichenwettbewerb statt. 1966 wird das Thema »Baustelle« vorgegeben, weil unser Schulhaus einem Neubau weichen wird. Ich gebe gleich mehrere Werke ein. Eines davon entspringt einem Experiment. Angeregt von den Frottages