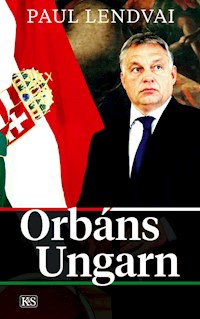20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecowin
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die politische Geschichte Österreichs: Eine zwiespältige Bilanz Ob Jörg Haider, Heinz-Christian Strache oder Sebastian Kurz: Österreichs Politiker haben in den vergangenen Jahren regelmäßig für Schlagzeilen gesorgt. Wie gelingt es charismatischen Persönlichkeiten immer wieder, an die österreichische Identität anzuknüpfen? Womit lassen sich die Erfolge des Rechtspopulismus in Österreich erklären? Und wo stehen das Land und seine politische Kultur heute, nach dem Schock der jüngsten Regierungskrise? Österreich-Insider und Journalist Paul Lendvai liefert eine messerscharfe Analyse der politischen Geschichte seiner Wahlheimat. Dabei schlägt er den Bogen von den Habsburgern, Persönlichkeiten wie Bruno Kreisky und Wolfgang Schüssel über den Aufstieg und Fall der FPÖ bis hin zum Ukraine-Krieg und der damit zusammenhängenden Gaskrise. - Österreich und seine politische Entwicklung: Eine differenzierte Problemanalyse - Auf der Suche nach Erklärungen: Erfolge der FPÖ und des Rechtspopulismus in Österreich - Paul Lendvai, preisgekrönter Journalist und intimer Kenner von Österreichs Politik-Szene - Ein Zeugnis der Zeitgeschichte: Aufschlussreiche Berichte über Begegnungen und Gespräche - Von Bruno Kreisky bis Sebastian Kurz: Schlüsselfiguren der politischen Geschichte Österreichs Zaungast der österreichischen Politik: Ein Blick hinter die Kulissen der Macht Jahrzehntelang ist Lendvai am Ballhausplatz ein- und ausgegangen. Die intensiven Hintergrundgespräche, die er mit einflussreichen Vertretern aller österreichischen Parteien geführt hat, sind das Salz in der Suppe seiner politischen Bücher. Heute bringt er Vergangenheit und Gegenwart zusammen, spürt den historischen Komplexen der Alpenrepublik nach und erklärt, was wir aus der Geschichte lernen können. Österreich, quo vadis? Lendvai zeigt auf, welche großen Linien die Politik Österreichs geprägt haben und liefert Einblicke in die Gedankenwelt charismatischer Entscheidungsträger.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
PAUL LENDVAI
VIELGEPRÜFTES ÖSTERREICH
Ein kritischer Befund zur Zeitenwende
Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren bzw. Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.
Gendererklärung
Der besseren Lesbarkeit wegen verwendet der Autor im nachfolgenden Text zumeist die Sprachform des generischen Maskulinums. Personenbezogene Aussagen beziehen sich auf alle Geschlechter.
1. Auflage
© 2022 Ecowing Verlag bei Benevento Publishing Salzburg – München, eine Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT
Gesetzt aus der Palatino, Bauer Bodoni
Umschlaggestaltung: nita. studio für visuelle gestaltung.
Umschlagmotiv: Fotografie (c) Florian Rainer
Autorenillustration: Claudia Meitert/carolineseidler.com
ISBN: 978-3-7110-0269-3
eISBN: 978-3-7110-5294-0
INHALT
Vorwort
Die Last der Vergangenheit
Mythos und Realität: Das Erbe der Habsburger
Hitlers Schatten, gestern und heute
Die Achterbahnfahrt der FPÖ: Von Friedrich Peter zu Jörg Haider
Österreich: Immer wieder »unter Beobachtung«
Karl Renner und Bruno Kreisky: Zwei große Persönlichkeiten der Sozialdemokratie
Geld statt Gesinnung: Der Niedergang der Sozialdemokratie
Die ÖVP, die ungewöhnlichste Volkspartei Europas
Von Wolfgang Schüssel zu Sebastian Kurz: Vom Original zur misslungenen Kopie
Die »echten« Österreicher und die Grünen
Österreich 2022: Ein betrübliches Sittenbild
Danksagung
Anmerkungen und Quellen
Literatur
Namensregister
VORWORT
Ich gehöre zu einer Minderheit mit einer Bindestrich-Identität in Österreich: als gebürtiger Ungar mit einem fremden Akzent in einem deutschsprachigen Land, als Jude unter Katholiken und Protestanten, ohne Verwandte im Land, da meine verstorbene Frau Margaret Engländerin war und meine geliebte Frau Zsóka eine waschechte Budapesterin ist wie ich.
Und trotz allem sage ich mit Joseph Roth in der Kapuzinergruft: Österreich ist »kein Staat, keine Heimat, keine Nation«, sondern »eine Übernation«, das einzige Land jedenfalls auch für mich, wo ich, wie weiland Roth, »zugleich Patriot und Weltbürger« sein kann. Das vorliegende Buch ist eine kritische Fortsetzung meines Werkes Mein Österreich – 50 Jahre hinter den Kulissen der Macht. Es war das beliebteste politische Sachbuch der Österreicher im Jahr 2008. Dieser »kritische Befund zur Zeitenwende« ist härter im Urteil über das politische Personal, aber – so hoffe ich – nicht ungerecht.
Diese Schrift eines vielgeprüften Neuösterreichers über ein vielgeprüftes Österreich, das mich, wie so viele vor mir, am 4. Februar 1957 aufgenommen und am 29. September 1959 eingebürgert hat, ist ein Produkt der kritischen Liebe und der tief verwurzelten Dankbarkeit, aber zugleich auch der Sorge um die Zukunft. Deshalb habe ich mit über 50 Politikerinnen und Politikern sowie Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens Gespräche geführt (ihre Namen stehen in der Danksagung am Ende dieses Buches), die zeitgeschichtlichen Analysen und Dokumente verarbeitet und meine persönlichen Erlebnisse zusammengefasst.
Ich beschäftige mich nicht mit der Frage »Was wird kommen?«, sondern mit den Lehren der Vergangenheit dafür, was wir vermeiden und was wir tun sollen. In diesem Sinne ist das Buch also ein Weckruf.
Wien, im Juni 2022
DIE LAST DER VERGANGENHEIT
Es war in den 1960er-Jahren, zur Zeit der ersten Verhandlungen über die Einbindung des neutralen Österreichs in die europäische Integration trotz des wachen Misstrauens der Sowjetunion als Signatarmacht des österreichischen Staatsvertrages: Bei einer Pressekonferenz des Präsidenten der Industriellenvereinigung, Franz Josef Mayer-Gunthof, für die Auslandspresse hatte der Wiener Korrespondent der New York Times, Mike Handler, leicht irritiert die Frage gestellt: »Warum spricht der Präsident, wie auch manche andere Gesprächspartner, stets über die ›besondere Position‹ dieses Landes?«
Mayer-Gunthof, der in Oxford studiert hatte, antwortete ihm in fließendem Englisch mit einem improvisierten Kurzreferat über den kurvenreichen Weg zur Zweiten Republik, vom Zusammenbruch der Doppelmonarchie über die NS-Zeit und den Zweiten Weltkrieg bis zur Erlangung der vollen Unabhängigkeit durch den Staatsvertrag. Er gehörte zur Gründergeneration und war stolz darauf, den ersten Nachkriegskredit für Österreich mit der Londoner Hambros Bank erfolgreich verhandelt zu haben. Als junger Wiener Korrespondent des Weltblattes Financial Times und wohl auch als frischgebackener österreichischer Staatsbürger (seit September 1959) war ich tief beeindruckt von seiner eleganten und überzeugenden Verteidigung des Opfermythos und des Sonderweges Österreichs zwischen den Blöcken.
Erst im Rückblick, nach mehr als 60 Jahren des Erlebens und des Studiums des »Österreich-Komplexes«1, konnte ich begreifen, wie tief mich bei meiner Beschäftigung mit der österreichischen Geschichte die Erinnerung an diese Szene und an viele ähnliche Gespräche mit dem damaligen Außenminister Bruno Kreisky und mit befreundeten Historikern wie unter anderen Adam Wandruszka und dem Sozialphilosophen Norbert Leser geprägt haben. Doch es besteht kein Zweifel, dass das unerschütterliche Grundgerüst meiner Haltung gegenüber Österreich vor allem in Krisensituationen bis heute auch die unendliche Dankbarkeit geblieben ist, dass dieses Land und seine Menschen mir, dem Zugereisten, wie Hunderttausenden anderen, in »finsteren Zeiten« (Bertolt Brecht) nicht nur einen Reisepass, sondern auch eine neue Heimat geboten haben.2
Trotz dieser Solidarität wäre es töricht, die unverkennbare Verschlechterung der innenpolitischen Lage und der internationalen Position des Landes in den letzten Jahrzehnten, vor allem seit dem Ende der Kreisky-Ära (1970–1983), zu übersehen. Als Auslandskorrespondent und später als Chefredakteur der Osteuropa-Redaktion des ORF und Intendant von Radio Österreich International habe ich nicht nur den Aufschwung unseres Landes, sondern auch die Umbrüche und Krisen, nicht zuletzt im Spiegel meiner Beziehungen zu maßgeblichen Politikern, erlebt. Diese persönlichen Eindrücke und Erfahrungen bestimmen auch meine Analyse der Wendungen in der Zeitgeschichte und der Rolle des Erbes der Vergangenheit in den nächsten Kapiteln.
Die Frage der Identität
Alles, was man auch heute über Österreich sagt, muss von der grundsätzlichen These ausgehen: »Es gibt kein geschichtliches Gebilde in Europa, dessen Existenz so sehr mit den Identitätsproblemen seiner Mitglieder verbunden ist wie Österreich.«3 Diese Feststellung stammt von Friedrich Heer, dem bedeutendsten Denker der Zweiten Republik. Dass dieser so produktive, noble Freidenker, »ein rückwärtsgewandter Prophet« (Gerhard Roth), trotz wiederholter Versuche keine Professur an der Wiener Universität bekommen hat, ruft den Fall von Sigmund Freud in Erinnerung. Der epochale Gründer der Psychoanalyse wurde wegen seines Judentums von der Universität ferngehalten, Heer wegen seiner offenen Geisteshaltung. Ich erinnere mich an unser letztes Treffen kurz vor seinem Tod. Er hatte einen Text zur Diskussion über die Provinzialisierung Österreichs in der Europäischen Rundschau verfasst und mich zu einem Gespräch in sein winziges Dramaturgen-Büro im Burgtheater eingeladen. Die Kluft zwischen seinem internationalen Ruf und seiner schäbigen Behandlung durch das offizielle Österreich provozierte und bestätigte zugleich seine bittere Diagnose: »Eine innere Geschichte der Zweiten Republik musste sich vorrangig mit der Verhinderung der Ausbildung kultureller Funktionen Österreichs durch Träger unserer beiden vorrangigen Nationallaster, Neid und uneigennützige Gemeinheit, beschäftigen.«4
Die Hass-Liebe-Hass-Beziehung so vieler österreichischer Schriftsteller zu ihrer Heimat hängt mit dem »Sonderfall Österreich«, mit der Gratwanderung zwischen der Dämonisierung im Ausland und der Verniedlichung im Inneren, geprägt von der Verstrickung des Landes in den Nationalsozialismus, zusammen. Das aus der Konkursmasse der von den Siegerstaaten des Ersten Weltkriegs zerschlagenen Donaumonarchie künstlich entstandene Restösterreich nannte man »eine Republik ohne Republikaner«, »ein Land ohne Existenzberechtigung«, »ein Land ohne Namen«, »einen Staatskörper ohne Herz«.
Diese Dialektik zwischen Außenbild und Selbstbild der Österreicher, die zur Herausbildung so vieler Klischees und Vorurteile geführt hat, kann nur vor dem Hintergrund des Zerfalls Österreich-Ungarns, der Schrumpfung eines Staatsgebildes von rund 680 000 auf knapp 84 000 Quadratkilometer und von 51 auf 6,5 Millionen Einwohner, der Verwandlung einer europäischen Großmacht mit dem »buntesten Völkergemisch Europas« (Friedrich Umlauft) in einen verstümmelten Kleinstaat begriffen werden, handelte es sich doch bei der Doppelmonarchie um flächenmäßig den zweitgrößten und nach Einwohnern den drittgrößten Staat Europas. Auch der Weg zum »Anschluss«, der Jubel nach dem Einmarsch der deutschen Truppen und der Massenrausch am Heldenplatz können ohne die mit dem Zusammenbruch der österreichischungarischen Monarchie verbundene Zäsur nicht erklärt und nicht verstanden werden.
Es ging in diesem »Staat, den keiner wollte« (Hellmut Andics) um »das österreichische Identitätsproblem im 20. Jahrhundert« schlechthin, darum nämlich, dass die Bürger »erst lernen mussten, Österreicher zu sein«5, zumal in der Monarchie die deutschsprachigen Bewohner einfach Deutsche genannt wurden. Sie sahen sich als die eigentliche Staatsnation nicht nur der deutschsprachigen Reichshälfte, sondern der ganzen Habsburgermonarchie. Dieser Staat wider Willen nannte sich »Deutsch-Österreich«, eine Republik, die »Bestandteil des Deutschen Reichs« sei. Infolge des Anschlussverbotes der Siegermächte musste Österreich seinen Namen von »Deutsch-Österreich« bald auf »Republik Österreich« umändern.
In seinem literarischen Testament, Die Welt von gestern, schrieb Stefan Zweig: »Zum ersten Mal meines Wissens im Lauf der Geschichte ergab sich der paradoxe Fall, dass man ein Land zu seiner Selbstständigkeit zwang, die es selber erbittert ablehnte.« Die politischen Eliten, allen voran die Sozialdemokraten, natürlich auch die Deutschnationalen, weniger die christlich-sozialen Konservativen, lehnten den Rumpfstaat ab. Sie alle, Karl Renner, Staatskanzler der Ersten und Bundespräsident der Zweiten Republik, ebenso wie Otto Bauer, sein Rivale und herausragender Kopf der Sozialdemokratie sogar noch im Exil, waren für den Anschluss an Deutschland.
Eine Geschichte aus den Memoiren des Bundespräsidenten (1957–1965) und ersten SPÖ-Vorsitzenden nach dem Zweiten Weltkrieg Adolf Schärf liefert den überzeugendsten Beweis, wie tief die Idee des Anschlusses verwurzelt war. Im Frühsommer 1943 widersprach Schärf in Wien einem deutschen Sozialdemokraten, der ihn und die österreichischen Genossen um die Unterstützung des geplanten Aufstandes gegen Hitler ersucht und davon geschwärmt hatte, dass der Anschluss auch nach Hitlers Niederlage aufrechterhalten bliebe: »Der Anschluss ist tot. Die Liebe zum Deutschen Reich ist den Österreichern ausgetrieben worden …« Der britische Historiker der österreichischen Geschichte, Gordon Brook-Shepherd, wies allerdings darauf hin, dass die berühmte Schärf-Aussage hierzulande »zwar oft zitiert wurde, doch hielt niemand von den Österreichern kurz inne, um sich darüber zu wundern, dass ein achtbarer und intelligenter Mann wie Schärf erst fünf Jahre unter den Nazis und Piefkes leben musste, um seinen alten sozialistischen Traum aufzugeben – und selbst dann nur, weil ein Deutscher versuchte, ihn am Leben zu erhalten.«6
In seinem großartigen Werk Der Kampf um die österreichische Identität wies Friedrich Heer darauf hin, dass der »permanente Bürgerkrieg« in der Ersten Republik 1918–1938 die Folge der gegensätzlichen, in Tiefenschichten verwandten Identitätskrisen von Österreichern gewesen sei. Über die Zahl von rund 540 000 im Jahre 1947 registrierten Nationalsozialisten hinaus7, Familien mitgerechnet, schätzte Brook-Shepherd, dass vor der Amnestie von 1948 ein Viertel der Bevölkerung vom Entzug des Wahlrechts betroffen war. Die Arisierung von 70 000 von Juden bewohnten Wohnungen, Geschäften und Unternehmen trug zum »Beginn einer einzigartigen Übung in Massenamnesie« bei, stellte Brook-Shepherd sarkastisch fest: »Zehn Jahre nach dem Anschluss und nicht einmal drei Jahre nach dem Ende des Hitler-Terrors hatten die Österreicher bereits begonnen, ihr Gedächtnis auszumustern und damit auch ihr Gewissen.«8
Friedrich Heer zeigt in seinem oben genannten Werk auch auf, dass die »heißen Eisen« der Identitätskrisen der Österreicher im Schatten der Besatzungsmächte von den führenden Politikern und den Medien verdeckt wurden. Erst nach dem Staatsvertrag von 1955 fragten sich die Menschen – sehr spät und sehr zögernd: »Was ist Österreich? Was ist der Österreicher? Welchen Lebenssinn [kursiv im Originalzitat] hat es, Österreicher zu sein? Gibt es eine österreichische Nation?«9 Heer beschreibt auch die leidenschaftliche Diskussion über die Existenz einer österreichischen Nation, die in der von Friedrich Torberg herausgegebenen Monatsschrift Forum 1955–1956 veröffentlicht wurde, ausgelöst durch die Warnung des Historikers Ernst Hoor vor der Berufung auf Österreichs Charakter als »zweiter deutscher Staat« und auf seine »deutsche Mission«. Er hatte die »antiösterreichische Geschichtsfälschung« angegriffen, die »das immer noch schwächliche Fundament unserer nationalen und staatlichen Gemeinschaft« untergrabe.
Das Bekenntnis zur österreichischen Nation
Damals und noch Jahrzehnte später handelte es sich bei den Debatten um die österreichische Nation keinesfalls um abstrakte Streitigkeiten. Im Jahr 1956 behauptete jeder zweite Befragte, dass die Österreicher keine Nation seien, auch 1964 bekannten sich nur 47 Prozent zu einer österreichischen Nation; allerdings meinten immerhin 23 Prozent, »die Österreicher beginnen sich bald als Nation zu fühlen«. Obwohl bis zum Ende der 1970er-Jahre der Anteil derjenigen, die sich zur österreichischen Nation bekannten, auf zwei Drittel stieg und der Anteil jener, die das nicht taten, auf 16 Prozent sank, blieb Heer in einem Ende 1978 veröffentlichten Artikel in der Solidarität, dem Organ des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, nach vielen Gesprächen mit Schülern, Gymnasiasten und Studenten sehr pessimistisch: »Noch immer wissen unsere Schüler über die neue Geschichte so viel wie gar nichts (…) Warum werden brennende Ereignisse weggewischt, überschwiegen oder verharmlost, die zum 13. März 1938 führten?? Die Gründe sind einfach: weil Geschichte weh tut. Nahezu alle älteren Österreicher, und hier bereits auch jüngere Jahrgänge, die aber durch ihre in der Ersten Republik Österreich und im Dritten Reich zu Erfolg oder Misserfolg gekommenen Väter und Mütter belastet sind – Familiengeschichte gehört zu den heikelsten Bereichen der Geschichte –, sind mit Narben behaftet. Mit Narben, von denen sie nicht gerne sprechen (…) Die Tragödie Österreichs besteht aus den Tragödien von Menschen, die mit ihren persönlichen Vergangenheiten nicht fertig wurden, auch heute noch nicht, wenn man sie ankratzt oder auch nur antippt, nicht fertig geworden sind und deshalb nicht darüber sprechen wollen. Und schon gar nicht wollen, dass ›ihre‹ Kinder, die ja gar nicht ihnen gehören, sondern dem Volkskörper, der Gesellschaft Österreich, in der Schule davon erfahren.«
Dass das deutsch-österreichische Problem auch grenzüberschreitende Aspekte aufwies, bestätigte die lebhafte Diskussion, die der umstrittene Aufsatz des Kieler Historikers Karl Dietrich Erdmann – »Drei Staaten – zwei Nationen – ein Volk?« – 1986 ausgelöst hat. Erdmann bezog sich damals auf die Bundesrepublik Deutschland, die DDR und – als dritten Staat und zweite Nation – Österreich. Er sprach sogar von der »Dreistaatlichkeit der deutschen Mitte Europas« oder vom »dreigegliederten Deutschland«. Die große Mehrheit der österreichischen Historiker lehnte Erdmanns Thesen vehement als »unzulässig« und »absurd« ab. Gerald Stourzh, der angesehene Geschichtswissenschaftler, warnte vor einer »Tendenz zur Wiedervereinnahmung« und vor einer Wiederbelebung großdeutschen Gedankentums, vor einer womöglich nicht nur musealen »Heimholung ins Reich«. Die grenzüberschreitende Debatte wurde vor allem hinsichtlich der Einbeziehung Österreichs in das Konzept für das geplante Deutsche Historische Museum in West-Berlin angezündet, zumal Erdmann auch der Sachverständigenkommission für das Museum angehörte.10
Die medial wirkmächtigste politische Kontroverse, ausgerechnet im Kontext des Gedenkjahres 1988 zur 50-jährigen Wiederkehr des »Anschlusses«, hat Jörg Haider, der damalige Landeshauptmann Kärntens, ausgelöst. In einem Fernsehinterview im ORF-Inlandsreport am 18. August 1988 bezeichnete Haider die österreichische Nation als eine »ideologische Missgeburt. Denn die Volkszugehörigkeit ist die eine Sache, und die Staatsangehörigkeit ist die andere Sache«. Dieser Ausspruch stand in der Tradition des Verhältnisses der FPÖ zum Deutschnationalismus und Nationalsozialismus. Später, noch unter Haider, schlug die FPÖ, die auch heute unter Herbert Kickl als »Heimatpartei« gilt, eine patriotische Linie ein, allerdings im Zeichen der unveränderten Fremdenfeindlichkeit.
Seit dem Staatsvertrag und dem Neutralitätsgesetz 1955 als identitätsstiftende Ereignisse wurde aus dem »Staat, den keiner wollte« allmählich »einer, den alle wollen« (Rudolf Burger). Trotz der Kritik an der Neutralität als inhaltsleere Formel wollten 2019 noch immer 79 Prozent der Befragten an der Neutralität festhalten.11 Auch die ausdrückliche Bejahung der österreichischen Nation hat bis 2007 eine Spitze mit 82 Prozent erreicht, 8 Prozent sehen Österreich auf dem Weg dahin. Nur 7 Prozent antworteten mit einem Nein.
Der neue Patriotismus
Die so rasche Identitätsbildung, wohl auch verbunden mit der wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte nach zwei Weltkriegen, nach dem Verlust zuerst der Großmachtstellung und dann der Unabhängigkeit, dürfte man auch im historischen Rückblick als fast beispiellos bezeichnen. Wie so oft hat auch in dieser Hinsicht Bruno Kreisky, der wohl bedeutendste Staatsmann Österreichs im 20. Jahrhundert, die treffendsten Worte gefunden. In einem langen Gespräch anlässlich des 25. Jahrestages des Staatsvertrags im Frühjahr 1980 sagte er mir unter anderem: »Der österreichische Patriotismus ist jedenfalls deshalb so überzeugend, weil er so selbstverständlich, so natürlich und so wenig plakativ ist. Die Formel des ›Deutschland, Deutschland über alles‹, die immer so verstanden wurde, dass es über allen sein soll, und jene österreichische Formel, dass alles Erdreich Österreich untertan sei, alle diese Formeln sind nicht mehr gültig für einen echten Patriotismus. Ein echter Patriotismus ist relativ still, will das eigene Land und stellt es gar nicht zur Diskussion. Es gibt unter jungen Leuten gar keine Diskussionen wie zu meiner Zeit, ob Österreich da sein oder bleiben soll oder nicht. Es ist ja auch verschwunden. Heute nimmt jeder mit größter Selbstverständlichkeit zur Kenntnis, dass Österreich so ist wie die Schweiz und dass es Österreich so geht wie Holland.«12
Von einer Deutschland-, Habsburg- oder Monarchie-Nostalgie kann seit vielen Jahren keine Rede sein. Im Gegensatz zu dem von Kreisky auch in seiner parlamentarischen Abschiedsrede (28. September 1983) gepriesenen »stillen Patriotismus« steht aber der bei Sportübertragungen zuweilen peinlich anmutende und auch im internationalen Vergleich rekordverdächtige Nationalstolz der Österreicher. In seinem grundlegenden Werk Die paradoxe Republik bietet der Historiker Oliver Rathkolb mit dem Schlüsselbegriff »Austrosolipsismus«, der permanenten, krankhaften Ichbezogenheit, eine Erklärung für den extrem überhöhten Nationalstolz, dessen fortdauernde Wurzeln er bereits in den Nationalkonflikten der letzten Jahrzehnte der Monarchie und in der dominierenden Stellung der deutschsprachigen Minderheit über die anderen Minderheiten (mit Ausnahme der Ungarn ab dem Ausgleich 1867) sieht. Hier fasst er auch die theoretischen Diskussionen über die Definitionen von Nation und Identität mit der Betonung des Trends zur allgemeinen Akzeptanz der österreichischen Nation als Staatsnation, als »politische Willensgemeinschaft«, zusammen.13
Ich komme noch zurück auf Anlassfälle für die permanente Selbstbespiegelung zwischen tief sitzendem Minderwertigkeitsgefühl und maßloser Überschätzung. Man sieht das Ausmaß des Erfolgserlebnisses und der Verwandlung der Zweiten Republik im Unterschied zur Ersten auch am Beispiel der Kennziffer über die Auswanderung der Deutschen nach Österreich. Heute sind die Deutschen die mit Abstand größte Gruppe unter den in Österreich lebenden ausländischen Staatsangehörigen. Am 1. Januar 2021 lebten 208732 deutsche Staatsangehörige in Österreich, verglichen mit 144 102 Anfang 2011. Wer hätte gedacht, dass das kleine Nachbarland das bevorzugte EU-Zielland deutscher Auswanderer sein würde? Braucht man einen besseren Beweis für die Überwindung des »Deutschland-Komplexes« im Zeichen der politischen und wirtschaftlichen Überlebensfähigkeit?
Es wäre trotzdem unklug, die Ergebnisse der diversen Meinungsumfragen über den so raschen Nationsbildungsprozess zum Nennwert zu nehmen. Eine im Juni 2019 durchgeführte empirische Online-Befragung über das österreichische Nationalbewusstsein ergab zum Beispiel nur einen Wert von 73 Prozent für die Bestätigung einer österreichischen Nation, statt 82 Prozent wie 2007 festgestellt. Diesmal sahen 7 Prozent Österreich auf dem Weg dorthin, 8 Prozent verneinten.14 Ob dieser überraschende Rückgang nur methodische Gründe hat, muss dahingestellt bleiben. Besonders deutlich ist die Ablehnung bei den Sympathisanten der FPÖ: Nur 69 Prozent sehen in Österreich eine eigenständige Nation, während 14 Prozent dies verneinen. Dieser mit Abstand höchste Negativ-Wert dürfte trotz der Betonung des Charakters der FPÖ als »Heimatpartei« durch die Parteispitze die starken deutschnationalen Wurzeln bei den Anhängern widerspiegeln.
Das große Schweigen
Ich will hier nicht den Erfolg der Identitätsförderung bestreiten, aber doch davor warnen, die großdeutschen Tendenzen und die Wirkung der familiären Traditionen, vor allem das Schweigen über die Verstrickung der Vorfahren oder Freunde in der NS-Zeit, außer Acht zu lassen. Ich rufe nur drei persönliche Erfahrungen in Erinnerung, die auch ich selbst verdrängt habe. Einer meiner ältesten Freunde war Prof. Dr. Adam Wandruszka (1914–1997), der herausragende Historiker, den ich in Warschau auf meinem Weg nach Österreich im Januar 1957 kennengelernt habe, er war damals Ressortchef für Außenpolitik der Presse. Er hat mir, wie auch unserem gemeinsamen Freund, dem amerikanischen Zeithistoriker Dennison Rusinow, bei der Knüpfung wertvoller Kontakte geholfen. Mit seiner Hilfe fand ich den Weg zur Presse als Ostkommentator und traf ihn auch in Köln, wo er zwischen 1959 und 1969 Professor an der Universität war. Er lud mich nach meinen Auftritten bei Werner Höfers TV-Frühschoppen mehrmals ein. Als ich ihn einmal fragte, warum er eigentlich in Köln und nicht an der Wiener Universität sei, erklärte er mir ohne Umschweife, er sei NS-Studentenführer gewesen und deshalb sei seine Berufung abgelehnt worden. Nachdem er 1969 doch Professor für österreichische Geschichte an der Wiener Universität wurde, habe ich ihn und seine italienische Frau von Zeit zu Zeit, auch zusammen mit dem nach dem »Anschluss« emigrierten, angesehenen amerikanischen Historiker Robert A. Kann, getroffen. Ich hörte von ihm seinerzeit nur, dass er sich in der amerikanischen Kriegsgefangenschaft im Lager Concordia im Bundesstaat Kansas 1943–1946 von seiner Vergangenheit distanziert hatte. Er hat jedenfalls zu den wenigen Österreichern gehört, die ihre Vergangenheit nicht beschönigt oder verschwiegen haben. Wie in so vielen ähnlichen Fällen habe ich ihn nicht gefragt, was er damals gemacht hat. Auch er hat mich nie gefragt, wie ich in Budapest die Judenverfolgung überlebt habe. Diese gegenseitige Zurückhaltung war in der damaligen Zeit eher die Regel als die Ausnahme. Erst bei den Recherchen für dieses Werk erfuhr ich aus einem Interview, dass Wandruszka sogar illegaler Nazi gewesen und bereits 1933 in die SA eingetreten war.15 Warum habe ich ihn nie über seine Vergangenheit gefragt? Wohl aus demselben Grund, warum ich in zwei anderen Fällen, mit noch engeren Freunden, heikle Themen vermieden habe.
Prof. Dr. Franz Gerstenbrand (1924–2017) war ein auch international angesehener Neurologe und Begründer der Komaforschung in Wien, der lange Jahre mich und meine später verstorbene Frau nicht nur behandelt hat – wir sind darüber hinaus auch enge Freunde geworden. Dass er auch mit Bundeskanzler Bruno Kreisky über die ärztliche Betreuung hinaus freundschaftliche Beziehungen gepflegt hat, trug zu unserer Eintracht bei. Er war in Mähren in der Tschechoslowakei aufgewachsen, war im Zweiten Weltkrieg Kampfflieger in der deutschen Luftwaffe, studierte und habilitierte sich an der Wiener Universität. Er stand mir in schwierigen persönlichen Situationen seelisch bei. Trotzdem sprach ich mit ihm nie über seine Vergangenheit. Auch dann nicht, als seine Frau mir erzählte, dass er ihr nach der Lektüre meiner Erinnerungen, unter anderem über den ungarischen Holocaust, gesagt habe, er schäme sich, ein Deutscher zu sein.Wohlgemerkt, nach vielen Jahren und Erfolgen in Wien bezeichnete er sich nicht als Österreicher. Auch diesmal schwieg ich und habe das Thema nicht angeschnitten. Wohl deshalb, weil ich Angst vor seiner Vergangenheit in der NS-Zeit hatte.
Im dritten persönlichen Fall ist es irgendwie umgekehrt. Ein sehr enger Freund von mir ist ein ehemaliger bürgerlicher Spitzenpolitiker und erfolgreicher Unternehmer, einige Jahre jünger als ich, der mir beruflich sehr viel geholfen hat. Wir haben uns sehr oft getroffen und uns immer offen über Politik und Wirtschaft unterhalten. Ich habe meiner Frau gesagt, falls mir etwas passiert, müsse sie sofort diesen Freund als Ersten kontaktieren. Selbstverständlich habe ich ihm auch alle meine Bücher sofort nach Erscheinen mit einer Widmung geschenkt. Während dieses halben Jahrhunderts der persönlichen Freundschaft erfuhr ich bloß, dass er als kleiner Junge bereits für die NS-Eliteschule Napola vorgesehen gewesen war. Er hat mich nie über meine Erfahrungen während des Krieges befragt, obwohl das alles in mehreren meiner Bücher detailliert geschildert ist. Ich vermute, dass er diese bis heute auch nicht gelesen hat.
Niemals vergessen!
Diese drei Fallbeispiele können als isolierte persönliche Erlebnisse registriert werden. Doch ich vermute, dass das von Friedrich Heer kritisierte Schweigen nicht nur die Lehrer, sondern auch die Generation der Großeltern und Eltern geprägt hat, vor allem in den Familien der schwer Belasteten und der Nutznießer der groß angelegten Arisierung von Zehntausenden Wohnungen, Geschäften und Unternehmen, vor allem in Wien. Die Juden sind – in einer Formulierung des französischen Historikers Jacques Le Goff – das »Gedächtnisvolk par excellence« geworden. Für jeden einzelnen Juden hat daher immer, so Elie Wiesel, der Schriftsteller, Holocaust-Überlebende und Friedensnobelpreisträger in einem Interview, die Maxime gegolten: »Jude sein heißt, sich zu erinnern.«16
Natürlich gilt auch für die österreichische Geschichte nach 1945 die Maxime Nietzsches, der seinen Lesern empfiehlt: »die Kunst und Kraft, vergessen zu können«, denn, so Nietzsche weiter: »zu allem Handeln gehört Vergessen« und »selig sind die Vergesslichen«.17 Doch für mich, wie wohl für die meisten von der Shoah direkt oder familiär betroffenen Menschen, kann vieles nicht einfach »vergeben und vergessen« werden. Ich habe immer wieder – so 1973 nach der Schließung des Transitlagers Schönau für russische Juden, 1986 zur Zeit der Waldheim-Affäre und 2000 nach der Bildung der ÖVP/FPÖ-Regierung – unser Land gegen Pauschalverdächtigungen mit voller Überzeugung in Reden und Artikeln im Ausland verteidigt.18 Ich anerkenne auch den unbestrittenen Wandel und die Leistungen bei der Aufarbeitung der Vergangenheit. Trotzdem oder gerade deshalb war ich vom Skandal um die unbeschreiblichen Liederbücher der schlagenden Verbindungen und die saloppe Art der Rechtfertigung durch die führenden FPÖ-Funktionäre (»Wir wussten es nicht«, »es wurde ja nicht gesungen«) tief betroffen. Auch der rasante Wiederaufstieg der FPÖ ab 2008 hat meine Besorgnisse über das nach wie vor große Reservoir der potenziellen FPÖ-Wähler bestätigt. Sowohl die vorher erwähnten Beispiele aus dem Freundeskreis wie auch die Vorgänge bei den Demonstrationen während der Pandemie lassen berechtigte Zweifel an der Stichhaltigkeit mancher schön klingenden Umfrageergebnisse über die Vergangenheit aufkommen.
Das zweifellos positivste Beispiel in dieser Hinsicht in meinem Bekanntenkreis war mein bester Freund und »Österreich-Lehrer«, der große katholische Journalist Kurt Vorhofer (1929–1995), mit dem ich im Laufe der Jahre unzählige Gespräche über die Gegenwart und die Vergangenheit geführt hatte. »Jetzt kommt wieder eine grausliche Geschichte …«, seufzte er, wenn ich mich an die Verfolgung 1944/45 in Ungarn erinnerte. Man muss allerdings hinzufügen, dass sein tiefes, aufrichtiges Verständnis auch durch die Lebensgeschichte seiner Frau Lydia mitgeprägt wurde. Sie hatte einen jüdischen Vater, den – ebenso wie zahlreiche Verwandte – die Nazis umgebracht haben. Sie, Jahrgang 1931, lebte mit ihrer Mutter, musste fast jedes Jahr die Schule wechseln, und ihre Jugendfreundinnen waren ausnahmslos auch »Halbjuden«. Sie wurde zwar eine gläubige Katholikin, aber die Narben blieben. Diese Ausnahmegeschichte in meinem Freundeskreis zeigt mir im Rückblick, dass die volle Wahrheit über die Nazi-Terrorherrschaft nur jene Menschen begreifen konnten und wohl auch wollten, deren Familien aus welchem Grund immer Anti-Nazi gewesen waren und die künftigen Generationen in diesem Sinne erzogen. Auf einem anderen Blatt stehen jene jungen Österreicher und Österreicherinnen, die bereits 1968, oder noch mehr nach 1986, ihre Eltern und Großeltern, ohne lockerzulassen, gezwungen haben, ihre Vergangenheit in der NS-Zeit aufzudecken.
MYTHOS UND REALITÄT: DAS ERBE DER HABSBURGER
Es war ein strahlender Sommertag, als am 30. Juli 1996 eine Privatmaschine aus der Schweiz in Hohenems landete. Der Pilot hieß mit vollem Namen Karl Thomas Robert Maria Franziskus Georg Bahnam Habsburg-Lothringen. Es war der damals 36-jährige Enkel Kaiser Karls I., der älteste Sohn von Otto Habsburg. Auf die Frage, ob er etwas zu verzollen habe, soll er Nein geantwortet haben. Im Gepäck führte er allerdings ein Diadem im Wert von nach diversen Schätzungen zwischen 50.000 und 105.000 Euro mit. Er habe das Diadem erst erwähnt, als sie angefangen hätten, die Maschine unter die Lupe zu nehmen, erklärten die Zöllner. Beim Finanzstrafverfahren beteuerte Habsburg hingegen, das Diadem von sich aus erwähnt zu haben. Nach seiner Berufung gegen eine Geldstrafe landete der Fall schließlich drei Jahre später beim Berufungssenat der Finanzlandesdirektion für Vorarlberg. Dieser bestätigte das Urteil der ersten Instanz und verurteilte Karl Habsburg wegen versuchten Schmuggels eines Diadems zu 13.081 Euro Strafe. In seiner Stellungnahme räumte Habsburg ein, er habe »vielleicht einen Fehler gemacht«, habe aber jedenfalls nie etwas schmuggeln wollen. Für den Senatsvorsitzenden handelte der Angeklagte aber keineswegs aus Unwissenheit, sondern mit Vorsatz.19
Trotz dieses Vorfalls wurde Karl Habsburg nach einem erfolgreichen Vorzugsstimmenwahlkampf im selben Jahr für die ÖVP zum Abgeordneten im Europäischen Parlament gewählt. Seine kurze politische Karriere endete mit dem sogenannten World-Vision-Spendenskandal. Diese internationale Wohltätigkeitsorganisation vermittelt Patenschaften für bedürftige Kinder in aller Welt. Ein Prüfbericht bestätigte beträchtliche Überweisungen von Spendengeldern (rund 46.500 Euro) an die Paneuropa-Bewegung Habsburgs. Ein Teil davon floss 1996 in die Finanzierung seines Wahlkampfs. Paneuropa-Österreich-Generalsekretär Wolfgang Krones und seine Frau, die Geschäftsführerin von World Vision Österreich war, wurden später rechtskräftig verurteilt. Karl Habsburg zahlte erst 2004 rund 37.000 Euro an den Verein zurück, die – laut Habsburg ohne sein Wissen – für die Finanzierung seines Wahlkampfes verwendet worden waren. Trotz öffentlichen Druckes trat er als EU-Abgeordneter nicht nur nicht zurück, sondern wollte im Juni 1999 erneut kandidieren. Nachdem die ÖVP ihn nicht wieder für die EU-Wahlen aufstellte, trat er mit der eigenen Liste CSA – Christlich-Soziale Allianz (Liste Karl Habsburg) an, konnte aber nur 1,5 Prozent der Stimmen gewinnen.
Dass sich der damals 86-jährige Otto Habsburg (selbst EU-Abgeordneter der CSU 1979–1999) hinter seinen Sohn stellte und die Angriffe gegen Karl mit der Judenverfolgung verglich, löste allgemeine Empörung aus. Der Chef des Hauses Habsburg habe jedes Maß, jedes Gefühl für Verhältnismäßigkeit verloren und sich selbst nach einer langen Europa-Karriere demoliert, schrieb die österreichische Publizistin Anneliese Rohrer und fügte hinzu, dies könne »nur der tragische Schlusspunkt unter eine Serie von Fehlverhalten seines Sohnes sein; einer Serie, die immer und immer wieder mit ›Blauäugigkeit‹, Naivität und Intrigen der anderen erklärt wurde«.20
Karl Habsburg, seit 2007 familienintern Oberhaupt des Hauses Habsburg, sorgte 2018/19 mit einer Beschwerde gegen die Bestrafung wegen der Verwendung des Adelszeichens »von« auf seiner persönlichen Website wieder für Aufmerksamkeit. Schließlich scheiterte er beim Verfassungsgerichtshof: Das »Von«-Verbot verstößt nicht gegen die Verfassung. Die Strafe für die Verwendung von Adelsnamen wird in dem alten Gesetz (vom 3. April 1919 über die Aufhebung des Adels) noch in Kronen angegeben. Deshalb gab es für Karl Habsburg keine Strafe, aber einen Schuldspruch.21 Abgesehen von diesen Gerichtsverfahren war der Kaiserenkel in den letzten Jahren kein Thema mehr. Erwähnenswert wäre noch, dass sein jüngerer Bruder, Georg Habsburg, nach einer wechselvollen Karriere in Ungarn Ende 2020 in den Dienst der Orbán-Regierung als ungarischer Botschafter in Paris getreten ist.
Nach dieser Rückblende auf die kleinen kompromittierenden Vorfälle im Leben des Trägers eines großen historischen Namens könnte man die Frage stellen: Warum ist das alles heute noch interessant? Warum sollte man sich damit beschäftigen?
Für die Behauptung, dass Österreich den Sturz vom Weltreich zum Kleinstaat auch nach einem Jahrhundert nicht verwunden hat, findet man in der politischen Kultur der Zweiten Republik keine Bestätigung. Für eine Sehnsucht nach einer monarchischen Bewegung, nach einer Restauration, gibt es nicht die geringsten Anzeichen. Zugleich sind aber die Spuren der Zeit der Habsburger, die das Land 640 Jahre lang regierten, im Bereich der Fremdenverkehrsindustrie und im Kulturverständnis der Österreicher und Österreicherinnen auch heute allgegenwärtig. Es dürfte kaum Demokratien in Europa geben, die so stark wie Österreich auf monarchischen Fundamenten aufbauen.22
Es vergeht auch jetzt kaum ein Jahr, in dem nicht mehrere Bücher über die historische Langzeitwirkung des Vielvölkerstaates oder die tragenden Persönlichkeiten der Habsburgermonarchie erscheinen. Der US-amerikanische Politikwissenschaftler A. Wess Mitchell würdigte als Schlussfolgerung seiner Studie über die Strategie des Habsburgerreiches den seither nie erreichten Grad der »geopolitischen Stabilität und des relativen Wohlstandes« im Herzen Europas.23 In ähnlichem Sinn beschrieb einmal der deutsch-böhmisch-amerikanische Schriftsteller Johannes Urzidil (1896–1970) die Donaumonarchie als eine »Hinternationale«. »Ein Reich, das hinter den Nationen mit ihrem Nationalismus zurückblieb, weil es so viele Völker und Nationen verknüpfte und damit in die Zukunft wies, in eine Zukunft, in der Mannigfaltigkeit und Einheit, nicht Vereinheitlichung, einander ergänzten: Die Donaumonarchie glich einem Anachronismus und war zugleich eine Verheißung.«24
In seinem glänzenden, 624 Seiten langen, 2021 erschienenen Werk über die Habsburger unternimmt der britische Historiker Martyn Rady eine Neubewertung der Herrscherfamilie (»das erste globale Unternehmen«) und schließt mit einer hierzulande kaum vorstellbaren ausführlichen Würdigung der Persönlichkeit Otto Habsburgs: »Er war wahrscheinlich der beste Kaiser, den die Habsburger niemals hatten.«25
Otto Habsburg – eine wechselvolle Geschichte
Vor diesem Hintergrund komme ich zurück zu meiner Begründung für die Schilderung der tragikomischen Abenteuer einer völlig unbedeutenden Figur, Überbleibsel einer historischen Entwicklung. Wenn man bedenkt, welche für das Schicksal Österreichs doch manchmal wichtige, wenn auch eher negative Rolle noch Otto Habsburg während des Zweiten Weltkrieges und dann in den ersten Jahrzehnten danach gespielt hat, kann man erst, im Spiegel des endgültigen Niederganges der einstigen Herrscherfamilie einer europäischen Großmacht, am hier gezeichneten erbärmlichen Beispiel des gegenwärtigen Oberhauptes, die Ironie der Geschichte ermessen. Deshalb habe ich mit diesem tragikomischen Schlusspunkt der Habsburger das Kapitel über die Spuren der Aristokratie in Gesellschaft und Politik begonnen.
Was die von dem Londoner Historiker Martyn Rady angeführte »herausragende Leistung« Otto Habsburgs betrifft, sind die positiven Seiten in seinem langen Leben (1912–2011) unbestreitbar: der konsequente Kampf für die Unabhängigkeit Österreichs und gegen Hitler-Deutschland, wenn auch zwischen 1935 und 1938 im Rahmen enger Kontakte mit dem Schuschnigg-Regime. Schuschnigg hat allerdings die Forderung Ottos nach der Übernahme der Kanzlerschaft mit Sondervollmachten abgelehnt. Otto Habsburg und seine Familie wurden nach dem »Anschluss« vom NS-Regime steckbrieflich gesucht, viele Monarchisten wurden verhaftet. Rady hebt auch die Rettung von einigen Tausend Juden in Frankreich durch Ottos persönlichen Einsatz und sein Engagement als EU-Parlamentarier für den europäischen Einigungsprozess und für die Aufnahme der osteuropäischen postkommunistischen Staaten in die EU hervor.
Es ist interessant, dass der britische Autor die Schattenseiten in Otto Habsburgs langem Leben ignoriert hat. Das starke Misstrauen der österreichischen Sozialisten und bürgerlichen Republikaner gegenüber den Mitgliedern des Hauses Habsburg ging auf Ottos Aktivität gegen die Provisorische Staatsregierung Karl Renners 1945 und seine späteren politischen Absichtserklärungen zurück. So forderte er in einem Brief an US-Präsident Harry Truman vom 2. Juli 1945 die Nichtanerkennung der Provisorischen Regierung – sie sei ein trojanisches Pferd der Kommunisten. Schließlich siedelte sich die Familie Habsburg im bayerischen Pöcking an. Von hier aus betrieb Otto Habsburg die Rückkehr nach Österreich. Manche Andeutungen von seiner möglichen Rolle als »Staatsnotar« oder »Justizkanzler« lieferten seinen Gegnern sozusagen auf silbernem Tablett die Argumente in dem 1961–1963 voll entbrannten Konflikt in der ÖVP/SPÖ-Koalition um die Einreisegenehmigung für Otto Habsburg.
Die Lunte der aus heutiger Sicht bizarr und unverständlich erscheinenden Habsburg-Krise begann im Juni 1961 zu brennen, als die SPÖ in der Koalitionsregierung die Zustimmung zu einem Antrag Bundeskanzler Gorbachs verweigerte, eine Herrschaftsverzichtserklärung Ottos als ausreichend zu akzeptieren. Kurz die Vorgeschichte: Nach der Gründung der Republik beschloss der Nationalrat ein Gesetz, demzufolge alle Habsburger, die nicht ausdrücklich auf ihre Herrschaftsansprüche verzichten, des Landes verwiesen sind und bleiben. Eine Rückkehr nach Österreich war ihnen nicht gestattet, solange sie nicht eine derartige Verzichtserklärung abgaben. Als der Verwaltungsgerichtshof 1963 entschied, dass Habsburgs Verzichtserklärung für eine Einreise ausreichend sei, kam es zu schweren Tumulten im Nationalrat. Die SPÖ versuchte eine mögliche Rückkehr Ottos als eine große Gefahr für die Republik zu stilisieren. Im Parlament stimmten SPÖ und FPÖ in einer zentralen Frage erstmals gemeinsam gegen die ÖVP, um seine Rückkehr trotz Beschlusses eines Höchstgerichtes zu verhindern. Unter der ÖVP-Alleinregierung reiste Otto Habsburg dann am 31. Oktober 1966 zum ersten Mal legal in Österreich ein – es gab keine Massendemonstrationen.
Das berühmte Foto vom »historischen Händedruck« Bundeskanzler Kreiskys bei einem Empfang im Bundeskanzleramt mit Otto Habsburg am 4. Mai 1972 am Rande der 50. Jubiläumstagung der von Habsburg geführten Paneuropa-Bewegung symbolisiert in den Geschichtsbüchern das öffentlich entkrampfte Verhältnis der österreichischen Sozialdemokratie zu den Habsburgern. Der älteste Sohn des letzten regierenden Kaisers wurde dann zum 95. Geburtstag von Bundespräsident Heinz Fischer zu einem Besuch in der Hofburg eingeladen. »Sie haben es aber schön hier«, meinte der Gast, und Fischer sprach von »einem langen und nützlichen« Gespräch. Er fügte noch hinzu, die österreichische Sozialdemokratie sei in der Zeit des Kaisers Franz Joseph I. oft als »k. u. k. Sozialdemokratie« bezeichnet worden, weil sie ja zunächst ein durchaus pragmatisches Verhältnis zur Monarchie gehabt habe.
Als Postskript zu Ottos wechselvoller Karriere muss seine besondere Beziehung zu Ungarn kurz erwähnt werden. Seine Rolle als Schirmherr beim legendären »Paneuropäischen Picknick« auf dem Grenzstreifen bei Sopron ging in die Geschichte ein, weil es im August 1989 hier zur ersten Flucht von 640 DDR-Bürgern über die österreichisch-ungarische Grenze führte und damit zum Auftakt der späteren Grenzöffnung wurde.
Otto Habsburg war von seiner Mutter Zita auch zum künftigen König von Ungarn erzogen worden und musste dementsprechend Ungarisch lernen. Sofort nach der Wende stattete er Ungarn einen Besuch ab. Seine erste öffentliche Rede in Ungarn hielt er dann, vielleicht symbolträchtig, vor der jüdischen Gemeinde in Budapest. Als ich ihn bei einer Konferenz von Auslandsungarn um 1996 in Budapest hörte, war ich, wie so viele andere Teilnehmer, über sein perfektes Ungarisch erstaunt. Einige Jahre später ließ er mich bei einer internationalen Konferenz in Prag, wo wir beide Vorträge gehalten hatten, zu sich rufen und führte mit mir ein längeres Gespräch auf Ungarisch. Zum letzten Mal traf ich ihn in Innsbruck bei einer Tagung, wo ich moderierte und Otto Habsburg, immerhin damals schon über 85, eine glänzende Rede über die Lage in Europa völlig frei, ohne Notizen, hielt.
Im Alter von 98 Jahren starb Otto Habsburg; er hinterließ 7 Kinder, 22 Enkel und 2 Urenkel. Sein Sarg wurde nach einer Messe im Stephansdom in der Kapuzinergruft und sein Herz getrennt in der Benediktinerabtei von Pannonhalma in Ungarn beigesetzt, als Zeichen seines Einsatzes für beide Hälften der Doppelmonarchie.
Es gibt übrigens verschiedene Schätzungen über die Zahl der Träger des Namens Habsburg. Weltweit zählt man über 400 Habsburger, rund zwei Drittel dürften in Österreich ihren Wohnsitz haben. Das Vermögen der Habsburger wurde auf rund 100 Millionen Euro und die Umwegrentabilität im Tourismus durch die Marke Habsburg auf 10 bis 30 Millionen geschätzt.26