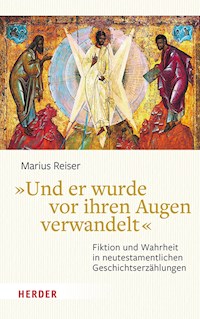Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Katholisches Bibelwerk
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Stuttgarter Bibelstudien (SBS)
- Sprache: Deutsch
In diesem Buch wird der Versuch gemacht, die Anfänge der Evangelien bis zum jeweiligen ersten öffentlichen Auftritt Jesu mit den Augen eines heidnischen Zeitgenossen der Evangelisten zu lesen. Dieser etwas jüngere Zeitgenosse ist Plutarch, der eigens vorgestellt wird und dessen Biographien und sonstige überlieferte Schriften ausgiebig zum Verständnis herangezogen werden. Dadurch rückt auch die Frage der "Mythen" in den Evangelien in ein neues Licht, und der Porträtcharakter dieser Biographien tritt deutlich hervor. Der sorgfältige Vergleich der Synoptiker untereinander und dieser wiederum mit Johannes soll die Unterschiede akzentuieren, aber auch die Einheitlichkeit des Gesamtporträts aufzeigen. Auf diese Weise lässt sich die Perspektivität der vier Porträts schärfer erfassen als bisher. Auch die Frage der historischen Zuverlässigkeit der Evangelien kann so differenzierter beantwortet werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
STUTTGARTER BIBELSTUDIEN 244
Begründet von Herbert Haag, Norbert Lohfink und Wilhelm Pesch Fortgeführt von Rudolf Kilian, Hans-Josef Klauck, Helmut Merklein und Erich Zenger
Herausgegeben von Christoph Dohmen und Michael Theobald
Marius Reiser
Vier Porträts Jesu.
Die Anfänge der Evangelien gelesen mit den Augen Plutarchs
© Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH,
Silberburgstraße 121, 70176 Stuttgart 2019
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Finken & Bumiller
Satz: SatzWeise, Bad Wünnenberg
Druck und Bindung: Sowa Sp. z o.o., ul. Raszynska 13,05-500 Piaseczno, Polska
Printed in Poland
www.bibelwerk.de
eISBN 978-3-460-51075-3
ISBN 978-3-460-03444-0
Vorwort
„Darauf allein kommt es an, daß wir von Christus ergriffen werden,“ schreibt Reinhold Schneider.1 Wenn es allein darauf ankommt, dann muß das Bild Christi, wie es die Evangelien zeichnen, einheitlich sein und historisch glaubwürdig. Beide Voraussetzungen werden in der modernen Exegese seit der Aufklärungszeit bestritten, freilich nicht eigentlich aufgrund von Ergebnissen historischer Forschung als vielmehr aufgrund von gewandelten weltanschaulichen Voraussetzungen und Prämissen. Diese Voraussetzungen und Prämissen kommen auch im Folgenden gelegentlich zur Sprache, sollen hier jedoch nicht Thema sein, da ich andernorts ausführlich darauf eingegangen bin.2 Dort habe ich meine hermeneutischen und dogmatischen Voraussetzungen begründet und zur Diskussion gestellt.
In diesem Buch geht es mir darum, die Einheitlichkeit des Bildes Jesu in seiner vierfachen Brechung aufzuzeigen und seine historische Glaubwürdigkeit. Da die Grundzüge des jeweiligen Porträts bereits in den ersten Kapiteln sichtbar werden, gehe ich so vor, daß ich den Text der Evangelien entlang gehe bis zum ersten öffentlichen Auftritt Jesu, mit dem er sein Wirken programmatisch beginnt. Es ist auffällig, daß wir auf diese Weise zu vier verschiedenen „ersten“ öffentlichen Auftritten geführt werden. Sie finden auch an vier verschiedenen Orten statt: nach Markus in der Synagoge von Kafarnaum, nach Lukas in der Synagoge von Nazaret, nach Matthäus auf dem Berg der Bergpredigt, nach Johannes im Tempel von Jerusalem. Nur im Fall des Markus- und des Lukasevangeliums mußte ich über das genannte Limit deutlich hinausgehen, damit man die Bearbeitung und Umgestaltung der markinischen Vorlage in den späteren Evangelien besser einschätzen und würdigen kann. Ein summarischer Blick auf das Ganze des jeweiligen Evangeliums durfte natürlich nicht fehlen.
Bei der genannten Fragestellung muß die historische mit der literarischen Betrachtungsweise verbunden werden, denn die historische Aussage ist nur zu gewinnen, wenn die literarische Gestaltung und Darstellungsabsicht des Autors verstanden ist. Und nur von der literarischen Darstellungsabsicht her lassen sich auch die Unterschiede der Synoptiker untereinander und dieser im Vergleich mit dem vierten Evangelisten begreifen. Zu diesen beiden Betrachtungsweisen soll hier als dritte eine sachliche Betrachtungsweise treten, die wenigstens ansatzweise versucht, die Absicht der Erzähler und das Dargestellte für heute verständlich zu machen.
Zur historischen Glaubwürdigkeit einer Quelle gehört, daß sie die sozial- und kulturgeschichtliche Welt, in der die erzählten Ereignisse spielen, richtig zeichnet. Zur Veranschaulichung dieser Welt und ihres Denkens, wie sie sich in den Evangelien spiegelt, dienen in den üblichen Kommentaren sogenannte „Parallelen“ aus der antiken Literatur und archäologischen Quellen. Ihr Erklärungswert für den kommentierten Text ist allerdings oft fragwürdig. Isolierte Zitate aus verschiedenen Autoren verschiedener Zeiten wirken nicht selten eher verwirrend als hilfreich.
Nehmen wir als Beispiel den in seiner Art ausgezeichneten Markuskommentar von Lars Hartman.3 Allein in den Anmerkungen zu Mk 1,1–13 und im ersten Exkurs zum Begriff „Evangelium“ werden neben der Septuaginta und den übrigen neutestamentlichen Autoren folgende frühjüdische Quellen zitiert: das Jubiläenbuch, die Psalmen Salomons, die Patriarchentestamente, die Paralipomena Jeremiae, das Leben Adams und Evas, die Schriften von Qumran, Philo und Josephus, außerdem der Talmud. Dazu kommen neben Inschriften und Papyri an heidnischen Autoren: Aristophanes, Posidonius, Diodorus Siculus, Strabo, Plutarch, Dio Cassius, Apuleius, Pseudo-Lukian, Galen; an frühchristlichen Autoren: Irenäus, Origenes, Basilius der Große, Johannes Chrysostomus. Für Benutzer, die die zitierten Autoren und Quellen vielleicht nur dem Namen nach kennen, ist es schwer, die Bedeutung eines einzelnen daraus zitierten Satzes oder eines längeren Passus für einen bestimmten Sachverhalt einzuschätzen. Da helfen auch vereinzelte erklärende Bemerkungen kaum weiter.
Deshalb ziehe ich in dieser Untersuchung zum Vergleich einen einzigen Hauptautor heran, den ich auch eigens vorstelle: den Philosophen, Historiker und Theologen Plutarch, der in diesen drei Sparten ein breitgefächertes Werk hinterlassen hat. Von seinen zahlreichen Schriften ist so viel überliefert, daß wir in der Lage sind, die Evangelien mit seinen Augen zu lesen. Das jedenfalls will ich hier versuchen. Plutarch hat zudem den Vorzug, daß er der einzige antike Autor ist, von dem nach Form und Darstellungsart mit den Evangelien vergleichbare Biographien überliefert sind. Im Vergleich mit ihnen sind es freilich vielfach weniger die Übereinstimmungen als die Unterschiede in der Darstellungsart, der Denkweise und dem Wertekanon, die erhellend und profilierend wirken. Mit seinen Ausführungen läßt sich auch das umstrittene Problem von Mythos und Historie genauer fassen und einer Lösung zuführen. Wir müssen ja fragen: Was ist eigentlich ein Mythos? Was hat man zur Zeit unserer Evangelisten darunter verstanden? Sind Mythen dasselbe wie Märchen? Oder eher so etwas wie Sagen? In welchem Sinn konnten antike Menschen daran glauben? Haben sie darin Wahrheit gefunden? Welche? Am Ende steht ein Gedankenexperiment: Hätte Plutarch einen Zugang zu den Evangelien und ihrem „Helden“ finden können? Eine eindeutige Antwort auf diese Frage ist naturgemäß unmöglich, aber Vermutungen sind erlaubt. Und wenn nach der Lektüre des Buches wenigstens so etwas wie ein geistiges Porträt des Autors Plutarch entstanden ist, wäre das ein erwünschter Nebeneffekt des durchgehenden Vergleichs.
Man wird sich vielleicht wundern, daß Probleme, die in der Exegese der letzten hundert Jahre mit größter Intensität erforscht und diskutiert wurden, in dieser Untersuchung fast gar keine Rolle spielen. Viele davon sind nur auf spekulativem Weg zu lösen. An historischen und literaturgeschichtlichen Spekulationen möchte ich mich hier aber nicht beteiligen. Das gilt etwa für die Frage nach schriftlichen Quellen des Evangelisten Markus, aber auch für die Frage nach der Herkunft des Überlieferungsmaterials, das Matthäus und Lukas über das ihnen von Markus Gebotene hinaus bieten. Man schreibt es gewöhnlich zwei Quellen zu: was Matthäus und Lukas gemeinsam haben, der sogenannten Logienquelle oder Q, alles andere mündlichen Sonderüberlieferungen. Selbst wenn es einmal gelingen sollte, die Frage der Natur (mündlich oder schriftlich?), des Umfangs und des Wortlauts der Logienquelle zur Befriedigung der Mehrheit der Gelehrten zu lösen, wäre das meines Erachtens von geringer Bedeutung für die wichtigen historischen Fragen.
Morna D. Hooker hat ein Büchlein geschrieben mit dem schönen Titel: „Beginnings. Keys that open the Gospels“ (London 1997).4 Ihre Anfänge sind allerdings schon äußerlich recht eng gefaßt (Mk 1,1–13; Mt 1–2; Lk 1–2; Joh 1,1–18). In diesen Anfangsteilen sieht sie den Schlüssel für das jeweilige Evangelium, der für die anderen nicht passen würde. Ich möchte den Begriff des Anfangs in dieser Untersuchung weiter fassen und nicht nur literarisch auf die Anfänge der Evangelien beziehen, sondern auch historisch auf die Anfänge Jesu und der Bewegung, die mit ihm beginnt. Denn für antikes, aber auch für heutiges Denken ist der Anfang einer Sache von großer Bedeutung. Man muß eine Sache richtig beginnen, damit sie gelingen kann. Die gelungenen Anfänge wiederum bestimmen das Ganze und können, wo es sich um die Identität einer sozialen Bewegung handelt, verpflichtenden Charakter haben. Nicht von ungefähr beginnt Markus sein Evangelium mit diesem Stichwort und will Lukas nach Auskunft seines Vorworts den Anfängen nachgehen. Auch Matthäus beginnt sein Werk mit einem historischen Anfang, wenn er bei Abraham einsetzt. Daß Johannes noch weiter zurückgreift bis zum Anfang schlechthin, hängt mit seiner besonderen Sicht der Dinge zusammen.
Ein Buch mit einem ähnlichen Programm hat Boris Repschinski veröffentlicht: „Vier Bilder von Jesus. Die Evangelien – alt, doch aktuell“ (Würzburg 2016). Es bietet freilich keine zusätzliche antike Perspektive und verzichtet ganz auf griechische Wörter.
Mein Buch ist ursprünglich als Vorlesung für Studierende konzipiert. Es ist in gewisser Weise das positive Gegenstück zu meiner „kritischen Geschichte der Jesusforschung“ (SBS 235), Stuttgart 2015. Es setzt kein spezifisch exegetisches Wissen voraus. Man kann es ohne die Anmerkungen lesen, die hauptsächlich den Belegnachweisen dienen und auf weiterführende Sekundärliteratur hinweisen. Da es in erster Linie um die Vorstellung einer bestimmten Sichtweise geht, die nicht zuletzt durch den Vergleich mit Plutarchs Biographien und sonstigen Schriften gewonnen wurde, kann ich nicht zu jeder Streitfrage die Auseinandersetzung mit anderen Positionen führen. Ein gewisser Ersatz dafür sind Literaturhinweise in den Anmerkungen.
Man lasse sich durch die vielfach eingestreuten griechischen Wörter nicht irritieren; alle sind übersetzt oder erklärt. Sie geben dem Ganzen Prägnanz, und ohne sie müßte vieles unerklärt bleiben. Textwissenschaft kann nun einmal nur am Text in der Originalsprache erfolgen. In der Liste der abgekürzt zitierten Literatur findet man neben Standardwerken der Forschung auch neuere Übersetzungen von Werken Plutarchs. Seine Biographien zitiere ich, gelegentlich modifiziert, nach der Übersetzung von Konrat Ziegler. Alle anderen Übersetzungen stammen, wenn nicht anders angegeben, von mir. Als griechischen Text benutze ich die Loeb-Ausgabe der Werke Plutarchs mit ihren ausgezeichneten englischen Übersetzungen und oft hilfreichen Einführungen und Anmerkungen. Seine Essays führe ich wie üblich mit den lateinischen Titeln an. Antike Autoren kürze ich nach dem Lexikon der Alten Welt und der Theologischen Realenzyklopädie ab. Die Abkürzungen von Zeitschriften, Reihen, und Standardwerken richten sich nach dem Internationalen Abkürzungsverzeichnis für Theologie und Grenzgebiete von Siegfried M. Schwertner (2. Auflage) und dem Lexikon für Theologie und Kirche (3. Auflage).
Für Hinweise und Kritik danke ich meinem Lehrer Gerhard Lohfink und meinem Freund Michael Stahl, für Hilfen aller Art Leonhard Hell. Michael Theobald danke ich für kritische Bemerkungen und die Aufnahme in die Reihe der Stuttgarter Bibelstudien, Dr. Michael Hartmann für die gute Betreuung.
Heidesheim, 25. März 2019
Marius Reiser
1R. Schneider, Der Starez, in: Ders., Macht und Gnade. Gestalten, Bilder und Werte in der Geschichte, Wiesbaden 1946, 159–165, hier 165.
2Vgl. M. Reiser, Bibelkritik; ders., Kritische Geschichte der Jesusforschung; ders., Die Autorität der Schrift im Wandel der Zeiten.
3L. Hartman, Mark for the Nations. A Text- and Reader-Oriented Commentary, Eugene (OR) 2010, xiii. Die schwedische Ausgabe erschien 2004/5.
4Deutsch unter dem Titel: „Biblische Ouvertüren“, Würzburg 1999. Für den Hinweis darauf danke ich Konrad Huber.
Inhalt
Vorwort
1.Vier biographische Erzählungen ohne biographische Absicht?
2.Die Biographien Plutarchs und die Evangelien
a)Form und Schwerpunkte
b)Historie und Biographie
c)Die Evangelien als Lebensbilder
d)Der grundlegende Anfang
3.Markus
a)Der Täufer als Anfang des Evangeliums
b)Der Herold
c)Der Auftakt in Kafarnaum
d)Der Umstrittene
e)Anfang, Mitte und Schluß
4.Matthäus
a)Genealogie, Träume und die wunderbare Geburt des Immanuel
b)Magier und Kindermord
c)Der Auftakt auf dem Berg
5.Lukas
a)Historie und Mythos
b)Geburtsgeschichten, Dämonen und Engel
c)Die Wahrheit der symbolischen Ebene
d)Ein Datum und eine andere Genealogie
e)Der Auftakt in Nazaret
f)Wie arbeitet ein antiker Historiker?
g)Lukas und seine Schwerpunkte
6.Johannes
a)Der Prolog
b)Der Täufer und die ersten Jünger Jesu
c)Das Wunder von Kana
d)Der Auftakt in Jerusalem
e)Die Eigenart des vierten Evangelisten
7.Die Evangelien als Geschichtsdarstellungen
a)Die Jagd nach der historischen Wahrheit
b)Plutarch als Leser der Evangelien: ein Gedankenexperiment
c)Mythos, Logos und Historie
Abgekürzt zitierte Literatur
1.Vier biographische Erzählungen ohne biographische Absicht?1
Im Jahr 1968 hielt der Historiker Christian Meier seine Antrittsvorlesung an der Universität Basel. Bei dieser Gelegenheit brachte er die Idee einer „multiperspektivischen Geschichtsschreibung“ ins Spiel.2 Nach seinem Abschied von der Universität im Jahr 2012 wurde der 85jährige in einem Interview gefragt, warum in seinen Büchern von dieser Multiperspektivität nichts zu finden sei. Er antwortete: „Ich habe das Projekt stillschweigend aufgegeben. Es ist für die Antike nicht zu praktizieren.“3 Doch die Antike selbst kennt ein Beispiel einer multiperspektivischen Geschichtsschreibung, aus der in christlichen Kirchen jeden Sonntag vorgelesen wird: die vier Evangelien. Sie stellen sowohl nach antiken wie nach modernen Kriterien biographische Erzählungen dar. Ihre Vierzahl wurde im Laufe der Geschichte immer wieder als Ärgernis empfunden, dem man mit sogenannten Evangelienharmonien zu Leibe rückte. Selbst Baruch de Spinoza fragt: „Wer wird aber glauben, daß Gott viermal die Geschichte Christi habe erzählen und den Menschen schriftlich mitteilen wollen?“4 Doch die Autorität der Kirche hat unbeirrt daran festgehalten. Über diese Vierzahl und diese Unbeirrtheit kann man sich nicht genug wundern. Wie kam es dazu?
Die moderne Forschung über das literarische Verhältnis der ersten drei Evangelien hat ein klares und, wie mir scheint, gesichertes Ergebnis gebracht: Das älteste Evangelium, das Matthäus und Lukas als Grundlage diente, ist das des Markus. Wer vom Werk des Markus ausgeht und damit das Evangelium des Matthäus einerseits und das des Lukas andererseits vergleicht, wird fast in allen Fällen leicht eine Erklärung finden, wie und warum es zu Änderungen, Kürzungen und vor allem Erweiterungen in den beiden anderen synoptischen Evangelien kam. Wer dagegen annehmen möchte, daß der Evangelist Markus das Werk des Matthäus oder das des Lukas oder gar beide vor sich liegen hatte und bearbeitete, um eine gekürzte Fassung herzustellen, wird nur mit sehr gewundenen und unwahrscheinlichen Erklärungen argumentieren können. Ich will drei Beispiele anführen.
In Markus 3,21 wird erzählt: „Als die Seinen davon hörten, zogen sie aus, um ihn zu fassen, denn sie sagten: ‚Er ist verrückt geworden.‘“ Markus schreibt einfach, wie es war und wie es ihm vermutlich Petrus erzählt hat. Es ist nun leicht zu erklären, warum sowohl Matthäus als auch Lukas diesen Satz übergangen und aus dem Kommen der Angehörigen nach Kafarnaum einen bloßen Besuch ohne bestimmte Absicht gemacht haben.5 Solche Dinge verschweigt des Sängers Höflichkeit. Aber wie will man erklären, daß Markus das unbedingt hinzufügen wollte, wenn er nur eine Kurzfassung des Matthäus- oder Lukasevangeliums herstellen wollte?
Ein zweites Beispiel ist die Darstellung des Unverständnisses der Jünger vor Ostern. Markus streicht es drastisch heraus; die Jünger verstehen bei ihm bis zum Schluß nicht, was die Worte und Taten Jesu eigentlich bedeuten. Matthäus und Lukas haben deutlich gemildert.6 Der umgekehrte Vorgang, daß Markus die Jünger bewußt negativer darstellen wollte als Matthäus und Lukas, wäre schwer denkbar.
Ein drittes, besonders instruktives Beispiel bewußter Bearbeitung bietet die Szene mit der Blutflüssigen, die von Markus mit einer geradezu modernen Realistik erzählt wird. Die geplagte Frau faßt von hinten an das Gewand Jesu und spürt auf der Stelle, daß sie geheilt ist.
Und gleich bemerkte Jesus in seinem Inneren, daß ihn Kraft verlassen hatte, er wandte sich in der Volksmenge um und sagte:
„Wer hat mich angefaßt?“
Da sagten seine Jünger zu ihm: „Du siehst doch, wie die Menge dich umdrängt, da fragst du noch: ‚Wer hat mich angefaßt?‘“
Doch er schaute sich um nach der, die es getan hatte. (Mk 5,30–32)
Matthäus hat den Wortwechsel einfach gestrichen. Im Kürzen ist er ein Meister, und daß die Jünger ihren Herrn so vorlaut und unwirsch anfahren, hat ihm sicher nicht gefallen. Lukas dagegen wollte auf diese lebhafte Szene nicht verzichten, und so brachte er nur kleine Verbesserungen an. Es fiel ihm vor allem auf, daß Markus als Erzähler hier als eigenes Wissen wiedergibt, was doch nur Jesus selbst wissen konnte: den erlittenen Energieverlust. Seine verbesserte Version lautet:
Da fragte Jesus: „Wer hat mich angefaßt?“
Als alle verneinten, sagte Petrus: „Meister, du bist mitten im Gedränge der Leute!“
Doch Jesus antwortete: „Es muß mich jemand angefaßt haben, ich habe doch gespürt, wie mich Kraft verlassen hat!“
Als nun die Frau sah, daß sie entdeckt war … (Lk 8,45–47)
Lukas hat die respektlose Einrede der Jünger abgemildert und sie Petrus in den Mund gelegt. Die Tatsache des Energieverlusts läßt er Jesus in direkter Rede selbst nennen als Begründung dafür, daß es nicht um das normale Angerempeltwerden geht. Die Sache mit dem Umschauen Jesu nach „der, die es getan hat“, wo man nicht entscheiden kann, ob das Femininum aus dem Wissen Jesu kommt oder aus dem des Evangelisten, konnte er ohne weiteres weglassen. Die Szene ist durch die behutsame Bearbeitung zweifellos psychologisch verständlicher geworden, aber die Abmilderung der spontanen Jüngereinrede bedeutet auch einen Verlust an Lebensnähe und Realistik. Außerdem ist damit ein unscheinbarer, menschlicher Zug an Jesus verschwunden: wie er die Respektlosigkeit der Jünger souverän ignoriert.
Können wir also, von Markus ausgehend, einen Weg zum authentischen Jesus finden? Das wurde und wird von einer bestimmten Forschungsrichtung, die ich als liberal-skeptizistisch charakterisieren möchte, entschieden bestritten. Eine repräsentative Stimme ist der im Jahr 1968 veröffentlichte Kommentar zum Markusevangelium von Ernst Haenchen. In der Einleitung schreibt er:
Schon W[illiam] Wrede erkannte 1901: ‚Markus hat keine wirkliche Anschauung mehr vom geschichtlichen Leben Jesu‘ (129). Wrede erkannte aber nicht, daß es Markus gar nicht auf die historia Jesu im Sinne eines historischen Berichts ankam.7
Was Wrede angeblich noch nicht erkannte, war eine „Erkenntnis“ Rudolf Bultmanns. Er schreibt:
Den Evangelien fehlt das historisch-biographische Interessse, und sie berichten deshalb nichts von Jesu menschlicher Persönlichkeit, seiner Erscheinung und seinem Charakter, seiner Herkunft, Bildung und und Entwicklung.8
Erfährt man aus den Evangelien wirklich nichts über Jesu Charakter? Nichts über seine Herkunft? Nichts über seine Bildung? Mit was für Augen muß man die Evangelien lesen, um solche Behauptungen aufstellen zu können? In der formgeschichtlichen Tradition, die von Bultmann ausging, sah man Markus im wesentlichen als Redaktor und Kompilator, dessen Leistung darin bestand, die ihm zur Verfügung stehenden Quellen in eine einigermaßen zusammenhängende Erzählung zu bringen. Da man mit Wrede annahm, daß er keine wirkliche Anschauung vom Leben Jesu mehr besessen habe, ja an der wirklichen Geschichte Jesu gar nicht interessiert gewesen sei, ging man davon aus, daß sich der Evangelist bei der Komposition seiner Erzählung ganz von theologischen Ideen, insbesondere der Theorie des Messiasgeheimnisses, leiten ließ.
Diese Auffassung vertritt auch Philipp Vielhauers Handbuch über „Die Geschichte der urchristlichen Literatur“. Es erschien 1975. Darin konnte man im Kapitel über das Markusevangelium lesen:
Es braucht nicht weiter ausgeführt zu werden, daß Mk trotz des „biographischen“ Rahmens keine wirkliche Biographie ist. Dazu fehlt ihm das Interesse am eigentlich Biographischen, an Jesu Herkunft, Bildung und inneren Entwicklung, an einem literarischen Porträt, kurz, an seiner „Persönlichkeit“. Dieser Mangel beruht nicht nur auf der Lückenhaftigkeit der vorhandenen Tradition, sondern ist in dem Verkündigungscharakter des Evangeliums begründet.9
Der Anklang an Bultmann ist deutlich. Deutlich ist aber auch, daß diese Beurteilung der Befunde nicht durch den Vergleich mit antiken Biographien und literarischen Porträts entstanden ist, sondern von modernen Biographien herkommt. „Das eigentlich Biographische“, das der Autor bei Markus vermißt, hätte ihm auch Plutarch nicht geboten, sowenig wie eine vollständige Darstellung von der Wiege bis zur Bahre, eine genaue, korrekte Chronologie oder die Schilderung aller Umstände, die zum Verständnis der Laufbahn und der Geschehnisse nötig wären. „Eine antike Biographie gibt ein Paradeigma, ein Exemplum, ein Beispiel und nicht einen Entwicklungsroman.“10 Damit ist auch die Erklärung des vermeintlichen Mangels hinfällig. Denn warum soll der Verkündigungscharakter der Evangelien ein Desinteresse am eigentlich Biographischen begründen? Das Gegenteil ist der Fall. Gerade weil es in ihnen um Verkündigung ging, durften sie nicht mit Fiktionen und Verzerrungen der wirklichen Geschehnisse aufwarten.
Wie lebendig die Sichtweise, die wir bei Bultmann, Haenchen und Vielhauer finden, noch heute ist, zeigt das im Jahr 2017 publizierte „Jesus Handbuch“. Darin lesen wir, das Markusevangelium sei „keine ‚historische Erzählung‘, die als Gesamterzählung den Zugang zu Jesus von Nazaret eröffnet.“11 Die vielen charakteristischen Akzente, die Markus biete – man denke etwa an den zitierten Wortwechsel bei der Heilung der Blutflüssigen –, seien „vermutlich zumeist literarische Konstrukte und keine historische Reminiszenzen“.12 Diese Konstrukte sollten angeblich ein Dilemma der Urgemeinde lösen, das Dilemma nämlich, daß man Jesus im Gottesdienst als Messias und Gottessohn verehrte, obwohl man kein Zeugnis hatte, daß Jesus das auch nur beansprucht hätte. Aber woher wissen diese Exegeten, daß die Urgemeinde kein Zeugnis darüber hatte? Sämtliche Zeugnisse jedenfalls, die wir haben, auch die frühesten, gehen davon aus, daß Jesus diese Würde in Anspruch nahm und besaß. Und nur damit lassen sich die historischen Vorgänge wirklich erklären. Das angebliche Dilemma ist nicht ein Problem der Urgemeinde, sondern eine exegetische Konstruktion. Übrigens war Wrede hinsichtlich der Frage, ob Jesus sich für den Messias gehalten hat, noch zurückhaltend; erst Rudolf Bultmann verneinte sie pauschal.13 Neuere Untersuchungen sind zwar bereit, einen gewissen historischen Charakter des Markusevangeliums anzuerkennen, kommen über die formgeschichtlichen Vorurteile aber immer noch nicht hinweg.14
Gegen die angeblich lange und verwickelte mündliche Tradition, die nach formgeschichtlicher Auffassung hinter Markus und den Synoptikern insgesamt stand, wandte der Utrechter Neutestamentler Willem Cornelis van Unnik bereits 1972 folgendes ein:
Wieso weiß man eigentlich, daß hinter dem, was die synoptischen Evangelien bieten, eine lange mündliche Tradition steht, in der sich allerlei theologische Änderungen vollzogen haben, die das ursprüngliche Geschehen bis zur Unkenntlichkeit entstellt haben? … Wenn ich nach mehr als vierzig Jahren Erinnerungen an meine Studentenzeit schreiben würde, würden diese dann lediglich auf einer langen mündlichen Überlieferung beruhen?15
Aber solche Einwände werden von den Vertretern der Formgeschichte bis heute als simplizistisch vom Tisch gewischt. Eine neue wissenschaftliche Auseinandersetzung über diese Fragen wäre dringend notwendig. Aber Kontroversen sind in der Exegese merkwürdig selten geworden.
Das Zeugnis des Papias über die Verbindung des Markus mit Petrus hält man aufgrund der referierten Vorurteile für unhistorisch. Udo Schnelle meint in seiner „Einleitung in das Neue Testament“ von 1999:
Weder läßt sich hinter dem Markusevangelium petrinische Theologie feststellen, noch spielt Petrus eine über die Vorgaben der Tradition hinausgehende Rolle im Markusevangelium. Niemand würde hinter der eigenständigen Theologie des Markusevangeliums die Person des Petrus vermuten, wenn es nicht jene Papiastradition gäbe!16
Das ist ein merkwürdiger Einwand gegen ein historisches Zeugnis. Unter der „eigenständigen Theologie des Markusevangeliums“ versteht Schnelle lediglich die angebliche „Theorie“ des Messiasgeheimnisses. Und woher weiß er über die „petrinische Theologie“ und „die Vorgaben der Tradition“ vor Markus Bescheid? Die prominente Rolle des Petrus in diesem Evanglium ist jedenfalls augenfällig. Martin Hengel hat darüber gründlich geforscht und, wie mir scheint, richtig geurteilt.17
Über die Natur der Tradition, aus der Markus schöpfen konnte, falls es nicht hauptsächlich die Erzählungen des Petrus waren, können wir nur spekulieren. Auch vierzig Jahre nach den Ereignissen lebten jedenfalls noch genug Leute, die aus eigener Erfahrung oder aus den Erzählungen von Zeugen wußten, was geschehen war, und gegen grobe Verfälschungen der Tatsachen Einspruch erhoben hätten. Es war um das Jahr 70 n. Chr. sicher keine Schwierigkeit, noch Augenzeugen und verläßliche Tradenten zu finden. Darum hat sich ein antiker Historiker, der Zeitgeschichte schreiben wollte, vor allem bemüht. So bemerkt Plutarch, wer sich an ein Geschichtswerk machen wolle, benötige viele Bücher; doch für alles, „was den Autoren der Bücher entgangen, aber im Gedächtnis bewahrt und sicher genug beglaubigt“ sei, müsse man „sich auf Gehörtes verlassen und Erkundigungen einziehen, um ein Werk liefern zu können, in dem nichts von dem Erforderlichen fehlt“.18
Markus benötigte nicht viele Bücher, aber daß er Erkundigungen einzog, deutet er an einer Stelle seines Evangeliums sogar an, nämlich dort, wo er von Simon von Cyrene sagt, er sei der Vater von Alexander und Rufus gewesen (Mk 15,21). Die beiden Namen der Söhne, die in seiner Erzählung gar keine Rolle spielen, kann er bei den Adressaten offenbar als bekannt voraussetzen. Aber warum hat er sie überhaupt erwähnt? Offensichtlich doch nur als Zeugen oder Tradenten der Szene, die er gerade erzählt, und vielleicht nicht nur dieser Szene. Diese Art der indirekten Quellenangabe kennt auch Plutarch.19 Und es ist bemerkenswert, daß Paulus im Römerbrief einen Rufus und seine Mutter grüßen läßt (Röm 16,13). Die Wahrscheinlichkeit, daß dieser Rufus mit dem von Mk 15,21 identisch ist, kann man nicht einfach abstreiten.20
Im übrigen läßt sich die historische Zuverlässigkeit des Markusevangeliums an vielen Einzelheiten nachweisen, etwa im Lokalkolorit (z. B. „das galiläische Meer“) oder in der Darstellung der Pharisäer und Sadduzäer. Wir sollten uns also nicht so sehr in Spekulationen über die Quellen des Markus und seiner Nachfolger ergehen, sondern uns an das halten, was wir tatsächlich haben, und die Evangelien als das nehmen, was sie offenkundig sein wollen: biographische Porträts Jesu von Nazaret, der sich in den Osterereignissen endgültig als Sohn Gottes erwiesen hatte. Ihren historischen Wert muß man mit den üblichen Mitteln der historischen Wissenschaft beurteilen, das heißt vor allem: mit Hilfe von historisch verwertbaren Angaben und Indizien.21 Dazu gehört aber zunächst, daß man sich durch eine sorgfältige Lektüre mit der Darstellungsart des Autors vertraut macht, wie es Hermann Fränkel in einer klassischen Studie zu Cäsars Gallischem Krieg vorgeführt hat.22 Nur so wird deutlich, was der heutige Leser von der jeweiligen historischen Darstellung erwarten kann und was nicht.
Bemerkenswert zu unserem Gegenstand ist das Urteil eines bedeutenden katholischen Exegeten der Nachkriegszeit: Josef Schmid.23 Seine Kommentare zu den Synoptikern, die Ende der fünfziger Jahre des letzten Jahrhunderts erschienen, gehören meines Erachtens immer noch zu den besten, die wir haben. Zu Beginn seines Matthäuskommentars gibt er einen Überblick über „Die Evangelien als Quellen des Lebens Jesu“. Da liest man: Die Evangelien „wollen weder eine Biographie Jesu liefern noch sein Charakterbild zeichnen. Das historische und biographische Interesse tritt in ihnen ganz zurück hinter dem lehrhaft-religiösen. … Sie sind keine literarischen Kunstwerke, die einer schriftstellerischen Persönlichkeit ihr Dasein und ihre Gestalt verdanken, sondern Sammelwerke, die aus einer großen Zahl von Einzelstücken, seien es Erzählungen oder Worte Jesu, zusammengesetzt sind. … Damit ist auch gesagt, daß sie Dokumente des urchristlichen Gemeindeglaubens sind.“24
Mit diesen Urteilen wollte Josef Schmid offensichtlich den Auffassungen Rudolf Bultmanns und seiner Schule entgegenkommen.25 Aber er sah sehr wohl, daß diese Auffassungen den historischen Skeptizismus dieser Schule nicht rechtfertigen konnten. Deshalb fährt er fort:
Wenn die Evangelien der schriftstellerischen Art nach von den griechischen Geschichtswerken ihrer Zeit verschieden sind und ihr Zweck überhaupt nicht Geschichtsschreibung ist, so ist doch klar, daß ihr Inhalt als wirklich geschichtlich geschehen verstanden werden will, und zwar sogar in höherem Ausmaße als bei den Werken der griechischen Geschichtsschreibung. Sie wollen zwar nicht das Leben Jesu in biographischer Form erzählen, sondern das in Jesus Christus erschienene Heil verkündigen. Sie tun dies aber in der Weise, daß sie von dem sprechen, was Jesus … wirklich getan und gesprochen hat. Das Christusbild, das sie zeichnen, ist das des urchristlichen Glaubens. Aber damit ist nicht gesagt, daß dieses Bild auch falsch, erst selbst eine Schöpfung des Gemeindeglaubens sein muß, weil dieser Glaube nicht anders denn als schöpferisch, umgestaltend verstanden werden könne.26
Damit ist die zentrale These Rudolf Bultmanns abgelehnt. Josef Schmid begründet diese Ablehnung anschließend mit guten Argumenten und weist auf Befunde hin, die vom „unverfälschten ‚Erdgeruch Palästinas‘“ zeugen. Sein Fazit lautet:
Nicht zuletzt spricht aber der Gesamteindruck des Christusbildes der Evangelien, seine Geschlossenheit und einmalige Größe, die Verbindung echt menschlicher Züge mit hoheitsvoll-göttlichen, für seine Glaubwürdigkeit. Darin liegt der Grund, warum es nicht durch Geschichte, Legende und Mythos zusammen erst geschaffen sein kann. Der Christus der Evangelien, welcher der des urchristlichen Glaubens ist, ist darum kein anderer als der geschichtliche Jesus, und das durch die Evangelien überlieferte Bild von ihm verdeckt den Späteren deshalb nicht den Blick auf den wirklichen Jesus der Geschichte.27
Wenn dieses Fazit richtig ist – und ich halte es für richtig –, dann muß man die Aussagen Josef Schmids über das mangelnde biographische Interesse der Evangelisten allerdings stark modifizieren. Das gilt auch für seine Behauptung, die Evangelien seien „keine literarischen Kunstwerke“. Das Gegenteil ist wahr: Es sind ganz außerordentliche literarische Kunstwerke, gerade wenn man sie vergleichend in den Rahmen der antiken jüdischen wie heidnischen Literatur stellt.28 Im übrigen werden wir noch sehen, daß es eine einheitliche „biographische Form“ in der Antike nie gegeben hat.
So will ich hier einmal den Versuch machen, die Anfangscharakteristik, die Markus in seinen ersten drei Kapiteln von Jesus gibt, als Modell und Vorlage der beiden anderen Synoptiker zu verstehen und von hier aus zu erklären, wie sie den markinischen Text bearbeitet haben. Man sieht dann schnell, welche Lücken die beiden bei ihrem Vorgänger entdeckt haben und wie sie diese Lücken mit dem reichen Überlieferungsmaterial ausfüllten, das ihnen aus schriftlichen oder mündlichen Quellen zur Verfügung stand. Dabei wird sich noch deutlicher zeigen, was wir schon an dem Beispiel mit der Blutflüssigen gesehen haben: daß es diesen beiden Evangelisten nicht einfach darum ging, Lücken auszufüllen, sondern daß sie als souveräne Schriftsteller mit einem bestimmten Darstellungsziel arbeiteten. Dieses Ziel bestand darin, die Gestalt Jesu und seiner Verkündigung wahrheitsgemäß und möglichst umfassend darzustellen. So kam es zunächst zu drei verschiedenen Porträts Jesu, und man hätte sich durchaus vorstellen können, daß nach der Publikation der beiden späteren Evangelien das des Markus vom Markt verschwunden wäre. Das wäre geradezu der normale Lauf der Dinge gewesen. Aber so kam es nicht. Die Kirche wollte in ihrer Mehrheit alle drei Versionen der Geschichte Jesu erhalten wissen, obwohl schon sehr schnell klar war, dass man das Matthäusevangelium den beiden anderen, auch dem des Lukas, bei weitem vorzog. Bei dieser Bevorzugung des Matthäusevangeliums ist es in der Kirche geblieben, im Grunde bis heute.
Noch erstaunlicher ist aber die Tatsache, daß nach den drei so deutlich verwandten Versionen der Geschichte Jesu noch eine vierte entstand, die sich von den drei anderen so stark abhob, daß man zunächst den Eindruck haben konnte, es handle sich um eine ganz andere Geschichte. Die Geschichte ähnelte dann aber doch wieder so sehr der der drei anderen, daß man sie trotz aller Unterschiede für ein Porträt derselben Gestalt halten mußte, was der Autor auch deutlich genug beanspruchte. Und offensichtlich war man in der katholischen Kirche des 2. Jahrhunderts allgemein der Auffassung, daß der Autor dieser vierten Version ein Recht hatte, die Dinge so anders darzustellen als die drei früheren. Mit Hilfe der Kodikologie kann man zeigen, daß die ältesten Handschriften der kanonischen Evangelien zum großen Teil aus professioneller Herstellung und kirchlich kontrollierten Schreibzentren – man denke an Großstädte wie Antiochia, Cäsarea, Alexandria, Rom – stammen und als liturgische Lesetexte dienen sollten. Demgegenüber haben die frühen Handschriften der nichtkanonischen Evangelien durchweg privaten Charakter und waren nicht zum öffentlichen Vortrag gedacht. Sie stammen offenkundig aus marginalen Kreisen. Das jedenfalls sind Ergebnisse einer neueren, gründlichen Untersuchung.29
Die erstaunlichste Tatsache ist schließlich, daß man sich in der frühen Kirche mehrheitlich schon bald nach dem Erscheinen dieser vierten Version einig war, das sei jetzt genug, und daß man nicht etwa aus diesen vier eine zusammenfassende fünfte Version herstellen ließ, sondern die vier so, wie sie waren, nebeneinander stellte und als Einheit sah. Man hielt offenbar alle vier für wahre Darstellungen mit je eigener Perspektive und je eigenen Akzentsetzungen und wollte sie gerade in ihrer literarischen Eigenart bewahrt wissen, weil diese Eigenart jeweils zu ihrer Wahrheit dazugehört. Ihre Zusammengehörigkeit deutete man durch den Titel an, den man diesen vier Jesusgeschichten gab: Evangelium nach Matthäus, nach Markus, nach Lukas und nach Johannes. Solche merkwürdigen Titel gab es in der Buchgeschichte vorher nirgends. Mit ihnen sind die vier Jesusgeschichten als vier Versionen des einen Evangeliums gekennzeichnet. Wer wissen will, wer Jesus von Nazaret war, was er wollte, was er lehrte und wie es ihm erging, der muß alle vier Geschichten zusammennehmen. Nur zusammengenommen bilden sie das Evangelium, nur zusammengenommen erfassen sie die singuläre Gestalt dessen, von dem sie erzählen. Dieses Zusammennehmen muß aber gleichsam unvermischt und ungeschieden erfolgen; das wahre Bild Jesu ergibt sich nur, wenn die jeweilige Eigenart der einzelnen Porträts hineingenommen wird.
Man hat freilich von Anfang an gesehen, daß sich in diesen vier Versionen und vier Perspektiven nicht alles ohne weiteres vereinbaren läßt, daß es da Ungereimtheiten, Spannungen und verwirrende Unterschiede gab, in Einzelheiten sogar Widersprüche. Versuche, alle Unterschiede und Spannungen zu harmonisieren und sogar regelrechte Evangelienharmonien herzustellen, um diese störenden Elemente loszuwerden, gab es von Anfang an, und sie werden bis heute unternommen. Aber die katholische Kirche hat alle derartigen Versuche unbeirrt als Versuchungen verstanden, gegen die man kämpfen muß. Deswegen nahm Theodoret, als er im Jahr 423 n. Chr. Bischof von Kyros bei Antiochia geworden war, den Syrern ihre Evangelienharmonie, an die sie seit Generationen gewohnt waren, mit Gewalt weg, vernichtete alle über zweihundert Exemplare und zwang die Verantwortlichen, im Gottesdienst die einzelnen Evangelien in ihrer jeweiligen Eigenart vorzulesen.30
Um die jeweilige Eigenart kennenzulernen, muß man die Evangelien miteinander vergleichen. Es geht mir jedoch bei dem folgenden Vergleich nicht nur um das jeweilige besondere Profil, das sich im Vergleich besser zeigt, sondern auch darum, eine Entwicklung aufzuzeigen. Ich möchte verständlich machen, wie Matthäus und Lukas gearbeitet haben, und Markus dabei das Modell, der wichtigste Informant und Ideengeber war. Das ist zunächst eine rein literarische Betrachtungsweise. Die historische Perspektive kommt dadurch in den Blick, daß es in diesen Erzählungen um die Darstellung historischer Ereignisse geht. Wir werden von Markus die ersten drei Kapitel genauer betrachten, von Matthäus die ersten vier, von Lukas die ersten fünf und von Johannes die ersten beiden Kapitel. Diese Kapitel werden wir am Text entlang besprechen.
Der Grund für den Einschnitt ergibt sich aus dem jeweiligen Auftakt des öffentlichen Wirkens Jesu. Dieser ist in allen vier Evangelien ein anderer. Der Auftakt findet im Markusevangelium in der Synagoge von Kafarnaum statt (1,21–28), bei Matthäus auf dem Berg der Seligpreisungen (5–7), bei Lukas in der Synagoge von Nazaret (4,16–30), bei Johannes im Tempel von Jerusalem (2,13–22). Im Fall des Markus- und des Lukasevangeliums müssen wir etwas weiter über den öffentlichen Auftakt hinaus gehen, um die Bearbeitung der Nachfolger einschätzen zu können. Außerdem wird nur so die Charakteristik Jesu in diesen Evangelien einigermaßen vollständig. Da aber jeder Teil einer Erzählung als Teil des Ganzen gesehen werden muß, wollen wir das jeweilige Gesamtwerk nicht ganz aus den Augen lassen.
Im übrigen will ich versuchen, die Dinge so zu nehmen, wie sie wohl ein antiker Leser genommen hat, der ohne viel Vorwissen an das Markusevangelium und darauf an die übrigen Evangelien geraten ist. Ich stelle mir dabei nicht nur einen jüdischen Leser vor, der zumindest die heiligen Schriften kennt, sondern auch einen heidnischen Leser, der historisch interessiert ist. Um diesen heidnischen Leser nicht ganz im Abstrakten und Spekulativen zu belassen, wähle ich einen konkreten Autor als Leitfigur eines gedachten idealen Lesers, der weder Jude noch Christ war: Plutarch. Plutarch war philosophisch, religiös und historisch hoch gebildet und auf diesen Feldern schriftstellerisch tätig. Von seinem breitgefächerten Werk ist genug übrig, daß wir uns ein echtes Bild seiner Persönlichkeit und seiner Weltanschauung machen können. Wenn wir nun versuchen, die Evangelien mit seinen Augen zu lesen, so kann das natürlich nur ein Gedankenexperiment sein. Der Vergleich mit Plutarchs Biographien kann aber auf jeden Fall helfen, sowohl die literarische als auch die historische Leistung der Evangelisten besser und gerechter einzuschätzen, als es die formgeschichtliche Schule Rudolf Bultmanns getan hat. Auf diese Weise kann die Gestalt Jesu mehr Profil gewinnen.
1Das Standardwerk zu den damit verbundenen Fragen ist: M. Hengel, Die vier Evangelien.
2Ch. Meier, Der Historiker und der Zeitgenosse. Eine Zwischenbilanz, München 2014, 217.
3Ebd. 178.
4B. de Spinoza, Theologisch-politischer Traktat, hg. von G. Gawlick, Hamburg 1994, 202 (Kap. 12).
5Vgl. Mt 12,46–50; Lk 8,19–21.
6Man vergleiche nur Mk 8,17–21 mit Mt 16,8–12 und Lk 12,1!
7E. Haenchen, Der Weg Jesu. Eine Erklärung des Markus-Evangeliums und der kanonischen Parallelen, Berlin 1968, 34. Er bezieht sich auf die einflußreiche Untersuchung von William Wrede, Das Messiasgeheimnis in den Evangelien. Zugleich ein Beitrag zum Verständnis des Markusevangeliums, Göttingen 1901. Die 4. Auflage erschien 1969. Vgl. dazu A. Yarbro Collins, Mark 170–172; M. Hengel / A. M. Schwemer, Jesus und das Judentum 506–525; M. Reiser, Kritische Geschichte der Jesusforschung, Register s. v. W. Wrede.
8R. Bultmann, Die Geschichte der synoptischen Tradition, Göttingen 81970, 397. Vgl. M. Reiser, Kritische Geschichte der Jesusforschung 82–87.
9Ph. Vielhauer, Geschichte der urchristlichen Literatur. Einleitung in das Neue Testament, die Apokryphen und die Apostolischen Väter, Berlin / New York 1975, 354.
10H. Cancik, Die Gattung Evangelium. Das Evangelium des Markus im Rahmen der antiken Historiographie, in: Ders., Markus-Philologie 85–113, hier 95.
11Jesus Handbuch, hg. von J. Schröter / Ch. Jacobi, Tübingen 2017, 84 (C. Breytenbach).
12Ebd. 134 (J. S. Kloppenborg).
13Vgl. M. Hengel / A. M. Schwemer, Jesus und das Judentum 506–525.
14Vgl. A. Yarbro Collins, Is Mark’s Gospel a Life of Jesus? The Question of Genre, Milwaukee 1990; dies., Mark 19–43; E.-M. Becker, Das Markus-Evangelium im Rahmen antiker Historiographie (WUNT 194), Tübingen 2006; dies., Der früheste Evangelist. Studien zum Markusevangelium (WUNT 380), Tübingen 2017. Sachgerechter scheint mir das Urteil bei A. D. Baum, Einleitung 120–145.
15W. C. van Unnik, Josephus in seiner Bedeutung für den Ausleger des Neuen Testaments, in: Ders., Flavius Josephus als historischer Schriftsteller (Franz Delitzsch Vorlesungen 1972, Universität Münster), Heidelberg 1978, 55–67, hier 61. Eine gründliche Kritik der formgeschichtlichen Skepsis in historicis bietet N. Thomas Wright, The New Testament 418–443. Sie wurde in Deutschland kaum beachtet. Deutsch: N. T. Wright, Das Neue Testament 531–542.
16U. Schnelle, Einleitung in das Neue Testament. 3., neubearbeitete Auflage, Göttingen1999, 216 f.
17Vgl. M. Hengel, Der unterschätzte Petrus. Zwei Studien, Tübingen 2006, 58–78 („Markus, der Schüler des Petrus“). Dort geht er auch auf die merkwürdige Argumentation Schnelles ein. Vgl. außerdem: M. Hengel, Entstehungszeit und Situation des Markusevangeliums, in: H. Cancik, Markus-Philologie 1–45; ders., A. M. Schwemer, Jesus und das Judentum 216–224; ders., Die vier Evangelien 141–158.
18Plut. Dem. 2,1.
19Vgl. Ch. Pelling, Plutarch Caesar 314 (zu Plut. Caes. 32,7).
20Zu dieser historischen Wahrscheinlichkeit vgl. C. E. B. Cranfield, The Epistle to the Romans (CECNT) Bd. 2, Edinburgh 1986, 793 f.
21Einen guten Überblick über die Methodik und Hermeneutik des althistorischen Arbeitens gibt Arnaldo Momigliano in einem kurzen Beitrag, den Daniel Schwartz übersetzt hat: The Rules of the Game in the Study of Ancient History, in: D. E. Schwartz, Reading the First Century. On Reading Josephus and Studying Jewish History of the First Century (WUNT 300), Tübingen 2013, 182–190.
22H. Fränkel, Über philologische Interpretation am Beispiel von Caesars Gallischem Krieg, in: Ders., Wege und Formen frühgriechischen Denkens. Literarische und philosophiegeschichtliche Studien, hg. von F. Tietze, München 1967, 294–312. Der Beitrag stammt aus dem Jahr 1933. Leider bleibt der Lateinunterricht, soweit ich sehe, von solchen Einsichten unberührt.
23Vgl. W. Pesch, Josef Schmid (1893–1975), in: C. Breytenbach / R. Hoppe (Hg.), Neutestamentliche Wissenschaft nach 1945, Neukirchen-Vluyn 2008, 399–406.
24J. Schmid, Das Evangelium nach Matthäus (RNT 1), Regensburg 51965, 6–8.
25Vgl. R. Bultmann, Die Geschichte der synoptischen Tradition, Göttingen 81970, 395–398.
26J. Schmid, Mt (Anm. 24) 8 f.
27Ebd. 13.
28Näheres dazu bei M. Reiser, Sprache und literarische Formen 190–194.
29Vgl. Scott D. Charlesworth, Early Christian Gospels: Their Production and Transmission (Papyrologica Florentina 47), Florenz 2016.
30Das berichtet Theodoret selbst: Thdt. haer. 1,20. Vgl. W. L. Petersen, Tatian’s Diatessaron. Its Creation, Dissemination, Significance, and History in Scholarship (SVigChr 25), Leiden u. a. 1994, 41 f.
2.Die Biographien Plutarchs und die Evangelien1
Plutarchs Heimatort Chaironeia in Böotien, wo er den Großteil seines Lebens verbracht hat, ist ein kleines Städtchen in der Nähe von Delphi. Dort ist er gegen 50 n. Chr. in einer alteingesessenen, wohlhabenden Familie geboren und 120 n. Chr. oder kurz danach gestorben. Er ist also nur knapp eine Generation jünger als unsere Evangelisten. Er war Philosoph, gab philosophischen Unterricht und hielt Vorträge. Er bekannte sich zu Platon und der alten Akademie. An den Stoikern, besonders Chrysipp, übte er scharfe Kritik; die Epikureer verachtete er, weil sie seiner Ansicht nach mit der Religion jede gesellschaftliche Ordnung zerstörten.2 Doch ist er gegen die einen wie gegen die anderen in der Polemik teilweise sehr ungerecht, ganz ähnlich, wie er es auch gegenüber Herodot ist. Sein Interesse galt vor allem ethischen und religiösen Fragen, die er in vielen Essays behandelt hat. Für Wilhelm Schmid ist er „der letzte universale Vertreter hellenistischer Weltanschauung und Darstellungsweise, ihr Markstein und Inbegriff“.3 Seine Belesenheit, die sich in seinem großen historischen und kulturgeschichtlichen Wissen und zahlreichen Zitaten aus der klassischen Literatur zeigt, ist geradezu stupend.4 Daß die Zitate meistens aus dem Gedächtnis erfolgen und deshalb oft ungenau sind, versteht sich von selbst. Vom Christentum ist er ganz unberührt, auch wenn man viele seiner moralischen Urteile als Christ durchaus sympathisch findet.5
Er war aber nicht nur Philosoph, sondern auch Priester in Delphi und damit verantwortlich für diese berühmte Orakelstätte. Zusammen mit seiner Frau war er in die Dionysosmysterien eingeweiht und glaubte von daher fest an die Unsterblichkeit der Seele und die Seelenwanderung.6 Seine Vorstellung vom Jenseits des Todes gleicht der christlichen in frappierender Weise, er kennt sogar ein Purgatorium.7 Wie wir aus einer Inschrift wissen, war er auch römischer Bürger, was er in seinen erhaltenen Werken jedoch nie erwähnt.8 Von seinen zahlreichen Werken – ein unvollständiger antiker Katalog seiner Schriften, der sogenannte Lampriaskatalog, führt 227 Schriften auf – ist uns etwa die Hälfte erhalten.9 Sie nehmen in der Loeb-Ausgabe, nach der ich durchweg zitiere, 26 Bändchen ein.
a)Form und Schwerpunkte
Plutarchs eigentümlichste historische und literarische Leistung sind die 48 erhaltenen Biographien großer Römer und Griechen. Sie entstanden in den ersten beiden Jahrzehnten des zweiten Jahrhunderts, sind also Werke der Reifezeit. Der Großteil dieser Biographien ist in Paaren angeordnet. Plutarch stellt jeweils einen Griechen und einen Römer nebeneinander, die einen ähnlichen Charakter und eine ähnliche Karriere aufweisen. Leider sind auch eine Reihe von Biographien verloren gegangen, zum Beispiel die über Augustus und Tiberius und eine Biographie über den Philosophen Krates, um die es mir besonders leid ist.
Die Biographien haben einen naheliegenden Aufbau.10 Am Anfang stehen einführende Bemerkungen oder gleich Informationen über die Abstammung und Familie des Protagonisten. Darauf folgt oft eine allgemeine Charakteristik seiner Person, nach Möglichkeit mit typischen Anekdoten zur Illustration. Dazu können Angaben über das Aussehen kommen. Diese Angaben beschränken sich aber gewöhnlich auf besondere Kennzeichen, im Fall Sullas zum Beispiel auf den stechenden Blick seiner blaugrauen Augen und einen Gesichtsausschlag.11 Die Lebensbeschreibung des Titus Flamininus beginnt Plutarch mit dem Hinweis: Wer wissen wolle, wie er ausgesehen hat, solle sein ehernes Standbild betrachten, dessen Ort in Rom er genau angibt. Zu Marius heißt es: „Im oberitalienischen Ravenna habe ich eine Marmorbüste des Marius gesehen, aus deren Zügen eindrücklich der mürrische, herbe Charakter spricht, den man ihm zuschreibt“ (2,1).
Den Großteil der erzählenden Darstellung macht in jedem Fall das öffentliche Wirken der Protagonisten aus. Dabei gibt es Schwerpunkte. Von den 33 Kapiteln der Biographie des Crassus verwendet Plutarch allein 18 auf die Erzählung über den Feldzug gegen die Parther, der mit der bekannten Katastrophe von Carrhae endete (53 v. Chr.). In der Biographie des Antonius, die 87 Kapitel umfaßt, sind 16 Kapitel dem wiederum erfolglosen Feldzug gegen die Parther (36 v. Chr.) gewidmet (37–52) und 14 dem Krieg, der mit der Niederlage von Actium endet (31 v. Chr.) (56–69). Die letzten zehn Kapitel gehören ganz Kleopatra; sie erzählen die Ereignisse der wenigen Tage bis zu ihrem berühmten Ende. In der Biographie Ciceros nimmt die detaillierte Erzählung der Affäre um Catilina 24 von insgesamt 49 Kapiteln ein. Vier Kapitel (25–27. 38) sind mit Anekdoten (Apophthegmata) angefüllt, denn Cicero war für seinen Witz bekannt. Solche Anekdotenreihen können die ungefähre chronologische Ordnung einer Biographie jederzeit durchbrechen.
Die Auswahl der erzählten Begebenheiten erfolgt nach dem Gesichtspunkt ihrer Denkwürdigkeit. So kann Plutarch schreiben: „Das ist es, was an denkwürdigen Begebenheiten in den Berichten über Demosthenes und Cicero zu meiner Kenntnis gelangt ist.“12 Oder: „Nachdem die Taten beider, soweit wir sie der Erzählung und des Gedächtnisses für würdig halten, dargestellt sind …“.13 Dieses Prinzip gilt nicht nur für Plutarch, sondern für die antike Geschichtsschreibung ganz allgemein. Und wir sollten nicht übersehen, daß dies auch heute noch gilt. Robert L. Wilken veröffentlichte eine Geschichte der ersten tausend Jahre des Christentums und schreibt in der Einleitung: „In writing the history of the first thousend years I have chosen to highlight those events and persons that, in my judgement, are worthy of remembrance at the beginning of the third millenium.“14
Gibt es nun allgemeine Kriterien der Denkwürdigkeit? Über zweierlei war man sich in der Antike einig: Denkwürdig sind, wie Herodot schreibt, „die großen und erstaunlichen Leistungen“,15 insbesondere aber die Leiden der Helden wie der Völker.16 So steht es schon in den Vorworten der beiden großen Epen Homers. Die Ilias besingt „den Zorn des Peleus-Sohns Achilleus, / den verderblichen, der zehntausend Schmerzen über die Achaier brachte“, die Odyssee „die Schmerzen“ des Helden auf dem Meer und das Verderben seiner Gefährten. Leiden im Krieg und unter dem Krieg machen einen großen Teil der antiken Geschichtsschreibung aus. In antiken Biographien gehört den Leiden der Helden und ihrem Weg in den Tod ein besonderes Augenmerk. Charakteristisch ist Plutarchs Schlußsatz der Biographie des Griechenbefreiers Titus Flamininus: „Da mir aus späterer Zeit politische oder kriegerische Taten des Titus nicht bekannt sind und er sein Leben in der Stille beschloß, wollen wir uns nunmehr der Vergleichung [mit Philopoimen] zuwenden.“ Ein Leben ohne politische und kriegerische Taten, beschlossen durch einen gewöhnlichen Tod, ist kein lohnender Stoff für einen Geschichtsschreiber oder Biographen.17
Der Gesichtspunkt der Denkwürdigkeit kann sogar den Gesichtspunkt der Authentizität zurücktreten lassen. Das sagt Plutarch selbst im Zusammenhang mit einer bekannten Anekdote, die er in der Lebensbeschreibung Solons ausführlich erzählt. Es ist die Begegnung Solons mit dem König der Lyder, Kroisos. Danach zeigt Kroisos seinem Gast Solon seine Besitztümer und fragt, ob er einen glücklicheren Menschen als ihn kenne. Solon nennt überraschende Beispiele und erklärt schließlich: Man kann einen Menschen erst glücklich nennen, wenn er es bis zu seinem Tod war. Aber bevor Plutarch diese Anekdote und das Ende des Kroisos ausführlich erzählt, bespricht er ein kritisches Problem:
Solons Begegnung mit Kroisos glauben einige aus zeitlichen Gründen als erdichtet erweisen zu können. Ich kann mich aber nicht entschließen, eine so berühmte, von so vielen Zeugen berichtete Geschichte, die, was noch wichtiger ist, dem Charakter Solons entspricht und seiner hohen Gesinnung und Weisheit würdig ist, preiszugeben einigen sogenannten chronologischen Tabellen zuliebe, an denen unzählige herumbessern und doch bis heute zu keiner allgemein anerkannten Lösung der Widersprüche gelangen können.18
Die Chronologie geschichtlicher Ereignisse und Daten in einem größeren Raum war für die antiken Historiker ein dorniges Problem. Da es keine staatenübergreifende Zeitrechnung gab, konnte man absolute Datierungen nur durch die Synchronisierung von Königen, Herrschaftsperioden und lokalen Ären vornehmen. Dafür waren einschlägige Kenntnisse nötig, zu denen nicht jeder, auch nicht jeder Gebildete, Zugang hatte. Plutarch kennt chronologische Tabellen und weiß um ihre Problematik, die teilweise bis heute besteht.19 Einen exakten Synchronismus nimmt er überhaupt nirgends vor. Im Fall einer so gut bezeugten Geschichte jedenfalls, die eines Solon würdig ist und eine so wichtige Aussage über das Leben und die Frage des Glücks macht, ist Plutarch nicht bereit, sie wegen einer chronologischen Schwierigkeit aufzugeben.20 Die Denkwürdigkeit einer Anekdote und ihre Übereinstimmung mit dem übrigen Charakter der Betreffenden ist im Zweifelsfall wichtiger für die Authentizität als die Güte der Bezeugung. Für dieses Urteil konnte Plutarch auf so gut wie allgemeine Zustimmung unter den antiken Geschichtsschreibern rechnen. Heute würden nur wenige moderne Historiker noch so urteilen. Doch die modernen Historiker vergessen manchmal sich zu fragen, für wen, warum und wozu sie eigentlich Geschichte darstellen.
Aber nicht nur die absolute Chronologie war für Plutarch Nebensache, auch die chronologische Abfolge eines Lebenslaufs war ihm nicht wichtig. Er ordnet seine Erzählung zwar grob chronologisch, im übrigen aber begnügt er sich fast durchweg mit relativen Angaben wie „ungefähr zur Zeit des Peloponnesischen Krieges“,21 als dieses und jenes geschah, in seinem ersten Konsulat, ein Zeitgenosse von dem und dem, „um diese Zeit“, „damals“ „nun geschah es, daß …“, „dann“, „danach“, „kurz darauf“, „inzwischen“, „am folgenden Tag“. Das kann der Erzählung einen episodischen Charakter geben. Ungewöhnlich sind präzise Angaben wie „um die zweite Nachtwache“,22 „als es tagte“, „um die Mitte der Nacht“, „schon krähte da und dort ein Hahn“,23 „es war die sechste Stunde, als ein Wind aufkam …“.24
Einmal heißt es: „Wenige Tage später rückte Caesar ein und bemächtigte sich Roms.“25 Eine Anmerkung des Übersetzers berichtigt: Es sei mehr als zwei Monate später gewesen.26 Aber das wußte Plutarch durchaus, wie er an anderer Stelle zeigt. Er hat hier wie an vielen Stellen im Interesse des Zusammenhangs seiner Erzählung die Chronologie gerafft, um keine Leerstelle in der Erzählung zu lassen.27 Mit solchen Erzähltechniken muß man bei einem antiken Autor, auch bei den Evangelisten, rechnen. Im übrigen gehört das zeitraffende Erzählen zu den elementaren Notwendigkeiten des Erzählens überhaupt und hat verschiedene Formen.28
Diese Rücksicht auf die Kohärenz seiner Erzählung ist es auch, warum Plutarch mit Zeitangaben so sparsam ist, ja sie geradezu meidet. Über weite Strecken der Erzählung fehlen chronologische Angaben ganz. Er kann eine Anekdote erzählen und hinzufügen: „Aber das war später“ oder „Das geschah allerdings früher“.29 Genaue Daten fügen die modernen Herausgeber und Kommentatoren aufgrund von anderen Quellen und modernen Berechnungen hinzu. Dasselbe gilt für Altersangaben. Plutarch meint, Pompeius sei zur Zeit seines 3. Triumphs gegen 40 Jahre alt gewesen. Nach heutigem Wissenstand war er damals 45.30 Das Alter Catos erfährt der Leser erst ganz am Ende: Bei seinem Tod war er 48 Jahre.31
Das Episodische und Anekdotische ist besonders auffallend in Plutarchs Biographie des Phokion (402–318 v. Chr.), den man den letzten Ehrenmann des alten Athen genannt hat.32 Darin bildet, ähnlich wie in den Evangelien, die einzige längere, in sich geschlossene Erzählsequenz die Passionsgeschichte. Sie endet wie bei Sokrates mit dem Schierlingsbecher (31–38). Den Weg seiner Helden in den Tod nimmt Plutarch sehr wichtig; er schildert ihn nach Möglichkeit mit Einzelheiten.33 Das gehört zur Denkwürdigkeit der Leiden. Überhaupt wurden die Todesumstände bedeutender Menschen in der Antike sehr genau verfolgt. Denn im Unglück und im Angesicht des Endes muß sich nach antikem Ethos ein Charakter vor allem bewähren. Catos Selbstmord in Utica wird in 14 Kapiteln geschildert (58–72). Es sind die Geschehnisse von nur drei Tagen. Die Passion des Gaius Gracchus erstreckt sich ebenfalls über drei Tage und wird in fünf Kapiteln eingehend erzählt (34 [13]–38 [17]). Dazu kommen noch zwei Kapitel Nachgeschichte. Die Ereignisse vom Vorabend bis zum Tod Cäsars am nächsten Morgen umfassen vier Kapitel (63–66).34 In diesem besonderen Fall kommen noch drei lange Kapitel Nachgeschichte dazu; sie enden mit dem Tod seines Mörders Brutus. Auch ihm hat Plutarch eine Biographie gewidmet. Darin erzählt er die Geschichte des Mordes noch ein zweites Mal, nicht weniger ausführlich, mit neuen Einzelheiten, jetzt aber aus der Perspektive der Mörder (14–17). Auch Plutarch kennt also zumindest ansatzweise so etwas wie Multiperspektivität.
Auch Cicero hat seine Passionsgeschichte, die detailliert erzählt wird (47 f). Ihn mußte Oktavius, der spätere Augustus, dem Haß des Antonius opfern. So kam er auf die Proskriptionslisten, auf denen die Namen derer standen, die zur Ermordung freigegeben waren. Cicero geht seinem Ende jedoch ganz unheldisch entgegen und ist in dieser Hinsicht ein Vorbild e contrario. Selbst sein eigentlicher Mörder Antonius, den seine Liebe zu Kleopatra ins Verderben führt, macht am Ende eine bessere Figur. Seine Passionsgeschichte nach der verlorenen Seeschlacht bei Actium, die Plutarch ausführlich schildert (67–77), schließt mit einem letzten Wort des Besiegten, das Plutarch allerdings nur in indirekter Rede bietet. Er hat es zweifellos sehr passend erfunden.35
Das gilt auch von der längeren, bewegenden Klage Kleopatras über dem Grab des Antonius, die sogar in direkter Rede geboten wird.36 Hier haben wir ein klassisches Beispiel einer Charakterdarstellung durch direkte Rede, einer sogenannten Ethopoiie (ἠθοποιία) oder Prosopopoiie (προσωποποιία), wie sie in der Rhetorikschule eingeübt wurde. Dort konnten Aufsatzthemen lauten: Wie hat wohl der oder die bei der und der Gelegenheit gesprochen?37 Der anschließende Tod Kleopatras ist mit geradezu biblischer Knappheit und Prägnanz erzählt, mit einem kurzen, in direkter Rede gegebenen Dialog zwischen dem Abgesandten Oktavians und einer der Dienerinnen, dessen Knappheit und Natürlichkeit auf Authentizität deutet.38 Darauf folgt – ganz unbiblisch – eine kritische Diskussion der Todesart.
Am Ende eines Paars vergleicht Plutarch seine Helden und zeigt Ähnlichkeiten und Unterschiede auf. Dabei kann er von seiner eigenen Ethik aus werten und Kritik üben. Aber auch schon bei der erzählenden Darstellung spart er nicht mit Reflexionen über die Geschehnisse und mit wertenden Urteilen. So bemerkt er zu Cicero: „Die übermäßige Freude daran, gelobt zu werden, und der leidenschaftliche Drang nach Ruhm blieb ihm bis zum Ende treu und machte oftmals viele seiner vernünftigen Überlegungen zunichte.“39 Später wird er noch deutlicher:
Damals stand Cicero auf der Höhe seines Ansehens, machte sich aber bei vielen verhaßt, nicht durch irgendwelche schlechten Handlungen, sondern dadurch, daß er sich immerfort selbst lobte und rühmte, erregte er den Widerwillen vieler. Kein Senat, keine Volksversammlung, kein Gericht konnte zusammentreten, bei dem man sich nicht das Gerede über Catilina und Lentulus anhören mußte. Am Ende füllte er auch seine Bücher und Schriften mit diesen Lobpreisungen der eigenen Person, und seinen sonst so schönen, anziehenden und geistvollen Vortrag machte er für die Hörer widerwärtig und abstoßend, weil ihm immer wie ein Fluch diese Geschmacklosigkeit anhaftete.40