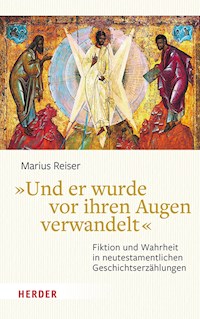Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Jeanne d'Arc, ein frommes, kriegerisches Bauernmädchen (1412–1431), ist Frankreichs Nationalheldin, weil sie die entscheidende Wende im Hundertjährigen Krieg gegen die Engländer brachte. Sie geriet in englische Gefangenschaft und wurde durch einen Inquisitionsprozess als Häretikerin zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt. 25 Jahre später wurde sie durch einen weiteren Inquisitionsprozess rehabilitiert. Diese Vorgänge und die Gestalt dieses Mädchens sind einzigartig in der Geschichte Europas. Wie kam es zu der Wende im Hundertjährigen Krieg? Wie stand es mit den Offenbarungen Gottes, auf die sich dieses Mädchen berief? Warum wurde sie von kirchlichen Gerichten zuerst zum Tod verurteilt und dann rehabilitiert? Und wie kam es zu ihrer Heiligsprechung 1920? Davon und von einigen Beispielen der literarischen Rezeption ihrer Gestalt handelt dieses Buch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 574
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Bild auf dem Umschlang: „Jeanne d’Arc im Gebet“
Bronze-Statue vor dem Rathaus von Orléans nach dem Original von Marie d’Orléans (1813 –1839). Sie war die Tochter des Bürgerkönigs Louis-Philippe, der ihr den Auftrag dazu gab. Auch die Kopie in Bronze wurde nach dem Tod der Künstlerin von Louis-Philippe in Auftrag gegeben und der Stadt Orléans angeboten. Das Original entstand 1835 in Gips, davon gab es später eine Marmorkopie und zahlreiche Nachahmungen in verschiedenen Größen und Materialien. Das Schwert der Bronzekopie vor dem Rathaus von Orléans ist beschädigt.
Der abgebrochene Knauf ergab ursprünglich ein Kreuzsymbol.
Literatur: Nora M. Heimann, The Princess and the Maid of Orléans: Sculpting Spirituality during the July Monarchy, in: A.W. Astell/B. Wheeler (Hg.), Joan of Arc and Spirituality 229 –247; A. Dion-Tenenbaum (Hg.), Marie d’Orléans 1813 –1839.
Princesse et artiste romantique, Paris 2008 (Ausstellungskatalog).
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2024
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Verlag Herder, Freiburg im Breisgau
Umschlagmotiv: © mauritius images/David Taljat/Alamy/Alamy Stock Photos
Satz: B. Herrmann, Freiburg im Breisgau
Karten (Vor-/Nachsatz): Peter Palm, Berlin
E-Book-Konvertierung: Newgen Publishing Europe
ISBN (Print) 978-3-451-39861-2
ISBN E-Book (EPub) 978-3-451-83561-2
ISBN E-Book (PDF) 978-3-451-83461-5
Inhalt
Vorwort
I. Geschichte und Gestalt
1. Die Anfänge
2. Chinon, Poitiers, Orléans und Reims: Virgo potens
3. Gutachten und Zeugnisse: „Virgo simplissima“
4. Der Prozess 1431
a) Virgo prudentissima
b) Virgo fidelis
5. Der Revisionsprozess 1455/1456: Rehabilitation
6. Die Heilige und Märtyrerin
Schluss
II. Zeitgenössische Zeugnisse und Anekdoten über Johanna die Jungfrau
Einführung
1. Domremy
2. Vaucouleurs, Chinon, Poitiers
3. Orléans
4. Feldzug zur Salbung und Krönung in Reims
5. Letzte Aktivitäten und Gefangenschaft
6. Prozess in Rouen 1431
7. Der letzte Tag
III. Die Herkunft von Johannas Stimmen und Erscheinungen
1. Der historische Befund für die Stimmen und Erscheinungen
a) Biographischer Überblick
b) Aussagen im Prozess
2. Die Diskussionen im 15. Jahrhundert
a) Heinrich von Gorkum (um 1378 –1431)
b) Die Gutachten des Revisionsprozesses 1455/56
3. Die moderne Diskussion
a) Geschichtswissenschaft
b) Theologie
4. Eine missverstandene himmlische Mitteilung
5. Analogien
a) Martin von Tours und Pachomius
b) Bernadette Soubirous
Schluss
IV. Literarische Gestaltungen
1. Fronton Du Ducs Jungfrau von Dom-Remy
a) Die tragische Geschichte
b) Zur Deutung
2. William Shakespeares Púcelle
a) Der Gang der Ereignisse um die Pucelle im Drama
b) Shakespeares Heldin und die Historie
3. Abbé d’Aubignacs Pucelle
a) Der Gang der Handlung
b) Zur Deutung
4. Friedrich Schillers Jungfrau
a) Das märchenhafte Drama
b) Deutung
5. Bernard Shaws Heilige
a) Der Gang der Handlung
b) Johan Huizingas Besprechung
6. Jean Anouilhs Lerche
a) Der Gang der Handlung
b) Zur Deutung
7. Jeanne d’Arc auf dem Scheiterhaufen. Ein dramatisches Oratorium von Paul Claudel und Arthur Honegger
a) Die Handlung
b) Zur Deutung
8. Max Mells Jeanne d’Arc
a) Der Gang der Handlung
b) Zur Deutung
Schluss: Wo ist die Tragik?
V. Jeanne d’Arc in den liturgischen Texten
Zeittafel
Bibliographie
Personenregister
Vorwort
Im Jahr 1429 war das französische Königreich nahe daran, ein Teil des englischen Königreichs zu werden. Die Lage des französischen Königs schien hoffnungslos. Da trat ein 17-jähriges frommes Bauernmädchen auf und brachte in wenigen Monaten die Wende im Kriegsgeschehen zugunsten der französischen Seite. Sie geriet 1430 in Gefangenschaft und endete 1431 auf dem Scheiterhaufen. Diese Geschichte wirft Fragen auf: Wie kam ein einfaches Mädchen vom Land dazu, sich auf ein ganz und gar verrücktes kriegerisches Unternehmen einzulassen? Wie konnte dieses Unternehmen entgegen aller Wahrscheinlichkeit innerhalb kurzer Zeit gelingen? Warum wurde das Mädchen dafür in einem hochkarätig besetzten und teuren kirchlichen Prozess als Hexe und Ketzerin verbrannt? Und warum war das nicht das Ende der Geschichte? Denn das Urteil des Prozesses von 1431 wurde 25 Jahre später durch einen weiteren, wiederum hochkarätig besetzten, mindestens ebenso teuren kirchlichen Prozess annulliert. 1920 wurde die Kriegerin heiliggesprochen, und kurz darauf beschloss das französische Parlament einen Nationalfeiertag zu ihren Ehren. Wie ist das alles zu erklären? Mir scheint, dass die gestellten Fragen trotz einer schier unüberschaubaren Forschungsliteratur immer noch nicht befriedigend beantwortet sind und dass gerade Theologinnen und Theologen hier mehr als bisher beizutragen hätten.
Schon die Zeitgenossen haben das Erscheinen und Wirken dieses einfachen Mädchens auf der politischen und militärischen Bühne als einzigartig, mirakulös und wunderbar empfunden. Schon zu Lebzeiten war „die Jungfrau“ eine sagenhafte Gestalt, von Legenden umrankt.1 Ihre hellseherischen und prophetischen Gaben sind unbezweifelbar, aber eigentliche Wunder hat sie nicht gewirkt. Und doch wird man ihrem Auftreten und Tun mit seinen unübersehbaren geschichtlichen Auswirkungen kaum anders gerecht werden, als dass man im Hinblick auf das Ganze von einem Wunder spricht.2 Diesem Wunder versuche ich mit den Mitteln und Methoden des Historikers, aber auch des Theologen und Literaturwissenschaftlers auf die Spur zu kommen.
Der Historiker hat freilich nicht nur Mittel und Methoden, sondern auch Voraussetzungen und Ziele. Was diese hermeneutischen Fragen angeht, halte ich mich an die Leitprinzipien historischer Forschung, die Henri-Irénée Marrou in seinem Standardwerk „De la connaissance historique“ von 1954 anschaulich mit Beispielen dargelegt und begründet hat.3 Für Marrou ist das eigentliche Ziel der historischen Forschung das Verstehen vergangener Zeiten und Geschehnisse, soweit wir über sie Bescheid wissen. Das Maß des Verstehens ist dabei abhängig vom Wissen um Kontexte, Hintergründe und Zusammenhänge, aber auch vom allgemeinen Weltwissen und vom geistigen Horizont des Historikers. Kein Historiker arbeitet ohne ein Vorurteil oder besser: Vorverständnis. Das Vorverständnis kann er oder sie im Verlauf der Forschungen korrigieren, aber nie ganz überwinden. Sachlichkeit sollten wir anstreben, Objektivität bleibt Gott vorbehalten. Ereignisse werden nicht nur sehr verschieden erlebt, sondern auch sehr verschieden beurteilt. Bei alldem muss Wahrheit das Ziel aller Forschung sein, auch wenn sie selbstverständlich immer nur annäherungsweise zu erreichen ist. Über ein gewisses Maß an Wahrscheinlichkeit kommt der Historiker nun einmal nie hinaus.
Und noch etwas benötigen wir zum wirklichen Verstehen: eine gewisse innere Affinität zum untersuchten Gegenstand oder Sachverhalt. Im Letzten kann nur ein poetisch veranlagter Mensch Poesie verstehen, nur ein musikalischer Mensch Musik, nur ein philosophisch begabter Mensch Philosophie, nur „ein weises Herz die Sprüche der Weisen“, wie schon Jesus Sirach sagt (3,29).4 Und so wird nur ein Frommer einen Frommen wirklich verstehen können und nur ein Christ einen Christen. Wer also ein frommes Mädchen wie Jeanne d’Arc und ihre christliche Umwelt verstehen will, sollte möglichst ähnlich fromm sein wie sie und ihre Umwelt. Wer ihr Weltbild und ihren Glauben an das Wirken Gottes in dieser Welt nicht teilt oder als Einbildung betrachtet, wird schwerlich zu einem echten Verstehen ihres Verhaltens, ihrer unleugbaren politischen und militärischen Erfolge, aber auch ihres Leidens im Prozess unter dem Zwiespalt einer politisch gespaltenen Kirche gelangen können. Agnostische Historiker werden dort, wo solche Phänomene zu Tage treten, zurückhaltend oder deuten sie auf ihre Weise. Meistens lassen sie religiöse Sachverhalte gänzlich unterbelichtet. Können wir auf diese Weise einem Mädchen gerecht werden, das seine gesamten öffentlichen Aktivitäten auf Offenbarung zurückführt, wie es bei Jeanne d’Arc der Fall ist? Heißt das nicht vielmehr, dass man sie gar nicht ernst nimmt?
Selbstverständlich gibt es keine historische Forschung ohne die Methoden der historischen Kritik an den Dokumenten und Quellenaussagen. Doch Kritik kann leicht in Kritizismus und Skeptizismus ausarten. Dann liest man die Quellen vielleicht mit dem Verdacht, dass sie nicht nur von Interessen geleitet sind, sondern überhaupt eher die Unwahrheit als die Wahrheit darlegen wollen. Es gibt „schimärische Geister“, wie Marrou sagt, die mit großem Scharfsinn unlösbare Fragen stellen, um die Aussagen der Texte als unglaubwürdig erscheinen zu lassen.5 Das kann dazu führen, dass man Quellen grundsätzlich gegen den Strich liest, um so zur vermeintlichen Wahrheit zu gelangen. Das ist eine absurde Methode. Im Gerichtswesen gilt heute die Unschuldsvermutung; bei der genannten Art der Quelleninterpretation dagegen gilt sozusagen die Schuldvermutung bis zum Beweis des Gegenteils. Das war im Mittelalter das Prinzip der Inquisitionsprozesse. Es wurde im Revisionsprozess für Jeanne d’Arc zu Recht kritisiert. Denn damit gerät alles von vornherein in ein schiefes Licht. Diese Betrachtungsweise ist für Marrou ein Grundübel der historischen Forschung, das ein Verstehen unmöglich macht. Ein Verstehen verlangt vielmehr die Fähigkeit, von der eigenen Denkweise abzusehen, wenigstens versuchsweise, und sich auf eine fremde einzulassen. Dazu gehören eine gewisse Demut und Liebe – Marrou sagt: Freundschaft – gegenüber den Menschen der Vergangenheit (oder der Gegenwart, je nachdem).
An der Forschungsliteratur zu den beiden Prozessen in Rouen fällt dem Theologen auf, dass Historikern und Juristen manch mal nicht klar zu sein scheint, was für die katholische Kirche seit der Väterzeit eigentlich unter einer Häresie zu verstehen ist. Eine Häresie ist ein bewusst und hartnäckig vertretener Widerspruch gegen eine verbindliche Glaubenslehre der Kirche. Ein bloßer Irrtum hinsichtlich einer Glaubenswahrheit ist für sich genommen noch keine Häresie, kann es aber werden, wenn er hartnäckig verteidigt wird.6 Ob eine solche Häresie bei Johanna vorliegt oder nicht, war die entscheidende Frage in den beiden Inquisitionsprozessen in Rouen, die sich mit ihrem Fall befassten. Der erste meinte Ja und verbrannte angeblich eine Häretikerin, der zweite Nein und rehabilitierte sie. Wer von beiden hatte recht? Die namhafte Mittelalterhistorikerin Claude Gauvard will diese Frage in ihrem großen Essay von 2022 gar nicht entscheiden, sondern lediglich zeigen, wie es zu den beiden so gegensätzlichen Sichtweisen der Heldin bei ihren Feinden einerseits und ihren Freunden andererseits kam. Am Ende stellt sie mit Bedauern fest, dass diese Fragestellung zu einem undurchsichtigen Bild führt, „un écran opaque“. „Wer die Jungfrau in Wirklichkeit war, können wir nicht wissen.“7 Müssen wir uns mit diesem Ergebnis bescheiden? Können wir dem Ziel eines sachlichen Urteils und des Verstehens nicht näherkommen? Nicht einmal angesichts einer solchen Fülle von guten Quellen?
Schon im 19. Jahrhundert setzt eine Forschungsrichtung zu unserem Thema ein, die zu zeigen versucht, dass der erste Prozess, den man dem kriegerischen Mädchen 1431 machte, korrekt und in guter, ehrlicher Absicht gegen die Angeklagte geführt wurde, während der Revisionsprozess 25 Jahre später nur mit Verdrehungen der Wahrheit zum Ziel gelangen konnte. Man geht davon aus, dass die ausgewählten Zeugen damals zumeist nur sagten, was man von ihnen hören wollte. Für Malte Prietzel etwa war der Prozess von 1431 „mustergültig“ und „ging ordentlich zu Ende“, der Rehabilitierungsprozess dagegen weist eine „Vielzahl bewusster Manipulationen“ auf.8 Dann wäre Jeanne d’Arc zu Recht verurteilt worden, zumindest nach den Kriterien ihrer Zeit, und ihre Rehabilitation und spätere Heiligsprechung zu Unrecht geschehen. In diesem Zusammenhang will ein neuerer Aufsatz den Richter des ersten Prozesses, Pierre Cauchon, rehabilitieren und präsentiert den Inquisitor des zweiten Prozesses, Jean Bréhal, als Erdichter einer schwarzen Legende über Bischof Cauchon. Er führt sorgfältig die Invektiven Bréhals gegen Cauchon auf, ohne die Frage zu stellen, ob Bréhals Vorwürfe nicht wenigstens zum Teil gerechtfertigt sind.9 Dieser wissenschaftliche Aufsatz könnte durchaus der Beginn einer schwarzen Legende über Jean Bréhal werden. Man muss freilich damit rechnen, dass derart einseitigen Hypothesen Antipathien zugrunde liegen, die religiöser oder ideologischer Natur sind und vielleicht mehr mit der Kirche und Politik der Gegenwart zu tun haben als mit jener des 15. Jahrhunderts. Dabei werden nur Vorzeichen umgedreht. Schwarz oder weiß sind jedoch selten die richtigen Alternativen in der Beurteilung menschlicher Angelegenheiten. Der Versuch eines Verstehens und einer gerechten Beurteilung muss anders aussehen. Doch wie gesagt: Ganz ohne Vorverständnisse und Vorurteile geht es nicht.
Jeanne d’Arc hatte zu Lebzeiten zwei berühmte Autoritäten als Fürsprecher und Lobredner: den Theologen und Kanzler der Pariser Universität, Jean (Johannes) Gerson, und die hochgebildete Dichterin und Schriftstellerin Christine de Pizan. Den ersten Prozess 1431 erlebten beide nicht mehr. In den Protokollen dieses Prozesses werden weder er noch sie auch nur mit einer Silbe erwähnt. Im großen Tribunal saß freilich keiner, der es an Kompetenz und Autorität hinsichtlich der verhandelten Fragen mit dem Pariser Kanzler hätte aufnehmen können. In den monatelangen Verhören Johannas wurde kein Sachverhalt ans Licht gefördert und kein Argument vorgebracht, das Gerson widerlegen würde. Christine de Pizan als theologisch, politisch, militärisch und humanistisch gebildete Frau lief ohnehin außer Konkurrenz. Dieser Sachverhalt sollte auch heute noch zu denken geben.
Für denjenigen nun, der sich wie der Verfasser dieses Buchs nicht ein Forscherleben lang im Mittelalter umgesehen hat, tut sich eine große Schwierigkeit auf: Einiges an Demut, Empathie und Liebe kann er wohl mitbringen, aber es fehlen ihm die nötigen kulturgeschichtlichen Kenntnisse. Selbst mit den Möglichkeiten, die das Internet heute bietet, bleibt für ihn viel an Forschungsliteratur und Quellenausgaben unerreichbar. Er kann seine Wissenslücken nicht in wenigen Jahren stopfen. Und er kann unmöglich alle wissenschaftlich relevante Literatur lesen und verarbeiten. Da bleibt nur übrig, dass man sich an gelehrten Autoritäten orientiert. Die wichtigste Autorität für unsere Thematik war für mich der 2022 verstorbene Philippe Contamine, der vielleicht beste Kenner der Quellen und der Welt, die zum Verstehen unserer Heldin notwendig sind. Abgesehen von der Lektüre der wichtigsten Quellen verdanke ich seinen Beiträgen, vor allem dem Handbuch, das er zusammen mit Xavier Hélary und Olivier Bouzy verfasst hat, am meisten. Nur selten und in Einzelheiten wage ich es, von seinen sachlichen Urteilen abzuweichen.
In Frankreich und zunehmend auch in England und Amerika gibt es eine Fülle seriöser Forschungen und Darstellungen zu Jeanne d’Arc, deutsche Beiträge dagegen sind eher rar. Auch in kirchengeschichtlichen Darstellungen fällt das Desinteresse an ihrem Schicksal auf. Dabei war es 1834 ein deutsches Werk, das der Forschung, auch der französischen, neue Wege wies: „Die Jungfrau von Orleans. Nach den Prozessakten und gleichzeitigen Chroniken“ von Guido Görres. Aus den letzten Jahren ist vor allem Gerd Krumeichs große Biographie zu nennen. Ich möchte mit meinem Buch auf dem heutigen Forschungsstand an die Tradition von Guido Görres anknüpfen und den religiösen und theologischen Sachverhalten in dieser einzigartigen Geschichte besondere Aufmerksamkeit schenken, selbstverständlich in aller Sachlichkeit. Um ihr religiöses Umfeld zu erkunden, nahm ich mir das berühmteste geistliche Büchlein aus jener Zeit vor: die „Imitatio Christi“ (Nachfolge oder besser Nachahmung Christi) des Thomas von Kempen (1380 –1471). Es gilt als geistlicher Höhepunkt der Devotio moderna, einer frommen Laienbewegung, die auch die Klöster erfasste, vor allem aber eine Reform der Frömmigkeitskultur für einfache Gläubige anstrebte. Im 15. Jahrhundert vermutete man als Autor meistens Jean Gerson. Ich war überrascht, wie gerade die Elemente der eigenartigen Frömmigkeitspraxis Johannas zu den damals ganz ungewöhnlichen, aber gerade von dieser weitverbreiteten Bewegung empfohlenen Elementen gehörten, so etwa die Häufigkeit der Beichte und Kommunion. Thomas schrieb die „Imitatio Christi“ in den Kindheitsjahren Johannas. Vor allem durch Bettelprediger konnte sie solche Ideale kennenlernen. Dieses Phänomen hat in der Forschung über sie, soweit ich sehe, noch wenig Aufmerksamkeit gefunden.10
Ich beginne mit einer Darstellung der Geschichte und Gestalt des Mädchens, das ihre Zeitgenossen nur als la Pucelle „das Mädchen, die Jungfrau“ kannten. Ich verfolge ihr Geschick bis zur Rehabilitation und Heiligsprechung (Kapitel I). Diese Darstellung wird in Kapitel II mit einer Reihe von Anekdoten und Zeugnissen, auch Selbstzeugnissen Johannas, aus den zuverlässigen Quellen über ihr Leben und Sterben ergänzt. Sie sind chronologisch geordnet und knapp kommentiert, so dass sie als Ergänzung zu den jeweiligen Zeitabschnitten ihrer Vita gelesen werden können, aber auch für sich. Kapitel III ist ganz dem Verständnis und der Glaubwürdigkeit ihrer „Stimmen“ gewidmet, die nach Auskunft der Jungfrau selbst ihr ungewöhnliches Tun initiiert und durchgehend bestimmt haben. In Kapitel IV werden acht Theaterstücke über dieses Mädchen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert nacherzählt und gedeutet. Sie lassen etwas von der Rezeptions- und Wirkungsgeschichte dieser Gestalt ahnen, deren Faszinationskraft im Lauf der Geschichte eher zu- als abgenommen hat. Kapitel V widmet sich kurz der Besprechung der liturgischen Texte zu ihrem Gedenktag.
Die Jungfrau von Orléans, Jeanne d’Arc, ist zu einer Symbolgestalt geworden, in Frankreich zu einer nationalen Symbolgestalt. Mir scheint jedoch, dass sie eine allgemein menschliche und vor allem christliche Symbolgestalt ist, die mit ihren Tugenden immer noch Vorbildcharakter hat. Als Heilige gehört sie nicht allein Frankreich, sondern der ganzen Welt, insbesondere den Überfallenen und Unterdrückten.
In der Darstellung und den Anekdoten wird man eine Vielzahl von Namen finden, die einem anfangs die Lektüre vielleicht erschwert. Das bringt die Fülle der zeitgenössischen Quellen und die Art der Ereignisse, in die unsere Heldin verwickelt war, mit sich. Ich habe mich bemüht, nur die wichtigsten Namen zu nennen, die auch öfter vorkommen. Natürlich ist auch die Zahl der Anmerkungen schrecklich groß. Niemand muss sie lesen. Doch die Historiker wollen Belege und vielleicht weiterführende Hinweise. Außerdem sieht man daraus, auf welchen Quellen und Forschungsbeiträgen meine Sicht der Dinge beruht.
Übersetzungen sind, wenn nicht anders angegeben, meine eigenen. Ich danke den Kollegen, die mich auf Literatur aufmerksam gemacht oder mir diese beschafft haben, allen voran meinem alten Mainzer Kollegen Leonhard Hell. Frau Jessika Vollstädt hat die Bekanntschaft mit Gerd Krumeich vermittelt. Das Gespräch mit ihnen war für mich sehr erhellend. Dr. Bruno Steimer vom Verlag Herder hat mein Manuskript mit vorbildlicher Akribie und vielen hilfreichen Verbesserungsvorschlägen lektoriert.
Heidesheim, Ostern 2024
Marius Reiser
1 Vgl. Ph. Contamine, Signe, miracle, merveille. Réactions contemporaines au phénomène Jeanne d’Arc.
2 Vgl. dazu die erhellenden Ausführungen von Paule Petitier, Jeanne d’Arc et le merveilleux historique. Notes sur quelques historiens du XIXe siècle, in: J.-P. Boudet/X. Hélary (Hg.), Jeanne d’Arc. Histoire et mythes 215–227. Die vier Beispiele sind Prosper de Barante, Henri Martin, Jules Michelet und Henri Wallon.
3 H.-I.Marrou, De la connaissance historique; dt.: Über die historische Erkenntnis, 1973.
4 Vgl. J. Piper, Was heißt Interpretation? (Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften. Vorträge 234), Opladen 1979, 22–25.
5 H.-I. Marrou, De la connaissance historique 69 (frz.)/88 (dt.).
6 Ich verweise hier lediglich auf die Ausführungen in der STh des Thomas von Aquin II-II 11,1. 2.
7 C. Gauvard, Jeanne d’Arc. Héroïne diffamée etmartyre, Paris 2022, 179: „Impossible de savoir qui fut réellement la Pucelle.“
8 M. Priezel, Jeanne d’Arc. Das Leben einer Legende, Freiburg i. Br. 2011, 191.204. Vgl. auch G. Krumeich, Jeanne d’Arc 228 mit der Anmerkung 1 S. 358.
9 So Laurence Silvestre, L’inquisiteur contre l’évêque: Jean Bréhal et la légende noire de Pierre Cauchon, in: J.-P. Boudet/X. Hélary (Hg.), Jeanne d’Arc. Histoire et mythes, Rennes 2014, 125–142.
10 Vgl. É. Delaruelle, La spiritualité de Jeanne d’Arc 87 Anm. 28.
I. Geschichte und Gestalt
„Frömmigkeit und Selbstbeherrschungwiegen alle Geistesbildung der Welt auf.“1
Im 14. und 15. Jahrhundert wurde auf französischem Boden ein blutiger, verheerender Krieg zwischen dem englischen und dem französischen Königreich ausgetragen. Man nennt ihn gewöhnlich den Hundertjährigen Krieg.2 Heinrich V. aus dem Haus Lancaster, seit 1413 König von England, erhob dynastische Ansprüche auch auf die Krone Frankreichs und ging von einer Personalunion zweier Kronen aus. Deshalb war der Krieg aus englischer Sicht ein Bürgerkrieg. Im Jahr 1420 verbündete sich der Burgunderherzog Philipp der Gute mit den Engländern im Vertrag von Troyes, indem er den dynastischen Anspruch einer englisch-französischen Doppelmonarchie akzeptierte. Der französische Dauphin (Kronprinz) Karl VII. aus dem regierenden Haus Valois (1403–1461) wurde für illegitim erklärt. Der englische König Heinrich V. war zwar der Schwiegersohn des französischen Königs Karls VI., doch der französische Dauphin war nicht nur Schwiegersohn, sondern Sohn von Karl VI., womit die Frage der Legitimität für die französische Seite eigentlich klar war. Für sie war der Vertrag von Troyes „der schändliche Vertrag“, für die Engländer dagegen der „finale Friedensvertrag“. Damit begannen die schwärzesten Jahre der französischen Geschichte.3
Burgund war damals eines der mächtigsten Herzogtümer Europas. Es beherrschte auch das wirtschaftlich bedeutende Flandern und war zudem verbündet mit dem Herzogtum Luxemburg. Deshalb brachte die englisch-burgundische Koalition das Königreich Karls VII. in größte Bedrängnis. Nun gehörte das Herzogtum Burgund traditionell als Lehensgut zum Reich des französischen Königs, der Burgunderherzog stammte aus dem Königshaus der Valois und war der erste Pair von Frankreich. Aus diesem Grund und weil auf Seiten der Engländer auch Franzosen aus den besetzten Gebieten, vor allem der Normandie, kämpften, hatte der Krieg nicht nur aus englischer, sondern auch aus französischer Sicht Züge eines Bürgerkriegs.
Schon im Jahr 1405 war ein Bürgerkrieg zwischen den mächtigsten Fürsten des Reichs ausgebrochen, dem Herzog von Burgund, Johann Ohnefurcht, und Ludwig, dem Herzog von Orléans. Johann Ohnefurcht ließ seinen Rivalen 1407 auf offener Straße ermorden. Ein Professor der Universität Paris verteidigte den Mord als Tyrannenmord. Während sich nun die französischen Fürsten gegenseitig bekriegten, bereitete England eine neue Invasion Frankreichs vor. Im Jahr 1415 setzten die Engländer über den Kanal und brachten dem französischen Heer bei Azincourt eine furchtbare Niederlage bei. Vier Jahre darauf kam es zur Ermordung des Herzogs von Burgund, Johann Ohnefurcht, durch Begleiter des jungen Dauphins bei einem Treffen zu Friedensverhandlungen. Das geschah 1419 auf der Brücke von Montereau. Der Hintergrund des Mordes waren die blutigen machtpolitischen Auseinandersetzungen zwischen dem Burgunderherzog und dem wichtigsten Unterstützer des Dauphins, Graf Bernhard VII. von Armagnac, vor allem in Paris.4 Nach diesem Grafen, der mit dem Haus Orléans verschwägert war, wurden die Anhänger Karls VII. von seinen Gegnern pauschal als „Armagnacs“ beschimpft. Der Mord auf der Brücke von Montereau beendete den 1405 begonnenen Bürgerkrieg und gab den Anlass für den Vertrag von Troyes und das verhängnisvolle Bündnis Burgunds mit den Engländern im Jahr 1420.
Acht Jahre darauf hatten die Verbündeten die Normandie und den Norden Frankreichs erobert und planten jetzt die Überschreitung der Loire, um in den königstreuen Süden Frankreichs zu gelangen. Im Sommer 1428 führte der Graf von Salisbury, Thomas Montagu, als Oberkommandierender ein frisches Heer von über 3.000 Mann Richtung Orléans. Alles war sorgfältig geplant. Unterwegs eroberte man eine Anzahl Städte, vor allem Meung, Beaugency und Jargeau. Die Belagerung von Orléans begann am 12. Oktober. Auch burgundische Truppen nahmen daran teil. Orléans war eine Stadt, die mit etwa 30.000 Einwohnern an Größe und Bedeutung gleich nach Paris kam, das freilich über 200.000 Einwohner hatte. (Die größte Stadt Deutschlands, Köln, hatte damals 40.000 Einwohner.) Die Verbündeten eroberten in harten Kämpfen und mit starker Artillerie die Festung Les Tourelles samt Wall und Graben am Brückenkopf jenseits der Loire. Als Salisbury am 24. Oktober von einem Fenster im Turm herunter die Stadt besichtigen wollte, traf ihn eine Kanonenkugel am Kopf. Er starb acht Tage darauf. Die Belagerer bauten zwölf weitere Basteien und Bollwerke und beschossen von hier aus die Stadt, die ihrerseits mit großen und kleinen Kanonen antwortete. Ihre schönen Vorstädte hatten die Einwohner Orléans vor der Ankunft des feindlichen Heers eigenhändig niedergebrannt, um die Belagerung zu erschweren. Rouen, die Hauptstadt der Normandie, war 1419 nach einer sechs Monate dauernden Belagerung gefallen; würde es Orléans ebenso ergehen? Mit dem Fall der Schlüsselstadt Orléans wäre das Ende des Krieges abzusehen gewesen, jedenfalls aus englisch-burgundischer Sicht. Die politische, finanzielle und militärische Situation des französischen Königs war prekär, fast hoffnungslos. Nur Schottland schickte starke Hilfstruppen.
Die große Wende im Kriegsgeschehen brachte im nächsten Frühjahr die unerwartete Erscheinung eines kriegerischen Bauernmädchens, für das sich in der bekannten Weltgeschichte nichts Vergleichbares findet. Egon Friedell charakterisiert dieses Mädchen in seiner Kulturgeschichte der Neuzeit als
„ein Wesen, das dauernd im Transzendenten lebte, in jener Welt des Geistes, deren Existenz, da wir über sie nichts Positives auszusagen wissen, von seichten Empirikern bestritten wird, deren deutlich spürbare Wirksamkeit aber die ganze Menschheitsgeschichte durchdringt und in ihren Höhepunkten bestimmt.“5
Ein Bauernmädchen, das Kriegsgeschichte macht und die Politik eines Königreichs bestimmt, obwohl oder genauer: weil es dauernd im Transzendenten lebt; das 1429 siebzehnjährig die politische Bühne betritt; zwei Jahre später nach einem Inquisitionsprozess als Hexe und Ketzerin verbrannt wird; 25 Jahre darauf rehabilitiert und 1920 heiliggesprochen wird: das ist wahrhaftig eine verrückte Geschichte. Sie kann uns gerade heute vieles lehren, nicht nur die offenkundige Wirksamkeit jener Welt, deren Existenz von seichten Empirikern bestritten wird. Schauen wir uns diese Geschichte genauer an.
1. Die Anfänge
„Das, was ein Mensch tut, beginnt ihn zu verwandeln.“6
Das Bauernmädchen namens Jeanne wurde in offiziellen Dokumenten seit ihrer Erhebung in den Adelsstand im Dezember 1429 nach dem Beinamen ihres Vaters Jeanne d’Arc genannt. Denn Jeanne war damals der häufigste Frauenname, ebenso wie Jean der häufigste Männername, so dass ein Zusatz oder eine eigene Benennung notwendig wurde. Sie selbst sagt im Prozess, ihr Beiname sei d’Arc oder Rommée und fügt hinzu, in ihrer Heimat trügen die Mädchen gewöhnlich den Beinamen der Mutter.7 Der Name der Mutter war Isabelle (oder Isabeau), ihr Beiname Rommée. Dieser Beiname wird in der Überlieferung gerne als „Rompilgerin“ gedeutet, ob zurecht, ist umstritten. Als Geburtstag Jeannes gilt traditionell, aber kaum zurecht, der 6. Januar 1412.8 Vor ihrem öffentlichen Auftreten wurde sie nur Jeannette gerufen. Ich werde sie im Folgenden, wo es nicht um ihre öffentliche Rolle geht, Johanna nennen.
Sie stammte aus Domremy – heute Domrémy-la-Pucelle im Département Vosges –, einem kleinen Dorf von etwas mehr als 200 Einwohnern am Rand von Barrois mouvant und Champagne am linken Ufer der Maas. Auf der anderen Flussseite begann Lothringen. Schon Zeitgenossen bezeichnen Johanna immer wieder als „Lothringerin“. Die weltlichen und kirchlichen Herrschaftsverhältnisse waren freilich recht verworren. Kirchlich gehörte das Dorf zur Diözese Toul, damals Teil des Deutschen Reiches. Zwei Nachbardörfer und die nächste größere Stadt, Neufchâteau, nur neun Kilometer südlich von Domremy gelegen, gehörten zum Herzogtum Lothringen. Für die Identität der Einwohner sind die verschiedenen Blickwinkel zu berücksichtigen: von außen oder von innen betrachtet, politisch, landschaftlich, kirchlich. Politisch stand vor allem die Bezirkshauptstadt Vaucouleurs, zwölf Kilometer von Domremy entfernt, mit ihrem Stadtkommandanten Robert de Baudricourt treu zu Karl VII.9
Wie bei Mädchen vom Land üblich, hatte Johanna keinerlei Schulbildung. Das sagt sie einmal selbst mit der Redewendung: „Ich kenne weder A noch B.“10 Ihr Vater war im Dorf angesehen und verhältnismäßig begütert. Man wählte ihn als Vertreter des Dorfes in Streitsachen.11 Durch Kriegszüge der Burgunder war Jeanettes Heimat weithin verwüstet. Schon als Kind wusste sie, was Krieg bedeutet. Im Dorf war sie allgemein beliebt durch ihre Natürlichkeit und Hilfsbereitschaft, aber auch weil sie gern arbeitete, wie mehrere Zeugen hervorheben. Auffällig wurde sie nur durch ihre besondere Frömmigkeit und den Übereifer, mit dem sie betete, beichtete und die Kirche besuchte. Wer sie und ihr späteres Geschick verstehen will, muss mit dieser Auffälligkeit beginnen. Mit ihr sind wir „im Herzen der Persönlichkeit Jeanne d’Arcs“.12
Nach eigener Aussage in der ersten Gerichtssitzung in Rouen lehrte sie ihre Mutter das Paternoster, das Ave Maria und das Credo. Diese drei Grundgebete musste das Beichtkind vor jeder Beichte aufsagen, und zwar auf Französisch. Kirchlich vorgeschrieben waren lediglich die Osterbeichte und die Osterkommunion. Die Osterkommunion blieb für gewöhnlich die einzige im Jahr. Eine christliche Unterweisung erfolgte im Mittelalter vor allem durch die Predigten in der Pfarrkirche, die auf dem Land oft von geringer Qualität waren. Eine Ergänzung konnten Wallfahrtsorte, Klöster, fromme Vereinigungen und reisende Prediger aus den Bettelorden bieten. Domremy lag nicht am Ende der Welt. Zumindest in Neufchâteau konnte Johanna solche Prediger hören. Dorthin flüchtete sie auch mit ihrer Familie vor einem Raubüberfall der Burgunder auf ihr Dorf. In den zwei Wochen, die sie dort verbrachte, beichtete sie nach eigener Auskunft zwei oder dreimal bei Bettelbrüdern.13 Dabei musste sie, da die Beichtväter sie nicht kannten, zweifellos die drei erlernten Grundgebete aufsagen. Sie und ihre Freundinnen pflegten am Samstag die Marienkapelle von Bermont zu besuchen, wo sie auch gerne Kerzen hintrugen. Bermont war eine kleine Einsiedelei, unweit von Domremy an der mittelalterlichen Straße nach Vaucouleurs gelegen. Die Gewohnheit des täglichen Messbesuchs am Morgen bei Sonnenaufgang, die Johanna schon früh hatte, war damals durchaus üblich, vor allem bei Frauen. Fromme Formeln und Wendungen wie „Jesus Maria“, „prendre tout en gré“ (alles willig hinnehmen) oder „notre Sire“ für Gott waren ihr geläufig.14
Im Übrigen waren im Mittelalter der Alltag und das ganze Leben religiös geprägt. Zeitangaben erfolgten nach dem kirchlichen Festkalender. Das galt für die Landbevölkerung ebenso wie für die Adligen. Politik und Kirche waren eng verknüpft. Die meisten Bischöfe waren Adlige oder Hochadlige und nahmen wichtige politische Ämter und diplomatische Aufgaben wahr, denn höhere Bildung war im Allgemeinen Sache der Kleriker. Die Hochadligen begannen ihren Tag mit dem Hören wenigstens einer Messe und beendeten ihn mit dem Blättern in ihren herrlich illustrierten Stundenbüchern.15 Das hielt der englische Regent für Frankreich nicht anders als der französische König. Ihr Krieg hatte damit offenbar nichts zu tun. Ein Kenner wie Francis Rapp spricht von der „Allgegenwärtigkeit des Religiösen“.16
Im Mittelalter und noch in der Barockzeit herrschte allgemein ein starkes Bewusstsein der Unbeständigkeit und Vergänglichkeit alles Irdischen vor, das nur durch die Verheißungen des christlichen Glaubens erträglich schien. Dabei spielten nicht nur die Kriegsverhältnisse eine Rolle, sondern auch Pestepidemien, die ganze Landstriche entvölkerten. Der Tod war allgegenwärtig, die einfachsten sittlichen Gebote verloren ihre Kraft. Eine Verarmung und Verelendung der Bevölkerung war die Folge.17 Im Blick darauf schrieb der berühmteste Theologe seiner Zeit und Kanzler der Pariser Universität, Johannes Gerson (1363 –1429), der auch im Leben Johannas eine Rolle spielen sollte, drei kleine, viel gelesene Traktate: über die Zehn Gebote, über die Beichte und über die Kunst des Sterbens. Davon fertigte er nicht nur eine lateinische, sondern auch eine französische Version an. Denn sie waren gedacht „zur Belehrung der einfachen Leute, die nie eine Predigt hören oder doch nur selten oder, wenn überhaupt, eine schlechte“. Gemäß dem dritten Traktat soll der Sterbende unter anderem gefragt werden: „Verzeihst du von Herzen allen, die dir Schaden zugefügt haben, um der Verehrung und Liebe unseres Herrn Jesus Christus willen, von dem auch du Vergebung erhoffst? Bittest du desgleichen darum, dass dir jene verzeihen und vergeben, die du mit Worten oder Werken verletzt hast?“18 Die Antwort auf beide Fragen hat Johanna vom Scheiterhaufen herab gegeben.19
Von den genannten Gepflogenheiten ist Johannas eigentümliche Spiritualität und Frömmigkeitspraxis zu unterscheiden. Sie geht aus zahlreichen Quellen und Zeugenaussagen deutlich hervor. Mit auffälliger Betonung setzt Johanna in allen Belangen Gott und seinen Willen an die erste Stelle.20 Aber sie war keine Mystikerin, sie suchte nicht Kontemplation und besprach ihre Visionen mit keinem Beichtvater, der sie dann vielleicht aufschrieb. Sie schloss sich auch keiner religiösen Gemeinschaft oder Strömung an und fragte sich nie: Wozu hat Gott mich berufen? Niemals träumte sie vom Martyrium als Beweis höchster Hingabe. Wir wissen von keinem frommen Buch, das sie besonders beeinflusst hätte. Und doch entsprechen ihre Spiritualität und Frömmigkeitspraxis in vieler Hinsicht dem Ideal, das ihr Zeitgenosse Thomas von Kempen in seiner berühmten „Imitatio Christi“ (Nachfolge Christi) zeichnet. Dieses Werk wurde nach der Bibel das verbreitetste europäische Buch. Es entstand wohl zwischen 1414 und 1425, also in den Jahren der Kindheit Johannas.21 Ein Mann wie Ignatius von Loyola schätzte es hoch, der große Dichter Pierre Corneille hat es in Stanzen übersetzt, Theresia von Lisieux konnte es auswendig.
In diesem Büchlein wird das Gebet unter Tränen empfohlen, das für Johanna so typisch ist.22 Die Tränengabe ist in der kirchlichen Tradition ein hochgeschätztes geistliches Charisma.23 Hexen können nach mittelalterlicher Auffassung nicht weinen.24 Johanna aber weinte beim Beichten, bei der Elevation zur Wandlung, beim Kommunionempfang; sie weinte, wenn sie beleidigt wurde und als ein Pfeil sie traf; sie weinte aber auch aus Mitleid, als William Glasdale und viele Engländer bei der Eroberung von Les Tourelles in der Loire ertranken.
Auf die Frage, warum sie so oft beichte, wo sie doch so sicher sei, keine Todsünde begangen zu haben, antwortet sie ihren Richtern – fast alle französische Kleriker – trocken: „Man kann sein Gewissen nie genug reinigen.“25
In der „Nachfolge“ des Thomas von Kempen ist vom reinen Gewissen oft die Rede, etwa wenn es heißt: „Es gibt keine wahre Freiheit und keine rechte Freude außer in der Gottesfurcht und einem guten Gewissen.“ (I 21,6) Das zweite Buch bietet ein eigenes Kapitel darüber (II 6). Anschließend folgen zwei Kapitel „Jesus über alles lieben“ und „Vertraute Freundschaft mit Jesus“. Im ersten steht der Satz: „Halte dich fest an Jesus im Leben und im Sterben und überlass dich ganz der treuen Liebe desjenigen, der allein noch helfen kann, wo alle andere Hilfe versagt.“ (II 7,7) Die Anrede Christi oder Gottes mit bloßem „Jesus“ begegnet in diesem Büchlein nicht ganz selten. Es ist längst eine fromme Tradition. Der Kartäuser Ludolf von Sachsen (um 1300 –1378) erklärt die Bedeutung des Namens Jesus richtig mit „Salvator (Erlöser, Heiland)“ und beschließt seine berühmte „Vita Jesu Christi“ mit dem noch heute gesungenen, langen Gedicht „Jesu dulcis memoria“ des (Pseudo-)Bernhard von Clairvaux.26 „Jhesu Maria“ ließ Johanna auf ihr Banner setzen, und „Jesus“ war ihr letzter Ruf auf dem Scheiterhaufen. Möglicherweise wusste sie um die etymologische Bedeutung dieses Namens.
Das ganze vierte Buch der „Nachfolge“ handelt von der Eucharistie. Ein Kapitel darin ist überschrieben: „Dass es nützlich ist, oft zu kommunizieren“. Den Frommen wird ans Herz gelegt, ihr Gewissen so reinzuhalten, dass sie zur täglichen Kommunion bereit wären – wenn sie die Erlaubnis dazu hätten und es ohne öffentliches Aufsehen geschehen könne. Denn: „Was nützt es, lange mit der Beichte zu warten oder die heilige Kommunion aufzuschieben? Reinige dich so rasch wie möglich; speie das Gift schnell aus!“ (IV 10,11.19) Der spätere Kaplan der Jungfrau bezeugt, dass sie „so gut wie täglich beichtete, häufig kommunizierte“ und dabei weinte.27 Diese Praxis war, wie schon angemerkt, damals sehr ungewöhnlich. Es waren vor allem der Mystiker Johannes Tauler, der schon genannte Johannes Gerson, und eben die „Imitatio Christi“, die frommen Seelen eine häufigere, eventuell sogar tägliche Kommunion anempfahlen. Doch erst mit dem Konzil von Trient in der Mitte des 16. Jahrhunderts sollte sich die häufige Kommunion durchsetzen.28 Johanna jedenfalls hat sich an die zitierten Ratschläge, wo immer es ging, mit größtem Eifer gehalten. Dem Richtergremium in Rouen war ihr häufiges Kommunizieren verdächtig, es fürchtete eine inflationäre Wirkung.29
Natürlich hat Johanna die „Imitatio Christi“ des Thomas von Kempen nicht gekannt. Doch die hier formulierten Ideale der Devotio moderna wurden durch Bettelmönche und Beginen verbreitet. Beginen lebten ohne Gelübde und Regelbindung in Gemeinschaft nach den evangelischen Räten (Armut, Gehorsam, Keuschheit). Etwas von ihrem Geist steckt offenkundig auch in Johanna.
Das Ideal einer Jesus-Frömmigkeit, das sich in der beständigen Reinigung des Gewissens, häufiger Beichte und häufigem Kommunionempfang vollzieht, sollte Johanna freilich nicht in der Stille eines Klosters oder als Begine verwirklichen, sondern in eiserner Rüstung im Kriegslärm eines politisch zerrissenen Landes. So etwas war in keinem frommen Buch vorgesehen, und das Mädchen schauderte zurück, als ihm vom Himmel so etwas zugemutet wurde. Dieses Unternehmen konnte auch nicht lange gut gehen, wie Johanna schnell begriff. Dass sie mit 13 Jahren eine Erscheinung des Erzengels Michael hatte und in der Folge häufigen Besuch von den Heiligen Katharina (von Alexandrien) und Margareta (von Antiochien) – beide Jungfrauen und Märtyrerinnen –, die ihr einen konkreten politischen Auftrag erteilten, wusste niemand im Dorf, auch ihre Eltern nicht. Sie erzählte es mit Bedacht nicht einmal ihrem Beichtvater, was ihr später im Prozess zum Vorwurf gemacht wird.30
Bereits bei der ersten Erscheinung der Heiligen Katharina und Margareta gelobte sie Jungfräulichkeit, solange es Gott gefallen würde.31 Sie spricht ausdrücklich von „ihrer Jungfräulichkeit an Leib und Seele“.32 Die Jungfräulichkeit als Symbol der Uneigennützigkeit und Reinheit ihrer Sendung war ein wesentlicher Bestandteil ihres Selbstverständnisses, und sie hat einiges auf sich genommen und ausgestanden, um sie zu bewahren. Ihre Selbstbezeichnung „la Pucelle“ (das Mädchen, die Jungfrau), unter der sie seit ihrem öffentlichen Auftreten bekannt wurde, hat sie von den genannten heiligen Frauen übernommen, die sie auch kurz und bündig als ihre „Stimmen“ bezeichnete. Diese pflegten sie bei Erscheinungen nach eigener Auskunft oft „Jeanne la Pucelle, fille de Dieu“ (Johanna die Jungfrau, Tochter Gottes) zu nennen.33 Übrigens führten die Beginen in Metz die Bezeichnung „Pucelles“ schon im Namen ihrer Häuser.34 Das Wort „pucelle“ bezeichnet wie das hebräische almáh, das griechische parthénos und das deutsche „Mädchen“ ein unverheiratetes Mädchen, von dem Jungfräulichkeit selbstverständlich erwartet und vorausgesetzt wurde, jedenfalls damals. Ihre diktierten Briefe unterschrieb die Jungfrau – offenbar nach einer Vorlage, die sie abmalte – allerdings nicht mit „La Pucelle“, sondern schlicht mit „Jehanne“.
Mit 17 Jahren erschien dieses eigenartige Mädchen um die Pfingstzeit des Jahres 1428 in der königstreuen Bezirkshauptstadt Vaucouleurs, die nur zwölf Kilometer von Domremy entfernt liegt. Sie trug ein rotes Kleid, wahrscheinlich ihr bestes, und war begleitet von ihrem Vetter Durand Laxart, den sie aufgrund des Altersunterschieds von etwa 17 Jahren „Onkel“ nannte. Sie wollte den Stadtkommandanten Robert de Baudricourt sprechen mit der Begründung, sie sei von Gott gesandt, um das Königreich zu retten. Zu diesem Zweck wollte sie mit einer Begleitmann schaft zum Dauphin (Kronprinz) nach Chinon geschickt werden. Baudricourt, ein erfahrener Militär und Politiker, „der mehr auf ein gutes Schwert als auf hundert gottbegeisterte Jungfrauen hielt“,35 empfahl dem „Onkel“, dem Mädchen ein paar Ohrfeigen zu geben und sie wieder nach Hause zu bringen. Im Prozess erwähnt Johanna selbst, dass sie Baudricourt, den sie vorher nie gesehen hatte, bei diesem Zusammentreffen mit Hilfe ihrer himmlischen Stimme gleich erkannt habe.36
Im Dezember dieses Jahres, vielleicht auch erst im Januar des nächsten, tauchte das Mädchen jedoch wieder in Vaucouleurs auf, wieder in Begleitung ihres Vetters, mit demselben Begehren. Sie hatte ihren Eltern wohlweislich nichts von ihrem Vorhaben gesagt, nur der Vetter war eingeweiht. Baudricourt wies sie wieder ab. Diesmal kehrte sie jedoch nicht mehr nach Hause zurück – sie sollte nie mehr dahin zurückkehren –, sondern wartete beharrlich, mit immer neuen Bitten, drei Wochen lang auf einen Empfang. Während dieser Zeit wohnte sie bei einer befreundeten Familie. Sie besuchte täglich die Frühmesse und betete in der Krypta vor einem Marienbild, das noch heute existiert.37
Inzwischen wusste die ganze Stadt, was sie wollte, und dass sie sich für jene Jungfrau hielt, die nach einer allgemein bekannten Weissagung aus Lothringen kommen sollte, um Frankreich zu retten. Sie konnte die Leute fragen: „Habt ihr nie die Weissagung gehört, dass Frankreich durch eine Frau zugrunde gerichtet wird und durch eine Jungfrau aus Lothringen wiederhergestellt werden soll?“38 Mit der Frau, die Frankreich zugrunde richtet, war Isabeau von Bayern, die Mutter Karls VII., gemeint, die sich der englisch-burgundischen Seite angeschlossen hatte. Auch vor diesem Hintergrund gebrauchte Johanna programmatisch die Selbstbezeichnung „la Pucelle“, das Mädchen, die Jungfrau. Allein unter dieser Bezeichnung kannten sie ihre Zeitgenossen. Kurz vor ihrem Weggang von Domremy hatte sie ein junger Mann wegen eines angeblichen Eheversprechens – vermutlich hatten ihm ihre Eltern Hoffnungen gemacht – vor dem bischöflichen Gericht in Toul verklagt, aber sie gewann den Prozess, da sie glaubwürdig versichern konnte, dass sie niemandem ein Eheversprechen gegeben habe. Nach dem Recht der Kirche durfte kein Mädchen zu einer Ehe gezwungen werden.
Ihre natürliche, verständige und bestimmte Art überzeugte die Leute in Vaucouleurs, und sie gewann sogar zwei junge Edelleute aus der Umgebung des Stadtkommandanten, die später im Revisionsprozess aussagten: Jean de Metz (eigentlich de Nouillopont) und Bertrand de Poulengy. Sie muss einen ganz eigenen Charme gehabt haben. Ein Ritter aus der Gegend von Vaucouleurs meinte später: „Das Mädchen war sehr beredt!“39 Diese Beredsamkeit mit wenigen, aber treffenden Worten hat sie oft bewiesen, auch als es später darum ging, Städte zur Unterwerfung unter den französischen König zu überreden.40 Von Anfang an tritt sie souverän, mit dem Selbstbewusstsein der Gottgesandten auf und zugleich bescheiden und anspruchslos, ohne falsche Empfindlichkeit. Sie hat klare Pläne und Ideen, weiß sich zu helfen und im Dienst ihrer Sache auch in Szene zu setzen.
Die Kriegslage in Orléans war inzwischen fast hoffnungslos geworden. Am 12. Februar 1429 erlitten die undisziplinierten Truppen aus der Stadt trotz zahlenmäßiger Überlegenheit eine katastrophale Niederlage gegen die gut ausgebildeten Engländer. Daraufhin bot die verzweifelte Stadt Orléans dem Burgunderherzog die Übergabe an, um eine Art neutralen Status zu erhalten. Man wollte alles, nur nicht englisch werden. Die Verhandlungen führte Marschall Poton de Xaintrailles, später einer der treuesten Mitkämpfer der Jungfrau. Der Burgunderherzog, Philipp der Gute, Sohn des ermordeten Johann Ohnefurcht, reiste zusammen mit Johann von Luxemburg nach Paris, um die Sache mit dem englischen Regenten für Frankreich, Herzog John Bedford, zu besprechen. Doch Bedford wies den Vorschlag zurück. Er wollte diese fette Beute schon selber machen. Im Übrigen habe das Unternehmen die Engländer schon genug gekostet und stehe kurz vor dem Erfolg. Daraufhin zog der verärgerte Burgunderherzog seine Truppen von Orléans ab.41 Das geschah am 17. April. Trotzdem wurde der englische Belagerungsring immer dichter gezogen, bis nur noch ein Stadttor offen passierbar war. Mit den nach und nach eingetroffenen Verstärkungen auf beiden Seiten entstand Ende April eine Patt-Situation: Keiner der beiden Gegner fühlte sich stark genug für einen entscheidenden Schlag.
In Vaucouleurs hatte Baudricourt Anfang Februar Erkundigungen über das Mädchen eingezogen und wohl auch mit dem Hof in Chinon korrespondiert; so entschloss er sich, Johanna wenigstens anzuhören. Er erschien zunächst im Haus ihrer Wirtin mit einem Priester im Ornat, der die überraschte Bittstellerin mit einer Beschwörung überfiel und mit Weihwasser besprengte, um Teufelei auszuschließen. Die Kandidatin bestand den Exorzismus auf den Knien, aber nicht ohne den Priester anschließend mit leisem Tadel daran zu erinnern, dass er doch ihre Beichte gehört habe. Im anschließenden Gespräch mit dem Stadtkomman danten berief sie sich nicht nur auf die Weissagung von der lothringischen Jungfrau, sondern auch auf ihre Erscheinungen. Baudricourt war nach ihrer eigenen Aussage der erste Mensch, dem sie dieses Geheimnis enthüllte.42 Darauf beschloss er, das Wagnis einzugehen. Immerhin konnte ein Christ etwas Derartiges nicht einfach für unmöglich halten.
Die Jungfrau, die künftig überwiegend in Männergesellschaft leben sollte, bat um Männerkleidung und das kurzgeschorene, das heißt: über den Ohren rund abgeschnittene Haar der damaligen Männermode. Das war auch ein Schutz gegen männliche Belästigungen. Die entsprechenden Kleidungsstücke und Utensilien besorgten ihr die Einwohner der Stadt, ihr Vetter kaufte ihr ein Pferd. Baudricourt ersetzte ihm die Ausgabe für das Pferd und gab der Jungfrau ein Empfehlungsschreiben mit, dazu ein Schwert und eine bescheidene Eskorte: die beiden Edelleute seiner Entourage, die für das Abenteuer bereits gewonnen waren, einen königlichen Boten, einen Bogenschützen und zwei Knechte. Mehrere Zeugen erwähnen eigens, sie hätten bei diesem Aufbruch am 13. Februar, dem ersten Sonntag der Fastenzeit, zugeschaut und gesehen, wie das Mädchen aufsaß und losritt. Ein einfaches Mädchen in Reithosen zu Pferd war damals sensationell, ein Schwert an ihrer Seite und die Begleitung von Männern eigentlich skandalös. Aber so konnte sie als junger Mann durchgehen, denn auf dem Ritt nach Chinon musste man wenigstens in den ersten Tagen mit feindlichen Truppen rechnen. Baudricourt verabschiedete sie mit den Worten: „Geh, geh, und geschehe, was geschehen mag!“43 Das klingt nicht gerade zuversichtlich.
Schon die Reise zum Herzog von Lothringen, der auf eine Wunderheilung durch das ungewöhnliche Mädchen gehofft hatte, hatte sie nur wenige Wochen zuvor zu Pferd gemacht.44 Chinon lag rund 600 Kilometer entfernt. Danach beherrschte sie das Reiten zur allgemeinen Bewunderung.45 Im Winter, zunächst durch englisch und burgundisch kontrolliertes Gebiet – man musste streckenweise nachts reiten und schlief im Freien, die Jungfrau zwischen den beiden Edelleuten –, erreichten sie ohne Zwischenfälle in elf Tagen Chinon, wo der französische König damals residierte. Vor seiner Salbung und Krönung nannte ihn Johanna nur Dauphin, obwohl er als König ausgerufen war. Unterwegs fragte Jean de Metz die Jungfrau immer wieder „ob sie auch tun werde, was sie gesagt habe“. Und sie antwortete jedesmal: „Keine Angst, das ist mein Auftrag! Meine Brüder aus dem Paradies haben mir gesagt, was ich zu tun habe.“ Schon vor vier oder fünf Jahren hätten ihre Brüder aus dem Paradies und ihr Herr, also Gott, ihr gesagt, sie müsse in den Krieg ziehen, um das französische Königreich zurückzugewinnen.46 Wie vor Baudricourt, so macht sie auch vor dieser ersten, immer noch bangen Truppe, die sie anführte, aus ihren Stimmen kein Geheimnis. Und es ist bemerkenswert, dass sie die himmlischen Auftraggeber als „ihre Brüder aus dem Paradies“ bezeichnet. Die Rede von den Heiligen des Paradieses war damals geläufig.
Bei der Ankunft in Gien, einer königstreuen Stadt, machte sie ihre Sendung erstmals öffentlich bekannt: Sie sei im Auftrag Gottes unterwegs zum Dauphin, um die Belagerung von Orléans aufzuheben und den Dauphin nach Reims zur Salbung zu führen. Diese Nachricht erreichte in wenigen Tagen Orléans. Der Stadtkommandant schickte daraufhin zwei Edelleute nach Chinon, um Näheres zu erfahren und vor allem diese angeblich Gottgesandte selbst zu sehen. Nach ihrer Rückkehr Ende März oder Anfang April konnten die Abgesandten in einer Volksversammlung mit sensationellen Nachrichten aufwarten.47 Wahrscheinlich hatten sie auch ein Exemplar des ersten provokativen Sendschreibens dabei, das die Jungfrau an die Engländer vor Orléans gesandt hatte, und konnten es öffentlich vorlesen. Seitdem wurde sie von der Stadtbevölkerung sehnsüchtig erwartet.
Der Stadtkommandant, den man allgemein und ohne abschätzige Nebenbedeutung den „Bastard von Orléans“ nannte – er war ein Halbbruder des Herzogs von Orléans –, wurde 1439 Graf Dunois. Unter diesem Namen ist er heute bekannt. Er war ein enger Vertrauter des Königs und einer seiner fähigsten Heerführer. Die Erfahrungen in Orléans sollten ihn zu einem überzeugten Anhänger der Jungfrau machen. Als diese in Sainte-Catherine-de-Fierbois, 40 km vor Chinon, angelangt war, hörte sie morgens in der Wallfahrtskirche schon zu Ehren ihrer bevorzugten Heiligen, gleich drei Messen und schickte den Boten in ihrer Truppe mit einem diktierten Brief zum König, um ihre Ankunft anzukündigen. Man schrieb das Jahr 1429. Es sollte „das Jahr der Wunder“ werden, wie man später sagte.48 Genaugenommen waren es nur sechs Monate.
2. Chinon, Poitiers, Orléans und Reims: Virgo potens
„Alles, was ich getan habe, geschah aufgrund von Offenbarung.“49
Mit der Ankunft in Chinon beginnt Johannas öffentliche Wirksamkeit, ihre politische Laufbahn. „Von da an war sie ständig unter den Blicken der anderen. Der Druck, dem sie ausgesetzt war, konnte furchtbar werden, zugleich aber musste sie, koste es, was es wolle, eine gewisse innere Distanz wahren und sich vom Milieu der Menschenansammlungen fernhalten.“50 Innere Distanz, die nach Alleinsein und Stille zum Gebet verlangt, war gerade in jenem Milieu, in das Johanna sich gesandt sah, schwer zu finden und verlangte eine beachtliche Selbstbeherrschung. Doch sie hat durchgehalten bis zum Schluss.
Chinon erreichte der Trupp wahrscheinlich am 23. Februar. Der König und seine engsten Berater zögerten, das Mädchen zu empfangen, zumal sie nicht nur behauptete, sie wolle die Belagerung von Orléans aufheben und den Dauphin nach Reims zur Salbung führen, sondern zugleich Leute, Pferde und Waffen verlangte, wenigstens eine kleine Truppe. Man ließ sie zwei Tage lang warten. Doch schließlich überwogen das Empfehlungsschreiben Baudricourts und das Zeugnis ihrer beiden vornehmen Begleiter, die auch über die gewagte Reise von Vaucouleurs nach Chinon berichteten.51 Dazu kam wohl eine gewisse Neugier. Der König veranstaltete noch ein kleines Versteck- und Verstellungsspiel, indem er einen anderen Hofmann als König vorschob, um auf diese Weise ihre übernatürlichen Fähigkeiten zu prüfen. Aber sie ließ sich nicht täuschen.52 Im Prozess sagte sie später selbst aus, sie habe den König bei ihrem Eintreffen „unter den anderen herauserkannt, und zwar mit Hilfe ihrer Stimme, die es ihr offenbarte“. Und sie meint sich zu erinnern, dass sie das dem König in ihrem Brief von unterwegs, in dem sie ihre Ankunft ankündigte, auch vorausgesagt habe.53 Demnach hätte sie selbst die Anregung für das Versteckspiel gegeben. Sie hat ja auch Baudricourt bei ihrem ersten Zusammentreffen herauserkannt. Ihre prophetische und hellseherische Begabung kann angesichts der zahlreichen Zeugnisse dafür nicht bezweifelt werden.54 Derartiges ist in der Geschichte der Frömmigkeit, zumal bei Heiligen, oft bezeugt.
Darauf kam es zu einer Begegnung mit dem König allein außer Hörweite für die anderen im Saal, die sich über zwei Stunden hinzog.55 Dabei konnte die Jungfrau den König von ihrer Sendung überzeugen, nicht zuletzt durch ein „Zeichen“, das sie ihm gab. Worin dieses Zeichen bestand, ist ein Geheimnis geblieben; für den König jedoch war es ein Beweis ihrer göttlichen Inspiriertheit. Er äußerte darüber lediglich, sie habe ihm etwas mitgeteilt, was außer ihm und Gott niemand wissen konnte. Außerdem versicherte sie ihm mit prophetischer Autorität, dass Gott ihm die Sache mit dem Mord an Johann Ohnefurcht vergeben habe und dass er wirklich der legitime Sohn Karls VI. sei.56 Es gingen nämlich Gerüchte um, die ihn für einen Bastard erklärten, und man darf nicht vergessen, dass die eigene Mutter, Isabeau von Bayern, zur englisch-burgundischen Koalition übergegangen war. Diese Gerüchte sollten die dynastischen Ansprüche Heinrichs VI. stützen, wurden aber nicht forciert, um das Ansehen der Königin zu schützen.57 Politik ist eine delikate Kunst.
Um jedoch sicher zu gehen, ließ der König in Johannas Heimat Erkundigungen über sie einziehen und sie durch Hofdamen untersuchen, ob sie Mann oder Frau und Jungfrau sei.58 Denn „junge Mädchen sind gewöhnlich keine Hexen oder Wahrsagerinnen und gehen auch keine stillschweigende oder ausdrückliche Pakte mit Dämonen ein“, wie ein Gutachter für den Revisionsprozess bemerkt.59 In dieser Zeit in Chinon übte sie sich auch im Reiten und im Gebrauch der Lanze. Dabei beobachtete sie der Herzog von Alençon, dessen Besitzungen in der von den Engländern eroberten Normandie lagen. Er war so begeistert, dass er ihr spontan ein Pferd schenkte. Das war bereits ihr zweites Pferd. Am Ende sollte sie wenigstens zwölf Pferde in ihrem Marstall haben. Ein gnädiges Schicksal bewahrte sie jedoch davor, jemals einen wirklichen Lanzenangriff mitmachen zu müssen.60
Der König ordnete weiter eine erste Befragung Johannas durch Kleriker an, die sich nach ihren Stimmen erkundigten. Dabei war auch der Herzog von Alençon anwesend.61 Diese Prüfung genügte dem König allerdings nicht. Er schickte Johanna noch nach Poitiers, neben Bourges seine Hauptstadt mit Universität und Parlament nach dem Verlust von Paris. Dort verbrachte sie sechs Wochen und wurde volle drei Wochen lang durch eine Kommission von hohen Würdenträgern und Hochschulprofessoren der Theologie – fast alle Flüchtlinge der Pariser Universität, die den Loyalitätswechsel nicht mitmachen wollten – auf ihre Glaubwürdigkeit geprüft. Zu dieser Kommission gehörte auch der Beichtvater des Königs, Gérard Machet. Er hat wahrscheinlich den Rat dazu gegeben.62 Den Vorsitz hatte der Kanzler des Königs und Erzbischof von Reims, Regnault von Chartres. Nach dem Mittagessen und nachts pflegte Johanna lange Zeit auf den Knien zu beten.63
Die Prüfer der Kommission waren erstaunt über ihre klugen Antworten, nicht anders als später die Prüfer in Rouen. Das Protokoll der Befragungen in Poitiers ist nicht erhalten, doch ein Beteiligter überliefert einen vielzitierten Wortwechsel. Ein Magister fragte: Wenn Gott das französische Volk aus seiner Not retten will, wozu braucht er da Soldaten? Sie antwortete: „Bei Gott, die Soldaten werden kämpfen, und Gott wird den Sieg verleihen.“ Mit dieser Antwort war der Magister zufrieden.64 Johanna sagte den Herrschaften vier Ereignisse voraus: den Entsatz von Orléans, die Salbung des Dauphins in Reims, die Rückeroberung von Paris und die Rückkehr des gefangenen Herzogs von Orléans aus England. Alle diese Voraussagen, so unwahrscheinlich sie zu diesem Zeitpunkt waren, trafen ein, die zwei letzten allerdings erst nach dem Tod der Prophetin. Bei den Befragungen kamen auch Johannas Stimmen und Erscheinungen zur Sprache, wie sie im Prozess von 1431 selbst bezeugt. In Poitiers beschloss man aber offenbar einvernehmlich, darüber in der Öffentlichkeit zu schweigen und sich damit zu begnügen, sie als gottgesandt zu bezeichnen.65
Die Prüfungskommission fand in ihrem Abschlussbericht nur Gutes an ihr: „Demut, Jungfräulichkeit, Frömmigkeit, Ehrbarkeit, Einfachheit“. Einfachheit, „simplesse“, meint auch Schlichtheit und Natürlichkeit. Man empfahl dem König angesichts der desolaten Lage und der Tatsache, dass man nichts Böses an ihr gefunden habe, das Mädchen, wie sie es wünschte, mit Soldaten nach Orléans zu schicken, auch wenn ihre Versprechungen – von Prophetien wollte man offenbar nicht reden – möglicherweise nur menschliche Erfindungen seien. Vielleicht sei sie aber wirklich von Gott zur Rettung gesandt. So gelte der berühmte Rat des Gamaliël: Abwarten, wie es herauskommt, sonst steht man am Ende vielleicht als Kämpfer gegen Gott da (Apg 5,38f). Ein Beglaubigungszeichen, also ein Wunder, müsse man allerdings verlangen.66
Die Jungfrau erklärte, sie sei nicht nach Poitiers gekommen, um Wunder zu wirken; das verlangte Zeichen werde der Entsatz von Orléans sein.67 Daraufhin erhielt sie aus der ziemlich leeren königlichen Kasse ein Streitross – ihr drittes Pferd –, ein Schwert und eine eigens für sie angefertigte Rüstung, die 100 livres tournois (= Francs) kostete. Das Schwert war aufgrund ihrer Angaben aus Sainte-Catherine-de-Fierbois geholt worden, wo es hinter dem Altar vergraben war. Das Wissen darum führte Johanna wiederum auf ihre Stimmen zurück.68 Als Kommandantin (capitaine) mit einem entsprechenden Sold samt Finanzverwalter für ihren „Hausstand“ (hôtel) wurde sie zur Fähnleinführerin einer kleinen Kampftruppe von „zwei bis drei Lanzen“, wie sie selbst erklärt.69 Eine „Lanze“ bestand gewöhnlich aus einem Ritter zu Pferd und zehn einfachen Kriegern. Demnach zählte ihr Fähnlein nur zwanzig bis dreißig Mann. Zu ihrem Hausstand – oder sollte man eher von einem Hof sprechen? – gehörten auch zwei Pagen und zwei Herolde. Herolde hatten neben Botengängen vielfältige Aufsichtsaufgaben.70 Zu ihrer Kampftruppe gehörten neben den beiden Edelleuten aus der Umgebung Baudricourts auch zwei ältere Brüder Johannas. Sie hatten von der Sensation gehört und kamen, um unter dem Kommando der kleinen Schwester mitzukämpfen. Der König vertraute die frischgebackene Kriegerin ohne Grundausbildung der Obhut des bewährten Ritters Jean d’Aulon an, der sie im Kampf stets begleitete und am Ende auch mit ihr zusammen in Gefangenschaft geriet.71 Er war ihr Haushofmeister und Stabschef. Er, der ihr oft in die Rüstung half, nennt sie „ein junges Mädchen, schön und von guter Figur“ (elle feust jeune fille, belle et bien formée). Doch er habe nie auch nur das geringste Begehren nach ihr verspürt.72
Bekannte stellten ihr einen Augustinereremiten, Jean Pasquerel, vor; der werde ihr bestimmt gefallen. Sie prüfte ihn, indem sie am nächsten Morgen bei ihm beichtete und die Messe hörte. Danach bat sie ihn, bei ihr zu bleiben. Er „diente ihr“, wie er sich selbst ausdrückte, „als Kaplan, indem er ihre Beichte hörte und die Messe sang“,73 zweifellos aber auch als Sekretär. Solche Kapläne hatten Fürsten als Hofgeistliche. Pasquerel blieb bei ihr und begleitete sie auch in den Kämpfen. Er wurde mit ihr zusammen gefangen genommen und sagte – in schriftlicher Form – wie d’Aulon später im Revisionsprozess aus.
Nach ihren Angaben, die sie auf ihre Stimmen zurückführte, wurde mit Erlaubnis des Königs eine Standarte, ein Banner,74 bemalt, dazu ein kleiner Wimpel mit dem Bild des Gekreuzigten für die mitziehenden Priester. Sie kosteten die königliche Kasse 25 livres tournois.75 Die Jungfrau verlangte zumindest von ihren eigenen Leuten, dass sie vor einem Kampf zur Beichte gingen. Und sie erreichte es durch deutliche Worte, dass man in ihrer Gegenwart das gotteslästerliche Fluchen unterließ. Diese Unart war gerade in der gehobenen Gesellschaft damals regelrecht zur Mode geworden.76 Den berühmten La Hire, der für sein fürchterliches Fluchen bekannt war, brachte sie dazu, vor den Augen der Soldaten zur Beichte zu gehen.
Ihr Banner zeigte auf weißer Seide Christus als König des Himmels und Richter über den Wolken zwischen zwei Engeln. In ihnen muss man wohl Michael und Gabriel sehen. Sie tragen Lilien, das Emblem des Königshauses, in ihren Händen. Dazu kommt der Schriftzug „Jhesu Maria“. „Jhesu“ ist der Vokativ, es handelt sich also um eine Anrufung. Auf der Rückseite war die Verkündigungsszene dargestellt. Solche Standarten, um die Mannschaften zu sammeln, durften eigentlich nur Armeekommandanten führen. Das Emblem der Vorderseite bringt zum Ausdruck, dass die Besitzerin nicht im Namen des Königs von Frankreich kämpft, sondern in dem Gottes. Sie sagt selbst, dass sie dieses Bildprogramm nach Anweisung ihrer Stimmen malen ließ.77 Ein Mädchen mit einem Banner war beispiellos, und dieses Banner war, wie sich schnell zeigen sollte, ihre wirksamste Waffe. Beim Angriff trug sie es selbst in der Rechten, schon um nicht in Versuchung zu kommen, ihr Schwert zu gebrauchen, wie sie sowohl in Poitiers als auch in Rouen aussagte: Sie habe nie einen Menschen getötet.78 Wie sich diese mit allen militärischen Insignien versehene Kommandantin allerdings in die bestehende militärische Führungsstruktur einordnen sollte, blieb eine ungelöste Frage bis zum Schluss. Die Behauptung, der König habe sie zur Kommandantin über alle Truppen ernannt, ist eine Legende, die sich freilich hartnäckig hält.
Die ganze Ausstattung Johannas war faktisch eine Nobilitierung. Sie hatte einen kleinen Hof samt Hofkaplan. Seit ihrer Ankunft in Chinon bewegte sie sich fast nur noch unter Adligen, meist Hochadligen. Das verlangte zweifellos einen eigenen Lernprozess, für den sie wenig Zeit hatte. Doch von Anfang an muss sie das Gefühl gehabt haben, dass ihre Zeit kurz bemessen war. Schon in Vaucouleurs war sie nach der Auskunft ihrer Wirtin „ungeduldig wie eine Schwangere“.79 Der Herzog von Alençon hörte einmal zufällig, wie sie den König zum Handeln drängte mit der Versicherung, sie werde sich nur ein Jahr lang halten können, nicht viel länger.80 Wie es dann ja auch wirklich kam. Ihre Ungeduld und ihr ständiges Antreiben konnten ihrem König und ihrer Umwelt freilich lästig werden. Sie selbst war unermüdlich.
Der achtjährige König von Frankreich und England, Heinrich VI., war der Sohn des Siegers von Agincourt, Heinrichs V., der 1422 fromm gestorben war. Zugleich aber war der junge König über seine Mutter, die eine Schwester Karls VII. war, ein Enkel Karls VI. Dieser Sachverhalt gab die dynastische Begründung für den Anspruch auf den französischen Thron ab. Die bestimmende Autorität in seinem französischen Reichsteil war der Onkel des minderjährigen Königs, John, Herzog von Bedford, mit dem Titel Regent. Diese Konstellation bestimmte jetzt die Geschicke Frankreichs auf der Grundlage des Vertrags von Troyes. Alle Verordnungen und offiziellen Briefe, die Bedford verfasste, ergingen im Namen des minderjährigen Königs.
Noch bevor die Jungfrau nach Orléans aufbrach und irgendetwas vollbracht hatte, außer dass sie alle neugierigen Besucher für sich einnahm, diktierte sie aus eigener Initiative am 22. März noch in Poitiers ein herausforderndes Schreiben an „den König von England“, den Herzog von Bedford und die hohen Militärs der Engländer, die alle namentlich aufgeführt werden. Solche Briefe gehörten zum damaligen Propagandakrieg. Man sollte in diesem Fall jedoch besser von einem Sendschreiben reden. Ein Sendschreiben ist nach dem Grimm’schen Wörterbuch „feierlicher als ‚Brief‘ und wird besonders von offiziellen Schriftstücken, Briefen urkundlichen Charakters oder von solchen Schreiben gebraucht, die in Form eines Briefes für die Öffentlichkeit oder doch weitere Verbreitung bestimmt sind“81. Genau darum handelt es sich in unserem Fall. Von Seiten einer unbekannten „Jungfrau“ jedoch musste ein solches Sendschreiben als lächerliche Anmaßung und Frechheit erscheinen, zumal sie darin einen atemberaubenden Ton anschlug, bezeichnet sie sich doch in vollem Ernst als „Kriegsherrn“ (chef de guerre)82 und verlangt nicht weniger als „die Schlüssel aller guten Städte“, die ihre Gegner besetzt hielten. Denn sie sei „von Gott, dem König des Himmels, hierher gesandt, um Euch, Mann für Mann, aus Frankreich hinauszuschlagen“. „Und wenn sie [die Gegner ihres Königs] nicht gehorchen wollen, lasse ich sie alle töten.“ Freilich sei sie gern bereit, Frieden zu schließen und Gnade walten zu lassen, wenn man sich ihr füge. „Wenn ihr den Neuigkeiten (nouvelles) von Gott und der Jungfrau aber nicht glauben wollt,… werden wir ein solches Kriegsgeschrei erheben, wie man es in Frankreich seit tausend Jahren nicht gehört hat.“ Karl sei der einzige Erbe der französischen Krone, wie ihm „die Jungfrau“ von Gott offenbart habe, und er werde im Triumph in Paris einziehen. „Euch, Herzog von Bedford, bittet und ersucht die Jungfrau, Euch nicht selbst zu zerstören… Und gebt Antwort, ob Ihr in der Stadt Orléans Frieden schließen wollt, und wenn Ihr es nicht tut, werdet Ihr das bald zu Eurem großen Schaden bereuen. Geschrieben am Dienstag der Heiligen Woche.“83 Das siebzehnjährige Bauernmädchen konnte unter Umständen mit Grandeur reden, wie Philippe Contamine bemerkt hat.84 Dieses berühmte Sendschreiben ist das beste Beispiel dafür. Sie übersandte es durch ihre Herolde an die Engländer vor Orléans.
Später ließ sie ihrem ersten Schreiben noch einen kurzen Warnbrief in englischer Sprache folgen. Einen dritten diktierte sie schon vor Ort und ließ ihn von einem Bogenschützen mit einem Pfeil ins englische Lager schießen. Diese Briefe und ihr persönliches Erscheinen als Bannerträgerin mit einem Schwert an der Seite verfehlten ihre Wirkung gerade auf die einfachen Soldaten nicht. Von ihrem ersten großen Sendschreiben ließ Karls Hof sofort zahlreiche Abschriften anfertigen und zusammen mit weiteren Dokumenten über sie in ganz Europa verbreiten. Zu diesem Dossier gehörte auch der Abschlussbericht der Prüfungskommission von Poitiers.85 Das war äußerst riskant angesichts der starken Worte dieses Mädchens. Mit der Möglichkeit eines militärischen Fiaskos und einer ungeheuren Blamage musste man immerhin rechnen. Doch der Hof setzte alles auf eine Karte.
In Blois hatte sich ein Heer von etwa 3.000 Mann gesammelt und ein Proviantzug. Unterwegs musste man auf dem freien Feld übernachten. Die Jungfrau schlief zum ersten Mal in der Rüstung, wie sie es in der Folge immer tat, wenn sie nachts keine Frau bei sich haben konnte, und fühlte sich am nächsten Morgen wie gerädert. An diesem Tag gelangten die Truppen in Sichtweite von Orléans, aber nicht auf dem Nordufer, wie man ihr versprochen hatte, sondern auf dem Südufer der Loire. Sie wurde ungehalten und wollte mit dem frischen, auch geistlich vorbereiteten Heer gleich einen Angriff auf die exponierteste der Basteien führen. Doch die Herren Kommandanten fanden diesen Plan zu riskant und wollten das Heer weiter östlich an einen Hafen zur Einschiffung bringen. Sie musste schließlich nachgeben.