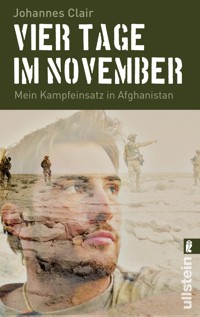
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
"Wir waren dort, um zu kämpfen. Wir wurden gedrillt, auf Menschen zu schießen. So wurde es uns gesagt, und genauso ist es gekommen." Johannes Clair, ein 25-jähriger Fallschirmjäger, hat den Krieg in Afghanistan am eigenen Leib erlebt. Er war dabei, als erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg Artillerie eingesetzt wurde, hat mehrere Sprengstoffanschläge und vier Tage Dauerbeschuss überlebt. In seinem mitreißenden und sehr persönlichen Buch erzählt er von seinem Wunsch, in Afghanistan etwas bewirken zu können, vom Leben als Soldat, von seinen Hoffnungen und seiner Todesangst. Clair ist ein reflektierter Beobachter und beschreibt ehrlich, wie der Einsatz ihn verändert hat. Ein sehr bewegendes Dokument über eine moderne Kriegserfahrung. "Hammer Buch" Til Schweiger
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
Als der Fallschirmjäger Johannes Clair im Sommer 2010 mit seiner Einheit in Kundus, Afghanistan, landet, ahnt er kaum, was ihn erwartet: Sprengstoffanschläge, Häuserkampf und zermürbende Stellungsgefechte – die Schrecken des Krieges sind auf einmal da. Doch zugleich ist er fasziniert von der rauen Schönheit des Landes. Nach monatelangem Einsatz, gekennzeichnet von Entbehrungen und einer schleichenden Veränderung seiner Gefühle, gipfelt der Einsatz der deutschen Elitetruppe Anfang November in der Operation Halmazag, die die Aufständischen endgültig aus der Region vertreiben soll. Vier Tage kämpfen, vier Tage Todesangst – das ist der Preis für Frieden im Distrikt Chahar Darrah.
Clair ist ein guter Beobachter und reflektiert die Herausforderungen und Probleme des offensiven Kampfeinsatzes und wie er sich dadurch verändert. In seiner brillant erzählten, sehr persönlichen Geschichte lässt er uns wie keiner zuvor die ganze Dimension des Afghanistan-Einsatzes spüren. Ein bewegendes Dokument über eine existentielle Kriegserfahrung von heute.
In der aktualisierten Neuausgabe berichtet er darüber, wie sich sein Leben durch den Einsatz verändert hat und was die Rückkehr der Taliban im Sommer 2021 in ihm auslöst und für das Land zu bedeuten hat.
Der Autor
JOHANNES CLAIR, geboren 1985, verpflichtete sich nach Abitur und Wehrdienst für vier Jahre als Zeitsoldat. Als Infanterist Spezielle Operationen nahm er am Afghanistan-Einsatz teil und erlebte den Strategiewechsel der NATO hautnah mit. Der Fallschirmjäger kämpfte von Juni 2010 bis Januar 2011 als Mitglied einer »Task Force« an vorderster Front.
Johannes Clair
Mein Kampfeinsatz in Afghanistan
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-0332-1
Aktualisierte Neuausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage Oktober 2021
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2012 / Econ Verlag
Umschlaggestaltung: zero-media.net, unter Verwendung einer Vorlage von Etwas Neues entsteht, Berlin
Titelabbildungen: © Daniel Pilar (Autorenfoto),
© dpa (Hintergrundfoto)
© für Karten: Peter Palm, Berlin
© für Fotos: Privatbestände, Joel van Houdt
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Für Florian und Hardy
Krieg wird von wenigen beschlossen und auf den Schultern vieler ausgetragen.
AUF DEM WALL
Eine Windböe fegt mir ins Gesicht. Für einen Moment spüre ich sie auf meiner Haut. Wie einen warmen Atem, den der Himmel wie ein Drache ausbläst, als wollte er diesen kargen Ort noch trostloser machen. Der Sand, der mir ins Gesicht wirbelt, hat sich auf meine spröden, ausgetrockneten Lippen gelegt und in meinen Augenbrauen verfangen. Die feinen Körner fühlen sich auf der nackten Haut rau an. Wenn ich mir mit der Hand über das Gesicht wischte, würden sie in den zahlreichen Kratzern und kleinen Wunden, die sich inzwischen über das ganze Gesicht verteilen, wie Feuer brennen. Spuren der vergangenen Tage.
Unbarmherzig steht die Sonne schräg über mir, sie wird noch höher steigen. Es ist bereits jetzt so warm, dass die Kleidung wie ein nasses Handtuch am Körper hängt. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Trocken schlucke ich herunter. Ich muss die Augen zusammenkneifen, um noch etwas erkennen zu können, so grell ist es. Dabei gelangen feine Sandkörner in meine Augen, weshalb ich sie sofort heftig öffne und schließe, ohne Erfolg. Aber das hilft wenigstens gegen die Müdigkeit.
Ich liege still. Seit zwei Stunden. Seit zwei Stunden liege ich still und warte. Es ist über eine Stunde her, dass ich das letzte Mal angesprochen wurde.
Um mich herum ist Ruhe. Der Boden unter mir ist spärlich mit Gras bedeckt, und die hellbraune Erde wirkt an manchen Stellen grau, wie in einem Garten, in dem man den Boden umgräbt und anfangs schwarze Erde hervortritt, bis sie an der Luft ihre frische Farbe verliert und blass wird.
Rechts und links von mir wachsen wild wuchernde Büsche und einige dünne Bäume. Sie rahmen die kleine Lichtung ein, in der ich mich befinde. Von dieser Lichtung aus kann ich nach vorne die Umgebung einsehen, ohne dass allzu viel Bewuchs den Ausblick stören würde. Wenige Meter vor mir befindet sich ein Graben, der sich über die gesamte Breite der Lichtung und darüber hinaus erstreckt. Unter mir verläuft ein Wall, der zu diesem Graben hin sanft abfällt. Es muss sich ein wenig Wasser darin befinden, denn ein lockerer Gürtel aus hohem Schilf wächst daraus empor, das zwischen mir und dem dahinterliegenden Feld eine natürliche Barriere bildet. Es verbirgt mich vor dem direkten Blick von jenseits des Feldes. Dort, im Schatten einer Baumreihe, befindet sich ein weiterer Graben. Die kleinen, struppigen Bäume, denen der Staub eine seltsam blasse Farbe verleiht, sind vielleicht so weit entfernt, wie ein guter Fußballer einen Ball schießen kann, wenn er ihn aus der Hand kickt, und so breit, dass man sich bei angenehmeren Temperaturen schon sehr anstrengen müsste, um das ganze Stück im Sprint zurückzulegen. Jetzt scheint es unmöglich.
Sehr weit reicht mein Blick nicht, so dass ich nur erahnen kann, was sich dort abspielt. Am linken Ende der Baumreihe beginnt eine Schonung aus zierlichen Bäumen und verdeckt das dahinterliegende Dorf. Die Häuser sind vereinzelt darüber zu sehen. Das Feld vor mir ist bereits abgeerntet worden. Die Stoppeln, die sich mal mehr, mal weniger dicht über den gesamten Acker verteilen, wurden noch nicht in den Boden eingearbeitet. Am Feldrand stehen große Säcke. Wahrscheinlich enthalten sie die Ernte oder das Stroh, das übrig geblieben ist. Man kann es auf dem Feld liegen lassen, denn es fängt hier erst kurz vor dem ersten Schneefall an zu regnen.
In der Ferne erheben sich die Ausläufer mächtiger Berge. Sie leuchten rot in der Sonne und scheinen in fahlem Grau, wo der Schatten sie bedeckt. Sie sind einige Kilometer entfernt, und doch ist es möglich, die steilen Felsgrate zu erkennen, die wie die Arme eines Kraken in meine Richtung ragen, und die dunklen Täler, die dazwischenliegen. Die Berge wirken wie eine Wand aus Fels, die das Tal begrenzt, in dem ich mich befinde. Unüberwindbar, aber doch nicht bedrohlich, mehr wie eine Kulisse, die lediglich die Szenerie begrenzt, in der sich die Handlung abspielt. Als wären die Berge schon zu lange vor uns und auch noch zu lange nach uns dort, um sich für das zu interessieren, was gerade um sie herum passiert.
Die Kühle der Nacht ist nun endgültig der Hitze eines neuen Tages gewichen. Weit entfernt höre ich ein paar Vögel und das Rumoren von Motoren. Das nun lauter werdende Brummen dringt nur sehr schwach an mein Ohr. Ich versuche es auszublenden, um konzentriert zu bleiben, und stecke den Gehörschutz ein Stück tiefer in meine Ohren.
Bäuchlings liege ich auf dem Wall, so dass der größte Teil meines Körpers gerade noch von der Wallkrone verdeckt wird. Nur der obere Teil meines Rückens, meine Schultern, mein rechter Arm und natürlich mein Kopf sind von der anderen Seite aus zu sehen. Aber auch das ist eigentlich zu viel.
Vor zwei Tagen, als es am schlimmsten war, haben wir abends angefangen, den Wall mit Gräsern und Gestrüpp zu bedecken, damit wir uns dahinter verbergen können. Nur wenige Lücken haben wir gelassen, um die Sicht nicht zu behindern, wenn man hinter dem Wall liegt und die Umgebung beobachten will. Wir haben Tarnfächer angefertigt, Geflechte aus Ästen und Gräsern, um uns dahinter zu verbergen. Außerdem haben wir tiefe Löcher in die Rückseite des Walls gegraben. Löcher, in denen man bequem stehen kann, um den Rücken zu entlasten. Es ist nicht gut, die ganze Zeit auf dem Bauch zu liegen. In die Löcher kann ich mich hineinkauern und ein wenig geborgen fühlen. Nicht sicher, aber geborgen. Geborgener, als ich mich auf oder hinter dem Wall fühle. Jetzt kauere ich in keinem der Löcher. Ich liege nicht hinter dem Wall. Ich liege oben auf ihm.
Die Sonne heizt meinen Rücken auf. Der Schweiß fängt an, von meinem Rücken und meinem Gesicht zu laufen. Er läuft mir von der Nase und tropft in den Staub. Die Tropfen werden im Dreck zu einer kleinen Kugel, die grau schimmernd auf dem Boden liegt. Als ich mir heute Morgen etwas Wasser über den Kopf laufen ließ, verwandelte es sich sofort in eine dunkle Brühe, die mir an den Schläfen herunterrann. Ich hoffe nur, dass ich keine ungebetenen Gäste habe, denn meine dunkelblonden Haare sind inzwischen so lang, dass man Mühe hätte, sie zu finden. Mein Bart ist deutlich länger, als ich ihn normalerweise trage, und fängt ab und zu schon an zu jucken. Vor allem am Kinn ist es manchmal schlimm.
Wie meine Füße aussehen, habe ich mir das letzte Mal gestern Morgen angesehen. Zwei unförmige weiße Klumpen, voller roter Stellen an und zwischen den Zehen und der Ferse. Der Inhalt kleiner Blasen, die aufgegangen sind, wurde von meinen Socken aufgesaugt. Gestern habe ich beschlossen, die Socken, die am schlimmsten stinken, zu vergraben. Die Übrigen versuche ich zu trocknen, so gut es geht. Meine Stiefel trage ich nun seit über vier Tagen fast ohne Unterbrechung. Aber sie scheinen durchzuhalten. Nur sind sie so staubig, dass ich bei jeder Bewegung eine kleine Wolke verursache. Meine Kleidung ist voll Lehm und Dreck, übersät mit Löchern und kleinen Rissen. Mein Shirt habe ich schon das zweite Mal angezogen, zuletzt vorgestern, es war heute Morgen als Einziges noch einigermaßen trocken. Es hat überall braune Flecken und fühlt sich an wie ein Putzlappen, in den ich meinen Körper gewickelt habe. Ich muss furchtbar stinken.
Dazu der schwere Helm, der jede Kopfbewegung mühsam werden lässt, aber nötig ist, um mich zu schützen. Und die Weste. Mit Kevlarplatten und Splitterschutzeinlagen. Sie wiegt über zehn Kilogramm und lässt jede Bewegung roboterartig und unbeholfen wirken. Die Hitze darunter staut sich und tritt bei jeder Bewegung wie eine kleine, warme Wolke zutage, die mir von unten ins Gesicht bläst.
Muli kam vor einer Stunde zu mir und sagte, dass ich bald herunter müsse. Ich wüsste, warum. Natürlich wusste ich, dass sie in den letzten vier Tagen fast jedes Mal um dieselbe Zeit gekommen waren. Dass wir anfingen, Wetten darauf abzuschließen, wann es wieder losgehen würde. Dass wir mit diesen Wetten fast immer richtig lagen, der eine mehr, der andere weniger. Dass ihr Kommen bedeuten könnte, dass es wieder verdammt knapp werden wird. Wie so oft in den letzten Tagen.
Aber noch habe ich ein paar Minuten. Die will ich mir selbst geben. Und sie denen nehmen, die uns in den letzten Tagen so viel genommen haben. Ich will zeigen, dass wir uns nicht abschrecken lassen. Ein Zeichen. Für die anderen. Für mich.
Vorsichtig schaue ich auf die Uhr. Ich darf meinen Kopf nicht zu stark bewegen. Denn dann könnte ich auf dem Wall entdeckt werden. Behutsam ziehe ich meinen linken Arm in Richtung Gesicht. Wo der Handschuh endet, der meine Hand schützt, beginnt ein brauner Streifen aus Sand. Das Glas meiner Uhr ist zerkratzt, eine Schicht aus Staub und Schmutz bedeckt sie. Ich betrachte die Ziffern kurz im Augenwinkel. Das genügt, um zu erkennen, dass es gleich so weit sein müsste. Sofort blicke ich wieder nach vorne. Die Zeit läuft.
In der ersten Stunde war Hardy noch bei mir. Er lag auch auf dem Wall, aber schräg hinter mir, so dass er an mir vorbeisehen konnte. Es war seine Schicht. Ich wäre jetzt nicht dran, hätte mich noch ausruhen können. Aber Hardy hatte gut beobachtet. Als er mir die Stelle zeigte, sagte er mir, dass es etwa 480 Meter seien. Dann legte er sich schräg hinter mich und wir beobachteten. So, wie wir es gelernt haben. Nach einer Stunde zog er sich zurück, auch er brauchte Ruhe. Er würde ohnehin nicht mehr viel Zeit haben, bevor es losging. Das wusste er. Ich blieb oben liegen und wartete. Würde es noch mal so weit kommen? Würde die Zeit reichen?
Als er mich weckte, war die Sonne gerade über dem Horizont erschienen, und ich lag in meinem Schlafsack hinter dem Wall in einer Mulde auf dem Boden. Ich hatte mich von der Sonne weggedreht, um ihre Strahlen nicht ins Gesicht zu bekommen. Schlaf war wichtig in den letzten Tagen. Jede Minute war bedeutend. Sie half, bei Kräften zu bleiben, nicht aufzugeben. Aufgeben wollte ich niemals. Aber ich wollte nicht mehr das ertragen, was in den letzten Tagen um uns und mit uns geschah. Als sie es wieder und wieder versuchten. Als es so aussah, als würden ihre Bemühungen zum Erfolg führen. Ich hatte mich verkrochen. Erst mit dem Kopf, dann mit dem Körper. Erst hatte ich versucht, an etwas anderes zu denken. Ich hatte versucht, mir vorzustellen, wie schön doch alles sein könnte. Wenn ich nicht hier wäre, sondern auf einer Wiese liegen würde, über mir der blaue Himmel. Ein paar Wolken vielleicht und Vögel.
Vögel sind wichtig. Ich liebe Vögel über alles. Früher habe ich oft in einer Falknerei gearbeitet. Nebenbei, so oft es eben ging. Meistens an den Wochenenden. Ich habe den Vögeln in die Augen sehen dürfen und Weisheit erkannt, Güte vielleicht. Ich gab ihnen Futter, bin mit ihnen auf dem Handschuh umhergelaufen, habe das Lächeln in den Gesichtern der Kinder gesehen, wenn sie den Falken streicheln oder selbst einmal festhalten konnten. Das Glücksgefühl in ihren Augen, an der Erhabenheit dieses majestätischen Tieres teilhaben zu dürfen. An seiner magischen Kraft. Als ob seine Flügel auf dich selbst übergingen, er sie dir gibt, damit auch du fliegen kannst. Ein Vogel verleiht dir Freiheit. Oft wünsche ich mir, auch meine Flügel ausbreiten zu können, einfach loszufliegen. Mich mit kraftvollen Schlägen vom Boden zu erheben und einfach in den Himmel zu schwingen. Ich würde über allen Dingen gleiten und langsam, ganz weit oben meine Bahnen ziehen. Ich würde frei sein.
Stattdessen bin ich hier. Kann nicht weg. Kann nur hilflos mit ansehen, wie die Dinge um mich herum passieren, dann versuchen zu reagieren. Aber das ist das Schlimmste. Das hat es zu oft gegeben. Reagieren. Nicht selbst bestimmen zu können, was wann geschieht, ist nicht deprimierend. Es ist zerstörend. Ich soll zerstört werden. Vielleicht habe ich mich wegen dieses Gefühls der Ohnmacht verkrochen. Habe mich in ein Loch gekauert. Habe mich so klein gemacht, wie es ging, und gewartet. Gewartet, dass es vorübergeht. Gewartet, dass es irgendwie schon werden würde. Es ist der falsche Weg. Es ändert nichts. Es macht alles schlimmer.
Vielleicht habe ich einfach nur Angst. Angst, nicht das Richtige zu tun. Angst, alles könnte umsonst sein. Angst, mich selbst zu verlieren. Angst, alles zu verlieren. Aber was ist alles?
EINE SCHRECKLICHE NACHRICHT
Es war ein warmer Sommertag in Deutschland und einige Monate früher. Der Reisebus fuhr gemächlich eine Allee entlang, deren große Bäume ihren Schatten auf die Straße warfen. Ich konnte die Felder dahinter sehen. Saftige, grüne Weiden wechselten sich mit dunkelgelben Kornfeldern ab. Dazwischen wiegte der Wind langsam den jungen Mais hin und her. Irgendwo am Rand eines Dorfes spielten Kinder auf einem großen Erdhaufen, der vielleicht zu einer Baustelle gehörte. Die Sonne kitzelte mich. Ich dachte daran, wie angenehm es jetzt wäre, an einem Baggersee auf dem Boden zu liegen. Unter mir den feinen Sand zu spüren, den Geruch von frischem Gras und Wasser in der Nase und dabei die Wolken zu beobachten, wie sie langsam am Himmel entlangziehen.
Joe, gib mir mal ’nen Kugelschreiber.
Ich wurde von Hardy aus meinen Gedanken gerissen. Joe war mein Spitzname in der Schulzeit. Und weil wir uns in Afghanistan nicht wie in der Bundeswehr sonst üblich beim Nachnamen nennen wollten, fand er neue Verwendung.
Weißt du, wo wir gerade sind?, wollte Hardy wissen.
Ich schaute nach draußen. Der Bus bog auf den Autobahnzubringer ein. Wir würden bald am Flughafen sein. Ich schaute an mir herunter, betrachtete den sandfarbenen Anzug mit den grünen und braunen Flecken. Sie sahen aus, als hätte jemand einen Pinsel in zwei Farbtöpfe getaucht und damit die Hose und die Bluse bespritzt. Ein unregelmäßiges Muster, die Farben ineinander verlaufend. Bequem war der Anzug. Viel bequemer als der dunkelgrüne, den wir sonst trugen. Er war luftig, aus viel dünnerem Stoff. Hatte Netzeinsätze unter den Armen für eine bessere Luftzirkulation. Mein Name prangte über der linken Brusttasche. Fein gestickt auf einem olivfarbenen Streifen, der durch einen Klettverschluss mit der Bluse verbunden war. Ich hatte kaum etwas in den Taschen. Es war verboten worden. Wegen der Sicherheit im Flugzeug, hatten sie gesagt. Das kam mir etwas merkwürdig vor. Wenn man bedachte, wer wir waren und wohin wir reisten, sollte das eigentlich die geringste Sorge sein.
Endlich geht’s los!, rief Muli von vorne.
Endlich? Wir hatten uns lange vorbereitet. Jedem von uns war die Aufregung ins Gesicht geschrieben. Diese Art von Erregung, die dich ergreift, wenn du lange auf etwas wartest, ohne genau zu wissen, was es ist. Wie früher, als Kind an Weihnachten. Du wusstest, dass du Geschenke bekommst, und trotzdem warst du so gespannt, weil du nur raten konntest, welche.
Muli war vor einem Jahr unser Gruppenführer geworden. Er war ein kleiner Mann, Anfang dreißig und hatte kurze, schwarze Haare, die vermutlich wie dicke, schwarze Wolle aussahen, wenn er sie wachsen ließe. Er trug lange Koteletten und oft einen kurz geschnittenen Bart. Die südländische Herkunft war ihm sofort anzusehen. Zierlich gebaut und schlank, hatte er meistens ein Grinsen im Gesicht, das irgendwie schelmisch wirkte. Muli war sehr kommunikativ. Die meisten fühlten sich in seiner Umgebung sofort wohl, weil er wusste, wie man Menschen für sich einnahm. So bekam er immer, was er wollte. Mit seinen sechs Auslandseinsätzen brachte er eine unglaubliche Erfahrung in die Gruppe. Er war schon mehrmals in Afghanistan gewesen und sagte, das Land sei inzwischen wie eine zweite Heimat für ihn.
Muli und ich mochten uns auf Anhieb und waren in gewissen Dingen auf einer Wellenlänge. Wir hatten gelernt, uns zu vertrauen, und führten viele Gespräche über die Gruppe, wenn die Übrigen nicht dabei waren. So versuchte ich eine Brücke zwischen ihm als Vorgesetzten und uns Untergebenen zu schlagen und ihn zu beraten. Seinen Spitznamen hatte er während eines früheren Auslandseinsatzes im Kosovo bekommen, als er auf einem Maultier geritten war, das nicht mehr anhalten wollte. Muli.
Gemeinsam mit Nossi hatte er jeden Einzelnen von uns ausgesucht. Nossi war sein Stellvertreter und das genaue Gegenteil von Muli. Still, und obwohl auch er häufig einen Kommentar nicht für sich behielt, viel zurückhaltender in dem, was er sagte. Er war deutlich größer als Muli und kräftiger gebaut. Er hatte breite Schultern, und trotz des Bauchansatzes konnte man sehen, dass er viel trainierte. Auch er hatte südländische Wurzeln. Seine dunklen Augen konnten blitzen wie der Teufel. Sein Wille und seine anstrengende Ausbildung waren berüchtigt. Viele aus der Gruppe hatten ihn bereits in der Grundausbildung erlebt und wussten, dass er seine Männer für gewöhnlich bis zum Äußersten forderte. Als er uns kurz vor dem Einsatz in Afghanistan das Du anbot, weil wir ein Team waren und er meinte, dass es einfacher sei, wenn wir auf einer persönlichen Ebene zusammenarbeiteten, drohte er uns gleich an, dass wir ihn wieder mit Herr Oberfeldwebel anzureden hätten, wenn wir Mist bauten. Er konnte uns gut motivieren.
Wir waren schon so oft zusammen im Einsatz, wir sind wie ein Ehepaar, hatten Muli und Nossi uns am Anfang gesagt. Und wirklich hatten sie unsere Gruppe wie eine Familie zusammengefügt. Da waren neben den Führern Muli und Nossi der hübsche Mica, der zynische Hardy, der launische TJ, der ehrgeizige Jonny, der kleine Kruschka, der fluchende Simbo, der zähe Wizo, der sanfte Dolli, der starke Butch, der schweigsame Russo und ich. Und jeder hatte seine eigene Geschichte. So wie Butch, dessen Frau schwanger war, oder Wizo, der die Einheimischen verfluchte, weil schon sein Vater als russischer Soldat in Afghanistan gekämpft hatte.
Obwohl die meisten in der Vorbereitungszeit immer wieder aus der Gruppe gerissen wurden, um Lehrgänge und Fortbildungen zu besuchen, hatten Muli und Nossi aus uns eine Einheit geformt. Eine Gruppe von dreizehn jungen Männern, die eine Hälfte des Golf Zuges. Der Golf Zug war der zweite Zug unserer Kompanie und hatte noch eine zweite Gruppe. So ist das in einem Zug von etwa 25 Mann. Im Einsatzland wurden die Namen aller deutschen Infanteriezüge nach dem Nato-Alphabet vergeben. Unsere Kompanie hatte vier Züge, und zwar Foxtrott, Golf, Hotel und India. Der Name wurde am Einsatzende an die Nachfolger weitergegeben.
Unter den Zügen unserer Fallschirmjäger-Kompanie herrschte Konkurrenz. Wie bei einem großen Turnier waren alle bekannt oder befreundet, aber jeder war stolz, ein Mitglied seiner Mannschaft, seines Zuges zu sein. Die übrigen Züge waren die anderen Mannschaften. Das erhält den Ehrgeiz, hatte unser Zugführer einmal gesagt. Jeder will am besten dastehen, deshalb gibt jeder sein Bestes! Das hörte sich irgendwie seltsam an. Als würden wir auf einen Sportplatz fahren und nicht in den Krieg ziehen.
Viele in der Kompanie waren schon seit der Grundausbildung ganz am Anfang ihrer Militärzeit in ihren Zügen zusammen. Ich selbst war als einer der Letzten in den Golf Zug gekommen, hatte mich freiwillig gemeldet. Ich wollte es unbedingt, wollte in eine Infanterieeinheit. Schon über drei Jahre war ich in der Armee. Erst als Wehrdienstleistender, dann hatte ich freiwillig verlängert und wollte schließlich für vier Jahre Zeitsoldat werden. Hatte in der Personalabteilung gearbeitet, danach im Geschäftszimmer. Büroarbeit. Nicht das, was ich mir erträumt hatte. Aber der Job gab mir die Gelegenheit, die internen Arbeitsabläufe der Bundeswehr kennenzulernen. Büro bedeutete Verantwortung. Wenn ich etwas verlegte, konnte das Karrieren und Lebenswege zerstören. Ich habe dabei viel gelernt. Dennoch, meine Ziele sahen anders aus. Ich wollte hinaus, wollte von Anfang an in den Wald, zu den »Grünen«, also jenen Soldaten, die kämpfen müssen, wenn es drauf ankam. Grün war die Farbe der Infanterie.
Ich hatte meinen Kompaniechef so lange mit dieser Bitte aufgesucht, dass er mich vom Geschäftszimmer in einen der Rekrutenzüge steckte, die es in unserer Kompanie gab. Dort wurden die Neuankömmlinge drei Monate lang ausgebildet. Wieder ein anderer Blickwinkel. Es war eine sehr schöne Zeit für mich, denn ich habe schon immer gerne mit Menschen zusammengearbeitet. Bereits in der Schule fuhr ich als Betreuer für jüngere Klassen auf Schulfahrten mit. Diese Hilfestellung, das Anleiten und auch Führen war etwas, mit dem ich mich identifizieren konnte. Ich wollte Verantwortung übernehmen.
Mir war wichtig, die Rekruten zu fordern und zu besonderer Leistung zu motivieren. Die meisten Menschen sind in der Lage, viel mehr zu leisten, als sie sich selbst zutrauen. Das wollte ich aus den Rekruten herauskitzeln. Ich habe dabei niemals den Grundsatz vergessen, durch Vorbild zu führen. Also musste ich alles vor- und mitmachen. Mit den Rekruten zu arbeiten, sie an ihre Grenzen zu führen, sie zu fördern, ihnen den Beruf des Soldaten bei- und näherzubringen, betrachtete ich als Möglichkeit, auch mich selbst weiterzuentwickeln. Häufig dankten meine Schützlinge es mir, indem sie mir ihr Vertrauen schenkten und auch in persönlichen Anliegen das Gespräch mit mir suchten. Die Beziehung zwischen ihnen und mir baute auf gegenseitigem Respekt auf. Das wollte ich vermitteln. Ich fühlte mich dort gut aufgehoben.
Aber etwas nagte an mir. Ich sagte den jungen Männern und Frauen immer, wer sich für den Dienst in den Streitkräften entscheidet, hat sich freiwillig einen Beruf ausgesucht, der anders ist als alle anderen. Ich hob hervor, dass es ein Unterschied zu allen anderen Berufen ist, wenn man als Soldat einen Eid auf den Staat leistet. Einen Schwur, der dich an die gewählte Regierung und ihre Entscheidungen bindet. Einen Schwur, der von dir verlangt, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Treu dienen und tapfer verteidigen, genau so stand es im Diensteid. Ich sagte den Rekruten, dass Treue bedeutete, zu seinem Schwur zu stehen, auch wenn es unbequem war. Und dass man tapfer handelte, wenn man etwas auf sich nahm, obwohl dabei die Gesundheit oder das Leben auf dem Spiel stand.
Aber im Grunde wusste ich nicht, was es wirklich bedeutete, diesen Eid zu erfüllen. Ich wusste es nicht, weil man sich dessen nur bewusst sein kann, wenn man am eigenen Leib erfährt, was es heißt, diesen Eid erfüllen zu müssen. Ich fühlte mich wie ein Feuerwehrmann, der niemals zu einem Brand mitgenommen wurde. Fast wöchentlich sah ich Bekannte und Freunde aus meiner Kaserne in die Einsatzländer aufbrechen. Ich wollte sie nicht allein gehen lassen. Deshalb fragte ich meinen Kompaniechef, ob ich gehen dürfe. Er überlegte einen Tag und unterstützte schließlich meinen Wunsch. Ich fing an, Gesuche an meinen Bataillonskommandeur zu schreiben, denn dieser musste als nächsthöherer Vorgesetzter entscheiden. Ich wurde enttäuscht. Mein Kommandeur lehnte ab. Trotzdem nervte ich ihn ein Jahr lang. Selbst als er durch einen Nachfolger ersetzt wurde, war das Ergebnis das Gleiche. Ich war frustriert. Ich fragte mich, wie man jemandem, der in den Einsatz musste, aber nicht wollte, erklärte, dass es Soldaten gab, die wollten, aber nicht durften. Und schließlich wollte ich doch nur das Eine: selbst erleben, was es bedeutete, diese Verantwortung, diese Bürde zu tragen.
Zu dieser Zeit wurde Muli drei Monate lang als zusätzlicher Ausbilder in unsere Rekrutenkompanie versetzt. So lernte ich ihn kennen. Er sprach davon, dass seine Heimatkompanie bald nach Afghanistan gehen würde. Durch unsere Zusammenarbeit lernten wir uns schätzen und irgendwann fragte er mich, ob ich mir vorstellen könne, mit ihm in den Einsatz zu gehen. Der Rest war nur eine Formalität. Absurd, wie einfach es »hintenherum« war, wenn man bedachte, wie lange ich auf offiziellem Weg versucht hatte, ins Ausland zu kommen. Ich wurde zunächst auf Probe in die Kampfeinheit kommandiert.
Skeptische Blicke empfingen mich am ersten Tag. Ein Neuer ist immer erst einmal verdächtig. Nach einer halben Woche ging es für zwei Wochen auf einen Truppenübungsplatz. Würde ich mich dort beweisen können? Um schließlich das zu machen, was ein Soldat macht.
Als der Einsatz langsam näher rückte, hatten Muli und Nossi angefangen, uns die Wahrheit zu sagen. Ihr werdet dorthin gehen und nicht mehr auf Scheiben schießen. Ihr werdet auf Menschen schießen. Und Menschen werden auf euch schießen, hatten sie uns gleich bei der ersten Besprechung klargemacht. Auf Menschen schießen. Auf Menschen schießen.
Dieser Satz hallte mir an jenem Abend sehr lange im Kopf nach. Sie werden auf euch schießen, ihr werdet auf sie schießen. War es das, was ich wollte? War ich bereit dazu, einem Menschen das Leben zu nehmen, ihn zu töten? Wie würde ich reagieren, wenn es so weit kommen sollte? Musste es so weit kommen? Warum fand ich keine Antwort auf diese Fragen?
Jeder von uns ging anders mit dem Thema um. Einige hängten sich einfach an die Meinung derjenigen, die immer das Wort führten, immer einen Kommentar oder eine Meinung parat hatten, egal ob sinnvoll oder nicht. Einige wurden still, wenn das Thema angesprochen wurde. Und andere schienen sich viele Gedanken darüber gemacht zu haben. Eines Abends saß ich mit Jonny auf seiner Stube. Jonny war jünger als ich, hatte seine Lehre auf dem Bau gemacht und auch lange dort gearbeitet. Zur Armee sei er gegangen, um eine neue Herausforderung zu bekommen, hatte er gesagt. Er war sehr schlank, hatte aber einen wahnsinnig drahtigen Körper. Ich hatte noch niemals vorher jemanden so verbissen trainieren sehen wie ihn. Er war immer in Bewegung. Kraftraum, laufen, schwimmen. Jonny wirkte auf mich wie ein getriebener Hund. Aber dazu war er sehr lern- und wissbegierig. Wann immer er konnte, bildete er sich selbst weiter, eignete sich das Wissen an, von dem er meinte, es brauchen zu können. Er sagte immer gerade heraus, was er dachte, und das war bemerkenswert. Das machte ihn zu einem Kameraden, dem man bedingungslos vertrauen konnte, weil er nie falsch war. Auf andere mag er vielleicht primitiv gewirkt haben. Aber ich wusste um seine Fähigkeit, Situationen und Menschen zu analysieren. Unter der Oberfläche war er ein stiller Denker und trotzdem sehr impulsiv. Ein Freund. Von allen in der Gruppe war er mir der liebste. Unser Verhältnis war von großem gegenseitigem Respekt geprägt, wir hatten Achtung voreinander.
An jenem Abend auf seiner Stube sprachen wir darüber, ob es uns fertigmachen würde, einen Menschen zu erschießen.
Da sagte er Folgendes: Wenn ein Mensch mich erschießen will, ist es mir egal, ob er schwarz, weiß, dick, dünn, alt, jung oder Familienvater ist. Wenn er auf mich schießt, macht er sich zu meinem Feind. Und dann werde ich meinen Feind töten.
War es wirklich so einfach? Ich fuhr sehr nachdenklich nach Hause. Was wäre, wenn der Feind eine schwangere Frau war? Oder ein Jugendlicher oder ein Kind? Was, wenn keiner vorher auf mich geschossen hat, ich aber als Erster schießen muss, um beispielsweise einen Anschlag zu verhindern?
Ich hätte gehen können, einfach nein sagen. Ich hatte mehrmals die Chance dazu.
Ich werde niemanden dazu zwingen, mitzukommen, sagte Muli uns einmal bei einer Besprechung. Wenn einer nicht will, denke ich nicht schlechter von ihm.
So war mit der Zeit eine Gruppe entstanden, bei der klar wurde, dass sie zusammen funktionieren würde. Dass jeder sich auf den anderen würde verlassen können.
Die Einsatzausbildung war hart. Bereits frühmorgens im Dunkeln machte Nossi auf einer Wiese vor unserem Kasernengebäude mit uns Nahkampftraining. Es war unglaublich anstrengend. Faustschläge, Tritte, Liegestütze, wieder Faustschläge. Er ließ uns üben, bis wir Arme und Beine nicht mehr heben konnten. Wir hassten es. Woche für Woche, Tag für Tag. Irgendwann merkten wir, wie unser Selbstvertrauen stieg, wie sich die Leistungsfähigkeit von Körper und Geist steigerte. Wir genossen es nicht, aber wir wurden uns unserer Fähigkeiten bewusster. Anschließend übten wir bis in die späten Abendstunden all die Verfahren, die wir würden anwenden müssen, wenn es zu kritischen Situationen kam: Unter Beschuss Verletzte bergen, zurückschießen, in Formation bleiben. Vorrücken, sichern, wieder vorrücken. Grundlagen, die wir so oft übten, bis sie uns in Fleisch und Blut übergegangen waren. Danach übten wir weiter. Das Ganze wechselte sich mit dem Trainieren von Fahrzeug- und Fußpatrouillen ab, oft über mehrere Tage, irgendwo im Gelände, um das richtige Auf- und Absitzen im Gefecht und die Fähigkeiten unserer Fahrer zu trainieren.
Wir gingen auf die Schießbahn. Wir übten und übten. Allmählich wurde uns klar, dass wir im entscheidenden Augenblick nicht nachdenken durften, sondern handeln mussten. Einen solchen Automatismus erreicht man nur mit intensiver, wiederholter Arbeit. Wir erlernten auch Techniken, die nicht zum normalen Repertoire eines deutschen Soldaten gehörten. Dinge, die sonst nur von Spezialkräften angewendet wurden. Wir hatten das große Glück, einen Zug in der Kompanie zu haben, der für Spezialaufgaben ausgebildet war. Die Kameraden hatten ein jahrelanges Training hinter sich, und wir konnten von ihnen viel lernen. Komplexe Dinge wie den Orts- und Häuserkampf. Ein Gebäude zu stürmen, sieht nur im Film einfach aus. Aber auch Dinge, die weniger auffielen, wie das sinnvolle Zusammenstellen von persönlicher Ausrüstung. Dies verdankten wir in erster Linie diesem Zug unserer Kompanie, aber auch Männern wie Nossi, die diese Spezialausbildung ebenfalls genossen hatten und sie an uns weitergaben. Und auch unserem Kompaniechef, der die normale Einsatzvorbereitung der Bundeswehr als nicht ausreichend bewertete und unser Training ergänzen ließ.
Keine Sekunde ließ er uns daran zweifeln, dass wir in einen Krieg ziehen würden. Unser Kompaniechef sprach immer offen aus, was er von uns erwartete: Das zu tun, was sonst keiner tue, dorthin zu gehen, wo sich sonst keiner hinwage, dort weiterzumachen, wo andere aufgaben. Er nannte es Treue um Treue.
Fürs Vaterland und den Kameraden neben uns. Wir waren »seine Männer«. Angriff ist die beste Verteidigung, beschrieb er seine Philosophie. Er war ein Offensivdenker. Auch dass er über die übliche Zeit hinaus fast vier Jahre lang unser Kompaniechef war, um uns im Einsatz führen zu können, und dadurch vielleicht Karrierenachteile in Kauf nahm, war kennzeichnend für seinen Charakter. Davon abgesehen, hatte unser Chef den Grundsatz, die zentrale Dienstvorschrift nicht zu wörtlich zu nehmen. Solange der Laden lief und niemand zu sehr über die Stränge schlug, ließ er uns an der langen Leine. Trotzdem genoss er innerhalb der Kompanie einen unglaublichen Respekt.
Seine Erscheinung war beeindruckend. Ein ebenmäßiges, strenges Gesicht, eine etwas zu groß geratene Nase und einen Blick, der alles durchdringen konnte. Er sprach mit einer tiefen Stimme und langsam, schien jedes Wort mit Bedacht zu wählen. Beim Sport trug er eine Hose, die etwas zu kurz geraten schien, ähnlich den Trainingshosen, die man in den siebziger Jahren trug. Dadurch kamen seine langen Beine sehr zur Geltung, was uns jedes Mal schmunzeln ließ, wenn wir ihn so sahen. Er war ganz anders als die meisten Offiziere, die wir kannten. Er vermittelte uns das Gefühl, ernst genommen zu werden, und verströmte ein Vertrauen, wie ich es bei keinem anderen Offizier erlebte. Niemals hatte ich das Gefühl, dass er einfach nur dastand, sondern dass er in seiner aufrechten Haltung, mit den auf dem Rücken verschränkten Armen, immer große Gedanken in seinem Kopf hin und her bewegte. Es war eine Feldherrenpose.
Die meiste Ehrfurcht hatten wir aber davor, dass er uns immer seine Meinung ins Gesicht sagte. Selbst vor der angetretenen Kompanie sprach er frei von der Leber weg. Er legte Wert darauf, uns zu informieren, uns nicht im Unklaren zu lassen. Durch nichts konnten wir als Kompanie mehr beeindruckt werden als durch diesen Mann. Er überblickte die Dinge wie kaum einer sonst. Sogar beim Sport konnte er uns allen davonlaufen, war überhaupt immer vorne zu finden. Für ihn schien es das Absurdeste zu sein, sich selbst als mittelmäßig wahrzunehmen. Er hatte immer das Streben, erstklassig zu sein. Diesen Gedanken verankerte er durch seine Art, uns zu führen und Präsenz zu zeigen, in unseren Herzen. Wir fühlten uns wie etwas Besonderes. Wie eine Kompanie, die dazu geschaffen war, Besonderes zu leisten. Dieser Gedanke setzte sich über die Feldwebel bis in die Köpfe der einfachen Soldaten fort. Daraus entstand eine unglaubliche Kraft. Eine Kraft, der wir uns alle fügten, eine Kraft, die uns eine Stärke verlieh, von der wir vorher nichts wussten.
Natürlich entstanden aus dieser Haltung auch Probleme: Einerseits ein arrogantes Elitedenken, das die Leistung der anderen Armeeangehörigen ausblendete. Und andererseits ein übergroßes Selbstvertrauen und ein Gefühl der Unverwundbarkeit. Kaum einer gab es offen zu, aber wir fühlten uns bereits wie Kriegshelden. Dabei saßen wir noch nicht einmal im Flugzeug in Richtung Osten.
Auch Muli ließ keinen Zweifel daran, dass er es mit uns ernst meinte. Dass er uns ausgewählt hatte, weil er mit uns, und nur mit uns, diesen Einsatz durchziehen wollte. Ein Einsatz, über dessen Qualität die meisten nichts wussten. Von dem wir nur eine vage Vorstellung hatten. Eines schärfte uns Muli immer wieder, bei jedem Training, jede Woche und jeden Tag ein: Wir, seine Gruppe, mit ihm als Gruppenführer, mussten uns darüber im Klaren sein, dass er von uns mehr erwartete als von anderen. Wir würden früher aufstehen und später ins Bett gehen als alle Übrigen. Weiter laufen und mehr tragen. Er würde ein Team führen, das sich immer als Erstes freiwillig meldete. Für uns würde es hart werden.
Wir fühlten uns geschmeichelt, er traute uns das also zu. Wie sehr sich diese Forderung, diese einfach gesprochenen Worte, als wahr herausstellen sollten, konnte keiner von uns, nicht einmal Muli selbst, zu diesem Zeitpunkt ahnen.
Wenige Monate vor Einsatzbeginn wurde jedem Einzelnen in der Gruppe seine feste Aufgabe im Team zugewiesen. Es gab den Fahrer. Es gab einen, der das schwere Maschinengewehr tragen und abfeuern musste und einen Zweiten, um die Munition des Maschinengewehrschützen zu tragen. Außerdem einen Funker, einen Medic für die Erstversorgung der Verwundeten, einen für die Panzerfaust, einen für das leichte Maschinengewehr und für die meisten Positionen noch einen Ersatzmann, der so trainierte, dass er die Rolle des Ersten mit übernehmen konnte. Schließlich war es jederzeit möglich, dass es zum Ausfall eines Kameraden kam. Ausfall eines Kameraden. Es war leicht, diese schwerwiegenden Worte leichtfertig auszusprechen. Es bedeutete, dass einer von uns fiel. Im Kampf getötet wurde. Es konnte jederzeit dazu kommen, und es konnte jeden von uns treffen.
Die Positionen in der Gruppe waren unterschiedlich beliebt. Letztendlich entschied Muli anhand der besonderen Fähigkeiten jedes Einzelnen. Nicht jeder schoss mit jeder Waffe gleich gut, nicht jeder konnte ein Fahrzeug unter Stress sicher fahren. Und dazu kam, was jedem von uns im Kopf spukte, aber keiner in Worte fassen konnte: das Ganze im Gefecht anzuwenden.
Die Position des G3-Schützen war in der Gruppe besonders beliebt. Der Schütze dieser Waffe mit Zielfernrohr sollte eine deutlich bessere Schießausbildung erhalten und so das Bindeglied zu den Scharfschützen bilden. Weil die meisten anderen auf einem Lehrgang waren, als die Ausbildung beginnen sollte, wurden Kruschka und ich dafür eingeteilt.
Kruschka war gelernter Koch und türkischer Abstammung. Klein und ein wenig introvertiert, war er jemand, den man erst kitzeln musste, um ihn aus der Reserve zu locken. Aber ein verdammt guter Freund, der einem immer treu zur Seite stand. Er war erst wenige Monate vor dem Einsatz zu uns gestoßen und damit einer der Letzten, die in die Gruppe kamen. Seine infanteristische Ausbildung war lange nicht so gut wie unsere, aber er lernte schnell dazu. Jonny nahm ihn unter seine Fittiche. Bald hatten die beiden ein so enges Verhältnis, dass man immer wusste: Sah man den einen, war der andere nicht weit entfernt.
Schließlich begannen Kruschka und ich gemeinsam mit weiteren Kameraden aus den anderen Zügen die Ausbildung an dem alten Gewehr, das in der Bundeswehr für die Auslandseinsätze neue Verwendung fand. Wir beide waren schon mehrere Jahre Soldat und hatten genug Zeit auf der Schießbahn verbracht, um mit unseren regulären Waffen gut umgehen zu können. Pistole, Gewehr G36, Maschinengewehr. Aber was wir in den wenigen Wochen vor dem Einsatz bei der Ausbildung am G3 dazulernten, war absolutes Neuland.
Es war eine Herausforderung, das schwere Gewehr mit derselben Leichtigkeit zu führen wie das kleinere G36, das fast nur aus Plastik bestand. Und die Art der Ausbildung hatte sich auch geändert. Diese neuartige, uns bisher unbekannte und von den Amerikanern übernommene Methode vermittelte uns zum ersten Mal den Eindruck, dass das Training uns wirklich auf die Praxis vorbereitete. Es schien direkt aus der Kampferfahrung heraus zu kommen. Und je länger ich mit der Waffe trainierte, umso vertrauter wurde sie mir.
Kruschka und mir sollte es mit diesem Gewehr mit Zielfernrohr im Gefecht zukommen, einzelne Ziele auszumachen und zu bekämpfen, während der Rest der Gruppe sich eher auf das Unterstützungsfeuer konzentrierte.
Das alles war nur wenige Wochen her, und als ich wieder aus dem Fenster des Busses sah, waren wir dem Flughafen schon ein gutes Stück näher gekommen, und es würde nicht mehr lange bis zum Check-in dauern. Ich dachte an mein Zuhause, an meinen schönen Garten mit dem großen Kirschbaum. Wie gerne legte ich mich auf die Wiese in seinen Schatten. Ich würde dieses Jahr nichts von seiner reichen Ernte abbekommen. Ich dachte an meine kleinen Geschwister, denen ich versucht hatte, zu erklären, wohin meine Reise ging und was dort meine Aufgabe war. Hatten sie es verstanden? Unser letzter gemeinsamer Nachmittag fiel mir ein. Wir hatten Salate gemacht und Fleisch gegrillt. Es war unbeschwert, irgendwie leicht gewesen. Das helle Lachen meiner Geschwister hallte in meinem Kopf. Ich versuchte, mir ihre Stimmen vorzustellen, sie einzuschließen. Ich wollte sie fest in meinem Herzen bewahren. Doch je mehr ich mich anstrengte, an sie zu denken, desto weiter entfernt erschienen sie mir.
Das Bewusstsein, dass es jetzt ernst wurde, veränderte mein Empfinden. Muli hatte mich vor ein paar Tagen noch mal zur Seite genommen. Er war schon oft im Einsatz gewesen und hatte immer alle seine Männer gesund zurückgebracht. Er glaube nicht, dass es diesmal so sein würde, hatte er mir gesagt. Als ich jetzt an seine Worte dachte, lief mir ein kalter Schauer über den Rücken.
Als der Abflugtermin immer näher gerückt war, hatte unser Kompaniechef angefangen, uns mit aktuellen Informationen aus Afghanistan und besonders aus der Region um Kundus, unserem Einsatzort, zu versorgen. Dabei war fast jeden Tag die Rede von Beschuss, von Gefechten, von Anschlägen auf unsere Kameraden. Eine weitere Kompanie unseres Bataillons, die vierte, befand sich gerade dort, und viele von uns hatten Bekannte und Freunde in dieser Einheit. Außerdem führte eine weitere Fallschirmjägerkompanie aus unserer Kaserne gerade genau den Auftrag in Kundus durch, den wir in Kürze zu übernehmen hatten. Wir saugten die spärlichen Informationen auf wie Schwämme. Leider wurden uns einfachen Mannschaftsdienstgraden nicht viele Fakten und Unterlagen zugänglich gemacht, so dass uns immer einige Stücke vom Puzzle zu fehlen schienen. Ich dachte daran, wie wenig die Bevölkerung in Deutschland über diesen Einsatz wusste, und dass selbst wir, die man als Soldaten dorthin schickte, so kurz gehalten wurden.
Wir bekamen Bücher zur Landeskunde ausgehändigt. Aber das meiste erfuhren wir immer noch aus Gesprächen mit Kameraden, die schon einmal dort waren. Allerdings hatte sich die Sicherheitslage in Afghanistan den uns vorliegenden Informationen zufolge sich in den letzten Jahren so dramatisch verändert, dass wir diese Infos höchstens noch als grobe Orientierung werten konnten. Wir wussten, wir würden kämpfen müssen. Wir wussten, es würde um Leben und Tod gehen. Aber wir steuerten auf diese Wahrheit zu, die als große Ungewissheit über uns schwebte, als ob wir in einem Auto bei dichtestem Nebel ohne jede Sicht mit Tempo 150 über die Landstraße rasen würden.
Zwar hatte der neue Oberbefehlshaber der internationalen Truppen in Afghanistan, der amerikanische General McChrystal, der das Kommando 2009 übernommen hatte, einen Strategiewechsel angekündigt. Es sollte jetzt verstärkt darum gehen, die Herzen der Bevölkerung zu gewinnen. Mehr Soldaten als sonst sollten nach großen Operationen gegen die Aufständischen in die Dörfer gehen und dort auch für längere Zeit bleiben. Viele kleine Außenposten sollten geschaffen und gehalten werden, um eine Präsenz in der Fläche zu zeigen. Dies sollte den Menschen das Gefühl geben, dass wir den Gegner nicht nur schlagen, sondern auch dauerhaft für Sicherheit im Land sorgen konnten. Zwar hatten die beteiligten Politiker der Londoner Afghanistan-Konferenz im Januar 2010 die Einsatzziele neu definiert. Nach einer Aufstockung der Truppenstärke sollte der Abzug schrittweise erfolgen. Die Sicherheit sollte in die Hände der Afghanen selbst gelegt werden. Aber wir einfachen Soldaten konnten uns darunter kaum etwas vorstellen. Präsenz in der Fläche zeigen? Viele kleine Außenposten errichten und halten? Wir fragten uns, wie zum Teufel wir es schaffen sollten, die genannten Pläne umzusetzen.
Einzig unser Kompaniechef bewahrte nach außen hin die Ruhe und sagte, er werde alles in seiner Macht Stehende tun, um uns gut zu führen und alle heil nach Hause zu bringen. Er ging sogar so weit, uns das mit Humor zu vermitteln, als er einige Zeit vor unserem Abflug bei einem Kompanieantreten sagte, seine Frau habe die Karten gelegt und hätte gesehen, dass alle seine Männer am Leben bleiben würden. Solche mit einem Augenzwinkern vermittelte Information gab uns wieder die Ruhe, die wir dringend brauchten.
Die schreckliche Nachricht kam dann auch vollkommen überraschend. Niemand war darauf gefasst oder vorbereitet. Niemand hätte mit Derartigem so wenige Wochen vor unserer Abreise gerechnet. Es war ein Feiertag. Der Karfreitag 2010. Drei Kameraden aus unserer Kaserne waren im Kampf gefallen, eine große Zahl weiterer war schwer verletzt worden. In dem kleinen Dorf Isa Khel in einem Distrikt nahe Kundus war passiert, was wie ein Damoklesschwert über uns allen schwebte. Und die Kameraden kamen aus dem Zug, dessen Aufgaben wir, genau mein Zug, im Einsatz übernehmen sollten, dem Golf Zug.
An diesem Tag begriffen wir, dass das, was auf uns zukam, uns alles abfordern würde. An diesem Tag wurde uns allen klar, dass es nun ernst wurde. Es war, als ob ein Schalter in mir, in uns allen umsprang. Von diesem Tage an gingen wir noch ernsthafter, noch verbissener in die restliche Zeit der Ausbildung. Für die letzten eineinhalb Monate.
Bald darauf fand im Nachbarort unserer Kaserne die Trauerfeier statt. Wir alle standen an der Straße Spalier, um unseren Kameraden die letzte Ehre zu erweisen. Die Bundeskanzlerin und der Verteidigungsminister waren gekommen, es gab ein unglaubliches Medienecho um uns herum. Jeden schien es zu berühren, jeder schien dabei zu sein. Nach der Trauerfeier wurde einiges anders. Wir waren in Gedanken dort, bei den Kameraden. Es entstand ein wirkliches Kollektivbewusstsein, das uns half, unsere Gefühle zu kanalisieren. Und was wir fühlten, war Wut. Ohne wirklich greifen zu können, gegen wen sich unsere Wut genau richtete, wollten wir alle dorthin. Wir wollten endlich aufbrechen, um denen in den Arsch zu treten.
KUNDUS
Wie einen grellen Blitz, der kurz in mein Auge stach, nahm ich den ersten Sonnenstrahl wahr. Die alte Transall rollte noch, als sich langsam die Heckluke öffnete. Die Scharniere ächzten. Während sich die Öffnung schwerfällig erweiterte, fiel das Licht stoßweise in den Innenraum. Eine Wolke aus aufgewirbeltem Staub drang herein und segelte langsam durch die Bahnen aus Licht, die den Laderaum immer mehr ausfüllten.
Wir saßen in dem engen Flugzeug dicht gedrängt und umgeben von Taschen und Ausrüstung auf den Sitzbänken aus Segeltuch. Ich konnte durch eines der kleinen runden Fenster den Rotor sehen, der sich wie ein Kreisel drehte. Das tiefe Brummen der Motoren ließ die betagte Maschine vibrieren. Die alten Schutzwesten, die man uns für den Fall gegeben hatte, dass das Flugzeug beschossen wurde, ließen uns in der stickigen Luft noch mehr schwitzen. Der bittere Geruch von Männerschweiß mischte sich mit dem von Öl, Kerosin und altem Plastik, irgendwer hatte auch Aftershave benutzt.
Wir kannten die Maschine gut, nannten sie liebevoll Trall. Die meisten von uns waren ebenso wie ich viel öfter mit ihr gestartet als gelandet, weil wir sie vorher mit dem Fallschirm verlassen hatten. Fallschirmjägeralltag. Wir hofften auf den gleichen frischen Windhauch, der uns immer empfing, wenn sich die Heckrampe einer Trall öffnete. Doch nichts geschah. Als die Rampe komplett offen war, stand die Luft immer noch. Alle blickten gespannt in das grelle Licht. Ich versuchte, etwas zu erkennen, musste aber die Augen zusammenkneifen. Schließlich griff jeder nach seinen Sachen und beeilte sich, hinauszukommen. Es gab ein großes Gedränge, vor und hinter mir flogen Flüche durch die Luft.
Scheiße, pass doch auf!
Du Penner!
Wenn du schiebst, geht’s auch nicht schneller!
Ich stolperte die Rampe herunter, weil mir während des Fluges von der Versorgungsbasis im usbekischen Termez nach Kundus die Beine eingeschlafen waren. So waren meine ersten Schritte auf afghanischem Boden sehr unsicher. Für einen kurzen Moment blieb ich hinter der Maschine stehen und blickte mich um. Da waren wir also.
Ich sah eine gelblich schimmernde, von gleißendem Weiß durchzogene Geröllmasse, die sich über das ganze Hügelplateau erstreckte. Bräunliches Gestrüpp bedeckte flach den Boden. Über den kleinen Flugplatz verteilten sich Berge aus Schrott, alten Hubschraubern und irgendwelchem Müll, was einen jämmerlich trostlosen Anblick bot. In sanften Wellen zog sich die Landschaft bis zum Horizont, wo sie langsam mit dem Himmel verschwamm, und ein paar hundert Meter weiter war das amerikanische Feldlager als schmaler grauer Streifen mit ein paar Funkmasten zu erkennen. Der Staub in der Nase kitzelte mich, ich musste niesen.
Eine Stimme riss mich aus meinen Gedanken.
Na komm, los geht’s!
Es war Muli, der mich mit einem freundlichen Klaps auf die Schulter in Richtung Gebäude schob. In einer langen Schlange wurden wir zur Aufnahme geführt. Jeder musste mit den Listen abgeglichen werden.
Das ist doch nicht euer Ernst! Wir sind im Kriegsgebiet und es ist die gleiche Bürokratie wie in Deutschland. Da hätte ich auch gleich zu Hause bleiben können, bemerkte TJ launisch.
Es war TJs Art, sich über alles und jeden aufzuregen. Er war mit seinen zwei Metern Größe und seiner schlanken Gestalt jemand, der alles überblickte und immer etwas zum Beschweren fand. In sein schmales, jungenhaftes Gesicht zogen sich dabei tiefe Falten, und seine Stirn runzelte sich deutlich. Er war unser Fahrer, der Fahrer meines Fahrzeuges, und zeigte ein erstaunliches Talent. Er hatte sich in den letzten Monaten wahnsinnig entwickelt. Wenn auch fast jeder von uns fahren konnte, so beherrschte TJ die großen gepanzerten Fahrzeuge im Gelände wirklich sicher. Ihm würde unterwegs die größte Verantwortung zufallen, denn unser Leben lag in der Hand seiner Kunst, das Fahrzeug sicher zu führen.
Keine Angst, das wird noch schlimmer, bemerkte Muli, der weiter hinten stand. Ich hab das jetzt schon so oft mitgemacht, und es gibt nichts Schlimmeres als den Einweisungsmarathon am Anfang.
Was wollen sie uns denn erzählen, dass es hier draußen gefährlich ist?
Hardy versprühte den gleichen bissigen Sarkasmus, den er in der letzten Zeit immer offensichtlicher zur Schau stellte. Mit seinem langen Gesicht, seinem schlaksigen Gang und dem dünnen Körper ähnelte er einem etwas zu gutmütig wirkenden Büroangestellten. Weil er oft seinen Mund offen stehen ließ, erinnerte er mich ein wenig an Goofy. Aber in der letzten Zeit war er immer scharfzüngiger geworden.
Hardy war einer der Wackelkandidaten gewesen. Das hatte Nossi ihm auch offen gesagt. Stressresistenz ist wichtig, und Hardy zeigte anfangs nicht viel davon. Aber weil er während der Ausbildungszeit immer strenger zu sich selbst wurde und alle mit seiner Ernsthaftigkeit überraschte, stand irgendwann fest, dass er Teil des Teams war. Während man bei TJ immer wusste, dass sein Unmut echt war, konnte man bei Hardy nie ganz sicher sein, aus welchem Grund er sarkastisch wurde. Aber mit seinen vielen bissigen Kommentaren hatte er die Gruppe mehr als einmal aus einem Stimmungstief geholt.
Ich blickte nach oben. Der Himmel war wolkenleer. Als ob jemand ein Poster ausgerollt hätte, bildete sich bis zum Horizont eine gleichförmige, blaue Fläche ab. Auf dem Flughafengelände standen die Wracks alter russischer Militärhubschrauber neben ausgebrannten Lastwagen. Jemand hatte sie zur Seite geschoben. Das Flughafengebäude, vor dem wir jetzt standen, war eine Betonruine, die in blassem Blau schimmerte und mit Einschusslöchern aus vergangenen Zeiten übersät war. Ein paar bewaffnete deutsche Soldaten standen gelangweilt herum, und ich war froh, als ich in der Schlange der Wartenden endlich in das Gebäude treten durfte.
Name? Personenkennziffer?
Ich gab die Antworten schnell, denn ich war seit dem Abflug in Usbekistan nicht auf der Toilette gewesen. Während ich in Richtung der bereits Abgefertigten ging, sprach ich einen der deutschen Soldaten an, die mit Schutzweste und Waffe in der Eingangshalle standen.
’tschuldigung, wo kann man hier pissen?
Da hinten am Ende des Ganges links, war die kurze Antwort. Mit einer Kopfbewegung wies er mir die Richtung.
Kannst du mal eben auf meine Sachen aufpassen?, fragte ich Hardy im Vorbeigehen und schlenderte zum Klo.
Die Tür war nur noch an einem Scharnier befestigt. Als ich eintrat, blieb ich verdutzt stehen. Ich hatte das Gebäude gesehen und keinen Luxus erwartet, aber trotzdem war ich auf diesen Anblick nicht vorbereitet gewesen. Die Kabinen waren nicht durch Türen abgetrennt und statt Schüsseln gab es nur Löcher im Boden. Da kann ich mich unmöglich hinhocken, dachte ich und ging zu den Pissoirs. Ein braungelb schimmerndes, von dunkelgrauen Flecken übersätes und mit tief schwarzen Rändern garniertes Keramikbecken empfing mich. So etwas hatte ich noch nicht gesehen. Überall war Dreck, Schimmel tummelte sich zentimeterdick unter dem Rand, und zwischen den zerstörten Fliesen auf dem Boden sammelte sich das Wasser in kleinen, dunkelgrünen Pfützen. Ich betrachtete den Raum, als würde ich mich auf einem anderen Stern befinden und nicht an einem Ort, an dem die gleiche Spezies lebte wie bei mir zu Hause. Trotzdem ließ die Anspannung, die ich seit dem Abflug in Termez in mir hatte, deutlich nach.
Das deutsche Feldlager und der Flughafen lagen zusammen mit einem amerikanischen Camp und einer Ausbildungseinrichtung für afghanische Polizisten auf einem Plateau außerhalb der Stadt Kundus. Die Zufahrt dorthin wurde durch einen afghanischen Armeeposten und eine Schranke gesichert. Provincial Reconstruction Team Kundus stand auf einem großen Schild am Eingangstor des Feldlagers, als wir uns vom Flughafen aus näherten.
Seht ihr, deshalb sind wir hier!, rief Mica und zeigte auf das Schild. Die Provinz wieder aufbauen.
Also, ich bin hier, um in Ärsche zu treten, zischte Jonny zurück. Wir zeigens diesen Pissern und in sechs Monaten sind wir wieder zu Hause.
Muli lachte: Sechs Monate? Schaun wir mal.
Die Zufahrt wurde von einer hohen Wand aus Hescos gesäumt. Diese mit Schutt gefüllten viereckigen Drahtkörbe waren etwas über einen Meter hoch und konnten zu einer Mauer gestapelt werden. So boten sie Schutz vor Angriffen und Geschossen. Das gesamte Feldlager war voll von ihnen. Jedes Gebäude, jeder Schuppen, jeder Bereich war von Hescos umgeben.
Als wir das Lagertor hinter uns gelassen hatten, suchte ein afghanischer Wachmann den Mungo mit einem Spiegel von unten ab, um Sprengsätze zu finden. Ein deutscher Soldat stand dabei und grüßte freundlich mit einer Handbewegung.
Als wir ins Lager einfuhren, tat sich eine vollkommen andere Welt auf: Sauber geschotterte Straßen in bestem Zustand wurden von betonierten Abwasserrinnen eingerahmt. An den Rändern waren akkurat Rosenbüsche gepflanzt worden und junge Bäume wuchsen zwischen den Gebäuden und den Wegen. Das Lager war fast schachbrettartig angelegt und staubig, wirkte aber sehr aufgeräumt. Ich sah Zelte in verschiedenen Größen sowie feste Gebäude, dazwischen Container, überall Container. Die Schornsteine der Klimaanlagen blitzten silbern in der Sonne. Ich konnte Fahrzeuglärm hören und dazwischen das gleichmäßige Brummen der Stromgeneratoren. Über den Abwasserrinnen, die staubtrocken in der Sonne lagen, waren an verschiedenen Stellen Bretter gelegt worden, um die Wege abzukürzen. Es waren nicht viele Soldaten zu sehen, aber ein paar Geländewagen und Gabelstapler fuhren herum. Dazwischen liefen Afghanen in weiten Gewändern, die Schaufeln mit sich trugen. Wir hielten an einem großen, sandfarbenen Gebäude mit einem blauen Holzschild davor: Hauptbahnhof Lummerland.
Hier ist die Betreuungseinrichtung mit Bar und Fitnessraum, rief der Fahrer nach hinten. Übrigens, im ganzen Feldlager gibt es über 70 Baustellen, die von afghanischen Baufirmen betreut werden. Das macht bei 1500 deutschen Soldaten noch mal so viele Afghanen im Lager. Euer Gepäck holt ihr dahinten ab, ich muss wieder raus, den Rest reinbringen!
Er knallte die Tür zu und brauste mit den übrigen Fahrzeugen wieder zum Flugplatz. Kein schwacher Windhauch war zu spüren. Einzig die Sonne stand über uns am Himmel. Wir schwitzten.
Den ersten Tag verbrachten wir mit der Bürokratie, die wir aus Deutschland gewohnt waren. Aufnahme ins Feldlager, Rundgang, Fotos für die Sicherheitsausweise, ohne die sich niemand im Lager bewegen durfte. Wir schwitzten und waren alle kaputt von der Reise, und es war uns anzusehen.
Jeden Freitag ist Baseday, dann haben alle den Vormittag frei. Außerdem ist dann Kuddelmarkt, berichtete der Feldwebel, der uns in Empfang nahm.
Die Kuddel waren die Einheimischen. Jeder hier nannte sie so, wie ich schnell feststellte. Für mich lag eine gewisse Respektlosigkeit darin. Es klang abschätzig und schmutzig. Doch der Kuddelmarkt war eine wichtige Institution. Einige einheimische Händler durften freitags ins Feldlager kommen, um ihre Waren zu verkaufen.
Ein Offizier wies uns in die Sicherheitsbestimmungen und die Situation vor Ort ein. Er erzählte von den vielen Sprengstoffanschlägen in der Gegend. Und Raketen, die regelmäßig über die hohe und mit dem S-Draht genannten Nato-Stacheldraht bewehrten Mauer rund um das Feldlager hinweg zu uns abgefeuert wurden. Davor war noch ein breiter, ebener Geländestreifen, vor dem sich ein Zaun mit einer Krone aus Stacheldraht befand. Wachtürme und Kameras rundeten das Ganze ab. Bewacht wurde das Lager von Afghanen, unterstützt von deutschen Soldaten. Es sollte unser ruhiger Hafen werden. Eine Kontrastwelt zu dem, was uns draußen erwarten würde. Draußen, in Afghanistan.
Nach der Einweisung durften wir endlich etwas essen gehen. Der Speisesaal war eine kleine Halle irgendwo in der Mitte des Feldlagers. Mit dem »Verticker« genannten Duty Free Shop, dem Fitnessraum und dem Lummerland bildete die Küche die zentrale Anlaufstelle für alle im Lager. Im Verticker konnte man steuerfrei Zigaretten und Geschenke kaufen, aber auch Dinge des täglichen Bedarfs wie Getränke, Shampoo oder Schokolade. Der Vorrat an steuerfreiem Red Bull sollte für die meisten aus der Kompanie ein Grund werden, oft dort aufzutauchen.
Als wir zum Speisesaal gingen, stand schon eine lange Schlange davor. Darunter belgische Soldaten, Amerikaner, ein paar Ungarn und Armenier, die sich lautstark unterhielten. Ich erfuhr, dass die Armenier mit ungefähr dreißig Soldaten die Aufgabe hatten, den Flughafen zu sichern, um die deutschen Kräfte zu entlasten. Es stellte sich heraus, dass sie ihre komplette Ausrüstung von uns hatten. Sie trugen deutsche Uniformen, Stiefel, Waffen und fuhren sogar mit unseren Mungos. Einzig ihr Nationalitätskennzeichen auf dem Ärmel war original armenisch, und ihre Dienstgradabzeichen hatten sie mit gelbem Klebeband auf die Schultern geklebt.
Unglaublich, sagte ich zu Hardy. Ob die für den ganzen Kram Miete zahlen?
Pass mal auf, am Ende zahlen wir auch noch für die, damit die Regierung sich nicht rechtfertigen muss, noch mehr Soldaten hierher zu schicken, brummte TJ.
In einem Vorraum mit mehreren Waschbecken mussten die Hände gewaschen und desinfiziert werden, bevor es endlich ans Essen ging. Wir stürzten uns wie hungrige Löwen darauf. Das letzte Mal hatten wir nachts warme Würstchen in Termez gegessen. Das Essen war überraschend gut. Es gab jede Menge frisches Obst, Trauben, Pflaumen, Äpfel, Bananen und Kiwis. Dazu ein kaltes Buffet und am Abend zwei verschiedene warme Hauptmahlzeiten zur Auswahl. Mittags nur eine kleinere Hauptmahlzeit.
Nach dem Nachtisch sollten wir uns vor unseren Unterkünften sammeln. Für die ersten Tage würden wir in Zelten wohnen. Übergangsweise, weil unsere Vorgänger noch da waren. Dann würden wir deren Container bekommen.
Denkt dran, nachher zu denen zu gehen, um eine Containerausstattung abzugreifen. Wenn ihr könnt, besorgt euch ’nen Fernseher, Kaffeemaschine, Steckdosenleisten und einen Kühlschrank, hatte Muli uns geraten. Wenn ihr keinen Kühlschrank bekommt, habt ihr Pech gehabt, es gibt keine neuen, weil der Strom im Feldlager nicht reicht.
Er hatte wohl gerade wieder irgendwelche Insider-Infos erhalten.
Die Container sollten später unser Zuhause werden. 20 Fuß lange Standard-Container, aufgereiht als Wohneinheit für zwei oder drei Männer. In den Zelten besetzte zunächst jeder das Feldbett, das ihm am schönsten erschien. Es gab das übliche Gezanke.
Ich will nicht an der Tür schlafen! Ich will in die Mitte! Ich will neben diesen oder jenen!
Mica trat an das Bett neben mir.
Ist hier noch frei?
Klar, sagte ich.
Mica gehörte auch zu meinem Trupp. Er sollte der Richtschütze auf meinem Dingo sein, der Bediener der Waffenanlage. Etwa so groß wie ich, blond und immer braun gebrannt. Schönling, sagte Muli immer zu ihm. Und in der Tat hatte Mica ein verschmitztes Lächeln, das jeder Frau sofort den Kopf verdrehen musste. Charakterlich waren Mica und ich uns sehr ähnlich. Nur dass Micas Züge erst jetzt, mit Beginn des Einsatzes, immer deutlicher zutage traten. Wir beide waren Dickköpfe. Jeder für sich der Meinung, das Richtige zu wissen, weil wir mehr über die Dinge nachdachten als andere. Aber wir waren auch beide bereit, selbständig mehr zu arbeiten, uns einzubringen und vertraten ein sehr ähnliches Berufsverständnis. Das führte dazu, dass Mica genau wie ich eine Führungsrolle in der Gruppe beanspruchte. Erst viel später wurde mir klar, dass ich mit Mica so etwas wie einen Gegenspieler gefunden hatte, der gleichzeitig mein Vorbild war.
Aber so weit waren wir noch nicht. Da wir bisher der einzige Zug unserer Kompanie vor Ort waren, rechneten wir damit, dass es mit den Außeneinsätzen noch ein Weilchen dauern würde. Vermutlich würden sie nicht vor Eintreffen der anderen beginnen, die wir in den nächsten Tagen erwarteten. Zwar übernahmen wir bereits am ersten Tag unsere Fahrzeuge und Waffen von den Vorgängern, aber niemand glaubte daran, dass wir sie schon bald würden einsetzen müssen.
Als ich das Feldlager erkundete, fand ich nicht weit hinter unseren Containern, die noch vom Vorgängerzug besetzt waren, den Hubschrauber-Landeplatz. Dort waren ein paar Black Hawk-Hubschrauber der Amerikaner abgestellt. Zwei waren immer in Bereitschaft, einer zum Retten von Verletzten, der andere umkreiste den gelandeten Hubschrauber und schützte ihn mit der Bordwaffe. Im deutschen Feldlager waren nur wenige Amerikaner stationiert. Neben den Hubschrauber-Besatzungen noch eine Feuerwehreinheit und einige Verbindungsoffiziere.
Die Fahrzeuge, die unserem Zug zugeteilt waren, standen wie viele andere sauber aufgereiht neben diesem Landeplatz. Die drei Dingos sahen aus wie sehr hohe, aber schmale Jeeps. Sie hatten eine Station für eine ferngesteuerte Waffe auf dem Dach, was ihren Schwerpunkt auch wegen der Panzerung stark nach oben verlagerte. Zusammen mit der weichen Federung führte es dazu, dass die Dingos beim Fahren wie Schiffe auf hoher See schwankten. Wir kannten sie bereits aus Deutschland, hatten zwei Wochen Fahrausbildung mit ihnen absolviert. Der Dingo war komplett geschlossen, was den Schutz vor Sprengsätzen erhöhte, die Besatzung aber auch handlungsunfähig gegenüber der Außenwelt machte.





























