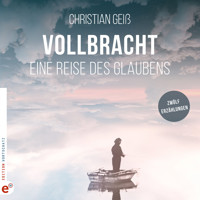Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Hat ein Gott, den wir nicht beweisen und dessen Wesen wir nur teilweise erkennen können, trotzdem eine Bedeutung für unser Leben? In einer einzigartigen Kombination aus Erzählung, Gedanken zum Apostolischen Glaubensbekenntnis und der Weltgeschichte begleiten Sie den Antiquitätenhändler Abid bei seinem Studium der Bibel und seiner Suche nach Wahrheit, Erkenntnis und Glauben. Ein Buch für persönliche Fragen, Diskussionen in einer Gruppe und für all diejenigen, die dem christlichen Glauben auf den Grund gehen möchten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian Geiß
Vollbracht
Christian Geiß
Vollbracht
Eine Reise des Glaubens
Druck und Bindung des vorliegenden Buches erfolgten in Deutschland.
Das verwendete Papier ist FSC-zertifiziert. Als unabhängige, gemeinnützige, nichtstaatliche Organisation hat sich der Forest Stewardship Council (FSC) die Förderung des verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgangs mit den Wäldern der Welt zum Ziel gesetzt.
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.d-nb.de abrufbar.
Soweit nicht anders angegeben, sind die Bibelverse folgender Ausgabe entnommen:Bibeltext der Neuen Genfer Übersetzung – Neues Testament und Psalmen
Copyright © 2011 Genfer Bibelgesellschaft. Wiedergegeben mit freundlicher Genehmigung. Alle Rechte vorbehalten.
Weiter wurden verwendet:
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 by SCM-Verlag GmbH & Co. KG, 58452 Witten. (ELB)
Gute Nachricht Bibel, revidierte Fassung, durchgesehene Ausgabe, © 2000 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart. (GNB)
Hoffnung für alle®, Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica Inc.® Verwendet mit freundlicher Genehmigung des Herausgebers Fontis, Basel. Alle weiteren Rechte weltweit vorbehalten. (Hfa)
Lutherbibel, revidierter Text 1984, durchgesehene Ausgabe, © 1999 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart. (LUT)
Lektorat: Nadine WeiheUmschlaggestaltung: Julia Ryll, www.mehrwertdesign.deSatz und Herstellung: Edition Wortschatz
© 2019 Christian Geiß. Alle Rechte beim Autor.
In gedruckter Fassung ist dieses Buch in der Edition Wortschatz erschienen, ISBN 978-3-943362-53-4, Bestell-Nr. 588 883
Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Autors
www.edition-wortschatz.de
Inhalt
Dem Geheimnis auf der Spur … 9
Einleitung Kapitel 1 bis 4 10
Kapitel 1: Der verlorene Garten 13
Ein Blick in die Bibel 27
Und was denkst du? 31
Quellenverzeichnis 34
Kapitel 2: Gott sucht den Menschen 35
Ein Blick in die Bibel 49
Und was denkst du? 53
Quellenverzeichnis 56
Kapitel 3: Der Mensch sucht Gott 57
Ein Blick in die Bibel 70
Und was denkst du? 75
Kapitel 4: Gott und Mensch finden zusammen 78
Ein Mann, sein Weg, dein Leben … 81
Einleitung Kapitel 5 bis 8 82
Kapitel 5: Der Weg und die Tür zum Garten 84
Ein Blick in die Bibel 99
Und was denkst du? 102
Quellenverzeichnis 105
Kapitel 6: Ein Wanderprediger in der Provinz 106
Ein Blick in die Bibel 120
Und was denkst du? 124
Kapitel 7: Ein Zeichen der Liebe und Gnade 127
Ein Blick in die Bibel 144
Und was denkst du? 148
Quellenverzeichnis 151
Kapitel 8: Vom Sklaven zum Freien 152
Die Grenzen des Denkens … 155
Einleitung Kapitel 9 bis 12 156
Kapitel 9: Der Auferstandene 158
Ein Blick in die Bibel 171
Und was denkst du? 174
Kapitel 10: Unsere Hoffnung 177
Ein Blick in die Bibel 189
Und was denkst du? 193
Quellenverzeichnis (Kapitel 9 und 10) 196
Kapitel 11: Das letzte Wort hat … 197
Ein Blick in die Bibel 213
Und was denkst du? 216
Kapitel 12: In Jesus ist das Heil zu finden – ein Bericht! 219
Die Heilung eines Gelähmten (Apg. 3,1 – 8; 4,7 – 12) 219
Unfassbar größer … 222
Einleitung Kapitel 13 bis 16 223
Kapitel 13: Der versprochene Tröster 225
Ein Blick in die Bibel 238
Und was denkst du? 241
Quellenverzeichnis 244
Kapitel 14: Ein Buch mit sieben Siegeln 245
Ein Blick in die Bibel 260
Und was denkst du? 264
Kapitel 15: Geheimnisse und viele Fragen … 267
Ein Blick in die Bibel 280
Und was denkst du? 283
Quellenverzeichnis 286
Kapitel 16: Jesus ist das Alpha und das Omega! 287
Jesus ist Anfang und Ende der Welt! (Kolosser 1,15 – 20) 287
An die Leserinnen und Leser 289
Danksagung 290
Stimmen zum Buch „Seelenkrieg“ / Der Roman zum Kurs 291
Leseprobe: Seelenkrieg – Der Roman 293
Prolog 293
Der Weg nach Sarajevo 296
Juni 1914 – die dunkle Insel 297
Bedrohliche Zeiten 307
Dem Geheimnis auf der Spur …
„Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.“
(1. Mose 1,1; Hfa)
Einleitung Kapitel 1 bis 4
„Wie, die Welt ist nicht so, wie sie sein sollte?“ Diesen Satz hörte ich während einer Autofahrt auf dem Weg von Berlin in den Hunsrück. Aus dieser kurzen Frage ergab sich ein sehr langes und intensives Gespräch über den Glauben an Gott mit einer Frau, die sich selbst als Atheistin bezeichnete.
Auch viele Christen haben tief greifende Fragen an den Glauben. Wie können wir an Gott glauben, wo es doch so viele Argumente aus Philosophie, Wissenschaft oder der Theologie selbst gibt, die an den Grundfesten des christlichen Glaubens rütteln?
Für mich ist der Glaube an den Gott der Bibel seit meiner Jugend das tragende Fundament meines Lebens. Er ist meine Hoffnung, mein Halt und meine Zuversicht. Ich kann mir ein Leben ohne diesen Glauben nicht vorstellen, und dennoch fühle ich mich oft hilflos. Denn Zweifel, Fragen und Ungewissheit gehören unweigerlich zum Glauben, ansonsten wäre es kein Glaube, sondern eine Wissenschaft.
Viele Gespräche und Impulse in den letzten Jahren haben dazu geführt, dass ich mich selbst intensiver mit meinem christlichen Glauben beschäftigt habe. Und das Ergebnis dieser eigenen „Glaubensreise“ ist dieses Buch, das in vielen Punkten dem Aufbau des Apostolischen Glaubensbekenntnisses aus dem 5. Jahrhundert nach Christus entspricht. Es sind Sätze, die seit Jahrhunderten den Kern des christlichen Glaubens widerspiegeln. Und es beginnt mit folgendem zentralen Satz, der die Grundlage für alle weiteren Aussagen bildet:
Ich glaube an Gott, den Vater,den Allmächtigen,den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und dabei ist schon das erste Wort entscheidend: Ich. Denn nur jeder selbst kann und muss für sich die Antworten nach Gott, Sinn und Wahrheit entdecken. Wir selbst müssen uns auf die Suche begeben, die großen Fragen des Lebens für uns zu beantworten. In den folgenden vier Kapiteln möchte ich dich daher einladen, dich mit den grundlegenden Fragen des christlichen Glaubens zu beschäftigen: Kann es einen Gott geben? Wer ist der Mensch? Wie sollen wir über Gott denken, wenn es ihn gibt?
Jedes Kapitel ist eine kleine Episode aus dem Leben des Antiquitätenhändlers Abid und seiner Familie. Dabei knüpfen die Kapitel inhaltlich aneinander an, aber sie bilden keine fortlaufende Geschichte. Auch der Handlungsort steht nicht im Mittelpunkt. In meiner Vorstellung war es ein kleiner Ort im Kaukasus in der Mitte des 20. Jahrhunderts.
In der Geschichte von Abid und seiner Familie finden sich einzelne Antworten auf die oben genannten Fragen, jedoch bleibt auch vieles offen. Bei der intensiven Beschäftigung mit der Bibel und mit Gott wurde mir deutlich, wie herausfordernd es ist, den Sprung des Glaubens zu wagen, wenn man nicht auf alles eine Antwort hat. Denn bei allem Forschen und Erarbeiten müssen wir immer wieder die Aussage aus 1. Korinther 13,9 bedenken:
Denn unser Wissen ist Stückwerk, und unser Weissagen ist Stückwerk.
Ich wünsche dir viel Freude beim Lesen der ersten Kapitel. Vielleicht sind die Texte dir eine Hilfe, dem Geheimnis von Gott auf die Spur zu kommen. Du kannst das Buch allein durcharbeiten, mit Freunden oder in einer Gruppe. Falls du dieses Buch mit einer Gruppe liest, dann empfiehlt es sich, dass alle Teilnehmer das jeweilige Kapitel vor dem Treffen lesen und in der Gruppe die Fragen zu dem Kapitel bearbeitet werden.
Den Abschluss der ersten Einheit bildet Kapitel 4. Es besteht aus einem Bibeltext, der sich auf die vorherigen Kapitel bezieht, und dazu passenden Fragen. Dieses Kapitel ist bewusst kurz gehalten und soll dir bzw. eurer Gruppe Raum geben, die bisherigen Gedanken und Geschichten zu reflektieren. Vielleicht könnt ihr auch ein gemeinsames Essen veranstalten, bei dem ihr euch über die Fragen austauscht, denn der Glaube, die Diskussion und das Verstehen leben von der Gemeinschaft.
Die Kapitel 1 bis 6 findest du auch als Hörproben auf der Website
www.christiangeiss.de oder www.seelenkrieg.com
Kapitel 1: Der verlorene Garten
„Hamide, Liebes, bist du hier?“, rief Abid mit flattriger Stimme. Mit dem Handrücken schob er den kupfernen Behälter auf seinem Schreibtisch zur Seite und legte die Feder auf das Pult.
„Du hast nach mir gerufen, Vater?“ Hamide stand nun dicht neben ihrem Vater, denn nicht nur dessen Stimme war nicht mehr so kräftig wie einst, auch seine Ohren vernahmen nicht mehr jedes Wort.
„Gut, dass du da bist. Bring mir doch ein neues Tintenfass, dieses ist schon wieder leer.“
„Wie weit bist du denn?“ Während Hamide fragte, griff sie nach dem leeren Töpfchen, ging zum Schrank in der anderen Ecke und holte einen kleinen, mit Tinte gefüllten Behälter heraus.
„Gott ist zu groß und zu mächtig, um ihn in einzelne Worte zu fassen. Er ist so unermesslich wie das Meer und es ist einfach unmöglich, ihn in seiner ganzen Fülle zu beschreiben“, sinnierte Abid über das, was ihn beschäftigte.
Mit einem Lächeln zog Hamide einen der hölzernen Stühle heran und setzte sich neben ihren Vater. „Wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann starte doch mit dem, wie alles begann“, schlug sie ihm vor und tätschelte ihn liebevoll am Arm.
Unter der Lampe auf Abids Schreibtisch befand sich eine aufgeschlagene Bibel. Dieses in Leder gebundene Buch war sein Ein und Alles. Falls er jemals fliehen müsste oder sein Haus und seine Heimat verlieren würde, so würde er vieles zurücklassen, aber nicht diese Worte.
Auf seinen Reisen hatte Abid verschiedene Denker und Philosophen kennengelernt, doch keine Sicht auf diese Welt schien ihm so plausibel, so einleuchtend, so verändernd und so persönlich wie das, was er in der Heiligen Schrift, der Bibel, las.
Mit immer noch ruhiger Hand griff er nach dem kleinen Etui, in dem er seine Lesebrille aufbewahrte. Leise klickend öffnete sich der Deckel und die runde Nickelbrille kam zum Vorschein. Genau wie diese Brille ihm verhalf, klar zu sehen, so betrachtete er die Welt und sein Leben seit einigen Jahren durch die Worte der Bibel. Diese Worte erklärten und erhellten die Welt. Die Sätze und Erzählungen, die darin für Generationen festgehalten waren, ergaben so viel Sinn. Nur in ihnen hatte Abid die Antworten auf die Fragen seines Lebens gefunden: Wer bin ich? Warum lebe ich? Wohin gehe ich?
Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück, schlug seine Bibel auf und begann zu lesen: „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.“ Langsam ließ er die Bibel wieder auf sein Schreibpult sinken und drehte den Globus, der nicht weit entfernt von ihm auf dem Tisch stand. In seinem Leben hatte er auf alle Kontinente seinen Fuß gesetzt. Afrikaner hatten ihn mit auf eine Löwenjagd genommen, in Südamerika war er bis zu den Galapagosinseln vorgedrungen und im Amazonasgebiet hatte er bei Einheimischen gewohnt. Diese Welt war schön – atemberaubend schön. Bei den ersten Sonnenstrahlen des Tages zu beobachten, wie Zebras durch die Savanne streifen, auf einer Bootsfahrt mit Delfinen zu tauchen oder am Gipfel eines Berges zu stehen und den Wind in den Haaren zu spüren – in all dem sah Abid Gottes Werk, seine Schöpfung. Sie war überwältigend, unvergleichlich, unbeschreiblich. „Liebes, kannst du mir bitte einen Tee holen?“
Ohne Widerworte stand Hamide auf und verschwand hinter dem Vorhang in der Küche.
Abid löste seinen Blick vom Globus, der sich immer noch langsam bewegte, und schaute aus dem Fenster. Wie sollte er jemandem erklären, dass Gott die Welt geschaffen hatte? Er konnte Gott ja nicht beweisen. Gott stellte sich in der Bibel als derjenige vor, der größer ist als das Denken der Menschen. Er ist zeitlos und im Neuen Testament heißt es: „Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.“
Es konnte gar keinen endgültigen Gottesbeweis geben, denn Gott und sein ganzes Wesen gehörten zu einer anderen Dimension. Deswegen können wir auch nicht mit den gleichen Fragestellungen an sein Wesen herantreten, mit denen wir unserem Leben oder der Geschichte dieser Welt begegnen, überlegte Abid.
Und auch wenn Gott nicht bewiesen werden konnte und er der ganz andere war, dann erblickte Abid ihn, wohin er auch schaute. Die Welt mit all ihrer Schönheit war nichts Abstraktes; sie war konkret, greifbar, die Wirklichkeit. Dahinter musste ein realer Schöpfer stecken. Es musste jemanden geben, der mehr war als nur eine Idee. Jemand, der selbst lebte und vielleicht sogar der Ursprung und die Quelle allen Lebens war – der Ursprung des Seins.
Ganz so wie der große Chemiker Louis Pasteur im 19. Jahrhundert festgestellt hatte, dass das Leben immer nur aus Leben entsteht. Ein Experiment und eine wissenschaftliche Feststellung, die bis heute nicht widerlegt waren.
Und hatten die Aussagen von Gregor Mendel, dem Vater der Genetik, keinen Bestand? Dieser großartige Augustinermönch hatte belegt, dass es zwar eine Mikro-, aber keine Makroevolution gibt, und Darwin in seinen Gedanken widersprochen.
Abid brauchte allerdings nicht die Theorien von Mendel und Pasteur in ihrer ganzen Tragweite zu verstehen, er hatte sein Leben lang mit Tieren gearbeitet und diese Erde bereist. Die Welt veränderte sich, das stimmte, aber es gab keine Zwischenstufen bei den Tieren und auch keine Menschen, die sich auf seltsame Weise zu höheren Wesen entwickelten. Die Evolutionstheorie wirkte plausibel, aber sie lieferte keine Begründung, warum die Welt und die Arten entstanden waren.
Und auch die neusten Gedanken, die die Evolutionstheorie belegen und stützen sollten, konnten Abid nicht überzeugen: Aufgrund der unvorstellbaren Zahl an Sonnensystemen im Universum war es eine logische Schlussfolgerung, dass es eine Konstellation von Sternen und Planeten geben muss, die Leben ermöglicht. Das war der neue Ansatz der Wissenschaft. Im ersten Moment war der Gedanke schlüssig, aber er widerlegte nicht die Theorien von Pasteur, Mendel oder den 2. Hauptsatz der Thermodynamik, der besagt, dass Chaos der „Normalzustand“ ist.
Doch alle diese Gedanken waren gefährlich, denn der Darwinismus und das Bestreiten eines Schöpfers bildeten die Grundlage für ganze Wirtschafts- und Weltsysteme.Nicht ohne Grund wurden unter Stalin die Erkenntnisse von Mendel verboten, und die Gedanken des Darwinismus und der daraus entwickelten Evolutionstheorie wurden in der Menschheit zum Sozialdarwinismus. Nur der Starke darf überleben und über das Schwache herrschen. Ein Gedankengut, das zur größten Katastrophe am Anfang des 20. Jahrhunderts geführt hatte. Eine Ideologie, die diese Welt verpestet und Abermillionen Menschen den Tod gebracht hatte.
Abid schüttelte nachdenklich seinen Kopf. Das Wesen Gottes und seine Größe waren unergründlich, doch für ihn war der Gedanke einer Schöpfung schlüssiger als der Gedanke der Evolution und der Entstehung des Kosmos aus einem Urknall. Es gab zwar auch keine unwiderlegbaren Beweise für die Existenz Gottes, aber aus seiner Weltsicht und in seinem Menschenbild entdeckte Abid den Schöpfer der Welt auf vielerlei Weise. Mit Gott verhielt es sich aus Abids Sicht genau so wie mit seiner Tochter Hamide, die sich im Moment in der Küche befand.
Gerade jetzt konnte er Hamide nicht sehen und er wusste trotzdem, dass sie ganz in seiner Nähe war. Einen Beweis dafür, dass sich Hamide gerade im Nachbarzimmer aufhielt, hatte er nicht – ebenso wenig wie er die Existenz Gottes beweisen konnte. Allerdings gab es Indizien: Geschirr klapperte, der Vorhang bewegte sich und es war ein leises Pfeifen zu hören. Abid müsste nur in die Küche gehen, und da stünde sie direkt vor ihm.
So ähnlich verhielt es sich aus Abids Sicht mit der Existenz Gottes. Sie war nicht zu beweisen, aber aus seiner Sicht gab es genügend Indizien, die sein Dasein belegten: Die Schöpfung, das Gewissen eines Menschen und seine Sehnsucht nach dem Sinn des Lebens waren für Abid Indizien, dass Gott real war, und dennoch war ihm klar, dass er dies nur im Glauben erleben und begreifen konnte (vgl. Hebräer 11,3; ELB).
Der Globus stand nun still und Abid griff nach seinem Stift. Nein, Gott beweisen könnte er nicht. Aber ebenso wenig konnte belegt werden, dass es ihn nicht gab.
„Hier ist dein Tee.“ Hamide war hinter dem Vorhang hervorgetreten und kam nun mit einer dampfenden Tasse auf ihn zu. „Bist du vorwärtsgekommen?“, fragte sie und reichte ihm den Tee.
Wortlos schaute er sie an. Wie schön seine Tochter doch war. Sie hatte das dunkle Haar und die Augen ihrer Mutter. Ihr Anblick schmerzte ihn jedoch auch. Nie würde er den Tag vergessen, an dem seine Frau sterben musste. Eine Träne rollte über seine Wange und tropfte auf die offene Bibel.
Hamide wusste, was in ihm vorging. Sie kannte diese Stunden, in denen er sich zurückzog oder einsam durch die Felder streifte.
Auf seinen Reisen hatte Abid zwar Gottes Schöpfung gesehen und durfte Gottes Handeln in seinem Leben erfahren, aber er kannte auch den Schatten dieser Erde. Er hatte die Hungernden und Kranken gesehen, diejenigen, die ein Krieg zu Waisen gemacht oder verstümmelt hatte, und er musste immer wieder an den Tod seiner Frau denken. Manche Menschen klammerten sich in ihrem Leid an Gott, andere verwünschten ihn. Abid wusste, dass es beides gab.
„Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.“ Immer und immer wieder murmelte er diese Worte vor sich hin.
Offenbar wollte die Bibel überhaupt keine Antwort darauf geben, wie die Menschen den Gedanken von Gottes ewiger Existenz begreifen können, und die Bibel gab auch keine Antwort auf den Ursprung des Bösen. Es ging in diesem Buch um Gott und seine Geschichte mit den Menschen und dieser Welt.
Noch einmal stieß Abid mit seinen Fingern an den Globus und schaute zu, wie dieser sich um die eigene Achse drehte. „Gott hat die Welt erschaffen, doch wozu?“, fragte er sich und blickte auf die Kontinente, die von Menschen bevölkert und bebaut wurden.
Abid wusste, dass Gott in der Bibel von Beginn an als der dreieinige Gott dargestellt wurde. Er brauchte die Welt nicht als Gegenüber. Doch was konnte dann das Ziel der Schöpfung sein? Alle Lösungsversuche auf diese Frage waren sehr abstrakt, aber die möglichen Antworten würden alle weiteren Gedankengänge beeinflussen.
Der Mensch und die Erde wurden zum Lobpreis Gottes erschaffen. Wie das Sternenmeer und die Heerscharen der Himmel. Alle Schöpfung verherrlichte Gottes Größe und war ein Ausdruck seiner Allmacht und Herrlichkeit. Diese Zeilen notierte sich Abid als eine mögliche Antwort auf diese philosophische Frage (vgl. Epheser 1, 11 – 12).
Abids Blick wanderte über die Verse der Bibel und er saugte die Worte in sich auf. „So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild; und er schuf sie als Mann und Frau“ (1. Mose 1,27; Hfa). Abids Gelenke knirschten und knackten, als er sich erhob, und er merkte, dass nicht nur seine Haut, sondern ebenfalls seine Knochen älter wurden. Aber auch wenn das Gehen ihm immer schwerer fiel, noch konnte er alle Dinge ohne fremde Hilfe verrichten.
„Wohin willst du denn?“ Hamide stellte sich neben ihren Vater, zog seinen Stuhl zurück und hakte sich bei ihm ein.
„Ich muss mich ein wenig bewegen, das hilft meinem Kopf, klarer zu denken.“ Durch die Jahre der Wanderschaft und Reisen hatte sich der Raum mit allem Möglichen gefüllt und der Platz zum Gehen beschränkte sich nun auf einen schmalen Weg, der durch die Erinnerungen seines Lebens führte. Jeder einzelne Gegenstand erzählte eine Geschichte. Mit jeder Lampe, Vase oder gar dem großen Wandteppich neben dem Fenster verband Abid etwas ganz Besonderes. Dann hielt er auf der Reise durch seine Vergangenheit an. Das, wovor er stand, schien eigentlich nichts Besonderes zu sein. Einem Besucher wäre es zwischen all diesen Kostbarkeiten vielleicht überhaupt nicht aufgefallen. Der matte Rahmen mit dem geraden Rand stach einem nicht direkt ins Auge. Verglichen mit allem anderen machte er einen unscheinbaren Eindruck. Vorsichtig griff Abid nach dem verstaubten Teil auf dem Boden und hob den Spiegel hoch, den er einst von einer Reise nach Indien mitgebracht hatte. „Der Mensch als Ebenbild Gottes und als sein Stellvertreter auf der Erde,“ wiederholte Abid den letzten Gedanken, den er eben in seiner Bibel gelesen hatte (vgl. Psalm 8).
Oberflächlich betrachtet schien der Mensch doch nicht mehr zu sein als ein Tier. Er wird geboren, wächst auf, altert und stirbt. Andererseits ist er den Tieren weit überlegen. Menschen können selbst Dinge erschaffen und sie besitzen ein Gewissen. Nur der Mensch ist unter den Geschöpfen in der Lage, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Wer oder was ist der Mensch? Was macht ihn so einzigartig?, überlegte Abid. Einerseits reine Materie und automatisch ablaufende chemische Prozesse und andererseits auf rätselhafte Art und Weise ein Wesen mit Gewissen, Bewusstsein und Persönlichkeit: ein Ebenbild Gottes.
Als Abids Gesicht auf der Glasfläche erschien, verwandelte sich der einfache Spiegel in den wertvollsten Gegenstand des Raumes.
Ohne weiter sein Spiegelbild zu betrachten, ging Abid zurück zu seinem Schreibpult. Diese Gedanken musste er unbedingt niederschreiben. Kratzend bewegte sich die Schreibfeder über das Papier: Gott hat den Menschen als sein Gegenüber geschaffen. Als jemanden, der etwas gemeinsam hat mit dem Schöpfer selbst. Wir sind keine Maschinen und auch keine Tiere. Wie Gott sind wir Person und können selbst Dinge erschaffen. Ja, viel mehr noch, wir dürfen tätig sein und eigene Entscheidungen treffen.
Abid schaute auf seine Hand und die Bibel, die vor ihm auf dem Schreibpult lag. Vor seinem geistigen Auge konnte er sehen, wie Adam und Eva einst im Garten Eden lebten, hineingestellt in eine Beziehung mit Gott. Sie wussten, wer sie waren und wozu sie lebten. Ihr Leben war auf ihn, den Herrn aller Dinge, ausgerichtet. Es musste wunderbar gewesen sein und unvergleichlich, paradiesisch, denn am Anfang war alles sehr gut.
Wie mochte wohl diese Liebe zwischen Gott und Mensch gewesen sein? Verträumt schaute Abid zu seiner Tochter, die in diesem Moment aus der Küche kam. Er liebte sie und würde alles für sie opfern. Doch gleichzeitig würde er ihr auch die Freiheit lassen, die sie brauchte. Denn Liebe bedeutet keinen Zwang. Liebe bedeutet Freiheit. Sie bedeutet, das Beste für den anderen zu wollen, ohne ihn zu einer Marionette zu machen.
In ihrer Hand balancierte Hamide das Geschirr und steuerte damit auf den Eckschrank neben der Sitzecke zu. Diesen Weg war sie schon so oft gegangen, dass sie ihn sicher auch im Schlaf finden würde. Noch nie hatte sie sich dabei gestoßen oder war aus dem Gleichgewicht gekommen – aber diesmal passierte es. Ihr Fuß verhakte sich in dem Läufer, der auf dem Boden lag, sie stolperte und die Teller glitten ihr aus der Hand. Klirrend und laut brach das Service auseinander und die Scherben verteilten sich über den Fußboden. Was einst so gut ausgesehen hatte, lag nun in Scherben.
Abid schaute traurig auf die zerbrochenen Teller und ging dann zu Hamide und half ihr, die Einzelteile einzusammeln. Stück für Stück legten beide die Überreste zusammen, und als die letzte Scherbe vom Boden aufgelesen war, verstand Abid, was vor langer Zeit geschehen sein musste.
Damals im Garten Eden zerbrach viel mehr als nur Geschirr. Genau wie bei seiner Tochter hatte etwas – oder jemand – Adam und Eva zum Stolpern gebracht.
Der Mensch hatte einen Willen, mit dem er sich für oder gegen Gott entscheiden konnte, doch von alleine hätte er sich nie von seinem Schöpfer abgewendet. Im Paradies lauerte einer, der nur darauf wartete, diese Beziehung zu zerstören. Einer, der selbst einmal in der Gegenwart Gottes gelebt und sich dann gegen Gott gestellt hatte. Mit geschickten Fragen brachte er die Menschen zum Fallen, und eine durch die Lügen des Bösen eingefädelte Entscheidung brachte Adam und Eva zum Stolpern; die Beziehung zu ihrem Schöpfer zerbrach.
In dem Moment, als die Menschen gegen die Anweisung Gottes handelten, brach die schlimmste Tragödie über die Menschheit herein. Der Kosmos, die Welt und der Mensch wurden beschädigt. Wie ein Scherbenhaufen lag die einst perfekte Beziehung in Trümmern und der Tod betrat diese Welt (vgl. Epheser 2,1 – 3).
Abid wusste, dass die Erzählung aus 1. Mose 3 eine der ältesten Erzählungen der Menschheit war. Aufgeschrieben und weitergegeben, um von dem zu berichten, was einst geschehen war. Viele weise Menschen hatten über Jahrtausende über diesen Text gegrübelt und immer wieder neue Sichtweisen dargelegt. Denn wie sollten diese Geschichten nur verstanden werden? Ein Text, der von seiner Textgattung als Poesie oder poetischer Hymnus zu verstehen war, konnte ja wohl kaum historische Tatsachen wiedergeben. Jedoch sprachen sowohl die Geschlechtsregister als auch andere Stellen im Neuen Testament dafür, die Erzählungen in den ersten Kapiteln der Bibel als tatsächlich geschehene Ereignisse zu betrachten (vgl. Matthäus 24,38 und 2. Petrus 2,5). Hier könnten nie alle Fragen beantworten werden, und dennoch hatten diese Texte eine Bedeutung für das Leben, dessen war sich Abid sicher.
Tagelang hatte Abid über die ersten Kapitel der Bibel nachgedacht und theologische Bücher studiert, denn die beiden Bäume im Garten Eden und der daraus resultierende Sündenfall wirkten für den, der den Glauben an Gott suchte, verstörend. Was war das für ein sadistischer Gott, der einen verbotenen Baum in das Paradies stellte?
Wie so oft fand Abid in der Fülle der theologischen Aussagen nur spärliche Antworten auf das Mysterium, das ihn hier beschäftigte: Vielleicht musste es die Bäume geben, damit Adam und Eva erkannten, dass sie trotz der Krone der Schöpfung nicht die Schöpfer waren und sie sich dem ewigen Gott unterzuordnen hatten. Oder möglicherweise waren die Bäume der Weg, auf dem Gott seiner Schöpfung ermöglichte, ihm ihre Liebe und Treue zu zeigen: Indem sie das eine Gebot hielten, drückten sie ihre Liebe und Treue zu Gott aus. Durch diese Sichtweisen waren die Bäume weder als Versuchung zu sehen noch als Verführung und auf keinen Fall sadistisch.
Abid merkte jedoch, dass er an dieser und vielen anderen theologischen Fragen zerbrechen könnte, je länger er sich mit ihnen beschäftigte. Er musste hier mit offengebliebenen Fragen leben, ihm blieb keine andere Wahl. Deswegen hielt er sich an das, was er von Gottes Wesen begriffen hatte, und klammerte sich an die spärlichen Antworten, die er im Gesamtzusammenhang der Bibel zu diesem Thema entdeckte.
Bis zum „Sündenfall“ war die Schöpfung der Welt sehr gut. Alles war perfekt und in einer absoluten Harmonie. Doch als der Mensch den Lügen des Teufels glaubte, bahnte sich das Chaos seinen Weg. Auf eine listige Weise stellte die Schlange die Aussagen Gottes infrage und suggerierte dem Menschen, dass Gott ihm etwas vorenthielt.
Die beiden Bäume im Garten waren der Baum der Erkenntnis und der Baum des Lebens, notierte sich Abid. Erkenntnis in seiner ganzen Tiefe und das Leben in seiner vollen Fülle. Abid legte den Stift beiseite, als er allmählich begriff, was Gott dem Menschen im Garten versagte und was ihm nicht zustand zu begehren: Es war die Gottgleichheit. Das war es, was sich vielleicht hinter diesem Bild der beiden Bäume verbarg. Denn in Jesus liegen verborgen alle Schätze der Erkenntnis und der Weisheit (vgl. Kolosser 2,3), und Jesus sagte von sich, dass er das Leben ist (vgl. Johannes 14,6).
Wegen der Verführung durch den Teufel wollte der Mensch nicht mehr, als selbst Gott zu sein. Er griff nach den Sternen und stürzte in die Tiefe. Der Teufel raubte den Glauben an Gott und versprach dabei das Leben – doch der Tod war die Konsequenz.
Später gab es immer wieder Versuche, die Trennung zwischen Gott und dem Menschen nicht als Verlust, sondern als etwas Positives oder eine Befreiung zu deuten. Der kindliche Mensch emanzipierte sich von dem großen Gott-Vater. Und der Mensch musste sich doch von Gott befreien, denn Freiheit ist das höchste Gut. So dachten die Philosophen und Denker der Aufklärung um das Jahr 1790.
Verstohlen schmunzelte Abid und blickte zu seiner Bibel. Die Kapitel 4 bis 11 im 1. Mosebuch beschreiben die Urgeschichte der Welt nach der Trennung von Gott. Eine Geschichte der Zerstörung, die sich fortwährend steigert und mit dem Turmbau zu Babel endet. Das, was als Freiheit ersehnt wurde, brachte nichts als Katastrophen und Leid. Und für dieses Leid waren der Mensch und das Böse verantwortlich.
Aber auch diese Sichtweise auf das, was im Garten Eden passiert war, wurde von vielen längst infrage gestellt. Das Gespräch mit dem Bösen wurde als Selbstgespräch des Menschen interpretiert, das durch den Dialog mit der Schlange für jeden sichtbar wurde. Wenn Abid diesen Gedanken jedoch weiterdachte, dann war auch das Gespräch mit Gott möglicherweise nur ein Selbstgespräch, und dann existierten sowohl Gott als auch das Böse rein in der Gedankenwelt von Adam und Eva (vgl. 1. Mose 3,14 – 19).
Während Abid einzelne Gedankenfetzen niederschrieb, betrachtete er den Scherbenhaufen aus zerbrochenen Tellern. Ohne ein Eingreifen von außen war das Chaos der Normalzustand. Als die Beziehung zwischen Gott und den Menschen zerbrach, da bahnte sich die Zerstörung den Weg in diese Welt, und jeder Mensch war von diesem Zustand betroffen – ausnahmslos.
„Entschuldigung, Vater, ich weiß, dass dir das Geschirr viel bedeutet hat.“ Hamide stand mit traurigen Augen da und hielt einen Eimer mit den Scherben in der Hand.
„Ist nicht schlimm, es waren ja nur Teller; wir finden bestimmt schnell Ersatz“, antwortete Abid und wandte sich wieder seinem Schriftstück zu. Wenn doch aller Zerbruch so einfach zu beseitigen wäre, dachte Abid und überlegte, was er als Nächstes schreiben sollte. Da standen sie also, Adam, Eva und ihr Schöpfer. Jeder trauerte über das Geschehene, aber alle waren sie in diesem Moment nicht in der Lage, die Scherben wieder zusammenzufügen. Und so formulierte Abid:
Etwas Schlimmes war geschehen. Die Menschen, die vorher dem liebenden Gott begegnet waren, begannen, sich vor ihm zu fürchten. Das Gottesbild hatte sich verzerrt. Der, der bis eben noch der liebende Vater war, wurde zu einem Wesen, vor dem sie sich fürchteten. Der Kern von dem, was dort geschehen war, wurde sichtbar: Eine gestörte Beziehung und ein falsches Gottesbild hatten die Welt betreten.
Abid überlegte: Was sollte nun geschehen? Der heilige, liebende Gott, zu dessen Wesen es gehört, dass er absolut gerecht und gleichzeitig barmherzig ist, tat, was er tun musste: Er schickte den Menschen aus seiner Gegenwart weg.
Ja, wie sollte ein heiliger, völlig reiner Gott in enger Gemeinschaft bleiben können mit Menschen, die ihre Reinheit verloren hatten? Das war unmöglich. Auf diese Weise kam die große Trennung zwischen Gott und Mensch in diese Welt und Gottes Ankündigung des Todes hatte sich erfüllt. Dabei bedeutete der Tod für Adam und Eva in diesem Moment nicht das Ende ihres Lebens, sondern das Ende ihrer innigen Beziehung zu Gott. Der Mensch wurde von seinem Schöpfer getrennt und musste den Garten verlassen. Adam und Eva waren als Menschen nicht in der Lage, das Geschehene aus der Welt zu räumen. Was würde Gott nun unternehmen, um gleichzeitig gerecht und barmherzig zu sein? Denn eines stand für ihn trotz alledem fest: Er wollte seine Menschen nicht aufgeben.
Nachdenklich legte Abid seinen Stift zur Seite und betrachtete seine Bibel. Er hatte sie einst von seinem Großvater geschenkt bekommen und dieser hatte schon sein Leben lang in diesem Buch geforscht. „Die Bibel ist kein Lehrbuch der Geschichte und auch kein Lehrbuch der Naturwissenschaft“, hatte sein Opa immer gesagt.
Sie ist auch in diesen Punkten von Bedeutung, aber im Kern geht es um etwas anderes, dachte Abid. Der Kern ist die Offenbarung Gottes. Wie kann Gott sich den Menschen offenbaren? Wie wird seine Offenbarung zur Geschichte in dieser Welt? Zu einer Geschichte, in der es um Heilung und Versöhnung geht: um Gottes Heilsgeschichte mit dieser Welt. Das große Bild der Bibel, das wollte Abid in den folgenden Kapiteln versuchen zu beschreiben. Die große Geschichte, die immer mit dem Glauben beginnt. Mit einem Glaubens- und Vertrauensvorschuss, dass ein ewiger Gott existiert. Ein Gott, der die Menschen liebt und der ihnen in einer Welt voller Zerbruch und Leid Hoffnung schenken möchte. Ein Gott, der den Menschen eine Zukunft verheißt und dessen Liebe zu seiner Schöpfung nie aufgehört hat.
Knarrend öffnete sich die Haustür und Hamide kam mit dem leeren Eimer zurück. Sie hatte die Scherben beseitigt. Mit ihr kam ein frischer Windhauch durch die Tür.
„Hamide, mein Schatz, habe ich dir eigentlich schon einmal den Römerbrief erklärt?“ Mit diesen Worten blätterte Abid in seiner Bibel im hinteren Teil und suchte in dem Brief, den der Apostel Paulus an die Christen in Rom geschrieben hatte, das dritte Kapitel. Immer und immer wieder hatte Abid die sechzehn Kapitel des Römerbriefs studiert und auch darüber gepredigt. Hier wurde systematisch aufgezeigt, in welchem Zustand sich der Mensch und die Welt befinden und wie Gottes Weg aussieht, die zerstörte Beziehung zwischen den Menschen und Gott wieder zu heilen. Abid hatte heute nicht die Zeit, um mit Hamide alle einzelnen Kapitel und Gedanken zu erörtern. Daher wollte er sich auf die Kapitel beschränken, die über den Zustand des Menschen ohne Gott sprechen.
„Nein“, antwortete Hamide, stellte den Eimer ab und ging hinüber zu ihrem Vater.
„Dann nimm dir doch mal einen Stuhl. Ich will dir etwas Wichtiges zeigen.“
Notizen
Ein Blick in die Bibel
Römer 3,11 – 12.23 (Hfa)
Es gibt keinen, der einsichtig ist und nach Gott fragt. Alle haben sich von ihm abgewandt und sind dadurch für Gott unbrauchbar geworden. Da ist wirklich keiner, der Gutes tut, kein Einziger.
Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte.
Der Römerbrief ist ein Brief des Apostels Paulus und zeigt das Evangelium (die frohe Botschaft von Jesus) deutlicher auf als die anderen Briefe des Neuen Testaments. Paulus erklärt in kurzen, klaren Worten den Weg zurück zu Gott. Aber bevor er diesen Weg präsentiert, führt er in den Kapiteln 3 und 4 aus, warum jeder Mensch, ob Jude oder Heide, vor Gott schuldig ist und nur Gott selbst, durch Jesus, unsere Rettung ist (vgl. Epheser 2,1 – 3).1
Um die Trennung von Gott aufzuzeigen, verwendet der Römerbrief den Begriff Sünde. Jesus verwendet in seinen Reden häufiger die Bezeichnung der Verlorenheit, um den Zustand des Menschen zu beschreiben. In den folgenden Erklärungen wird als zentraler Begriff die Sünde verwendet, denn von Gott als Sünder betrachtet zu werden bedeutet, verloren zu sein.
In Römer 3,9 – 20 stellt Paulus die allgemeine Sündhaftigkeit des Menschen dar. Er stellt klar, dass jeder von Gott getrennt ist und es keinen Menschen gibt, dessen Beziehung zu Gott von Natur aus gut ist. Dabei kann Sünde viele verschiedene Formen annehmen. Im Alten Testament wird der Begriff durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Wörtern ausgedrückt. Als Sünde kann alles bezeichnet werden, was gegen Gott gerichtet ist. Dabei umfasst der Ungehorsam einen passiven wie auch einen aktiven Aspekt. Der Mensch kann als Person neidisch oder stolz sein (passive Sünde) und er kann lügen und stehlen (aktive Sünde). Des Weiteren berichtet die Bibel an verschiedenen Stellen, dass wir in einem sündigen System leben und Gott das Volk zur Buße ruft (vgl. Amos, Maleachi). Die Hauptbetonung liegt jedoch auf dem Aktiven, nämlich dass Unrecht begangen wird.
Der berühmte dänische Philosoph Søren Kierkegaard schrieb 1849 ein faszinierendes Buch mit dem Titel Die Krankheit zum Tode. In ihm definiert er Sünde so: Sünde ist das verzweifelte Sich-Weigern, meine tiefste Identität in meiner Beziehung zu und im Dienst für Gott zu finden. Sünde heißt: Ich versuche, ohne Gott mein Ich, meine Identität zu finden.2 Der Mensch macht sich selbst und die Welt zum Ziel seines Lebens, anstatt den Schöpfer zu ehren und in ihm die Erfüllung des Lebens zu suchen.
Wer sich auf die Suche begibt, das Geheimnis der Sünde zu erfassen, der kommt auch nicht an einem der schönsten Gleichnisse von Jesus vorbei. Die Erzählung von den zwei Söhnen (vgl. Lukas 15) beschreibt die unterschiedlichen Arten, wie Menschen sich von Gott trennen können. Denn Sünde ist im Kern keine einzelne Verfehlung, sondern eine Lebenshaltung, die sich in Selbstverwirklichung und Selbstgerechtigkeit äußert. Das beschreibt Jesus in diesem Gleichnis. Doch in der Zentrierung auf uns selbst liegt weder Glück noch das Leben. Dort, wo der Mensch diese Haltung aufgibt und den Weg zu Gott, dem Vater, sucht, findet er das Leben. Alles Leben in der Trennung von Gott ist ein geistlich totes Leben. In einem selbstzentrierten Leben verpassen wir den wahren Grund und Sinn unseres Lebens. So befindet sich einer der schönsten Verse der Bibel auch in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn: Denn mein Sohn war tot, und nun lebt er wieder; er war verloren, und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern (Lukas 15,24).
Um das Problem der Sünde zu begreifen, ist es wichtig, das biblische Gottesbild zu verstehen. Die Bibel spricht von einem persönlichen Gott und nicht von einem abstrakten, nicht fassbaren Gott. Doch leider ist es genau dieses Gottesbild, das in der westlichen Kultur vorherrscht.3 Und weil Gott kein abstraktes Wesen ist, können wir auch ihm gegenüber schuldig werden. Dies führt Paulus im dritten Kapitel des Römerbriefes aus und dieses Bild zeigt sich auch im Gleichnis aus Lukas 15.
Dabei ist es von zentraler Bedeutung, die Sünde nicht in einzelnen moralischen Vergehen zu sehen, sondern zu verstehen, dass wir in einem Zustand der Trennung von Gott leben und dass die Bibel jeden mit dem Ruf zur Buße und Umkehr anspricht.
Die Bibel beschreibt den Menschen nach seiner Vertreibung aus dem Garten Eden als Sünder – unabhängig von seinem Geschlecht oder seiner Herkunft, egal wie ethisch gut er lebt, wie sehr er sich um die Natur kümmert oder sein Leben für andere einsetzt. Der Mensch ist Sünder, weil er von Adam abstammt.
Dazu kommt noch ein weiterer wichtiger Punkt: Der von Gott getrennte Mensch ist sich seines „Elends“ nur bruchstückhaft bewusst. Er merkt möglicherweise, dass die Welt und er nicht perfekt sind, doch den Grund dafür erkennt er nicht (vgl. 2. Korinther 4,3 – 6 und 1. Korinther 2,6 – 16). In dieser Blindheit hat sich der Mensch wie das verlorene Schaf verirrt. Und wie für ein verlorenes Schaf ist es dem Menschen nicht möglich, alleine zu Gott zurückzufinden. Gott, der Hirte, muss sich aufmachen und das Verlorene suchen und retten (vgl. Lukas 15).
Der Wissenschaftler Blaise Pascal sagte zu der Trennung von Gott, dass die Lehre von der Erbsünde auf den ersten Blick wie eine Beleidigung der Vernunft erscheine, doch einmal akzeptiert, diese den Schlüssel zum Verständnis des Zustandes des Menschen biete.4
Zwischen Gott und den Menschen gibt es also eine Kluft, sie sind voneinander getrennt. Dabei kann der Mensch sich Gott nicht einfach so wieder nähern, denn Gott ist heilig und rein und der Mensch lebt in Sünde. Aus diesem Grund hat Gott nach einem Weg gesucht, der seiner Heiligkeit gerecht wird, der die Sünde in ihrer ganzen grausamen Dimension ernst nimmt und den Menschen gleichzeitig die Freiheit und den Willen überlässt, sich für oder gegen Gott zu entscheiden.
Und was denkst du?
Der christliche Glaube zielt nicht auf ein theoretisches Wissen über Gott ab, sondern auf ein Bekenntnis: An diesen Gott glaube ich und ihm vertraue ich (Apostolisches Glaubensbekenntnis). Jedoch soll der Glaube nie beim Bekenntnis stehen bleiben. Der Glaube soll das Leben verändern und fordert uns heraus, umzukehren und unser Leben durch Gott verwandeln zu lassen. Und letztlich geht es noch einen Schritt weiter: Wer glaubt, wird herausgefordert, seinen Glauben aktiv in dieser Welt zu leben.
Die folgenden Fragen sind eine Einladung, sich mit diesen unterschiedlichen Facetten des Glaubens zu beschäftigen. Ich wünsche euch und eurer Gruppe einen offenen Austausch, fröhliche Diskussionen und lebensverändernde Gedanken.
Fragen zum Bekenntnis: Was glaubst du?
Unsere Erkenntnis ist Stückwerk, und daher gibt es auch noch andere Sichtweisen auf die Entstehung der Erde und die Frage nach der Existenz Gottes.
Was ist deine Sicht auf die Entstehung der Erde und die Frage nach der Existenz Gottes?
Welchen Punkten und Argumenten kannst du zustimmen und welchen würdest du widersprechen?
Sollten wir die Texte in 1. Mose 1 – 11 nicht eher symbolisch betrachten? Oder sind diese Texte historische Erzählungen vom Anfang der Welt?
Fragen, die unser Leben berühren und uns auf Gott ausrichten:
„Und die Erde war wüst und leer.“ So lautet einer der ersten Sätze der Bibel. Doch Gott ordnet die Welt, er gibt der Welt einen Rhythmus und dem Menschen eine Bestimmung. Glaubst du, dass Gott in deinem Leben Neues schaffen kann? Dass auch aus dem Chaos und Zerbruch unseres Lebens etwas Großartiges entstehen könnte?
Gott als Vater? Gott als Mutter? Gott als allmächtige Schöpferkraft? Welche Vorstellung von Gott entspricht deinem Gottesbild am meisten?
Wie kann der Mensch deiner Meinung nach wieder in die Beziehung zu Gott treten?
„Meine Beziehung zu Gott ist verloren gegangen!“ Was löst dieser Satz in dir aus? Wie denkst du darüber?
Die Begriffe Sünde und Erbsünde wirken verstörend und fremd. Wie denkst du über Gott und in welchem Verhältnis stehst du zu ihm?
Warum ist eine Beziehung zu Gott überhaupt wichtig? Können wir nicht auch gut oder sogar besser ohne Gott leben?
Praktisch glauben: Denn der Glaube zeigt sich im Leben und in unserem Handeln.
Gott hat diese Welt geschaffen. Wo kannst du mithelfen, diese Welt zu schützen und zu bewahren?
Der Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Wie können wir uns dafür einsetzen, dass jeder Mensch geehrt und geachtet wird?
Quellenverzeichnis
Horst Afflerbach: Handbuch Christliche Ethik. Witten: R. Brockhaus Verlag 2002.
Garry Collins: Die biblische Grundlage für beratende Seelsorge. Marburg: Francke Verlag.
John Eldredge: Der ungezähmte Christ. 5. Aufl. Gießen: Brunnen Verlag 2011.
Timothy Keller: Warum Gott? Vernünftiger Glaube oder Irrlicht der Menschheit? 2. Aufl., Gießen: Brunnen Verlag 2010.
Siegfried Kettling: Du gibst mich nicht dem Tode preis. Wuppertal: R. Brockhaus Verlag 1999.
Siegfried Kettling: Typisch evangelisch. Grundbegriffe des Glaubens. 2. Aufl. Gießen: Brunnen Verlag 1992.
Thomas Christian Kotulla: Die Begründung der Welt. Wie wir finden, wonach wir suchen. Gießen: Brunnen Verlag 2013.
Manfred Lütz: Gott. Eine kleine Geschichte des Größten. München: Knaur Taschenbuch 2009.
Hans Peter Royer: Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. 5. Aufl., Holzgerlingen: Hänssler Verlag 2008.
Thomas Schirrmacher: Ethik. Das Gesetz der Liebe. Hamburg: Reformatorischer Verlag Beese 2002.
Martin Schleske: Der Klang. Vom unerhörten Sinn des Lebens. München: Kösel Verlag 2010.
A. E. Wild Smith: Wer denkt, muss glauben. Holzgerlingen: Hänssler Verlag 1980.
soulfire DNA – Teil 8: Nach außen gewandt (Teil 1), http://soulfirekoeln.de/2010/10/06/soulfire-dna-teil-8-nach-ausen-gewandt-teil-1/ (letzter Zugriff: 05.09.2017).
Thorsten Dietz: Weiterglauben. Warum man einen großen Gott nicht klein denken kann. Moers: Brendow Verlag 2018.
1 Vgl. F. F. Bruce: Der Römerbrief. Ein Kommentar. ICI Deutsche Ausgabe 1986, S. 30 – 36.
2 Vgl. Timothy Keller: Warum Gott? Vernünftiger Glaube oder Irrlicht der Menschheit? 2. Auflage, Gießen: Brunnen 2010, S. 197.
3 Vgl. Herbert Schlögel OP: Schuld und Sünde. Moraltheologische Aspekte, http://epub.uni-regensburg.de/8838/1/ubr03567_ocr.pdf (letzter Zugriff: 15.10.2013).
4 Vgl. Genfer Studienbibel, Holzgerlingen: Hänssler Verlag 1999, S. 15.
Kapitel 2: Gott sucht den Menschen
Die Sonne versank, die Nacht brach herein und aus dem Fenster sah Abid, wie sich der Horizont in ein Farbenmeer aus Violett und Rot verwandelte. Ein weiterer Tag neigte sich seinem Ende, und gleichzeitig wurde aus dem Sommer langsam der Herbst. Bald müsste er eine Lampe entzünden, falls er abends weiter an seinem Schreibpult arbeiten wollte.
Wie sehr brauchte der Mensch doch das Licht, um zu leben und zu arbeiten! Erst im Licht wurden die Dinge sichtbar, nur durch diese Strahlen, die nicht einzufangen und selbst nicht zu sehen waren, traten die Elemente aus ihrer Verborgenheit hervor.
Neben Abids Bibel lagen mehrere beschriebene Blätter, die seine Erinnerungen und die Erlebnisse seines Lebens enthielten. In vielem glich sein Leben dem seiner Nachbarn. In dem kleinen Stall hinter seinem Haus lag eine Ziege mit ihren Jungen auf einem Strohbett, außerdem besaß Abid einige Kühe und sogar Pferde. Aber im Gegensatz zu vielen anderen war er auch ein Reisender gewesen. Anfangs hatten die Leute ihm gesagt, dass er arm würde, wenn er immerzu durch die Welt reiste. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Sein Leben wurde reicher, und die kostbaren Dinge, die er von seinen Reisen mitbrachte, hatten ihn sogar zu einem wohlhabenden Mann gemacht.
Als er über die Zeit seiner Wanderschaft nachdachte, kam ihm wieder seine erste Reise nach Kut al-Amara in den Sinn. Er hatte sich in seinem Leben nach Gott und einem Sinn gesehnt, aber es waren die verschiedenen Begegnungen und Erfahrungen des Lebens gewesen, die ihn zu Gott geführt hatten. Er war auf der Suche gewesen, doch Gott hatte ihn gefunden. Beides gehörte zusammen – so beschrieb es schon die Bibel.
Mittlerweile war es so dunkel geworden, dass Abid eine Öllampe entzündete. Im flackernden Schein des Lichts senkte er seine Schreibfeder auf das Pergament. Die Spitze berührte die rechte obere Ecke, und aus etwas bis dahin Schlichtem wurde nun etwas Besonderes. Genau das Gleiche geschah doch auch, wenn der Schöpfer das Leben eines Geschöpfes berührte und wieder das Recht erhielt, ein Leben zu formen und zu gestalten. Davon war Abid überzeugt und hatte es im eigenen Leben erfahren.
Wie die Beziehung zwischen Gott und den Menschen zerbrochen war, hatte Abid verstanden. Aber wie konnten diese wieder zusammenfinden? Nachdem die Sünde in die Welt gekommen war, lag die Beziehung zwischen Gott und den Menschen in Scherben. Adam und Eva mussten das Paradies verlassen und die Lasten und Schmerzen des Lebens nun am eigenen Leib spüren und tragen.
Abid kannte die schwere Feldarbeit, wie sie schon Adam erlebt haben musste. In endlosen Stunden hatte Abid seine Äcker bearbeitet und dabei immer wieder über jenen Ruf Gottes nach dem Sündenfall nachgedacht. „Adam, wo bist du?“, hatte es damals durch den Garten Eden geschallt. Wieso hatte Gott nach Adam gerufen? Gott war doch allmächtig, allgegenwärtig und allwissend. Er musste Adam und seine Frau gesehen haben, aber warum rief er ihn dann?
Immer und immer wieder beschäftigte Abid diese Frage. Brauchte Gott den Menschen, um vollkommen zu sein? Aber wenn Gott den Menschen brauchte, dann wäre er doch kein vollkommener Gott. Dann wäre er jämmerlich. Jemand, der zwar etwas schaffen konnte, dies aber nur tat, um nicht einsam zu sein. Das traf aber sicherlich nicht zu.
Der Gedanke an das verlorene Paradies schmerzte, und gleichzeitig wusste Abid genau: Gott war vollkommen. Er war drei und doch eins. Er brauchte niemanden sonst. Sein Geist schwebte bei der Schöpfung über dem Wasser, und durch und für seinen Sohn Jesus Christus war alles geschaffen. Die Welt, der Kosmos und der Mensch existierten zur Ehre Gottes und nicht, weil Gott das Geschaffene zwingend gebraucht hätte.
Abid konnte sich noch gut daran erinnern, wie er einmal bei der Feldarbeit den Blick von der Erde gehoben, zum Himmel geschaut und sich gefragt hatte, welchen Klang die Stimme Gottes wohl damals im Garten Eden gehabt hatte. Er hatte die Frage fast hören können: „Adam, Mensch, wo bist du?“
„Adam, Mensch, du, der du meine Stimme hörst – ja, ich rufe nach dir: Wo bist du?“ Die Stimme im Garten klang bestimmt weder emotionslos noch gelangweilt. In ihr schwang sicher der Schmerz eines Vaters mit, der sein Kind sucht. Gott tat das Herz weh, und vermutlich waren seine Worte voller Schmerz und Trauer. Gleichzeitig war Gott fest entschlossen, den Menschen, der sich von ihm abgewandt hatte, zu finden.
Denn der dreieinige Gott ist nicht nur ein gerechter und barmherziger Gott, dachte Abid, er ist auch die Liebe selbst. Er ist die reinste Form der Liebe und er liebt seine Menschen. Das war es! Das war der Grund, weshalb Gott nicht wollte, dass der Mensch in der Gottesferne lebte. Gott rang und kämpfte, denn nur Gott selbst konnte einen Weg finden, der seiner Gerechtigkeit entsprach und das Geschehene aus der Welt schaffen würde.