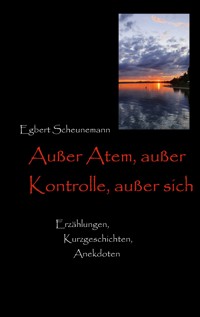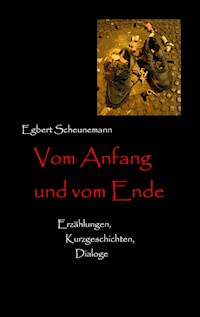
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was könnte es Wichtigeres geben als Fragen nach dem Anfang der Dinge? Und ihrem Ende? Nach dem Ursprung des Universums und dem ganzen Rest? Nach dem Sinn der ganzen Veranstaltung, auch Leben genannt? Die Antworten auf diese Fragen, die in dieser kleinen Sammlung von Erzählungen, Kurzgeschichten, Dialogen und Fragmenten angedeutet werden, mögen hier und da überraschen. Denn sie haben weit mehr mit Humor, Geist, Witz, Fantasie und gepflegtem Irrsinn zu tun als mit tiefenpsychologischen, seinsphilosophischen, existenzialistischen Anleitungen zu einem versauten Leben oder gar zum Selbstmord.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 121
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Prolog
Vom Anfang – die Schöpfung
A und B – vom Universum und dem ganzen Rest
Der Radfahrer
A und B – oder vom Sinn des Lebens
Parry Hotter – und der Sattelschlepper der Hölle
Ein letzter Brief
Eleni
Umberto und Peppe
A und B – vom guten Geschmack. Und der Wahrheit
Anton
Vom Ende – ein faustischer Pakt
Prolog
Eigentlich könnte ich erhebliche Teile des Vorwortes zu meiner Sammlung von Erzählungen „Trilogie des Scheiterns“ hier einfach hineinkopieren. Aber man muss ja was tun fürs Geld. Also: Auch in diesem kleinen Sammelband finden sich Erzählungen oder Dialoge, deren Themen, Charaktere und Szenerien in hohem Maße der Realität entnommen sind. Hier und da mehr oder weniger verfremdet, um reale Personen zu schützen – auch mich selbst. Nach wie vor schreibe ich gerne über Dinge, Phänomene und Vorkommnisse, von denen ich etwas Ahnung habe. Und am meisten Ahnung habe ich von mir selbst, meiner eigenen Lebensgeschichte, meinen engen Freundinnen und Freunden, meinem sozialen wie urbanen Umfeld – aber auch von den Professionen, mit denen ich mich, quasi hauptberuflich, seit Jahrzehnten beschäftige: Politik, Ökonomie, Philosophie und Naturwissenschaften.
Wovon ich keine oder wenig Ahnung habe, davon lasse ich lieber die Finger. Das wilde Konstruieren frei erfundener Storys, auch Romane oder Märchen für Erwachsene genannt, ist nicht so mein Ding. Noch weniger sind es narrative Konstrukte – Sex & Crime, gähn, an erster Stelle –, die nach dramaturgischen Schemata, ob cineastisch oder literarisch, verfasst sind, deren x-te Zurkenntnisnahme mich seit langen Jahren nur noch langweilt. Und deswegen mehr und mehr unterblieb und unterbleibt.
Etwas ganz anderes sind, um nur zwei Beispiele zu nennen, gut recherchierte und intelligent konstruierte Science-Fiction-Romane – gut recherchiert und intelligent konstruiert in dem Maße, wie sie harte Physik lediglich in räumlich oder zeitlich entferntere Sphären prolongieren, ohne den Geltungsbereich der Naturgesetze zu verlassen und den Raum des Lächerlichen zu betreten, und die damit reale Entwicklungen der Wissenschaften und der Technik oftmals Jahrzehnte davor voraussagten.
Und etwas ganz anderes sind auch Fantasy-Storys, also als solche offen deklarierte wirkliche Märchen, in denen die Fantasie nur so tobt, die uns staunen lassen mit offenen Mündern und großen Augen. Die uns Welten konstruieren und – wiederum: ob cineastisch oder literarisch – zeigen oder beschreiben, die einfach nur fantastisch und schön oder düster-schön oder auch nur düster sind, die uns inspirieren, unsere Fantasie entfachen, das Kind mit großen Kulleraugen in uns wecken oder wiedererwecken. Und wenn’s dabei auch noch was zu lachen gibt, ist das eigentlich nicht mehr zu toppen.
Naturwissenschaftlich aufgeklärte konstruktive Souveränität, Intelligenz, Fantasie, Geist, Esprit, Witz, Humor. Das genaue Gegenteil also vom deutschen Schicksalsroman oder Problemfilm. Oder den existenzialistischen linksrheinischen Pendants, Anleitungen zu einem versauten Leben und nicht selten zum Selbstmord.
Nun bin ich etwas vom Thema abgekommen. Aber was war noch das Thema? Ach, lesen Sie doch einfach, was folgt.
Hamburg, im Februar 2019
Egbert Scheunemann
Vom Anfang – die Schöpfung
Der kleine Junge quetschte inbrünstig den Schlamm durch seine Hände. Inzwischen hatte er die genau richtige Konsistenz, nicht so fest wie der Ton direkt aus der Baugrube, aber auch nicht zu dünn, zu flüssig. Genau richtig, um alles zu formen, worauf der kleine Junge Lust hatte. Es war für ihn die helle Freude, eine Portion der kühlen Matsche in die Hände zu nehmen und durch die Fingerritzen zu pressen. Dabei bildeten sich flache Bändchen wie die blonden Locken von Hannah, dem kleinen Mädchen von nebenan, das er inzwischen nicht immer nur doof fand. Er war aber viel zu schüchtern, es Hannah zu sagen. Und er konnte nicht wissen, dass auch Hannah ihn inzwischen nicht immer nur doof fand, aber noch viel schüchterner war als er.
Kaum hatte es aufgehört zu regnen, ließ seine ziemlich rund und kräftig ins Leben gebaute Mutter den kleinen Jungen raus. Er war der Kleinste unter seinen vielen Geschwistern und den Nachbarskindern. Die waren alle schon in der Schule, frisch eingeschult oder sogar schon in der zweiten oder einer noch höheren Klasse. Er war noch zu klein für die Schule. So hockte er alleine an der großen Pfütze neben der für ihn riesigen Baugrube, die sie vor dem Wohnblock, in dem seine Familie seit einiger Zeit lebte, ausgehoben hatten. Etwas hinter der Baugrube standen ein paar Kühe auf der Weide, guckten artgerecht, also ziemlich dämlich über den Zaun und warteten auf Küchenabfälle, meist Kartoffelschalen, die die Mutter des kleinen Jungen und auch einige Mütter der Nachbarskinder gegen Mittag oft über den Zaun schütteten. Eine Kuh hieß Herta. Sie war besonders zutraulich, ja gelegentlich sogar etwas zudringlich. Gerne ließ sie sich vom kleinen Jungen und anderen Kindern streicheln. Dumme, fiese Kinder schmissen auch Lehmklumpen oder sonst was auf die Kühe. Der kleine Junge machte so etwas nicht. Das fand er doof. Und gemein.
Aber Herta und die anderen Kühe interessierten den kleinen Jungen gerade nicht. Viel wichtiger und interessanter war die Lehmpampe, die er sich in beachtlicher Menge zurechtgeknetet und -gewalkt hatte. Der Regen setzte wieder ein, aber nur leicht. Der kleine Junge bemerkte ihn gar nicht und begann, einen kleinen Damm wie ein Halbrund in die Pfütze zu formen, vom Ufer links hinein in die Pfütze und wieder zurück zum Uferabschnitt ein Stück weiter rechts von ihm. Das war jetzt sein Hafen, in Schrittbreite der Küstenlinie der Pfütze abgerungen. Vom Rand der Pfütze her, der Festlandseite seines Hafens, formte der kleine Junge ein Gebäude nach dem anderen, Türme, Plätze, Stege und Brücken. Ein richtiges Kanalsystem, auf dessen Wasser er später kleine Schiffe fahren lassen wollte, von Wind und Zufall getrieben oder aus dicken Backen in die gewünschte Richtung gepustet. Vielleicht gebastelt aus halben Walnussschalen, vielleicht aus Rindenstücken der alten Kiefern, die gleich hinter der Kuhweide am Waldesrand standen. In den Wald durfte der kleine Junge aber nur, wenn mindestens eines seiner älteren Geschwister mitkam und auf ihn aufpasste. Aber die Schiffe kamen später, eins nach dem anderen, jetzt arbeitete der kleine Junge tief versunken und hoch konzentriert an seiner kleinen Hafenstadt.
In einer Christmette an Heilig Abend hatte der kleine Junge den Pfarrer sagen hören, dass der Mensch aus Staub geschaffen sei und zu Staub wieder werde. Er hatte das nicht verstanden. Er zog seinem Papa an der Hand, der guckte gütig runter. Der kleine Junge fragte leise, ob er denn wirklich aus Staub gemacht sei. Sein Papa flüsterte nur ein „später“ hinunter. Der kleine Junge war gespannt auf die Antwort. Für den Moment dachte er sich, dass die Menschen und die ganze Welt nicht aus Staub, sondern vielmehr aus Matsch geformt worden sind. Mit Staub konnte er doch gar nichts formen! Der klebte doch gar nicht! Der wurde doch gleich wieder vom Winde verweht!
Nach der Christmette, die noch eine Weile dauerte, hatte der kleine Junge seine Frage vergessen, und sein Vater auch. Jetzt an der Pfütze fiel dem kleinen Jungen diese Frage wieder ein. Gleich wenn sein Papa von der Arbeit zurückkommen würde, wollte er ihm diese Frage erneut stellen. Und er wollte seinem Papa stolz seine Schöpfung, die kleine Hafenstadt zeigen.
Was ein Bauarbeiter war, ein Baggerführer, das wusste der kleine Junge schon. Wenn sie kamen und die Straße, die an der entstehenden Siedlung entlangführte, verlängerten oder eine neue Baugrube aushoben, um einen neuen Wohnblock für Flüchtlinge zu bauen, von denen der kleine Junge und seine Familie selbst welche waren, konnte es der kleine Junge zu Hause nicht aushalten. Seine Mutter, ziemlich arbeitsüberlastet durch das Aufziehen von sieben Kindern, ließ ihn gerne raus, aber nur, wenn er in ihrem Blickfeld blieb, das sich bot, wenn sie zum Küchenfenster hinaussah. Das Fenster – eigentlich wurde in der Küche nahezu durchgehend gekocht, gebacken, gebraten – stand fast immer offen, nur im Winter bei heftiger Kälte nicht. Jetzt war Frühling. Wenn sich der kleine Junge zu sehr den Baggern und Lastern näherte, zitierte seine Mutter ihn durch ihr kräftiges Organ wieder ein Stück zurück. Auch viele Nachbarsmütter hatten immer wieder einen Blick auf die Kinder, die vor oder hinter dem Haus spielten. Alle passten irgendwie auf alle auf. Besonders Frau Reim. Sie sagte dem kleinen Jungen viele Jahre später, dass es für sie ein bleibender Eindruck gewesen sei, wie er unermüdlich an Pfützen, in halb fertigen Baugruben, auf kleinen Bergen aufgeschütteten Erdreichs saß und knetete, bastelte, formte, Areale absteckte mit Ruten nahen Gebüschs, kleine Kanäle aushob, Brücken darüber baute aus Bauholzresten, die später von den Arbeitern als Brennholz genutzt wurden. Oft hatten die Bauarbeiter Hemmungen, die Schöpfungen des kleinen Jungen, wenn nötig, zu zerstören. Sie waren ja selbst mal Kinder gewesen, und einige hatten auch Kinder. Aber sie mussten irgendwann fertig werden mit ihrer Arbeit, mit dem neuen Bau. Und das ausgehobene Erdreich musste wieder weg irgendwann. Der kleine Junge war natürlich traurig, wenn eine seiner Schöpfungen am nächsten Tag plötzlich verschwunden war. Aber nur kurz. Gleich schuf er etwas Neues. Wie jetzt.
Ja, so einer wollte er werden wie die Bauarbeiter und Baggerführer. Er wollte Häuser bauen und ganze Städte, damit immer mehr Menschen, immer mehr Kinder am abgelegenen Rand des kleinen Städtchens leben könnten, in das es den kleinen Jungen und seine Familie nach langer Flucht verschlagen hatte. Kinder, mit denen er spielen konnte.
Mit den einheimischen Kindern im Städtchen hatte er kaum Kontakt. Nur am Wochenende sah er welche, wenn sein Papa und einige seiner älteren Geschwister zum Großeinkauf in die kleine Stadt zogen. Oft wurden sie gepiesackt oder schief angesehen. Nur mit den Nachbarskindern in seiner werdenden Siedlung verstand sich der Junge gut. Nicht mit allen, aber mit vielen. Die Kinder in der kleinen Stadt sprachen auch ganz merkwürdig. Der kleine Junge verstand sie kaum. Er konnte noch nicht wissen, dass er und seine Familie aus einer fernen Großstadt im Osten in ein kleines Städtchen auf dem Lande im tiefen Süden gekommen waren, nach Zwischenstationen in vielen Flüchtlingslagern, verstreut über das ganze Land. Aus mondäner Modernität in konservative, autoritäre, stark religiös und vor allem katholisch geprägte kleinstädtische Verhältnisse. Davon wusste der kleine Junge noch nichts. Nur dass er und seine Familie in dem Städtchen abgelehnt wurden, nicht gewollt waren, davon wusste er, das spürte er. Nicht von allen wurden sie gemieden, aber von vielen.
Der kleine Junge wusste auch noch nichts davon, dass die Flucht seiner Familie, die Ursachen der Flucht – ein furchtbarer Krieg und die schlimmen Folgen für seine Familie und besonders für seinen Papa, dem das politische Nachkriegsregime Schritt um Schritt die Lebensgrundlagen entzog – und die nahezu dörflichen, provinziellen, bleiernen Lebensverhältnisse, in die sie geraten waren, seine Familie mehr und mehr zerstören würden. Er konnte nicht ahnen, dass sein Papa bald sterben und seine Mutter nur wenige Jahre später schwer erkranken würde. Dass seine Kindheit damit schroff zu Ende sein würde und er, gerade zehn Jahre alt, seine Mutter mehr pflegen musste, als sie ihn pflegen und behüten konnte. Dass viele seiner älteren Geschwister zerbrechen würden ohne elterlichen Beistand in einer ablehnenden, diskriminierenden, feindlichen Umgebung, in finanziellen, materiellen Verhältnissen nahe dem Existenzminimum. Und nicht selten darunter.
Sein Papa, ein sehr gebildeter Mann, hatte immer großen Wert auf die Bildung und Ausbildung seiner Kinder gelegt. Als er starb, mussten die beiden älteren Brüder des damals gerade acht Jahre alten kleinen Jungen, die als erste ein Gymnasium besuchen konnten, dieses sofort verlassen. Sie mussten Geld verdienen, seine Mutter, die ganze Familie unterstützen. Was für eine Schmach, was für eine Demütigung. Später, als der kleine Junge langsam begriff, was mit ihm und seiner Familie geschehen war, wunderte er sich nicht mehr, dass genau diese beiden Brüder sich am heftigsten dem Suff und anderen Drogen hingaben und ihre Gesundheit und ihr soziales Leben zerstörten. Und nicht nur ihres.
Von all dem ahnte der kleine Junge nichts, als er an seiner Pfütze saß. Er bemerkte nur einen plötzlich auftauchenden und rasch größer werdenden Schatten hinter sich. Noch bevor er sich umdrehen konnte, spürte er einen heftigen Tritt in den Rücken. Der kleine Jung fiel vorne über in die Pfütze und begrub seine Schöpfung unter sich. Der Schatten entfernte sich so schnell, wie er gekommen war – mit feixendem Gelächter. Der kleine Junge kannte dieses Feixen, er wusste, von wem es kam – einem Flüchtlingskind aus dem ersten Wohnblock der neuen Siedlung, das noch merkwürdiger, noch fremder sprach als die Kinder in der kleinen Stadt. Nicht nur unter den einheimischen Kindern gab es doofe, dumme, fiese. Der kleine Junge richtete sich mühsam wieder auf und schrie dem Schatten hinterher. Keine Worte, einfach nur Schreie, Wutlaute, Offenbarungen seines Zorns. Er stampfte auf den Boden, immer wieder, und schrie. Dann verstummte er und fing leise an zu weinen. Schlamm und Wasser der Pfütze tropften von seinem Gesicht, seiner Jacke, seiner Hose.
*
Als der kleine Junge fast ein junger Mann war, verließ er das kleine Städtchen. Es kam ihm vor wie eine erneute, eine zweite Flucht, eine Flucht aus furchtbaren, gewaltsamen Verhältnissen. Seine Mutter litt immer schwerer an ihrer Krankheit, oft musste sie in einer Klinik stationär behandelt werden, um, zumindest vorübergehend, zu gesunden. Oft für lange Zeit lag sie dort. Alle seine Geschwister waren inzwischen aus dem Haus. Lange Jahre musste der kleine Junge mit den älteren Geschwistern, die anfänglich noch im Hause lebten, kämpfen, sich vor seine Mutter stellen, wenn der Suff, die Drogen, der Kummer, der Frust, die feindliche Umwelt seine älteren, pubertierenden, halbstarken und irgendwann erstarkten, erwachsenen Brüder aggressiv werden ließ.
Der kleine Junge hatte sich durch alle Schulen gekämpft. In den ersten Jahren traf er fast nur auf zutiefst autoritäre, oft gewaltsame, prügelnde Lehrer. Er ließ sich nicht unterkriegen. Desto größer der kleine Junge wurde, desto stärker wurde er. Und sein großes Glück war, dass er in jeder Schule immer mindestens einen Lehrer hatte, der auf seiner Seite stand. Lehrer, die halbwegs wussten, was in der Familie des kleinen Jungen vor sich ging. Die ihn stützten, ihm halfen, sich vor ihn stellten, wenn es, wie so oft, Ärger gab mit einem der autoritären Zwangsneurotiker im Kollegium.