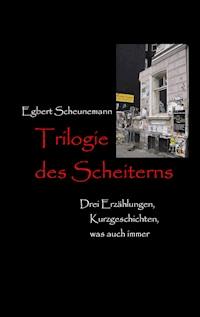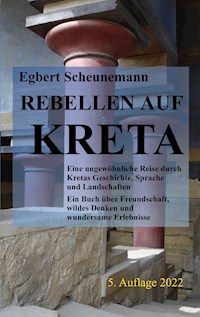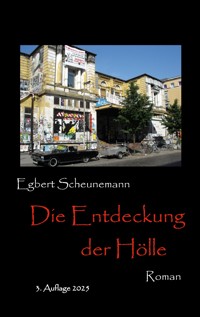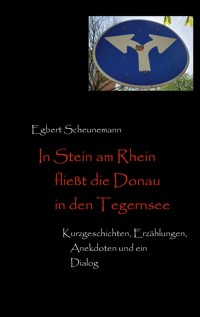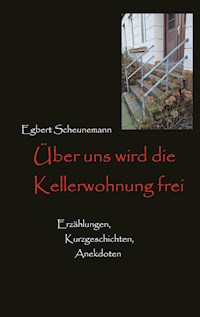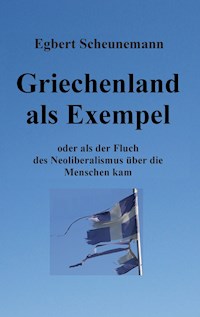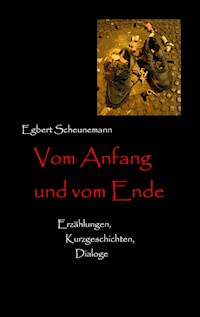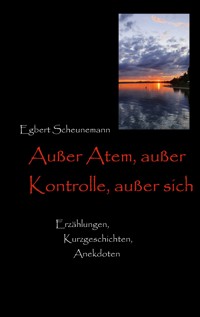
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Außer Atem, außer Kontrolle, außer sich - die Kurzgeschichten, Erzählungen und Anekdoten, die dieser Band versammelt, kreisen sowohl um die ganz kleinen, oft ulkigen Dinge im Leben, die uns gleichwohl ziemlich heftig aus der Spur werfen können, wie um das ganz Große, das Geschick der Menschheit, die bedroht ist wie kaum je zuvor, sozial, politisch wie ökologisch. Bedroht - durch Menschenhand. Durch Verantwortungslosigkeit. Und Dummheit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Prolog
Außer Atem
„Unter den Blinden“
Letztens beim Arzt und in der Apotheke
Die Lochbutze, die Matratze und der Neptun
Frau Nadig, ihr Sohn, der Lauterbach und das Narrengericht
Déjà-vu 2.0
Der Rollerfahrer
Der Mann am Bahnhof, der Schaffner und die Pauken
Die Spur
Neulich beim Altern – neue Folge
Der neue Auftrag
Hallo!
Das Nil kocht in St. Pauli
Die Rede seines Lebens
Prolog
Dies ist schon der fünfte Band mit Erzählungen, Kurzgeschichten und Anekdoten, den ich publiziere – ich komme, habe ich oft das Gefühl, kaum hinterher, all die komischen, schrägen, irritierenden oder berührenden Geschichten und Erlebnisse zu erzählen, die auf mich einprasseln. Im ganz normalen Alltagsleben, wohlgemerkt.
Aber so normal ist der Alltag eben nicht immer. Unverhofft geraten Dinge außer Kontrolle und wir außer Atem. Wir sind außer uns – und erzählen von den Ereignissen, die das bewirkten, brühwarm Freundinnen und Freunden, die man abends beim gemeinsamen Biere trifft. An ihren interessierten Gesichtern, ihren womöglich staunenden Augen sieht man, dass das, was passierte und man erzählt, eben erzählenswert ist, berührt, animiert, interessiert, Schauer über den Rücken laufen lässt, Stirnfalten verursacht – oder Lachfalten ins Gesicht zaubert.
In solchen Situationen frage ich mich oft: Warum nur meinen Freundinnen und Freunden davon erzählen, die ich so zufällig kenne und treffe wie sie mich? Warum nicht auch anderen Menschen – zum Beispiel Ihnen?
Hamburg, im Dezember 2024
Egbert Scheunemann
Außer Atem
Es fing an mit Schmerzen im Unterleib, irgendwo rechts und leicht unterhalb des Bauchnabels, gegen Mittag und mitten in meinem Sommerurlaub am Bodensee. Mal mehr, mal weniger, aber mit leicht ansteigender Tendenz. Vielleicht hatte ich etwas Falsches gegessen. Mir wurde jedoch nicht spontan schlecht, als ich im Kopf Schluck für Schluck, Biss für Biss dessen rekapitulierte, was ich in den letzten vierundzwanzig Stunden getrunken oder gegessen hatte – sonst ein untrügliches Zeichen dafür, dass etwas Unbekömmliches dabei war. Abends war ich noch mit Freunden verabredet zu gutem Essen, direkt am Ufer des Sees. Das ließ den Schmerz in den Hintergrund treten. Leckerer Fisch wurde kredenzt, noch besserer Riesling, danach ein runder fruchtiger Obstler – und während all dem anregende Gespräche und viel Gelächter mit alten Freundinnen und Freunden.
In der Nacht aber fand ich nicht wirklich zu Schlaf. Wellenartig brauste der Schmerz heran, immer wieder, immer öfter, immer heftiger. Mit der Morgendämmerung stand ich auf. Ich hatte Schmerzen, aber, interessanterweise, dennoch Appetit. Auf Kaffee. Ich trank zwei Becher in der Hoffnung, dass der Schmerz nach dem durch den Kaffee geförderten großen Geschäft nachlassen würde. Es hätte ja auch eine querstehende Jahrhundertblähung sein können, dachte ich mir. War es aber nicht.
Also setzte ich mich ans Laptop und recherchierte, wo ich in der kleinen Stadt, in der meine Ferienwohnung lag, Hilfe finden könnte. Und Bingo: Das örtliche Krankenhaus hatte vor drei Wochen geschlossen. Final. Man wurde auf der Homepage auf die beiden nächstliegenden Krankenhäuser verwiesen. Beim am nächsten gelegenen rief ich an, schilderte kurz meine Situation und fragte, was ich machen solle. Am besten möglichst bald vorbeikommen, sagte man mir, und gleich in die Notaufnahme. Selbsteinweisung.
Von da an lief alles wie am Schnürchen. Ich fuhr mit dem Fahrrad zum Bahnhof, der nur einen guten Kilometer entfernt war – das Radeln verursachte keine zusätzlichen Schmerzen im Vergleich zum Gehen oder auch nur Sitzen. Auf den Regionalexpress musste ich nur knappe zehn Minuten warten, weitere zehn Minuten später war ich in der Nachbarstadt. Vor dem Bahnhof stand ein abfahrbereiter Bus. Ich fragte den Fahrer, ob er zufällig am Krankenhaus vorbeifahre. Zufällig würde er das, meinte der Mann. Die dritte Station sei es. Und wieder nur einige Minuten später war ich am Ziel und kurz darauf am Schalter der Notaufnahme. Es war ziemlich genau zwölf Uhr mittags.
Mir schwante vor dem Betreten des Gebäudes zunächst Schlimmes. Rechts vom Eingang auf dem Vorplatz standen zwei Eiswagen in praller Sonne und boten ihre kühlen Köstlichkeiten an. Vor und um die Eiswagen waren – ich übertreibe nicht – etwa dreißig, vierzig weiß, hellblau oder hellgrün gekleidete Bedienstete des Krankenhauses zu sehen, die auf ihr Eis warteten oder es schon schlotzten. Oje, wie es dann wohl in der Notaufnahme aufgrund dieses Personalmangels der etwas besonderen Art zugehen würde? Dachte ich mir düster.
Aber nur viereinhalb Stunden später wurde ich operiert – Appendektomie, Entfernung des Appendix, meines akut entzündeten Blinddarms. Das hatten die Untersuchungen ergeben. Blutentnahme. Ultraschall. Abtasten. Letzteres gestaltete sich schmerzhaft, aber durchaus auch ganz lustig. Der Arzt, der mich schließlich auch operieren sollte, drückte mit den Fingern in meinen Unterleib. Links vom Bauchnabel. Von mir aus gesehen. Wohl zehn Zentimeter tief. Dann zog er seine Hand ruckartig weg. Schwupp, schwabbel – mein Bauch nahm ebenso ruckartig wieder seine Ruhestellung ein. Ob das wehgetan habe, fragte der Arzt. Ja, aber eher rechts, meinte ich. Daraufhin wiederholte der Arzt das Prozedere auf der rechten Seite – zumindest versuchte er es. Nach nur einem Zentimeter Drucktiefe musste ich nämlich darum bitten, den Abbruch dieser Untersuchungsmethode vielleicht doch in Erwägung zu ziehen. Der Arzt gehorchte aufs Wort.
Zum Schluss bat er mich, aufzustehen und leicht auf dem linken Bein zu hoppeln. Ob das wehtue. Ja, aber wiederum eher rechts. Dann also bitte noch mal auf dem rechten Bein hoppeln. Ich hoppelte, aber nur ein einziges Mal, denn ich wäre am liebsten direkt an die Decke gehoppelt vor Schmerz. Der Arzt streckte siegesgewiss den rechten Daumen in die Höhe. Ja, das sei ziemlich sicher ein entzündeter Blinddarm. Der müsse raus. Am besten noch heute.
Die Tür ging auf, eine Schwester, wie auf Zuruf und im Timing perfekt, überreichte dem Arzt die Ergebnisse der Blutuntersuchung. Die Entzündungswerte waren vorbildlich hoch. Jetzt war die Sache endgültig klar.
*
Schon auf dem Weg in den Aufwachraum kam ich zu Bewusstsein, war schnell wieder – trotz der Schmerzmittel – bei klarem Kopfe, musste dort aber noch eine Zeit lang liegen. Überprüfung der Stabilität des Kreislaufs, des Blutdrucks, des Pulses. Das Übliche nach einer Operation. Ich lag da mit drei anderen Patienten, die ich nur hören konnte. Den Kopf oder gar den Oberkörper etwas anzuheben, um besser sehen zu können, verbot sich mir radikal – beim ersten Versuch und bei vielen anderen Bewegungen in den nächsten zwei, drei Tagen merkte ich erst, und zwar oft sehr schmerzhaft, in wie viele Bewegungsabläufe die Bauchmuskulatur involviert ist. Inklusive Husten, Räuspern, Niesen. Das Zweitschlimmste war, aus dem Liegen aufzustehen. Das Schlimmste beim Stuhlgang zu drücken. Also ließ man es sein. Was nicht ohne Druck ans Tageslicht wollte, blieb halt in den Katakomben des Gedärms. Selbst schuld.
Zwei der drei anderen Patienten im Aufwachraum sagten nichts oder kaum etwas. Dafür der dritte umso mehr. Und zwar immer das Gleiche in nur kurzen Zeitabständen. Von der Stimme her eine sehr alte Frau. Sie rief immer wieder nach dem Pfleger. Sie wolle jetzt nach Hause. Wo denn ihre Sachen seien, sie wolle sich anziehen. Der freundliche Pfleger, ein junger Mann, erklärte ihr einfühlsam, dass das nicht möglich sei. Sie sei eben operiert worden. Es würde noch einige Zeit dauern, bis sie wieder nach Hause könne. Das ging so drei, vier Mal. Immer wieder das gleiche Prozedere. Der Pfleger blieb tapfer und freundlich, bis die alte, nicht wenig verwirrte Frau auf ihre Station gebracht wurde.
Ich wurde als Letzter auf die OP-Station gebracht – auf den, wie sich herausstellte, letzten Stellplatz im letzten nicht voll belegten Zimmer. Es war inzwischen schon dunkel. Nur am Kopfende meines Stellplatzes brannte ein schwaches Licht. Der andere Patient im Bett gegenüber schlief wohl schon. Man wollte ihn nicht stören. Die Pflegerin und der Pfleger, die mich reingeschoben hatten, erklärten mir alles mit sanfter Stimme, auf welchen Knopf ich drücken müsse, falls ich Hilfe brauche. Man verabschiedete sich und wünschte mir eine gute Nacht.
Ich ließ das schwache Licht noch etwas brennen, um mich zu orientieren. Den Kopf oder gar Oberkörper anzuheben, war noch immer kaum möglich. So sah ich mein Gegenüber nur schemenhaft, ein großer Hügel am entgegengesetzten Horizont. Der Mann musste eine mächtige Person sein. Die Bettdecke war heftig gewölbt, irgendwo dahinter verbarg sich der Kopf des Mannes, für mich nicht zu sehen. Ich hörte mal etwas rascheln, mal ein Geräusch, das beim Herausziehen einer metallenen Schublade aus einem metallenen Beistelltisch entsteht.
Was ich vor allem aber hörte, waren nicht wenig laute Brumm- und Vibrationsgeräusche in drei verschiedenen Klanghöhen und Lautstärken, jeweils kurze Pausen dazwischen, aber ohne Ende der Abfolge. Ich hatte keine Ahnung, welches Gerät diese sehr störenden Geräusche verursachte. Wohl irgendeines, das das Überleben des Mannes ermöglichte. Ein Beatmungsgerät vielleicht. Was auch immer.
Aber nein, es war der Be- und Entlüftungsmechanismus einer speziellen Matratze, die bei langfristig Bettlägerigen einen Dekubitus verhindern soll – das Wundliegen. Ein Beatmungsgerät also nicht für den Mann, sondern für die Matratze, auf der er lag. Das erzählte mir, ganz leise, nahe an meinem Ohr, ein junger Pfleger, der für den Nachtdienst eingeteilt war, nachdem er eine letzte Runde auf der gesamten Station gedreht hatte, um alle zu fragen, ob sie vor dem Schlafen noch etwas bräuchten. Ob man dieses Teil nicht zumindest in der Nacht ausschalten könne, fragte ich ihn. Nein, das ginge nicht. Beim Bettlägerigen drohe sonst Dekubitus oder gar eine Thrombose.
Prima, dachte ich mir, das wird eine tolle Nacht, Schmerzen im Bauch, Schmerzen in den Ohren und wohl bald auch Schmerzen im überdrehten, übernächtigten Kopf.
Aber das war nur das Präludium, wie sich herausstellte. Kaum war der Pfleger entschwunden, schlief mein Gegenüber ein, am beginnenden heftigen Schnarchen zu hören. Ein Schnarchen, wie ich es kaum je gehört hatte, mir nur bei einem Nilpferd vorstellen konnte. Und vor allem das Schnarchen eines Apnoikers, eines Menschen, der nach dem Einschlafen regelmäßig Atmungsaussetzer hat. Bis zu einer Minute – ich zählte die Sekunden bald qualvoll mit. Dann die kurzfristige Erlösung: heftigstes lautstarkes Schnappen nach Luft, Röcheln, Pfeifen, Schmatzen, Stöhnen, Lamentieren, Wortfragmente ausstoßend, Arme um sich werfend, oft lauter, wohl schmerzhafter Kontakt mit Bettkante oder Beistelltisch, danach wieder wenige Minuten sehr lautes, aber halbwegs normales Schnarchen – schließlich ein neuer Zyklus. Ein neuer Atemstillstand. Sekunde um Sekunde. Eins, zwei, drei, vier – achtundvierzig, neunundvierzig, fünfzig, einundfünfzig. Ich wusste nicht, wovor ich mehr Angst hatte: dass der im Fünf-Minuten-Takt um sein Leben Kämpfende gleich stirbt – oder ich. Es war unerträglich.
Ich kannte das Phänomen der Schlafapnoe bislang nur aus Fachzeitschriften. Und ich hatte mal in einer Wissenschaftssendung kurze, sehr kurze Zusammenfassungen eines Zyklus zwischen zwei Atemaussetzern gesehen, aufgenommen in einem Schlaflabor. Schon dem beizuwohnen, war kaum auszuhalten. Man litt mit, man konnte kaum hinsehen und -hören. Und ich erlebte es zwei Nächte nacheinander live – ohne Zusammenfassung. In extenso. Nachdem ich die Nacht vor meiner Selbsteinweisung in die Notaufnahme auch schon nicht geschlafen hatte.
Am nächsten Tag erfuhr ich von verschiedenen Seiten die ganze Geschichte des armen alten Mannes im Bett mit der Spezialmatratze: knapp achtzig Jahre alt, einhundertsechzig Kilo schwer, seit fünf Jahren querschnittsgelähmt nach einer misslungenen Operation an der Wirbelsäule, seit drei Wochen im Krankenhaus aufgrund einer Operation am offenen Bein. Eine Wunde, die nicht heilen wollte. Erst gar nicht. Dann nur langsam.
*
Am ersten Morgen nach meiner Operation kam die Frau des armen Mannes zu Besuch. Selbst, wie ich erfuhr, dauerhaft gehbehindert, auf eine Krücke angewiesen. Anfang, Mitte siebzig schätzte ich die Frau. Jovial, redselig, sehr um ihren Mann bemüht. Sie unterhielt sich mit ihm, als ob ich gar nicht anwesend wäre. So erfuhr ich alles. Wirklich alles. Über ihren Mann und über sie. Daten- und Patientenschutz waren neumodische Dinge, von denen diese alten Leutchen nichts wussten, nichts ahnten.
Später kam noch eine – die heißen heutzutage wirklich so – Wundmanagerin hinzu, die sich um das offene, so langsam dann doch wieder halbwegs geheilte Bein des alten Mannes kümmerte, und kurz darauf eine normale Krankenschwester, um den alten Mann zu pflegen, zu waschen, die Beutel mit den Exkrementen zu wechseln. Die eine meinte – in nasalem, einen grippalen Infekt indizierenden Tonfall – zur anderen, dass sie doch recht nasal klinge. Ja, meinte die andere, das könne sie aber nur stante pede zurückgeben. Beide, stellte sich heraus, kämpften seit Tagen mit einer Erkältung, schleppten sich aber zu Arbeit, weil sie ihre Kolleginnen und Kollegen nicht im Stich lassen wollten – die wegen Arbeitsüberlastung aufgrund personeller Unterausstattung so und so schon auf dem letzten Loch pfiffen.
So erlebte ich live, was ich über Jahrzehnte aus den Medien und aus Fachzeitschriften so und so schon wusste, aber zum Glück nur gelegentlich, etwa beim Erbitten und Erbetteln eines Facharzttermins, selbst hautnah erleben musste: In einem kranken Gesundheitssystem, kaputtgespart in Jahrzehnten des neoliberalen Privatisierungsfurors zugunsten maximaler Profitsteigerung, müssen zwei selbst kranke Krankenschwestern einen noch schwerer erkrankten Menschen pflegen – einen alten, schwer übergewichtigen, querschnittsgelähmten Mann, der am gleichen Tag wie ich nach Hause entlassen wurde. Dort gepflegt von seiner gehbehinderten Frau, jeden zweiten Tag kurze Zeit unterstützt von einer – höchstwahrscheinlich weiblichen – Pflegekraft von der Sozialstation. Die Einstufung in eine Pflegestufe, die ihm eine ganztägige Rundumpflege ermöglicht hätte, wurde dem armen alten Mann nämlich verweigert.
Wohlgemerkt: Ich selbst konnte nicht meckern. Nur viereinhalb Stunden nach meiner Selbsteinweisung in die Notaufnahme wurde ich operiert, schon zwei Tage später aus dem Krankenhaus entlassen. Alles, von der kleinen Kalamität mit der Schlafapnoe meines Nachbarn abgesehen, lief perfekt. Aber nur, weil sich Engel in weißen, hellblauen oder hellgrünen Kitteln aufopferungsvoll um mich gekümmert hatten. Engel, die verhindern, dass wir nicht unnötig früh selbst zu Engeln werden – ohne weiße, hellblaue oder hellgrüne Kittel. Oder gelegentlich auch zur Hölle fahren.
_______________
„Unter den Blinden“
Wer die schelmische, wenn nicht sarkastische bis böse Bezeichnung „Café unter den Blinden“ für das „Café unter den Linden“ in die Welt gesetzt hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall trifft sie in metaphorischem Sinne die Wirklichkeit, zumindest gelegentlich. Es verhält sich nämlich so, dass das „UdL“, wie unter Insidern abgekürzt wird, zu den wenigen verbliebenen Cafés gehört, die ihren Gästen eine sehr gute Auswahl von Zeitungen und Magazinen anbieten. Und die werden natürlich gelesen. Nachmittags beim Kaffeetrinken oder abends beim Feierabendbier oder einem Gläschen Wein. Manche bringen auch Bücher mit, Romane, die sie gerade lesen, oder auch, wie ich in der Regel, eine Fachzeitschrift, die es im Café nicht gibt. Viele Gäste sind also in ihrer Lektüre vertieft und erst mal unzugänglich für das, was um sie herum geschieht – sie sind also in einer bestimmten Weise blind, nehmen das soziale Leben, das sich links und rechts von ihnen abspielt, oft nicht wahr.
Früher war das übrigens noch weit schlimmer als in den letzten Jahren. Ich selbst bin seit fast vier Jahrzehnten Gast im UdL, gehöre also quasi schon zum Mobiliar. Mit der Entwicklung des Schanzenviertels, an dessen Rand das UdL liegt und ich wohne, von einem ehemals ganz normalen Hamburger Stadtteil zu einem Szeneviertel, einer Amüsiermeile, hat sich auch das Publikum des UdL etwas geändert. Es ist jünger geworden und greift nicht mehr so häufig zur Süddeutschen oder FAZ wie das ältere. Prollige, zumindest akustisch krawallige Kundschaft, die vor allem am Wochenende, zum Glück nur in Maßen, am Schulterblatt, der Hauptamüsiertrasse des Viertels, auftaucht, meidet das UdL dankenswerterweise nach wie vor. Aber es gab und gibt über die Jahre mehr und mehr junge Leute, oft in größeren Gruppen, die selbst im UdL dazu tendieren, sich zu unterhalten. Und womöglich sogar mal zu lachen. Obendrein etwas lauter. Im Extremfall.
Eine interessante bis amüsante Entwicklung ist auch, dass ein harter Kern alt eingesessener Gäste im Laufe der Zeit, man munkelt, immer älter wird – selbst mir passiert so was –, der Großteil der Bedienungen aber jung und frisch bleibt. Er setzt sich, von wenigen altgedienten Ausnahmen abgesehen, nämlich oft aus Studierenden zusammen, die im UdL jobben, um sich ihr Studium mitzufinanzieren. So sieht man diese jungen Menschen einige Jahre. Freundet sich gelegentlich sogar etwas an. Freut sich, wenn man sich sieht. Und dann sind sie plötzlich wieder weg. Das Studium ist zu Ende, und der erste Job fand sich beispielsweise in Berlin. Viele, die in Hamburg blieben, kommen nach ihrer Zeit als Jobber aber immer wieder auch als Gäste ins UdL zurück. Die Aktiven und die Ehemaligen bilden eine kleine Familie, hier und da auch zusammen mit langjährigen Gästen.
Weil nun viele der alteingesessenen Gäste zu den, siehe oben, sozial Blinden gehören, dauerte und dauert es gelegentlich lange Jahre, bis man sich, wenn überhaupt, nicht nur optisch wahrnimmt. Man nickt dann, nach nicht selten einem Jahrzehnt der Karenz, freundlich zum Gruße, setzt sich – und fängt an zu lesen. Ende der Kommunikation. Oft ist der Anlass, dass man sich erstmals anspricht, der Umstand, dass alle Tische im UdL besetzt sind, an manchen aber nur ein Lesender sitzt, den man dann also tollkühn fragt, ob man sich dazusetzen dürfe. Ganz leise natürlich. Und nur zum Lesen. Man darf fast immer.
Wenige Ausnahmen habe ich über die langen Jahre nur bei zuvor nie gesehenen Fremdlingen, Touristen etwa, erlebt, die hier und da reagierten, wie wenn man ihnen einen unsittlichen Antrag gemacht hätte oder Drogen verkaufen wollte. Zwei junge Damen etwa reagierten einmal auf meine Frage mit eisernem Schweigen. Aber sie antworteten nonverbal recht wortreich. Sie sahen sich und dann mich konsterniert bis empört an und bekamen leicht rote Backen. Ich entschuldigte mich gestisch und mimisch, inklusive leichtem Kotau, und suchte einen weiter entfernten anderen Tisch auf, einen, an dem nur eine Person, ein Mann, ein Lesender saß.
Der schmunzelte mich nach meiner Frage an: „Klar!“ Und legte gleich nach: „Die Mädels in diesem Alter sind gelegentlich doch recht wundersam.“ Er musste die Szene also mitbekommen haben. Von wegen sozial blind! Nun, ich zog meine Fachzeitschrift raus und wir beide beugten uns über unsere Lektüre.