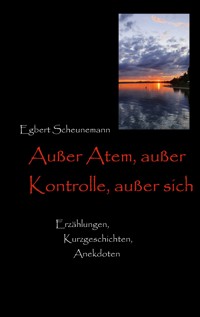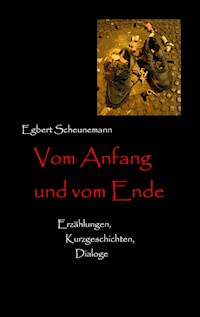Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In unserer hochkomplexen Welt kann man schon mal die Orientierung verlieren. Und wie ein komischer Kauz mal gesagt hat: Es kommt erstens meistens anders, als man zweitens denkt. In dieser kleinen Anthologie von Kurzgeschichten, Erzählungen, Anekdoten und einem Dialog finden sich einige Beispiele für charmanten Orientierungsverlust, amüsanten bis schmerzhaften Traditionsbruch, ungewollte Trennungen, aber auch eine unverhoffte erneute Kreuzung von Lebenswegen - mehr als ein halbes Menschenleben später. Hier und da bleiben Beulen am Kopf zurück oder auch Tränen der Trauer - aber zum Glück auch der Freude.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Prolog
Heute kein Lecks!
Bist Du der Michi?
Mail aus Belgien
In Stein am Rhein fließt die Donau in den Tegernsee
Der Fleck, das Loch, der Klaus, die Nichte und das Wermutkraut, die Visitenkarte
Neulich beim Altern
Wie sehr muss ich Dich lieben, meine Muse, dass ich so um Dich kämpfe?
Honniauit. Sellkaitsi!
Der kleine Supermarkt
Der Wurm, der Horror und der Staubsauger
Bier trinken in Istanbul
Der Schwur
Prolog
Dies ist meine vierte Sammlung von Kurzgeschichten, Erzählungen, Anekdoten und einem Dialog. In den Vorworten der bisher erschienenen drei Bände habe ich immer wieder damit kokettiert, Sie, liebe Leserinnen und Leser, etwas an der Nase herumzuführen mit der Frage, welche der geschilderten Geschichten der Realität entsprechen, welche nur teilweise und welche frei erfunden sind.
Nun, hier sei nicht kokettiert, sondern freiumwunden festgestellt: Der Realitätsgrad der elf Geschichten und des abschließenden Dialogs, die ich hier publiziere, ist massiv gestiegen – eine nicht geplante, aber post festum eben festzustellende Entwicklung, die wahrscheinlich vor allem dadurch zu erklären ist, dass die immer verrückter werdende Realität immer mehr lustige Vorlagen, schräge Anregungen und hier und da auch bittere Anlässe bietet. Man muss nur hinsehen. Nur Zeitung lesen. Seine Mitmenschen beobachten – und auch sich selbst.
Wahrscheinlich haben Sie mindestens genauso viele schräge, verrückte, amüsante oder auch kranke Geschichten in ihrem Leben erlebt wie ich – aber ich alter Schreibtischtäter tendiere wohl berufsbedingt, wenn nicht berufskrankheitsbedingt dazu, sehr viel schneller als Sie zur Feder, wenn nicht Tastatur zu greifen. Ich bin nun mal ein sozial eingestellter Mensch – an irren, lustigen, amüsanten, schrägen, extravaganten bis höchst unwahrscheinlichen, aber auch nachdenklich stimmenden Erlebnissen und Vorkommnissen lasse ich Sie doch gerne partizipieren. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Geteilte Freude ist doppelte Freunde.
_______________
Heute kein Lecks!
Die Macht der Gewohnheit. Ein ausgelutschtes Sprichwort. Abgeschmackt. Kennt jeder. Nicht der Rede wert. Aber sie treibt immer wieder neue Blüten.
Ich wurde mal wach von einem lauten Knall. Es klang wie Kopf auf Holzbrett. Und es war Kopf auf Holzbrett. Meine damalige Freundin sprang morgens, noch im Halbdämmer – was den Stand der Sonne betrifft wie auch den Zustand in ihrem noch schlaftrunkenen Kopf – aus dem Bett. Nur stand da, auf ihrer rechten Bettseite am Kopfende, seit gestern ein Kleiderschrank, der einen Tag davor noch nicht da stand. Meine Freundin, der Rückprall erleichterte es ihr ganz wesentlich, legte sich spontan wieder hin. Ich diagnostizierte, nun selbst hellwach, eine kleine Beule auf ihrer Stirn. Kaum der Rede wert. Nachdem der erste Schreck verflogen war, musste sie, also meine Freundin, lauthals lachen. Ich auch.
In meiner Stammkneipe, einer Taverne meiner Wahl, bestelle ich seit Jahrzehnten das Gleiche – ein Bier. Ein kleines Lecks in der Flasche. Gelegentlich auch zwei, wenn nicht – selten – tollkühn drei. Also nacheinander. Oft muss ich gar nichts bestellen, sondern das erste Lecks wird mir einfach auf den Tisch gestellt, noch bevor ich die Jacke ausgezogen habe und auf meinem Stuhl sitze. Top Service halt.
Und wie das so ist mit langjährigen Gewohnheiten, sie können, wenn man nicht aufpasst, zu Beulen am, wenn nicht Hohlräumen im Kopf oder auch zur Leberzirrhose führen. Nicht weil ein Blutwert beim letzten Test nicht hervorragend gewesen wäre, aus der Reihe getanzt hätte, gar massiv erhöht gewesen wäre – nein, ich wollte einfach so, prophylaktisch, wohl auch als kathartische Prüfung, ob ich noch Herr meiner selbst bin, eine kleine Alkoholpause einlegen. Man, samt Hirn und Leber, kommt ja ins Alter. Man kann nie wissen. Letztlich. Wenn der Tatter erst mal anfängt, die Gedächtnislücken größer und häufiger werden, ist es meist schon zu spät. Mit der alters- wie alkoholbedingten Verblödung ist es ganz ähnlich: In der ersten Phase merkt man sie nur selbst, in der zweiten auch die anderen, in der dritten nur noch die anderen. Das sagte mal ein schlauer Mensch. Wohl einer vom Fach. Seinen Namen habe ich gerade vergessen.
Neulich bestellte ich beim Griechen meiner Wahl also kein übliches Lecks, sondern ein alkoholfreies Hefeweizen. Es trug sich wie folgt zu und hatte Folgendes zur Folge: Konstantinos, einer der Kellner, stand direkt hinter dem Eingang. Zu meinem Glück. Ich konnte also gleich, bevor bestimmte Routinen ihren unheilvollen Lauf nehmen würden, meinen extravaganten Wunsch äußern: Heute bitte kein Lecks! Konstantinos guckte mich groß an, wandte sich zum einige Meter entfernten Tresen und rief, zum Glück auf Griechisch: Heute kein Lecks für Albert! Janni hinterm Tresen hatte mich erfreulicherweise bis dahin noch nicht gesehen, also noch kein Lecks aus dem Kühlschrank geholt oder gar schon geöffnet. Nun starrte er, sichtlich konsterniert und leicht verwirrt, in meine Richtung.
Gleich darauf kam Manolis, ein weiterer Kellner, aus der entgegengesetzten Richtung auf mich zu und sah mich sorgenvoll an. Ich erklärte ihm kurz die neue, verwirrende Situation. Und unmittelbar danach tauchte hinterm Tresen Leonidas auf, der Wirt – und zwar in des Wortes ganz direkter Bedeutung: Er hatte wohl in gebückter, hockender Haltung einen Kühlschrank aufgefüllt, die Sache aber akustisch mitbekommen: Mensch Albert, kein Lecks, was ist denn los? Nicht wenig – ich stand ja noch immer am Eingang, also etwas entfernt – lautstark artikuliert. Diesmal auf Deutsch. Links und rechts Publikum. Ich machte besänftigende Handbewegungen in alle Richtungen und meinte, dass ich selbst in meinem Alter zu Innovationen tendiere. Zustimmendes Nicken und Schmunzeln von allen Seiten. Inklusive Publikum. Ich setzte mich. Mein alkoholfreies Hefeweizen kam. Dann lief alles seinen gewohnten Gang.
Nur beim Zahlen am Tresen, ich hatte später auch noch eine kleine Flasche Lecks alkoholfrei bestellt, musste Leonidas sichtlich rechnen und schließlich aufs Display der Kasse gucken, um der neuen Preisgestaltung folgen zu können. Ich hatte zwar die Rechnung mit dem Wirt gemacht, aber mit meiner Unberechenbarkeit, meinem Bruch alter Gewohnheiten, hatte er wohl nicht gerechnet.
_______________
Bist Du der Michi?
Ich war noch ganz neu in Hamburg. Ende der 1970er-Jahre. Auf der Suche nach fast allem. Neue Freundin, neue Freunde, Wohnung, Studienplatz, Nebenjob. Und eine neue Band. Als Schlagzeuger.
Schon eine erste Anzeige in einem Stadtmagazin hatte Erfolg. Ein Michi hatte sich gemeldet per Telefon – Internet, E-Mails oder gar Smartphones gab es damals noch nicht. Man sei ein Quintett. Eigentlich. Nur sei der Schlagzeuger abhandengekommen. Man spiele Jazz, Jazzrock, Funk, Latin. Fusion halt. Die Besetzung der Band sei Bass, Gitarre, Keyboard, Querflöte – und hoffentlich auch bald wieder Schlagzeug. Das alles klang schon mal verheißungsvoll.
Wir verabredeten uns gleich am nächsten Tag zu manierlicher Zeit am S- und U-Bahnhof Sternschanze. Die Gegend dort war mir Hamburger Neuling völlig unbekannt. Ich wohnte damals noch in Barmbek in einer Zweierwohngemeinschaft. Da musste ich in wenigen Monaten raus. Die Mitbewohnerin bekam Nachwuchs. Nicht von mir. Auf jeden Fall brauchte sie bald Platz für den in ihrem Bauch heranwachsenden neuen Erdling. Vielleicht würde ich mit der neuen Band und den neuen Kontakten auch gleich noch eine neue Bleibe finden. Wer weiß.
Der Treffpunkt am Rande des damals noch ganz normalen, biederen, eher langweiligen Schanzenviertels war für mich also irgendwo im fernen Westen Hamburgs – ein nicht ganz kleines Problem für mich Orientierungstrottel, aufgewachsen in einem kleinen Städtchen im ländlichen Süddeutschland.
Aber es klappte alles. Ich kam mit der S-Bahn. Der Bahnhof hat zwar zwei Ausgänge, aber die meisten Passagiere tendierten zu dem in Fahrtrichtung. Das schien der Hauptausgang zu sein. Ich also hinterher. Unten stellte ich mich gleich an die Zubringerstraße, weithin sichtbar und mit Blick in alle Richtungen. Ich war viel zu früh. Man kann ja nie wissen. Michi hatte gesagt, dass er mit einem leuchtend blauen Kastenwagen anrücke, einem R4, zu jener Zeit das Transportmittel schlechthin für junge Leute wie uns. Ich suchte mit den Augen die Zeilen der parkenden Autos ab, sah nichts leuchtend Blaues, konnte am langen Zubringer aber auch nicht alle Fahrzeuge überblicken. Bestimmt war Michi noch gar nicht da.
Oder vielleicht doch? Ein junger Mann meiner Altersklasse stand etwa zehn Meter weiter zu meiner Rechten. In Suchstellung. Wie ich. Ich versuchte mein Glück, ging zu ihm hin, sagte Hallo, ich sei der Hubert, und fragte, ob er der Michi sei. Er schmunzelte, nein, er sei der Robert und warte auf einen Sven. Nein, der sei ich nicht, meinte ich, wünschte viel Glück und ging zu meinem alten Platz zurück.
Eine viertel Stunde passierte nicht viel. Kein Michi. Kein leuchtend blauer Kastenwagen. In meinem Rücken der Haupteingang zur S-Bahn Sternschanze. Rechts von mir, entlang der Zubringerstraße, erstreckte sich das Hochgleis des S-Bahnhofs über mehr als hundert Meter. Am Ende der Ein- und Übergang zur U-Bahn Sternschanze. Ob Michi wohl dort hinten stehen und warten würde? Das Ende der Zubringerstraße schien ein Rondell zu sein. Wendeplatz auch für die Busse, die entlang des Zubringers ihre Haltestellen hatten. Ich beschloss, dort hinzugehen. Michi war inzwischen auch schon einige Zeit zu spät.
Und in der Tat, dort stand ein junger Mann, wiederum meine Altersklasse, langes Haar, wie Michi sich beschrieben hatte. Kaum hatte ich ihn wahrgenommen, sah er mich, ging gleich auf mich zu und fragte, ob ich der Robert sei. Nein, ich sei der Hubert, aber der Robert stünde dort hinten vor dem Eingang zur S-Bahn und erwarte einen Sven. Ja, das sei er, sagte der junge Mann mit dem langen Wallehaar, lachte, bedankte sich für die Vermittlung und entschwand Richtung Robert.
Kurz darauf fuhr dann tatsächlich ein leuchtend blauer Kastenwagen vor und hielt direkt vor mir. Ihm entsprang Michi – wie sich herausstellte. Er ging auf mich zu, fragte leicht skeptisch, ob ich der Hubert sei. Auf meine freundliche Bestätigung wirkte Michi sichtlich erleichtert. Er habe nämlich gerade vorne am Eingang zur S-Bahn einen gefragt, ob er der Hubert sei. Nein, das war der Robert, fiel ich Michi ins Wort. Ob ich den denn kenne, fragte Michi verwundert. Nein, eigentlich nicht, aber ich hätte den Robert vorhin auch gefragt – jedoch, ob er der Michi sei. Es war dann aber eben der Robert, der auf einen Sven gewartet habe. Ja, stimmt, meinte Michi, der sei gerade dazugekommen als er, Michi, Robert gefragt habe, ob er der Hubert sei.
Trotz dieser leichten Wirrungen hatten wir uns also doch noch gefunden, Michi und ich. Jeder Deckel den passenden Topf. Schon auf dem kurzen Weg zum Proberaum von Michi waren wir uns handelseinig. Man wolle es probieren mit der gemeinsamen Band. Das Wichtigste, welche Art Musik man höre und machen wolle, hatte man so und so schon beim ersten Telefonat besprochen.
Der Proberaum – ein großer frei stehender ehemaliger Geräteschuppen – lag im Hinterhof des Häuschens von Michis Eltern, in dem er als frisch immatrikulierter Student noch wohnte. Es stand an einer kleinen schönen Allee am zum Bahnhof entgegengesetzten Ende des Schanzenviertels.
Nun, ab dann ging alles seinen geregelten und sehr erfreulichen Gang. Vor allem für mich. Ich lernte bei der ersten Probe die anderen Bandmitglieder kennen, Hartmut alias Hardy an der Gitarre, Jan-Peter alias Schmiddy am E-Piano und Hartmut alias Flöte, die er auch spielte. Wir hatten also zwei Hartmute, wenn nicht Hartmuts in der Gruppe. Zuordnungsprobleme gab es kaum – weit größer war das Problem unserer Namensfindungsschwäche bezüglich des Gruppennamens. Wir hatten bald schon unseren ersten Auftritt in der Tasche – aber noch keinen Bandnamen. Er sollte etwas Besonderes, Außergewöhnliches, Prägnantes, vielleicht auch Witziges sein. Provokativ womöglich, rebellisch und progressiv – wie man das damals noch nannte. Jugend, studierende vor allem, war nun mal fürs Rebellische zuständig. Zumindest damals noch. Also kam als Bandname auch folgender Vorschlag auf: „Denn sie wissen nicht, was sie tun“. Dieser Vorschlag wurde aber verworfen. Er klang zu sehr nach „Denn sie können nicht, was sie spielen“. Welcher Name es schließlich wurde – das verschweige ich hier lieber aus Gründen der Contenance und des guten Geschmacks.
Wie auch immer: Zwischenzeitlich hatte ich auch ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft mit zwei anderen Jungs in Eppendorf gefunden. Und eine neue Freundin – die Ex eines der beiden Jungs. Sehr praktisch. Da musste ich nicht lange suchen und auf die Piste gehen. Einerseits lag mein neues Domizil in Eppendorf sehr viel näher an meinem neuen Proberaum in besagter kleinen schönen Allee in Nord-Altona – sehr wichtig für einen Schlagzeuger, der ja nicht im Zimmer, in der Wohnung eines Mietshauses üben kann, sondern zu seinem Instrument fahren muss. Und das fast täglich, wenn er besser werden will. Andererseits wohnte meine neue Freundin jedoch – in Barmbek. Von wo ich gerade nach Eppendorf gezogen war. Und da man seine neue Freundin natürlich auch öfter mal sehen mochte, glich sich das wieder aus. Schließlich geschah es bald noch, dass die Mitbewohnerin meiner neuen Freundin aus ihrer gemeinsamen Bleibe auszog und also ihr Zimmer frei wurde – in Barmbek. Nun ja, ich landete ergo wieder – in Barmbek. In Hamburgs Osten.
Es war sehr schön dort mit meiner neuen Freundin. Aber die Musik, wörtlich wie metaphorisch, spielte westlich der Alster, dem See im Herzen Hamburgs. Proberaum, Uni, viele Freunde, angesagte Amüsierviertel – alles im fernen Westen. Und täglich mit dem Rad die weite Strecke zu fahren durch Hamburgs allerliebstes Wetter, also durch viel Regen und gelegentlich auch Schnee, das wusste nicht immer zu gefallen.
Das ging so lange, lange Monate. Bis mir ein altes Doppelhaus auffiel, nur gute hundert Meter entfernt von meinem neuen Proberaum in jener schönen Allee. Es sah schon die ganz Zeit ziemlich heruntergekommen aus und wurde jetzt augenscheinlich entmietet. Wahrscheinlich wurde es bald abgerissen, um Platz für einen Neubau zu schaffen. Mit womöglich einer neuen Wohnung für meine Freundin und mich? Nochmals: nur hundert Meter von meinem Proberaum entfernt. Für einen Schlagzeuger der Himmel, das Eldorado und das Schlaraffenland in einem.
Aber nein, das alte Haus wurde nicht abgerissen, sondern von Grund auf saniert und renoviert. Alles neu, Fenster, Türen, Gastherme für jede Wohnung – sodass man bis auf den letzten Kubikzentimeter faktisch nur das bezahlen musste, was man wirklich verbraucht hatte. Und Gas war damals das Billigste vom Billigen in Sachen Warmwasser und Heizung.
Ich beobachtete den Fortgang der Sanierung sehr genau. Die Telefonnummer der Baufirma, sie prangte auf einem großen Werbeschild vor dem Haus, hatte ich mir schon notiert. Die Firma musste aber nicht identisch sein mit dem Vermieter, dem Eigner, der für die Vermietung zuständigen Hausverwaltung. Irgendwann bin ich also zu einem Handwerker, der gerade aus dem Haus kam. Ob er vielleicht eine Nummer hätte vom Vermieter, bei dem man fragen könne. Er hatte! Eine Oetker-Hausverwaltung war zuständig für die Vermietung.
Nun, das Telefonat am nächsten Tag verlief nicht sonderlich erfreulich. Ich erwischte eine etwas unwirsche ältere Frau, Stimmlage zwei Schachteln Gauloises am Tag, inklusive manch doppeltem Cognac. Die Sanierung sei noch lange nicht fertig, nichts sei spruchreif. Ich solle in acht Wochen noch mal anrufen. Zumindest schaffte ich es noch, ihr meinen Namen und meine Telefonnummer durchzugeben – in der Hoffnung, dass sie diese auch wirklich notieren würde.
Und dann geschah das Wunder. Besagte Unwirsche mit der rauen, tiefen Stimme rief mich an. Nach nur drei Wochen. Kackfreundlich. Ich sei doch an einer Wohnung interessiert? Was es denn sein dürfe: zwei Zimmer, drei Zimmer, vier Zimmer, fünf Zimmer? Im Parterre ohne viele Stufen? Oder schön hell und ruhig unterm Dach? Es sei noch alles frei.
Ähm, ja, also, das sei ja fantastisch und kaum zu glauben – und zwei bis drei Zimmer wären für mich und meine Freundin schon recht passend. Ich war ganz durcheinander. Und was das denn kosten würde? Als mir die von Saula zu Paula Verwandelte die Mietpreise nannte, blieb mir endgültig der Atem weg. Das sei so billig, durchbrach Paula meine Wortlosigkeit, weil das Sozialwohnungen seien. Dafür brauche man zwar einen Berechtigungsschein, aber ich hätte doch gesagt, wir seien Studenten? Dann sei das so und so kein Problem. Und außerdem sei noch die Stelle eines Hausmeisters in Teilzeit zu vergeben, das wäre doch als Nebenverdienst ganz famos für einen Studenten – oder etwa nicht? Wenn wir eine Drei-Zimmer-Wohnung nehmen würden, wäre die dann sozusagen fast mietfrei.
Ich weiß nicht mehr, ob mich meine Freundin nach diesem Telefonat reanimieren musste. Wenn ja, dann hat sie es geschafft. Denn ich lebe in dieser Wohnung, inzwischen solo, seit fast vierzig Jahren. Hundert Meter von meinem Proberaum entfernt. Ruhig und sehr hell im dritten Stock. In einer kleinen Allee. Unweit des zwischenzeitlich tobenden, tosenden Schanzenviertels – für einen soloselbstständigen, also berufsbedingt einsiedlerischen Schreibtischtäter das ideale soziale Umfeld. Und aufgrund der nebenberuflichen, der sehr nebenberuflichen Hausmeisterei zu einem Spottpreis nach wie vor. Eine solche Wohnung gibt man nur in genau drei Fällen auf: Entweder ist man wahnsinnig geworden. Oder man hat mehrere Millionen im Lotto gewonnen. Oder man ist gestorben.
Wenn Sie also mal eine neue Band, neue Freunde samt neuer Freundin und auch noch eine neue, fast mietfreie Wohnung brauchen, dann sollten Sie vor irgendeinem Bahnhof einen offensichtlich Wartenden fragen, ob er der Michi sei. Oder der Robert. Wenn nicht der Sven.
_____________