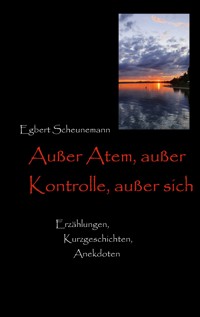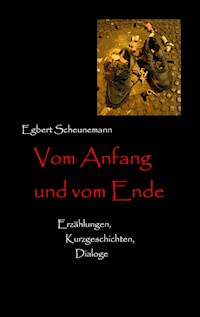Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Leben schreibt gelegentlich Geschichten, so verrückt, schrill und schräge, dass man schnell als peinlicher Aufschneider gilt, wenn man sie erzählt. Viele der Kurzgeschichten und Anekdoten, die sich in diesem kleinen Buche finden, sind von dieser Sorte: Sie schildern eins zu eins reale Erlebnisse - sind aber kaum zu glauben. Die Realität stand auch bei allen anderen Erzählungen Pate, aber hier und da übernahm die Fantasie das Zepter und führte ins Reich dessen, was hätte passieren können ... Man mag sich einen Sport daraus machen, herauszufinden, welche Geschichten das sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 125
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Prolog
Neulich auf dem Rad
Die Fliege
Der Fahrgast
Das Geländer
Der junge BWL-Student
Der Schal
Die Rückkehr
Der Mann an der Tür
Der Impftermin
Die nette Vermieterin
Sokrates
Eine Reise nach Fehmarn
Der Müllmann
Das Konzert
Das Bad im Bodensee
Prolog
Geschichten, die das Leben schrieb – eigentlich eine abgeschmackte Phrase. Aber sie trifft den Kern. Zumindest für einen großen Teil der folgenden Erzählungen, Kurzgeschichten und Anekdoten. Viele schildern eins zu eins reale Erlebnisse, ohne literarische Verfremdung, Überhöhung, sprachstilistisches Schaulaufen, verbalakrobatisches Muskelspiel. Vielleicht fokussiere ich hier und da auf den anekdotischen Kern, hebe die Quintessenz der Story hervor, betone die Pointe. Aber die Realität steht in der Regel im Vordergrund – obwohl das, was ich schildere, erzähle, oft kaum zu glauben ist. Würde man es als Drehbuchvorlage einem Produzenten, einem Regisseur vorlegen – man bekäme es als völlig übertriebene Schmonzette um die Ohren gehauen. Zu Recht – zumindest gemessen an den Maßstäben der Unterhaltungsindustrie. Aber was interessiert die Realität Hollywood?
Den Realitätsgehalt wird man bei einigen Geschichten leicht bemessen können. Sie spielen etwa im Hamburger Schanzenviertel, an dessen Rand ich seit bald vierzig Jahren lebe. Dieser Stadtteil ist mein Dorf, mein Kiez, mein Quartier. Hier wohne ich, hier lebe ich, hier gehör ich hin. Kein Wunder also, dass es die Szenerie abgibt für einige der folgenden Geschichten.
Bei wenigen anderen ließ ich meiner Fantasie mehr oder minder freien Lauf. Auch bei ihnen gab es aber immer reale Anlässe, Anstöße, Motive – so intensive jedoch, dass sie unwillkürlich meine Fantasie anregten, auch Ängste, Befürchtungen, düstere Ahnungen. Und die können handlungsmächtig werden. Mächtig handlungsmächtig. Bis hin zum kollektiven Wahn, der im 20. Jahrhundert Millionen von Menschen das Leben kostete. Oder auch nur bis zur individuellen Selbstvernichtung.
Ich werde Ihnen nicht den Spaß verderben, selbst herauszufinden, was im Folgenden der Realität entspricht und was eher oder nur meiner Fantasie. Vielfach ist die Sache ganz klar, aber eben nicht immer.
Hamburg, im Februar 2022
Egbert Scheunemann
Neulich auf dem Rad
Es war kurz vor Mitternacht, als ich mit dem Rad nach Hause fuhr. Im Olympischen Feuer, meinem Leib-und-Magen-Griechen im Schanzenviertel, hatte ich zwei Feierabendbiere verköstigt. Ich radelte in gemächlichem Tempo, kaum schneller als zehn, zwölf Stundenkilometer, über die Piazza am Schulterblatt, rücksichtsvoll und in gehörigem Abstand um die wenigen Passanten herum, die da noch anzutreffen waren.
Ziemlich genau auf Höhe der Roten Flora, vielleicht schon kurz dahinter, sah ich urplötzlich einen kleinen, wie sich später herausstellte: grau-schwarzen Hund, kaum größer als ein Schuhkarton für Winterstiefel, in grau-schwarzer Nacht von rechts aus einem Pulk zusammengestellter Sitzbänke und Biertische direkt in meine Fahrtrichtung stürmen. Keinen Meterfünfzig entfernt. Ich bremste ebenso reflexartig wie kräftig – und musste feststellen, dass heutige gute Scheibenbremsen ihre Arbeit in ganz hervorragender Weise zu leisten vermögen. Mein Rad kam nach einem Bremsweg von gefühlten fünfzehn Zentimetern und einer knappen halben Sekunde zum Stehen. Meine Körpermasse von etwa fünfundsiebzig Kilogramm hatte aber den nicht ganz unbedeutenden Impuls, im Volksmund auch Wucht oder Schwung genannt, von nahezu zweihundertfünfzig Kilogrammmetern pro Sekunde, also Newtonsekunden – wie ich später ausrechnete. Die Bremskraft, die obwaltete, war also keine ganz geringe. Meine Körpermasse, die Naturgesetze wirken ohne Gnade, erwies sich als artgerecht träge. Weit träger als die vielleicht vierzehn Kilogramm meines Fahrrads, das ja schon stand, wenn nicht lag.
Es trennte sich also meine Körpermasse von der Masse meines Fahrrads – in Fahrtrichtung, zunächst horizontal, dann mehr und mehr vertikal, man spricht in Fachkreisen auch von einer ballistischen Kurve. Während meines Fluges dachte ich mir ebenso fix wie vorausschauend, dass eine Landung auf voller Körperfläche – und nicht etwa zunächst auf einem Ellenbogen, wenn nicht meinem Schädel mit dem Gesicht als Abbremsfläche – die Wucht meines Aufpralls großflächig verteilen würde. Und so geschah es. Ich landete in voller Breite und Länge, Beine und Arme sternförmig ausgestreckt, auf dem Pflaster. Auch mein Rad nahm direkt hinter mir eine vorläufige Ruhestellung ein.
Wäre ich direkt auf dem Hündchen gelandet, hätte sein Körper für mich als Knautschzone fungiert. Korpus und Beinchen des Hündchens wären nicht wenig komprimiert worden, wahrscheinlich mit letalem Ausgang für das arme Tier. Auch für mich wäre es wohl nicht so glimpflich abgelaufen, weil ein großer Teil meiner abzubremsenden Masse konzentriert auf die räumliche Ausdehnung des kleinen Hundes gefallen wäre. Eine merkliche Prellung auf der Kontaktfläche zwischen mir und Hund wäre wohl die Folge gewesen – ich sehe hier aus Gründen der Contenance besser ab von der Schilderung der ganzen Sauerei, die ein blitzschnelles Komprimieren des kleinen Hundes wohl gezeitigt hätte. Also konnten Hund wie ich froh sein, dass ich circa dreißig Zentimeter vor dem konsternierten Tier auf voller Körperfläche zu landen kam. Da waren dann Geschwindigkeit und Impuls wieder null und den Gesetzen der Physik Genüge getan.
Wie es die Umstände also wollten, lag ich kurzfristig direkt vor dem Hund, der mindestens so ruckartig abgebremst hatte wie ich. Wir waren quasi auf Augenhöhe. Er guckte mich verdutzt an, ich ihn nicht minder, und wandte sich dann Hilfe suchend zu seinem Frauchen – wie sich herausstellte. Sie war inzwischen, woher auch immer, herbeigeeilt und wollte mir beim Aufrichten helfen. Ich wuchtete mich nach Art eines Liegestützes hoch, schnellte mit den Beinen zusammen und stand dann, doch etwas verwirrt und verdattert, senkrecht im Dasein. Die Frau, eine sehr schöne zu allem Überfluss, entschuldigte sich tausendfach. Ob mir denn was passiert sei? Fast hätte ich ihr gesagt, nein, ich steige immer so ab. Ich fühlte an mir herum und murmelte, dass ich das erst mal überprüfen müsse. Ich absolvierte Bewegungsübungen mit allen Extremitäten, alles war in Ordnung, nur meine Oberschenkel schienen irgendwie geprellt zu sein – mein Versuch der größtmöglichen Verteilung des Impulses war wohl nicht vollständig geglückt.
Während ich mein Rad untersuchte, die Räder freischwebend rotieren ließ, um zu überprüfen, ob sich eine Unwucht infolge der Wucht eingestellt hatte, hielt ich der jungen schönen Frau einen Vortrag über die Funktionstüchtigkeit heutiger moderner Fahrradbremsen, das Gesetz der Impuls- bzw. Energieerhaltung – und darüber, wie die Beleuchtung kleiner Hunde mittels entsprechend illuminierter Halsbänder verbessert werden könne, um manches Malheur zu verhindern. Der Kleine, inzwischen ganz klein neben seinem Frauchen sitzend, hätte womöglich ganz furchtbar ausgesehen, wenn ich nicht gebremst und er zweihundertfünfzig Newtonsekunden über sich hätte ergehen lassen müssen.
Ich verabschiedete mich und fuhr meiner Wege, nicht ohne skeptisch auf zusammengestellte Bänke und Tische zu meiner Rechten zu achten – und auf kleine grauschwarze Hunde in Schuhkartongröße in grau-schwarzer Nacht.
_______________
Die Fliege
Sie war größer als eine banale Stubenfliege, eher so eine Art Schmeißfliege. Der Klang ihres Fluges glich fast schon einem Brummen, kaum noch einem Summen. Für so ein Exemplar war es eigentlich schon zu kalt draußen – Ende November bei Temperaturen um den Nullpunkt. Sie tauchte zwar eines Tages in meiner Küche auf, aber irgendwo musste sie ja hergekommen sein. Von draußen. Dass sie zu dieser stattlichen Größe in meiner Küche, meiner Wohnung aufgewachsen wäre – das glaubte ich eher nicht. Als kindlich kleines oder jugendlich mittelprächtiges Modell war sie mir nie aufgefallen.
Auf jeden Fall war sie plötzlich da. Ich wollte fast schon zur Tat schreiten und sie plattschlagen. Aber sie nervte nicht so wie die meisten Stubenfliegen – durch Sturzflüge ins Gesichtsfeld, gar noch Kontaktaufnahme mit meiner Nase oder meinen Augen, durch sinnloses Anfliegen gegen die Fensterscheibe, tok, tok, tok, kurze Atempause, dann weiter für zwei, drei Minuten – tok, tok, tok.
Sie war vielmehr sehr zurückhaltend. Lange Stunden nahm ich sie nicht wahr. Dann ging ich in die Küche, griff nach dem Waschen meiner Hände zum Handtuch – und da schwirrte sie wieder an mir vorbei. Ich hatte sie nicht gesehen, wie sie auf dem oder irgendwo hinter dem Handtuch an der Wand saß. In solchen Fällen schlug ich, reflexartig, nicht nach ihr, sondern ich fuchtelte nur vor meinem Gesicht rum. Ebenso reflexartig.
Ich fand sie auch nie auf irgendwelchen Nahrungsmitteln, Obst, Gemüse, Salat, die offen in Schalen lagen, auf dem Tisch, dem Fensterbrett. Was sollte sie auch mit Äpfeln, Orangen oder Tomaten anfangen? Die hatten dicke Schalen. Und dass es zu fauligen Stellen hätte kommen können – das passierte mir selten. Ich habe bis heute keine Ahnung, wovon sich die Fliege ernährte, während sie über einige Tage mein Gast war. Womöglich von irgendwelchen kleinen Essensresten, Krümeln in Ecken oder Ritzen, Wassertropfen im Spülbecken, die für die Fliege so groß waren wie für uns Wassereimer, wenn nicht Fässer.
Wir gewöhnten uns aneinander. Sie kam mir immer näher, blieb zwar auf Distanz, die aber immer kürzer wurde. Ich schlug nicht nach ihr – irgendwann schien sie keine Angst mehr zu haben vor mir. Einmal saß ich am Tisch, aß von meinem Teller, und die Fliege saß fast die ganze Zeit nur eine Handlänge entfernt auf dem Küchentisch. Fast regungslos. Sie näherte sich nicht, schoss nicht auf und stürzte sich nicht auf meinen Teller oder meine Lippen gar. Sie saß einfach da. Und ich ließ sie sitzen. Und ich beobachtete sie. Und sie beobachtete mich.
Ich hatte das Gefühl, dass sie mich – nein, nicht verfolgte, aber dass sie sehr oft auftauchte, wo auch ich war, in der Küche, in meinem Büro, im Bad, in meinem Musikzimmer. Immer auf Distanz. Aber immer da. Fast immer. Nie aufdringlich. Eine höfliche Fliege.
Das ging so einige Tage. Ich fragte mich, wie lange gemeine Stubenfliegen oder Schmeißfliegen eigentlich leben. Wahrscheinlich relativ kurz. Und ich war erstaunt, als ich recherchierte: einige Wochen!
Ich ertappte mich eines Morgens dabei, dass ich mit der Fliege sprach. Ich nannte sie – keine Ahnung, warum – spontan Karl-Gustav. Wobei ich sie ab und zu auch einfach blöde Kuh nannte, wenn sie doch mal nervte, etwa weil sie wie blöd um eine Klemmleuchte in meiner Küche schwirrte – und ein Mal sogar in der Klemmleuchte. Der Trichter der Leuchte wirkte wie ein Schallverstärker, ein Lautsprecher in des Wortes direkter Bedeutung. Karl-Gustav muss mit enormer Geschwindigkeit um die Glühbirne in der Lampe geschwirrt sein. Ich stand an der Ablage meines Spülbeckens, schnippelte mein Gemüse und war zunehmend genervt von dem Getöse, keine dreißig Zentimeter von meinem Kopf entfernt. Irgendwann schaltete ich die Lampe aus, wartete etwas, bis die Birne nicht mehr so heiß war, und guckte in die Lampe – sah aber keine Fliege. Karl-Gustav war wohl entkommen, dachte ich mir zunächst. Sicherheitshalber schraubte ich die Birne jedoch raus – und da flog Karl-Gustav aus der Gewindehalterung, haarscharf an meinem linken Auge vorbei. Ich drehte die Birne erleichtert in ihre Fassung und schaltete die Lampe wieder an. Karl-Gustav lebte noch.
Meine WG mit ihm währte noch einige Tage. Irgendwann war Karl-Gustav nicht mehr da. Er entschwand spurlos und so unverhofft, wie er gekommen war. Aus dem und in das gefühlte Nichts. Meine höfliche Fliege.
_____________
Der Fahrgast
Der Mann starrte aus dem Fenster, er sah sehr angespannt aus. Ich fragte ihn, ob in dem Abteil noch ein Platz frei sei. Nur aus Höflichkeit. Denn es waren noch fünf Plätze frei. Der Mann sah kurz und fahrig hoch, nickte und wandte sich wieder zum Fenster. Ich setzte mich gleich rechts auf den Sitz direkt neben der Schiebetür, meinem Abteilnachbarn diagonal gegenüber, also weitestmöglich entfernt. Alles andere schien mir unschicklich. Der Mann strahlte große Distanziertheit aus. Fast schon eine Art Entrückung. Auf seinem Nebensitz lag ein Aktenkoffer. Der Mann hielt ihn mit seiner rechten Hand fest im Griff, nahezu krampfhaft. Die Adern auf seinem Handrücken waren deutlich zu sehen. Wahrscheinlich war etwas Wertvolles, etwas für den Mann sehr Wichtiges in dem kleinen Koffer.
Ich holte mein Lesezeug aus dem Trolley, hievte ihn dann auf die Ablage und setzte mich. Der Mann warf einen kurzen Blick auf meine Fachzeitschrift und wandte sich wieder ab. Ich zog meine Lesebrille aus der Brusttasche, griff das Heft und fing an, darin zu blättern. Ich hatte es erst vorhin aus dem Briefkasten gezogen und war gespannt auf die Themen.
Während des Blätterns sah ich immer wieder zum Fenster hinaus, also auch in Richtung meines Mitreisenden. Ein Blick in die Ferne, ins entlegene Nichts, erleichterte mir schon immer, mich zu konzentrieren, zu fokussieren. Der Mann saß ungerührt. Er war ein überaus ansehnlicher Mann, ein Herr, südländischer Typ, vielleicht ein Inder, Pakistani oder Perser, dichtes, lockiges, aber kurz gehaltenes Haar, analog sein gepflegter Vollbart, und sehr gut gekleidet. Dunkler Anzug, weißes Hemd, offener Kragen, keine Krawatte. Dunkelbraune Lederhalbschuhe mit feinziselierten Lochmustern. Ich kenne mich in solchen Dingen nicht aus, aber das Outfit des Mannes mit dem Aktenkoffer machte einen sehr edlen, teuren Eindruck. Auch der Aktenkoffer selbst. Womöglich war der Mann ein Geschäftsmann, wenn nicht Diplomat. Unser Zug fuhr nach Berlin.
Nach dem Durchblättern wollte ich zunächst den Artikel über neurobiologische Grundlagen des Denkens und Sprechens lesen – sehr spannend, eines meiner eigenen Themen. Aber ich konnte mich nicht gut konzentrieren. Vielleicht sollte ich einfach eine Weile die Augen schließen. Schlafen konnte ich tagsüber nie, aber allein das Schließen der Augen, auch nur eine viertel Stunde, wirkte auf mich überaus entspannend und erfrischend. Durch keinen Sinneskanal nimmt das Gehirn so viele Informationen auf wie durch das Auge. Nichts entlastet es so sehr wie das Schließen der Augen, die Unterbrechung des optischen Inputs. Ich legte meine Fachzeitschrift beiseite und schloss die Augen.
„Sie sind an Philosophie interessiert?“ Der Mann sah mich mit ernstem, aber auch sehr interessiertem Blick direkt an, als ich meine Augen wieder öffnete, kaum dass ich sie geschlossen hatte. Ich war völlig überrascht, hätte nicht erwartet, dass er mich ansprechen würde – in kristallklarem, völlig akzentfreiem Hochdeutsch mit durchdringender Stimme in basslastigem Timbre.
Ich musste mich erst etwas zurechtsetzen und konzentrieren. „Ja, ist wohl eine alte Berufskrankheit“, sagte ich leicht verlegen und wohl auch etwas augenzwinkernd.
Der Mann schmunzelte ganz kurz, kaum merklich, und wandte sich wieder zum Fenster. Und ohne seinen Blick davon abzuwenden, sprach er in einem ebenso warmen wie leicht spöttischen Ton: „Na, das entschuldigt Sie etwas.“
„Oh Gott, wofür denn?“ Meine Überraschung war kein bisschen gespielt.
„Sie glauben an Gott?“
„Was? Ich? Nein, natürlich nicht.“
„Und warum flehen Sie ihn mit Ihrem ‚Oh Gott!‘ dann an? Und was ist an Unglauben so natürlich?“ Die Stimme des Mannes war jetzt wieder sehr ernst.
„Also, wie soll ich sagen, das sind jetzt eine ganze Menge Themen auf ein Mal.“
„Also der Reihe nach.“ Der Mann sah noch immer zum Fenster raus. „Sie haben mich vorhin die ganze Zeit beobachtet.“
„Wirklich? War mir gar nicht bewusst. Ich habe vielleicht etwas öfter zum Fenster hinausgeschaut, zum fernen Horizont, das hilft mir, mich zu konzentrieren. Ich wollte Sie aber auf keinen Fall belästigen, tut mir leid.“
Der Mann sah noch immer in Richtung der weiten Landschaft und reagierte nicht, sagte nichts.
„Ich will ja nicht aufdringlich oder gar unhöflich sein – aber wie wollen Sie denn mitbekommen haben, dass ich Sie beobachte, wenn Sie selbst die ganze Zeit zum Fenster rausgeschaut haben?“ Ich war auf seine Antwort gespannt.
„Und woher wollen Sie wissen, dass ich die ganze Zeit zum Fenster hinausgeschaut habe, wenn Sie mich nicht die ganze Zeit beobachtet haben?“