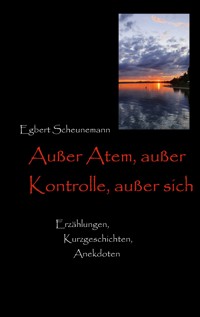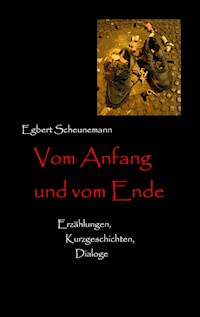Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Anton Stein ist Politikwissenschaftler und Philosoph. Und Wahrheitsfanatiker. Das macht ihn unbeliebt. Als gefürchteter Polemiker hat er sich fast mit dem gesamten Wissenschaftsbetrieb verkracht. Kaum noch ein Verlag publiziert seine Bücher, kaum noch eine Fachzeitschrift druckt seine Artikel. Das Sozialamt ist inzwischen weit öfter sein Aufenthaltsort als die Hamburger Universität, deren Lehrbeauftragter er einmal war. Als er im Hamburger Schanzenviertel eine junge Frau aus dem linksautonomen Spektrum kennenlernt, verändert sich sein Leben radikal. Anton findet sich plötzlich inmitten jener Politik wieder, die er bislang nur als Beobachter von außen betrachtet und analysiert hat. Er verstrickt sich mehr und mehr in eine Geschichte, die ihm zunächst äußerst reizvoll, weil ganz phantastisch und unglaublich erscheint. Schnell aber und immer tiefer steuert sie in ein Geflecht aus manischer Liebe, ökonomischer Macht, politischer Gewalt und ideologischem Irrsinn, das sein Leben immer bedrohlicher umschlingt - und in einer Katastrophe endet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 561
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort zur 2. Auflage
Vorwort zur 3. Auflage
I. Unter den Linden
II. Schanzenviertel
III. David Silbermann
IV. Wissenschaftsrebell
V. Ein langer Abend
VI. Eine lange Nacht
VII. Morgengrauen
VIII. Ein Verdacht
IX. Strategie und Taktik
X. Der Schock
XI. Landeanflug auf Kreta
XII. Loutró
XIII. Das Wesen west
XIV. Die erste Gewissheit
XV. Ekstase
XVI. Literatur über den Wolken
XVII. Die zweite Gewissheit
XVIII. Der Zangengriff
XIX. Das Verlies
XX. Das ewige Licht
XXI. Die Zeitung und das Pferd
XXII. Die Entdeckung der Hölle
XXIII. Der Schrei des Tieres
XXIV. Des Menschen Hirn
XXV. Die letzte Ungewissheit
XXVI. Die Möwe
Vorwort zum Vorwort: Drei Viertel meiner Freunde, die das Manuskript meines Romans „Die Entdeckung der Hölle“ Korrektur gelesen haben, rieten mir davon ab, das unten folgende Vorwort der 2. Auflage meines Romans voranzustellen – man füge, so das schlagende Argument, als Maler seinen Gemälden auch keinen Beipackzettel bei, der erläutere, wie diese zu interpretieren seien. Da ich inzwischen einige Reaktionen auf mein erstes Prosawerk bekommen habe, die mich in meinem anfänglichen Motiv, zumindest zu seiner 2. Auflage ein klärendes Vorwort zu schreiben, eher bestärkten, sei seine Publikation hier zumindest in virtueller Form nachgeholt. (Nachtrag 2025: Das folgende Vorwort zur 2. Auflage war nicht Bestandteil der Druckauflage, sondern stand nur zum Download auf meiner Homepage bereit: www.egbert-scheunemann.de/Vorwort-Die-Entdeckung-der-Hoelle-Roman-Scheunemann-Version-2.pdf)
Hamburg, im Mai 2009
Egbert Scheunemann
Vorwort zur 2. Auflage
Jede Ähnlichkeit der in diesem Roman vorkommenden Figuren mit real existierenden Personen wäre rein zufällig und ist in keiner Weise beabsichtigt.
Solche einleitenden Hinweise – beliebt auch im Filmvorspann effekthaschender Polit- oder Mafiathriller – waren schon immer etwas albern, weil sie in durchsichtiger Weise nur Aufmerksamkeit schinden und natürlich mit dem genauen Gegenteil der Behauptung locken wollen: Liebe Leute, lest dieses Buch, guckt diesen Film an, euer Bedürfnis, Verschwörungstheorien bestätigt oder die bis in die Unterwäsche hinein wahre Geschichte von Politiker X oder Halbweltdame Y serviert zu bekommen, wird aufs Köstlichste befriedigt!
Gewisse Reaktionen – und mit dieser Andeutung soll es sein Bewenden haben – auf die erste, noch ohne klärendes Vorwort erschienene Auflage meines Romans lassen es mich aber in der Tat angeraten erscheinen, in Sachen Authentizität der Charaktere wie der Handlung meines Romans ein paar klärende Worte zu verlieren.
Die Entscheidung, einen realistischen Milieuroman mit politisch nicht wenig brisanter Story und politisch nicht wenig neuralgischen Inhalten zu schreiben, führte mich zur Notwendigkeit, Romanfiguren zu konstruieren, die hochgradig realistisch wirken, aber in keinemFalle einer realen Person, von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens abgesehen, eins zu eins entsprechen. Letzteres verbieten Persönlichkeitsrecht wie Anstand gleichermaßen.
Die Lösung des Problems war naheliegend: Ich nahm einfach meine persönlichkeitsrechtlich völlig unproblematische eigene Person und interessante Menschen aus meinem privaten, politischen und wissenschaftlichen Umfeld, dekonstruierte ihr Äußeres wie ihr charakterliches und intellektuelles Inneres und konstruierte aus den gewonnenen Fragmenten die Figuren meines Romans. Das machte, wie ich gestehen muss, auch einen Heidenspaß, insbesondere im Falle der Konstruktion des Romanprotagonisten Anton Stein aus Fragmenten, die ganz offensichtlich aus meiner eigenen Biografie stammen, aber eben nicht nur. Im Konstruktionsprozess wurde natürlich manches dramatisiert, überakzentuiert, überzeichnet oder auch bewusst unterzeichnet – und weniges wurde aus dramaturgischen Gründen wie aus dem Motiv bewusster Verfremdung heraus frei dazuerfunden.
Ich kann also versichern, dass ich im realen Leben nicht zur Gänze jener zwischen Gefühlsextremen hin und her schwankende, sarkastische, hämische, soziophobe Kotzbrocken bin, der als Anton Stein durchs Leben polemisiert und kein gutes Haar lässt an Politik und Philosophie, am Wissenschafts- und Literaturbetrieb, an Hundehaltern und anderer suspekter Biomasse. Und ich kann vor allem versichern, dass ich niemals selbst die Katastrophe erleben möchte, die über Anton Stein – und nicht nur ihn – hereinbricht.
Welche Fragmente welcher real existierenden Menschen ich zu den anderen Charakteren meines Romans zusammengeschnippelt habe, das bleibt freilich bis ans Ende meiner Tage mein Geheimnis. Ich kann nur wiederholen: Alle Fragmente haben einen realen Background – selbst, wie ich zu meinem großen Glück sagen darf, die Schönheit und manch anderer Vorzug jener jungen Frau, die Anton Stein gleich zu Anfang des Romans kennenlernt.
Noch weit mehr der Realität entsprechen jene Bausteine, aus denen die Handlung des Romans und die Katastrophe, zu der sie führt, konstruiert sind. Sie sind so real und authentisch wie die örtliche Szenerie, das Hamburger Schanzenviertel und einige andere Lokalitäten, in die der Handlungsprozess eingebettet ist. Fiktiv ist allein das Gesamtkonstrukt.
Dies gilt notabene auch für eine zentrale Szene, in der zwischen Anton Stein, dessen Herz eindeutig links schlägt, und einer links orientierten politischen Gruppe eine heftige Diskussion ausbricht zur Frage der Legitimität und des taktisch-strategischen Sinns politischer Gewalt. Sie hat in dieser komprimierten Form real nie stattgefunden. Gleichwohl sind fast alle Argumentations- und Diskussionsfragmente, aus denen sich die Szene bis in den Jargon hinein zusammensetzt, aus Diskussionen authentisch extrahiert, die ich über Jahrzehnte mit Vertretern dieser Gruppe geführt habe, oder auch Flugblättern, Flyern und Texten entnommen, die ich im Hamburger Schanzenviertel über die Jahre immer wieder in die Hände oder via Internet auf den Bildschirm bekommen habe.
Was den Realitätsgehalt der Bausteine, aus denen die gesamte Story konstruiert worden ist, betrifft, könnte und sollte man das Eingangsmotto also fast auf den Kopf stellen:
Jede Ähnlichkeit der in diesem Roman beschriebenen politischen Vorkommnisse mit realen politischen Vorkommnissen ist in keiner Weise zufällig und auf jeden Fall beabsichtigt.
Hamburg, im Januar 2009
Egbert Scheunemann
Vorwort zur 3. Auflage
Eigentlich wollte ich nur etwas nachschlagen – denn auch ich gehöre zu jenen Autoren, die nicht alle ihre Schriften auswendig im Kopfe haben. Als ich dann nach langen Jahren wieder in meinem Erstlingsroman zu lesen begann und immer weiter las und las, war ich baff erstaunt, wie aktuell, ja brandaktuell die Geschichte ist, die er erzählt – die Auseinandersetzungen zwischen Staatsgewalt und Autonomer Szene im Hamburger Schanzenviertel sowie das Erstarken der politischen Rechten und des Faschismus.
2008, als die erste Auflage meines Romans erschien, war in Sachen E-Book noch nicht viel los – man konnte das Buch bislang nur als Print-Version erstehen und lesen. Beide Faktoren zusammen, die Aktualität der Geschichte wie die Möglichkeit, den Roman als E-Book und damit zu einem wesentlich geringeren Preis publizieren zu können, ließen mich auf die Idee kommen, das Epos neu herauszugeben – eben auch und vor allem in virtueller Form. Zumal ich viele Menschen kenne, die Bücher, Periodika oder welche Texte auch immer eigentlich nur noch in digitalisierter Form kaufen und lesen. Wie ich.
Das Wiedererstarken der politischen Rechten und des Faschismus – nur ein anderes Wort für Die Entdeckung der Hölle …
Hamburg, im Dezember 2024
Egbert Scheunemann
Der Wahrheit,
der Freiheit,
der Lust!
I. Unter den Linden
Der Kaffee war vortrefflich wie immer. Feinster Schaum, kein Espresso, normaler Kaffee, aber puderfein gemahlen durch die Maschine gepresst. Wenn er nachmittags draußen im Café Unter den Linden saß, bestellte er immer eine Tasse Kaffee. Ganz gewöhnlichen Kaffee mit einem großen Glas Leitungswasser. Keinen Latte macchiato oder anderen modischen Firlefanz. Sobald etwas in Mode kam, kulinarisch, musikalisch oder was die Garderobe betrifft, verweigerte er sich. Störrisch fast. Weil er sich sonst vorkomme wie ein Stück Herdenvieh, sagte er sich immer wieder. Und anderen, wenn sie’s hören wollten.
Als er vor ein paar Jahren im Hamburger Universitätsviertel im Café Backwahn saß, in dem er früher, als er noch Arbeit hatte, regelmäßig, und zwar köstlichst, zu Mittag aß, fragte ihn die Bedienung nach dem Essen, ob er auch einen Latte wolle, nachdem am Tisch dicht nebenan drei jüngere, gut aufgelegte Damen reihum einen bestellt hatten. Nein, gab er spontan und leicht hämisch zurück, er habe morgens schon eine Latte gehabt. Jetzt tät’s auch ein Espresso. Wie immer halt.
Kaum ausgesprochen, bereute er seine Worte. Aber er kannte die Bedienung, die gerade vor ihm stand, zum Glück seit Jahren. Ein junger, freundlicher, intelligent aussehender Mann, der wohl sein Studium durch Kellnern finanzierte. Er kicherte verschmitzt. Die drei gut aufgelegten jungen Damen gleich nebenan hatten zum Glück nichts gehört. Oder sie überspielten es perfekt.
Zu Hause zuckerte er seinen Kaffee nie. Nur wenn er im Süden war, im Urlaub, in Griechenland etwa, wie so oft. Da passte das: kräftiger Kaffee, klein, stark und zuckersüß. Und wenn er draußen im Unter den Linden unter den Linden saß, da passte das auch. Nicht zu zurückhaltend Zucker und einen wohldosierten Schuss Milch. Das Ergebnis rehbraun. Wunderbar. Anregung für den Schädel, für die zweite der in der Regel drei täglichen Lesesitzungen.
Wenn es das Wetter zuließ, saß er eigentlich jeden Tag nachmittags ein, zwei Stunden zum Schmökern in seinem Stammcafé. Dem Klimawandel sei Dank, war das inzwischen fast ganzjährig möglich – im ehemals verregneten, nasskalten Hamburg. Im Winter natürlich dick eingepackt und in Decken gewickelt, die zum Service des Cafés gehören. Auch wenn es regnete, konnte er unter der Markise auf der Terrasse sitzen. Allein fand er eigentlich immer einen Platz, auch am Wochenende, wenn es voll und eng war, oder wenn es zu regnen anfing und alles nach drinnen stürzte oder unter das schützende Vordach kroch.
Auch an jenem Tag, dessen Folgen sein ganzes Leben ändern sollten, setzte er sich vorsorglich unter die Markise. Dicke schwarze Wolken hingen am Himmel. Es war unglaublich warm für die Jahreszeit. Das erste Wärmegewitter des Jahres schien sich zusammenzubrauen – wenige Tage nach Ostern.
Er nahm es gelassen bis sarkastisch. Seine Doktorarbeit und Habilitationsschrift hatte er zum Thema Demokratisierung, Humanisierung und Ökologisierung der Industriegesellschaft geschrieben. Berge von Literatur hatte er über Jahre gewälzt, um Wege zu einer ökologisch und sozial nachhaltigen Ökonomie und Gesellschaft aufzufinden und aufzuzeigen. In zwei dicken Bänden hatte er sie ausformuliert, insgesamt über 1300 Seiten stark. Das eine Buch erschien vor siebzehn Jahren, das andere vor zwölf, beide ebenso inhaltlich hochwissenschaftlich wie formal, hier und da zumindest, polemisch formuliert. Deswegen von vielleicht hundert Menschen gelesen – weltweit – und ansonsten ignoriert.
Inzwischen schwätzten alle vom Klimawandel, in Politik und Medien, im Bekanntenkreis und selbst am Biertisch. Er blinzelte mürrisch bis höhnisch zum Himmel. Stolz war er nicht auf das Eintreten seiner und so vieler anderer Kritiker Warnungen und Prophezeiungen. Aber egal, sagte er sich. Sein Thema war das nur noch am Rande. Er hielt sich selbstverständlich auf dem Laufenden. Die Lektüre entsprechender Artikel in Fachzeitschriften und allgemeiner Presse war Pflicht. Und hier und da ein Buch zum Thema, immer wieder. Aber etwas wirklich Neues las er nur noch selten. Deswegen hatte er sich in den letzten Jahren auf ganz andere Probleme gestürzt, auf Themen, die ihn schon immer interessierten – Naturphilosophie, Theoretische Physik, Sprachphilosophie, Erkenntnistheorie. Und Musik natürlich.
Und leider auch auf die reale Politik. Fast drei Jahre engagierte er sich mit aller Kraft in der Neuen Linken. Die hatte sich 2004 gegründet, weil es eine parteipolitische Alternative zum neoliberalen, kapitalhörigen Mainstream der etablierten Parteien in Deutschland nicht mehr gab. Weil es eine Sozialdemokratie, die ihren Namen verdient, nicht mehr gab. Und weil sich die ehemals systemkritischen Umweltbewegten, sobald sie Partei geworden und in Regierungen eingetreten waren, in eine angepasste Mitläufertruppe verwandelt hatten. Richtig wütend konnte er werden, wenn er daran dachte, dass er lange Jahre daran gearbeitet und dafür geschrieben hatte, dass es zu einem Bündnis der alten Arbeiterbewegung mit den neuen sozialen Bewegungen kommt, dass sich die soziale Problematik mit der ökologischen verbindet und sich in humaner und naturverträglicher Weise löst. Vom Ökosozialismus gar hatte er mit anderen schwadroniert.
Dann machten 1998 die Roten und die Grünen in der Tat gemeinsame Sache – und Sozialleistungskürzungen, wachsende Arbeitslosigkeit und Armut und Steuergeschenke über Steuergeschenke für die Reichen waren das Ergebnis.
„Ist bei ihnen noch ein Platz frei?“
Er las gerade seinen jüngsten Artikel Korrektur, in dem er der Neuen Linken vorwarf, einen Anpassungskurs an den etablierten politischen Mainstream in fünfzehn Monaten durchgezogen zu haben, für den die Ökogrünen immerhin fünfzehn Jahre gebraucht hatten.
Als er realisierte, dass er angesprochen worden war, zog er sein Papier beiseite – und sah zunächst Springerstiefel. Als er den Blick nach oben richtete, lächelte ihn eine junge Frau an, eine Art Punkerin, vielleicht auch eine Gruftesse. So schnell konnte er das nicht einschätzen. Er muss auf jeden Fall etwas verdattert ausgesehen haben, denn die junge Frau wiederholte:
„Entschuldigung, ist hier noch ein Platz frei?“
Er schaute sie noch immer leicht abwesend und fast entgeistert an. Im Hamburger Schanzenviertel, in dem er seit gut zwanzig Jahren lebte, hatte er permanent Kontakt mit Punkern, Autonomen und Gruftis. Das war nichts Neues. Aber irgendetwas hatte diese junge Frau an sich, das anders war. Sie sah aus wie eine, nun, wie sollte er sagen: Edelpunkerin vielleicht – regelrecht gestylt und eigenwillig, aber ausnehmend gut und geschmackvoll gekleidet.
Und sie war ungemein schön, wie er langsam erfasste: südländisches, schmales, ebenmäßiges Gesicht, fast einer Pharaonin gleich, die Haare mit einem breiten, schwarzen Tuch turbanartig noch oben und hinten gebunden.
Die junge Frau musste inzwischen etwas schmunzeln. Ihre dunklen, fast schwarzen Augen wurden immer größer, ihr Blick immer erwartungsvoller.
„Unbedingt!“ Er stieß es hervor wie verbales Strammstehen. „Bitteschön!“
Er rückte seinen Stuhl etwas zurück, sodass er nun mit dem Rücken direkt zur Wand saß. Gleichzeitig schob er ihr den Stuhl zu seiner Linken entgegen. Sie setzte sich, drehte den Stuhlrücken in Richtung Straße und griff nach der Getränkekarte.
Er konnte erst mal nicht seinen Blick von ihr abwenden. Sie saß ihm frontal gegenüber. Um nicht unhöflich zu wirken, versuchte er, sich wieder in sein Papier zu vertiefen. Es war nichts Ungewöhnliches, dass man im Unter den Linden einzeln am Tisch saß und las. Das machten viele, zu gewissen Tageszeiten und an bestimmten Tagen sogar die meisten. Spötter nennen das Café deswegen auch Unter den Blinden – weil die Leseratten dortselbst nichts mitbekommen von der sozialen Umwelt links und rechts oder maximal grimmig aufblicken, wenn es jemand am Nachbartisch wagt, laut aufzulachen oder sich anders als flüsternd bis dezent zu unterhalten.
Er konnte sich jedoch nicht mehr konzentrieren. Ganz und gar nicht. Nicht nur das ungewöhnliche Outfit und die Schönheit seiner unverhofften Tischnachbarin verhinderten das. Die junge Frau schien auch eigentümlich unruhig zu sein. Mehrfach schon hatte sie sich etwas verstohlen nach links und rechts gewandt, um die beiden kleinen Straßen – Juliusstraße und Lippmannstraße –, an deren Kreuzung das Café Unter den Linden liegt, kurz in Augenschein zu nehmen. Womöglich erwartete sie jemanden. Aber warum setzte sie sich dann mit dem Rücken zur Straße? Wieder zog er sein Papier vor die Nase.
Die Bedienung kam, Michel, der einzige, mit dem er gelegentlich ein Wort sprach, aber auch nur deswegen, weil er ihn beiläufig als guten Bekannten eines seiner besten Freunde kannte. Ansonsten genoss er die Anonymität, das Unbehelligtsein, das ungestörte Lesen. Es hatte natürlich etwas Skurriles an sich, seit gut zwanzig Jahren regelmäßiger Gast eines Cafés zu sein, ohne, von Michel abgesehen, jemals mit irgendjemandem der dort Arbeitenden mehr als wenige Höflichkeitsfloskeln ausgetauscht zu haben – und auch nicht mit anderen Stammgästen. Man grüßte sich freundlich. Das war alles. Die Vorstellung war ihm ein Grauen, im Café zu sitzen oder durch sein Viertel zu gehen und mit jedem fünften Passanten, da über die langen Jahre irgendwie bekannt, die neuesten privaten Belanglosigkeiten austauschen oder ein belangloses Schwätzchen über noch belanglosere Themen absolvieren zu müssen, höflichkeitshalber.
Michel näselte in seinem wundervollen französischen Akzent: „Was darf isch ihnen bringen?“ Er meinte natürlich die Schöne.
Sie bestellte keinen Latte macchiato – sondern ein Bier. Nachmittags um drei. Warum nicht. Vielleicht hatte sie Urlaub und betrieb Revolutionstourismus im Hamburger linksautonomen Schanzenviertel. Oder, schoss ihm durch den Kopf, womöglich hat sie gleich ein Blinddate, ist etwas aufgeregt und sediert sich deswegen mit einem Bierchen am helllichten Tage. Das könnte auch ihr geschmackvolles Styling erklären: edles Leder, ausgesuchte Accessoires, überflüssigerweise – bei ihrem Aussehen.
„Anton, möchtest du noch einen Kaffee?“
Anton guckte Michel verwundert an. Er trank nie mehr als eine Tasse Kaffee. Das wusste Michel genau. „Nein danke, mein Guter. Die Birne ist noch hellwach. Und fast blank bin ich zudem.“ Michel wollte wohl nur der jungen Frau mit seinem französischen Charme gefallen, dachte sich Anton.
Wieder versuchte er, sich in sein Papier zu vertiefen. Wieder gelang es ihm nicht. Von seiner Tischnachbarin sah er nur den Turban. Sie war ganz in ihrem Stuhl versunken und hielt noch immer die Getränkekarte vors Gesicht, obwohl sie schon bestellt hatte. Das kannte er. Wenn er in einem Restaurant oder einer Kneipe auf jemanden wartete – er war meist überpünktlich –, studierte er, wenn nichts anderes Lesbares greifbar war, die Karte bis in kleinste Details, von vorne nach hinten und von hinten nach vorne.
Genau in Blickrichtung, oberhalb des Turbans der jungen Dame quasi, bemerkte er plötzlich einen Mann, der auf dem Gehweg direkt hinter dem gusseisernen, grün umrankten Zaun der Terrasse stand und forschenden Auges zu ihnen herüberschaute. Der Mann drückte etwas, ein ganz kleines Handy womöglich, an sein linkes Ohr. Als er registrierte, dass Anton ihn sah, wandte er sich wie beiläufig nach links ab und verschwand hinter einer Linde aus dem Blickfeld. Anton sah noch, dass ein kleines gekordeltes Kabel vom Ohr über den Nacken in die Jacke des Fremden führte und dass der Mann im Weggehen kaum merklich seine Lippen bewegte.
Anton schwante jäh Düsteres. Er erinnerte sich daran, dass heute eine Demonstration vor der besetzten Roten Flora stattfinden sollte, dem Zentrum der Hamburger autonomen Linken gleich um die Ecke, oder womöglich schon stattgefunden hatte. Man wollte gegen den Umbau des im nahen Schanzenpark gelegenen alten Wasserturms, der eigentlich unter Denkmalschutz steht, in ein Luxushotel protestieren und damit gegen die Verwandlung der Schanze, wie der Stadtteil auch heißt, in ein Schickimicki-Viertel mit steigenden Mieten und Verdrängung der alt eingesessenen, in der Regel sozial schwachen Bevölkerung – Studenten, Rentner, Arbeiter, Migranten.
Die Rote Flora am Schulterblatt 71, der zentralen Straße im Hamburger Schanzenviertel, wurde 1888 als Theater gebaut und auch lange Zeit als solches genutzt. Anfänglich hieß es Tivoli-Theater, dann Concerthaus-Flora, schließlich Flora-Theater. 1943 wurde es geschlossen und nur noch als Lager genutzt, 1949 nach grundlegender Renovierung wiedereröffnet und 1953 in ein Kino umgewandelt. Das machte Mitte der 1960er-Jahre Pleite. Danach diente die Flora als Standort einer Hamburger Warenhauskette – nicht gerade stilgerecht.
Das dachte sich wohl auch ein bekannter Musical-Produzent. Ende der 1980er-Jahre wollte er in der alten Flora das Musical Das Phantom der Oper zur Aufführung bringen, über lange Jahre und Jahrzehnte womöglich. Ein entsprechendes konsumorientiertes, an oberflächlichem Amüsement interessiertes bürgerliches Musical-Publikum wäre der soziale Kollateralschaden gewesen – im linken, alternativen, schmuddeligen Schanzenviertel. Das sahen seine Bewohner ganz und gar nicht ein und die Autonomen am allerwenigsten. Sie besetzten das Gebäude kurzerhand. Seitdem heißt es Rote Flora.
Es folgten Jahre der Auseinandersetzung zwischen Polizei, Besetzern und sympathisierenden Demonstranten. Regelrechte Straßenschlachten fanden statt. Trotzdem konnten die Besetzer den Abriss des hinteren und größten Teils des Gebäudes im April 1988 nicht verhindern. Lediglich die – immer noch recht zahlreichen und großen – Räume im Eingangsbereich des Theaters und seine klassizistische, mit politischen Parolen übersäte Front blieben stehen und weiter besetzt.
Nach Jahren militanter Konfrontation verkaufte die Stadt das Gebäude 2001 überraschend an einen Investor. Und der versicherte den Besetzern, dass er am Status der Roten Flora nichts ändern wolle, die sich inzwischen zu einem linken, selbstverwalteten Kulturzentrum und eben zum Zentrum der Linksautonomen entwickelt hatte. Aus ihren Reihen stammt der sogenannte schwarze Block in Demonstrationszügen und rekrutieren sich die üblichen Verdächtigen, wenn bundesweit oder auch nur in Hamburg Razzien gegen imaginierte linke Terroristensympathisanten, Staatsfeinde und andere Chaoten durchgeführt werden.
Das Viertel verwandelt sich, wenn die Autonomen vor der Roten Flora demonstrieren oder die Polizei eine Razzia durchführt, in eine nahezu gespenstische Szenerie – filmreife Kulisse für einen Politthriller der harten Sorte, nicht sonderlich weit entfernt von den Bildern, die man aus ehemaligen mittel- oder südamerikanischen Militärdiktaturen kennt: Hundertschaften martialisch ausgerüsteter Polizisten in gepanzerten schwarzen oder grünschwarzen Kampfanzügen, hinter Integralhelmen und Schutzschildern verschanzt, den Gummiknüppel in der Hand oder noch am Halfter, Tränengas und Pfefferspray ebenso, inzwischen alle über Funk vernetzt, das Mikrofon hinterm Visier. Mannschaftswagen an jeder Ecke und in den Seitenstraßen in langen Reihen hintereinander. Laster mit Flutlichtanlagen auf der Ladefläche. Auf den Dächern spezieller Kombis Funkanlagen und Überwachungskameras für die Beweisermittlung. Wasserwerfer im sichtbaren, drohenden Hintergrund und immer wieder im schmerzbringenden Einsatz. Und mitten drin der schwarze Block der Autonomen, junge Menschen wie die meisten Polizisten auch – und wie die junge Frau, die Anton gegenübersaß.
Anton sah plötzlich, wie der Mann mit dem Kabel hinterm Ohr wieder von links die Straße hochkam, forcierten Schrittes und mit zwei behelmten Polizisten im Kampfanzug hintendrein. Und erst jetzt, als er ihren Gang in Richtung Eingang des Cafés und Terrasse verfolgte, sah er, dass sich schon zwei uniformierte Polizisten zur Lippmannstraße, also nach rechts hin postiert hatten.
Der Zivilbeamte ging direkt auf die Schöne zu. Die beiden behelmten Polizisten blieben etwa zwei Meter hinter ihm stehen.
„Personenkontrolle. Bitte zeigen sie mir ihre Papiere.“ Der Zivilbeamte formulierte höflich, aber sehr bestimmt, während er seinen Dienstausweis in ihr Blickfeld streckte.
Die junge Frau schaute erschrocken auf das Dokument und dann zum Beamten hoch. Sie rückte sich auf ihrem Stuhl zurecht und suchte ebenso verlegen wie aufgeregt ihre Taschen ab. Vergebens.
„Es tut mir leid.“ Sie sprach mit erstickter Stimme. „Ich habe meinen Pass wohl zu Hause liegen lassen.“ Sie war völlig perplex.
„Ich muss sie dann leider bitten, uns zu einer Personenfeststellung zu begleiten.“ Der Zivilbeamte trat einen halben Schritt zurück, um ihr das Aufstehen zu ermöglichen.
„Aber sie können mich doch nicht einfach mitnehmen, nur weil ich…“
„Das kann ich sehr wohl, wenn sie sich nicht ausweisen können.“ Der Zivilbeamte unterbrach sie forsch.
„Aber ich kann meine Tochter ausweisen.“
Der Zivilbeamte drehte sich ruckartig zu Anton um, den er bis jetzt kaum wahrgenommen hatte: „Sie sind…“ Er sah ungläubig zwischen Anton und seiner vorgeblichen Tochter hin und her. „…sie sind der Vater dieser jungen Frau?“
„Zu meinem großen Glück. Was wollen sie denn von ihr?“ Anton spielte den leicht Empörten.
„Das tut hier nichts zur Sache. Könnte ich dann bitte ihre Papiere sehen?“
Der Zivilbeamte schien leicht verlegen zu sein. Sein Tonfall war nicht mehr so schneidend wie eben noch. Mit einer solchen Situation hatte er nicht gerechnet.
Anton zog ruhig seinen Personalausweis aus der Brieftasche und reichte ihn dem Beamten. Der schaute sich die Plastikkarte genau an.
„Sie heißen Stein, Dr. Anton Stein?“ Der Zivilbeamte sah Anton prüfend an.
„So ist es. Und könnte ich nun erfahren, was sie von meiner Tochter wollen?“
„Das tut noch immer nichts zur Sache. Wie lange sitzen sie schon hier?“
Anton zuckte leicht mit den Schultern und presste seine Unterlippe nach oben. „Eine gute Stunde. Vielleicht auch eineinhalb Stunden. Wieso?“
„Und ihre Tochter?“
„Ebenso lange. Aber warum fragen sie sie nicht selbst?“
Der Beamte überlegte kurz, wandte sich dann aber nicht zu ihr, sondern an die Gäste der Nachbartische, die sich schon wieder in ihre Lektüre vertieft hatten nach anfänglichem genervten, gelangweilten Aufblicken – gelangweilt, weil man in Sachen Präsenz der Staatsgewalt im Schanzenviertel geprüft ist über die Jahre. Aufs Härteste.
„Kann von ihnen jemand bestätigen, dass dieser Herr mit seiner Tochter seit über einer Stunde hier sitzt?“
„Aber natürlich kann isch das!“ Michel, Anton hatte ihn gar nicht kommen sehen, stand mit seinem Tablett einen guten Meter hinter dem Beamten, worauf dieser sich hastig umdrehte.
„Und wer sind sie?“
„Isch arbeite hier.“
„So, so. Sie können das also bezeugen? Können sie sich ausweisen?“
„Muss isch das als Ausländer inzwischen schon selber tun?“
Hinten in der Ecke lachte einer laut auf, unterdrückte seinen Ausbruch aber schnell durch gekünsteltes Hüsteln und pflichtbewusstes Weiterlesen. Anton begriff sofort, dass Michel einen Witz parodierte, den er ihm vor einiger Zeit erzählt hatte. In ihm bekommt ein konservativer Politiker dieselbe Rückfrage als Antwort auf seine Aufforderung, der türkische Käufer seines Gebrauchtwagens möge sich doch bitte ausweisen.
„Isch bin Staatsbürger von Fronkraisch.“ Michel legte sich richtig ins Zeug. „Und damit bin isch Bürger der Europäischen Union. In der Europäischen Union herrscht politische Freiheit. Liberté! Und Bewegungsfreiheit. Isch kann hier arbeiten, solange isch will. Sie können gerne meine Papiere sehen. Isch habe alles dabei. Einen Moment.“
Damit stellte er das Bier mit einem zuckerfreundlichen „Bitteschön, die Dame!“ auf den Tisch und entschwand.
Den Zivilbeamten schien das alles nicht mehr zu interessieren. Er stand schon während Michels wunderbarem Auftritt mit geschlossenen Augen und gesenktem Haupte da, Daumen und Zeigefinger seiner rechten Hand konsterniert an die Nasenwurzel gepresst. Kurz nach Michels Abgang wandte er sich zu den beiden Behelmten, steckte mit ihnen die Köpfe zusammen und murmelte einige unverständliche Sätze. Einer der beiden Behelmten schüttelte daraufhin leicht den Kopf und spreizte beide Unterarme, die Hände gen Himmel gestreckt.
Der Zivilbeamte griff sich wieder an die Nase, verharrte kurz, drehte sich um und sprach mehr zu Anton als zur Schönen: „Es handelt sich hier wohl um eine Verwechslung. Wir bitten um Entschuldigung.“
Damit eilte er samt seiner Behelmten rechts in die Lippmannstraße und nahm im Vorbeigehen die dort postierten Uniformierten mit.
Als gleich darauf Michel mit seinen Papieren in der Hand wieder herauskam, war er ganz enttäuscht, die Beamten nicht mehr zu sehen.
„Was war das denn, Anton?“ Er hielt sich seine flache Rechte an die Stirn und gab sich selbst und allen anderen die Antwort: „So ein Schwachsinn!“
Michel machte kehrt und ging kopfschüttelnd zurück ins Café.
Die Schöne saß sprachlos da. Sie wusste nicht recht, was hier und mit ihr eben geschehen war. Ihre Augen waren weit aufgerissen. Ihr Gesicht ein einziges Fragezeichen.
„Warum haben sie das getan?“ Sie brachte es mit leiser Stimme gerade so über die Lippen.
Plötzlich war Anton, der sich bislang eher amüsiert hatte, die ganze Sache etwas unangenehm. Er zögerte kurz.
„Ich weiß auch nicht so recht.“ Er sprach kleinlaut, die Augen auf den Tisch geheftet. So verharrte er einige Sekunden.
Dann sah er wieder zu ihr hoch. Er konnte ihren Blick kaum ertragen. Ihr Gesichtsausdruck war eine Gemengelage aus völliger Verwunderung, Verwirrung und Erschrockenheit, aber auch aus Freude und Dank.
Das Quäntchen Dank machte Anton unsicher. Er konnte mit Lob noch nie gut umgehen. Er druckste.
„Sie sehen nicht unbedingt wie eine Verbrecherin aus!“
Der Gesichtsausdruck der jungen Frau veränderte sich keinen Deut.
„Und rein theoretisch könnten sie ja wirklich meine Tochter sein! Und…“
In diesem Moment fielen erste dicke Regentropfen auf die Markise. Wenige Sekunden später schüttete es aus den Wolken. Der Regen prasselte derart laut auf das schützende Vordach, dass an eine weitere Unterhaltung erst mal nicht zu denken war. Die meisten Gäste rannten samt Getränken und Zeitungen ins Café, die wenigen unter der Markise verbliebenen rückten so eng zusammen, wie es Mobiliar und Höflichkeit gerade noch erlaubten.
Auch die Schöne rückte näher heran. Sie saß jetzt nur noch einen guten halben Meter links von Anton.
„Und… was?“ Sie nahm das Gespräch sofort wieder auf, als der Platzregen nach kaum einer Minute ebenso schnell nachließ, wie er begonnen hatte.
Ihre plötzliche Nähe war Anton unangenehm. Verlegenheit befiel ihn, Schüchternheit fast.
Irgendetwas musste er jetzt sagen. Nach kurzem Nachdenken ergriff er die Flucht nach vorn. Er ruckelte sich in seinem Stuhl zurecht, guckte beiläufig nach links und rechts, um sich zu vergewissern, dass potenzielle Mithörer in gehörigem Abstand saßen – derer gab es inzwischen nur noch zwei, jeweils tief in ihrer Lektüre versunken –, und sprach schließlich mit zwar gedämpfter, aber forscher Stimme: „Also, um ehrlich zu sein, wahrscheinlich wollte ich ihnen nur imponieren.“
Er hüstelte kurz.
„Sie sind eine ungewöhnlich schöne Frau. Womöglich kam bei mir ganz unverhofft der Jäger und Sammler zum Vorschein…“ Er schmunzelte neckisch. „…auf meine alten Tage.“
Anton sah sie triumphierend an und war ganz stolz auf seine kecke Antwort.
„Und außerdem müssen sie vor allem Michel danken. Und auch den anderen Gästen, die tapfer mitgespielt haben. Es hat sie ja keiner verraten. Also…“ Er kratzte sich am Hinterkopf. „…alles halb so schlimm und kaum der Rede wert.“
Die junge Frau guckte, die Augen noch immer weit geöffnet, nun auch noch äußerst ungläubig – und lachte unverhofft herzlich auf, wohl um ihre Anspannung zu überspielen. Weil Sie dieses Auflachen aber in der nächsten Sekunde anscheinend als ganz ungehörig empfand, tippte sie sich kurz mit der flachen Hand auf den Mund.
„Was sind sie denn für einer? Ich finde das ganz wunderbar, was sie eben für mich getan haben. Andernfalls säße ich jetzt in einem Gefangenentransporter oder auf dem Polizeirevier – oder schon in der Zelle. Und sie sehen ganz und gar nicht so aus, als ob sie das nicht auch für eine ganz hässliche Frau getan hätten!“
„So? Da wäre ich mir aber nicht so sicher…“
„Ich glaube ihnen kein Wort!“ Sie konterte sofort. „Und außerdem sehen sie auch nicht unbedingt wie mein Vater aus.“
„Bin ich denn so hässlich?“ Sie musste laut auflachen.
„Nein!“ Die junge Schönheit unterbrach sich ebenso schnell wie deutlich. „Natürlich nicht!“
„Echt?“ Anton flocht es mit gestellter Verwunderung ein.
„Ich meine…“ Nun war sie etwas verlegen. „Ich meine, sie müssten ja sehr früh angefangen haben mit… Also, was ich sagen wollte, sie müssten ja sehr früh Vater geworden sein, wäre ich ihre Tochter.“
„Ich war schon immer ein Frühstarter. Im Bett, am Tresen, bei der Vorbereitung meines nächsten Fiaskos…“
Er wusste selbst nicht, warum er plötzlich so spöttisch war. Womöglich wollte er ihr in der Tat etwas imponieren, dachte er sich. Aber vielleicht auch nicht. Sein Hang zu Sarkasmus und Polemik, zu Hohn und Spott hatte ihm schon so vieles vermasselt. Kaum eine Fachzeitschrift publizierte noch Artikel von ihm. Ganze Fachbereiche ignorierten seine Bücher. Fast mit dem gesamten Wissenschaftsbetrieb hatte er sich verkracht.
Als ihm das spontan durch den Kopf schoss, formulierte er plötzlich ganz sachlich und sittsam: „Na, wie alt schätzen sie mich denn?“
Er biss sich, kaum hatte er zu Ende formuliert, auf die Lippen. Ihm war klar, dass er seit Jahren sehr viel jünger geschätzt wurde, als er war. Er ärgerte sich für seine dämliche Frage, weil sie nach fishing for compliments roch, wenn nicht müffelte.
Die Schöne guckte ihm ganz unbefangen ins Gesicht, baldowerte gespielt und wog einige Sekunden den Kopf.
„Och, so knapp über 40!“ Ihre Einschätzung wirkte völlig authentisch.
Volltreffer. Er hörte es doch gern. Aber alter Wahrheitsfanatiker, der er war, korrigierte er sofort: „Ich bin 49.“
„49?“ Auch ihre Verwunderung wirkte völlig authentisch.
„Genau. Im nächsten Jahr wird die Welt mich schon ein halbes Jahrhundert ertragen haben. Sie sieht entsprechend aus.“
Wieder hätte er sich am liebsten auf die Finger gehauen, kaum dass er das letzte Wort ausgesprochen hatte, oder noch besser auf den Mund. Schön kräftig. Innerlich tat er es umso mehr. Wie konnte er wissen, dass sie sein spöttisches Mundwerk goutiert? Er kannte sie kaum eine halbe Stunde und wollte es sich mit ihr ganz und gar nicht vermasseln.
Die junge Frau saß zu seiner Freude aber sehr vergnügt in ihrem Stuhl.
„Na, dann hätten sie schon mit, ähm…“ Sie sah kurz grübelnd zu Boden. „Dann hätten sie schon mit 20 Vater werden müssen! Das passt überhaupt nicht zu ihnen.“
„Sie sind schon 29 Jahre alt?“ Jetzt war er stark verwundert – aber auch irgendwie erfreut. Er wusste gar nicht warum. Doch, er wusste es.
„Sie wirken, Entschuldigung, viel jünger!“ Anton betonte kräftig seine Worte. „Also, rein biologisch natürlich. Nicht geistig, mental, also…“ Er fasste sich an den Kopf.
Die Gelobte bedankte sich amüsiert, weil sie, so schien es, verstand, was er meinte, und weil sie ganz und gar keine Veranlassung hatte, ihn willentlich misszuverstehen.
„Und warum hätte eine so frühe Vaterschaft nicht zu mir gepasst?“
„Sie wirken so vernünftig.“ Erneut tippte sie sich kurz an den Mund. Sie schien ganz spontan und intuitiv geantwortet zu haben, ohne groß nachzudenken. Auch sie kannte ihn kaum eine halbe Stunde.
„Oje!“ Anton künstelte merklich. „Ich kann aber auch ziemlich unvernünftig sein. Schwärmerisch und romantisch! Leidenschaftlich und ekstatisch! Himmelstürmend und welterobernd! Und mächtig trinkfest!“ In seinem Innern schallte spontan eine Ohrfeige. Er konnte sich seinen Sarkasmus einfach nicht erklären.
Die Schöne schmunzelte indes ganz unbefangen: „Das glaube ich ihnen aufs Wort!“
Sie hatte langsam ihre Fassung wiedererlangt und sich beruhigt. Das Bier hatte sie recht schnell getrunken. Es wirkte.
Freundlich lächelnd sah sie Anton an. Er wich inzwischen nicht mehr jedem ihrer Blicke aus. Sie schien sich zu fragen, was für ein wundersamer Mann vor ihr saß und warum er ihr so seltsam bekannt vorkam und überhaupt nicht wie ein Fremder wirkte.
Michel kam um die Ecke. Er hatte seine Schürze abgelegt und trug seine Straßenmontur. „Isch wollte mich kurz verabschieden. Hab’ es heute etwas eilig. Alles Gute noch!“ Er sah nur die junge Frau an. Anton merkte es wohl.
Sie sprang auf und streckte Michel die Hand entgegen: „Tausend Dank für ihre Hilfe!“
Michel, der alte Charmeur, drückte ihr aber nicht die Hand, sondern verpasste der Schönen gekonnt einen dezenten Handkuss: „Aber nicht doch. Für die Schönheit mache isch doch alles!“
Er drehte sich schwungvoll um und ging. Nach ein paar Metern sah er kurz über die Schulter zurück und hob die Hand zum Gruße: „Ach, Anton, dir auch salü!“
Anton winkte zurück und grummelte: „Er kennt mich also doch noch.“
Inzwischen saßen Anton und die junge Frau allein unter der Markise. Die Zeit war fortgeschritten. Das Nachmittagspublikum war inzwischen weg. Das Feierabendpublikum blieb aufgrund des immer wieder kurz aufkommenden Regens aus oder ging gleich ins Café. Und für die abendlichen Gäste war es noch zu früh.
Anton spielte kurz mit dem Gedanken, die Sache nun zu beenden und sich zu verabschieden. Aber er brannte darauf, von der attraktiven Unbekannten mehr zu erfahren. Auch schien ihm, dass es ihr ähnlich ging. Anton wusste aber nicht recht, wie er die Unterhaltung fortführen sollte. Es entstand eine kleine Gesprächspause.
Die Situation löste sich, als kurze Zeit später die neue Bedienung herauskam. Auch sie, eine etwas grimmigere weibliche Erscheinung, kannte Anton seit Jahren – optisch zumindest. Ihren Namen kannte er nicht. Auf jeden Fall fragte sie etwas gelangweilt: „Darf es noch etwas sein?“
Die Schöne und Anton erkannten am erfreuten Blick des jeweils anderen sofort, dass es unbedingt noch etwas sein durfte.
„Och, ein kleines Bierchen fände ich jetzt auch nicht schlecht.“ Anton säuselte mit gespitztem Mund.
Noch bevor die etwas Grimmige ihren fragenden Blick auf Antons Tischnachbarin gerichtet hatte, meinte diese bestimmt: „Zwei!“ Sie lächelte beinahe triumphierend.
Die etwas Grimmige drehte ab.
„Ich bin übrigens wirklich vor der Polizei weggelaufen, als ich vorhin hier ankam und bei ihnen… nun, um Asyl bat.“
„Das dachte ich mir. Sie wirkten sehr unruhig, guckten dauernd und ganz verstohlen nach links und rechts und versteckten sich immer tiefer in ihrem Stuhl.“
Sie lächelte etwas verlegen. „Es war gar keine Verwechselung. Der Zivilbeamte hatte mich ganz richtig wiedererkannt, war sich dann aber sehr unsicher, weil sie sich so heldenhaft…“ Wieder berührten die Fingerspitzen ihrer rechten Hand kurz ihre Lippen.
„Mir schwillt die Brust ins Unermessliche!“ Anton flocht es, die kleine Pause nutzend, theatralisch ein.
„Quatsch! Doch! Weil sie sich für mich so heldenhaft eingesetzt haben und die Polizisten mich davor nur ganz kurz und im Vorbeigehen gesehen hatten, bevor ich…“ Sie hüstelte. „Ja, bevor ich weggerannt bin.“
„Weggerannt?“
„Ja, weggerannt, um einer sogenannten Personenkontrolle und Personenfeststellung zu entgehen. Wir sind auf ein verabredetes Zeichen hin in alle vier Himmelsrichtungen weggeprescht, als die drei Polizisten auf uns zukamen. Die wollten uns schon an der Ecke Bartelsstraße Susannenstraße abfangen.“
„Uns?“
„Ja, meine politischen Freunde und mich. Wir hatten erfahren, dass die Rote Flora mal wieder eine Razzia über sich ergehen lassen musste. Da haben wir uns spontan entschlossen, zur Flora zu gehen und dagegen zu protestieren.“
„Sollte heute nicht so und so eine Demo vor der Flora stattfinden?“
„Nein morgen. Deswegen wahrscheinlich heute die Razzia.“
„Und dann?“
„Nun, ich rannte um die Ecke und versteckte mich in einem Hauseingang. Der Zivilbeamte und die zwei Polizisten in Kampfanzügen rannten zum Glück vorbei. Ich veränderte kurz mein Aussehen und schlenderte dann unauffällig und über Umwege hier her. Hier im Unter den Linden tauchen die eigentlich nie auf.“
„Sie veränderten kurz ihr Aussehen?“
Sie schmunzelte, warf den Kopf etwas zurück, griff in ihren Nacken, löste das breite, zum Turban gebundene Tuch, zog ihre Lederweste aus, wendete sie, wie sich herausstellte, von innen nach außen, zog sie wieder an und krempelte die Ärmel hoch. „Und ganz so grässlich wie im Moment war ich davor auch nicht geschminkt.“
Anton sah so erstaunt wie versonnen auf ihr nun offen wallendes, fast schwarzes, lockiges, halblanges Haar. „Wie sehen sie denn erst ungrässlich aus?“
Sie lachte. „Geschminkt ist man schnell. Das Abtakeln dauert aber, wenn’s denn ordentlich sein soll. Und die entsprechenden Cremes und Wässerchen braucht man auch. Heute müssen sie mich also noch in Kampfbemalung ertragen.“
„Gerne. Überaus gerne ertrage ich sie.“ Die Biere kamen.
„Sie scheinen etwas versierter zu sein im Umgang mit der Staatsgewalt. Ich meine, wenn sie mit ihren Freunden schon Fluchtzeichen verabreden…“
„Ja leider, man muss im Schanzenviertel auch nur andeutungsweise wie ein Autonomer aussehen, um dreimal in der Woche kontrolliert zu werden. Kennen sie das Schanzenviertel? Sind ihnen die politischen Verhältnisse hier bekannt?“
Anton senkte den Blick und schmunzelte. „Ja, doch. So’n bisschen. Aber wirklich nur ein bisschen. Wohne hier nämlich erst seit zwanzig Jahren und bin erst seit 25 Jahren Politikwissenschaftler.“
Die Schöne lachte herzlich. „Sie sind ja ein unglaublicher Tiefstapler!“
„Och…“
„Na, dann brauche ich ihnen ja nichts mehr zu erzählen.“
„Schade!“ Anton gab den Traurigen. „Dann greife ich eben zur Flasche.“ Er schenkte sich nach. „Sind sie öfter im Schanzenviertel? Leben sie hier? Ich habe sie hier noch nie gesehen.“
„Ich wohne erst seit einem halben Jahr im Viertel, gleich unten, Ecke Susannenstraße Schanzenstraße. Und im Unter den Linden bin ich relativ selten. Je nachdem, welchen Tagesrhythmus man hat, kann man sich schon mal ein halbes Jahr ungewollt aus dem Weg gehen, auch in diesem kleinen, überschaubaren Stadtviertel.“
„Zu meiner großen Trauer.“
„Sie alter Charmeur!“
„Isch?“ In Gedanken bat Anton Michel sofort um Vergebung.
„Sie!“ Die Schöne lachte herzlich auf – und wieder tippte sie sich schnell mit der Hand auf den Mund.
Anton war ganz entzückt von dieser zarten Geste leichter Schüchternheit. Sie schien der jungen Frau selbst gar nicht bewusst zu sein. Er merkte aber auch, dass sie ihn gleich nach dem Tipper etwas nachdenklich ansah. „Habe ich etwas Falsches gesagt?“
„Oh Gott!“ Es platzte aus ihr heraus wie ein unterdrückter leiser Schrei des Erstaunens. „Äußerst aufmerksam sind sie anscheinend auch noch!“
Anton schlug sich eher symbolisch mit der rechten auf die linke Hand, als wolle er sich bestrafen.
„Nein, überhaupt nicht, sie haben überhaupt nichts Falsches gesagt. Ganz im Gegenteil. Es ist nur…“ Sie sah Anton freundlich an, senkte dann aber ihren Blick und zögerte kurz. „Es ist nur, dass sie mir so merkwürdig vertraut vorkommen, wie wenn ich sie schon lange Zeit kennen würde – und gar keine Hemmnisse vor ihnen haben müsste.“
„Hemmnisse?“
„Ja, nein, ich meine… Geheimnisse!“ Sie lugte etwas verlegen auf den Tisch, griff ruckartig nach ihrer Flasche und füllte ihr Glas auf.
Anton machte eine abwehrende Geste, zog theatralisch ein gelangweiltes Gesicht auf und ließ verlauten: „Och, das ist doch gar nichts. Das ist ganz normal bei mir. Hör’ ich andauernd. Nicht der Rede wert.“
Ihr Gesichtsausdruck verriet Anton, dass sie seine Schauspielerei durchschaute.
Er schmunzelte schüchtern und bemühte sich um einen sachlicheren Tonfall: „Na ja, mal im Ernst. Ich hasse Distanzlosigkeit. Grundsätzlich.“
Sie lächelte wissend.
„Was meinen sie, um nur ein Beispiel zu nennen, wie ich es genieße, hier im Unter den Linden seit langen Jahren unbehelligt lesen zu können, ohne Small-Talk-Verpflichtung wem gegenüber auch immer. Aber wenn mich ein Mensch interessiert, wenn ich jemanden kennenlerne und das Gefühl habe, dass er auch mich interessant findet und Gefallen daran hat, mich kennenzulernen, dann wüsste ich nicht, warum man sich mit albernen Formalitäten, aufgesetzten Höflichkeiten und diesem ganzen auswendig gelernten Verhaltensunsinn aufhalten sollte. Ich will ihnen nichts Böses, und wahrscheinlich merken sie das intuitiv. Und ich hoffe und glaube, dass auch sie mir nichts Böses wollen.“ Er lächelte sie etwas neckisch an.
„Warum sollte ich ihnen etwas Böses wollen?“ Sie fragte ebenso verständnislos wie über seine offenen Worte hoch erfreut.
„Warum siezen wir uns überhaupt?“ Anton hakte gleich nach. „Wir sehen beide nicht gerade aus wie verklemmt-autoritäre Kleinbürger, wir sitzen hier in einem, wie man – nicht ganz zu Unrecht – sagt, linken, aufgeklärten Stadtviertel und…“
„Ich habe damit angefangen.“ Sie gab sich schuldig.
„Ja, ich weiß, wegen meines biblischen Alters…“
„Jetzt schäkern sie wieder!“
„Stimmt, ich bin Atheist. Also: Wegen meines fortgeschrittenen Alters…“
„Das klingt schon besser. Vielleicht sollten wir sagen: Wegen ihres würdevollen Aussehens…“
„Die Würde lastet schwer auf meinen Schultern, ach! Ich fall gleich vom Hocker!“ Anton sprach’s mit verhaltenem Theaterdonner und machte Anstalten, wirklich gleich vom Stuhl zu fallen.
Die Schöne lachte herzlich auf. Und Anton war ganz erstaunt, dass der Tipper erstmals unterblieb.
Als ihr Lachen verstumm war, ruckelte sie sich auf ihrem Stuhl zurecht und streckte Anton die Hand zum Gruße entgegen: „Hallo Anton! Ich heiße Birthe. Sehr erfreut, dich kennenzulernen!“ Sie strahlte ihn an.
Anton ruckelte sich ebenso zurecht – es war ihm im eng zusammengerückten Mobiliar unter der Markise nicht möglich, spontan aufzustehen –, drückte Kreuz und Becken zum Gouvernantensitz durch, nahm ihre Hand in die seine und neigte kurz und brav das Haupt: „Hallo Birthe! Ganz meinerso! Äh, ebenseits! Nein, meinerseits! Ich meine, ebenso! Um nicht zu sagen…“ Anton griff sich an den Kopf. „Vielleicht sollte ich nachmittags doch kein Bier trinken…“
Birthe lachte belustigt. Anton gefiel ihr Lachen. Es war völlig unbefangen, offen, ehrlich, herzlich, kein bisschen polterig und ohne jedes Quäntchen Unachtsamkeit.
Sie saßen jetzt schon fast zwei Stunden zusammen. Der Nachmittag war weit vorangeschritten. Üblicherweise ging man um diese Zeit nach Hause zur Familie oder in die Singlebude.
„Es ist schon etwas spät geworden.“ Anton bemerkte es beiläufig.
„Müssen sie… Entschuldigung, musst du bald los?“ Ihr Tonfall verriet leichtes Erschrecken. „Du hast bestimmt noch etwas vor.“
„Ich habe immer etwas vor. Die Arbeit nimmt nie ein Ende. Aber zum Glück habe ich heute keinen festen Termin.“
„Ich auch nicht!“ Birthes Stimme klang freudig.
Im gleichen Moment klingelte ihr Handy. Sie rückte etwas vom Tisch ab, um besser in ihre Tasche greifen zu können. Mit einem knappen „Entschuldige kurz!“ wandte sie sich etwas zur Seite und nahm den Anruf entgegen.
Es dauerte keine Sekunde und sie zuckte zusammen. Ihr Gesicht verfinsterte sich schlagartig. Wut kochte in ihr hoch im Bruchteil eines Augenblicks. Es klang wie leises, mühsam unterdrücktes Brüllen, als sie das Telefonat nach kaum drei weiteren Sekunden beendete: „Nein! Lassen sie mich in Ruhe!“
Sie zitterte am ganzen Körper, warf Anton einen kurzen, entsetzten Blick zu und stierte dann zu Boden.
Anton saß mit zugeschnürter Kehle da und wusste nicht, was er tun oder sagen sollte.
Nach einer kurzen, für Anton quälenden Pause richtete sich Birthe in ihrem Stuhl abrupt auf. Sie rang sichtlich um Fassung. „Entschuldigung. Es tut mir leid. Ich bin gleich wieder okay.“ Sie senkte ihren Kopf und rieb sich mit den Fingerspitzen beider Hände kreisend ihre Schläfen. „Es ist gleich wieder gut.“
Anton stürzte augenblicklich aus einem wunderbaren Himmelsschloss in eine ihm nun fast bedrohlich erscheinende Realität. Das war eine Spezialität von ihm, ein Laster, eine Krankheit fast. Rationalist und Realist bis ins Knochenmark, wenn es um Wissenschaft und Wahrheitsfindung ging, konnte er doch träumen und sich in Fantasiewelten versetzen wie ein kleines Kind. Das war für ihn auch ganz und gar kein Widerspruch. Besonders, wenn er mit geschlossenen Augen Musik hörte, Mahler, Messiaen, Debussy, Prokofjew, Adams, verlor er sich in ferne jenseitige Welten – oder wenn er eine schöne Frau auch nur einen kurzen Moment länger sah, in einer Kneipe am Tisch schräg gegenüber, in der U-Bahn bis zur übernächsten Station. Schon liefen vor seinem geistigen Auge in Zeitraffer ganze gemeinsame Lebenswege ab.
„Ich habe dich ja völlig erschreckt!“ Sie legte, während sie sprach, ihre rechte Hand auf seine linke.
Anton schaute aus tiefer Versunkenheit auf: „Nein, nein.“ Er wehrte zunächst ab. „Na ja…“ Er räusperte sich. „…vielleicht schon ein bisschen. Aber…“
Anton sah in ihre noch immer ganz verstörten Augen und realisierte endlich – ohne noch zu wissen, warum sie dieses kurze Telefonat so aufgewühlt hatte –, dass nicht er, sondern sie einen allem Anschein nach heftigen Grund hatte, erschrocken zu sein. Er schämte sich fast für seine selbstmitleidige Reaktion.
„Es ist ganz merkwürdig.“ Er sprach mit nachdenklicher Miene und dem Anflug eines Lächelns. „Als ich sah, wie sich dein Gesicht verfinsterte und wie dein Körper zitterte nach diesem anscheinend furchtbaren Telefonat…“ Er sah kurz zu Boden und fasste neuen Mut. „…da hat es mir regelrecht die Kehle zugeschnürt. Wir kennen uns erst seit zwei Stunden und ich reagiere, als seist du meine – Tochter...“
„Du musst dich nicht dafür entschuldigen, dass du ein einfühlsamer Mensch bist.“ Birthe wirkte schon wieder etwas gelöster. „Menschen fühlen mit anderen Menschen. Das ist doch ganz natürlich. Selbst wenn wir wildfremde Menschen leiden sehen, in den Nachrichten etwa, kann uns das doch erschüttern. Und denke nur an das Geschluchze im Kino bei gewissen melodramatischen Filmen.“
Sie tätschelte dreimal sachte seine Hand und lächelte ihm aufmunternd zu.
„Ja, ja. Stimmt. Hast ja recht.“
Anton interessierte es natürlich brennend, welches, wie er innerlich formulierte, Arschloch sie so erschreckt hatte. Wahrscheinlich ihr Ex- Freund oder Ex-Mann oder Ex-Lover, dachte er sich zunächst. Aber nein, sagte sie nicht „Lassen sie mich in Ruhe!“? Er konnte sich keinen Reim darauf bilden. Direkt fragen wollte er sie auch nicht, sie nicht in Verlegenheit bringen. Womöglich waren sie insgesamt schon zu weit gegangen, waren nach so kurzer Zeit schon zu vertraut miteinander.
„Vielleicht sollte ich dir kurz sagen, warum ich eben so heftig reagiert habe am Telefon.“
„Nein, das musst du nicht. Wir kennen uns doch kaum. Das hat mich doch gar nicht zu interessieren…“
„Es ist nichts Schlimmes, ich meine, nichts Intimes oder so. Es ist nur sehr lästig und macht mich oft sehr wütend. Und ich fühle mich – na ja, zumindest in meiner Fantasie – irgendwie auch bedroht…“
„Bedroht?“
„Ja.“ Birthe stockte kurz. „Nun, es, nein: er ist so eine Art…“ Sie tüpfelte mit Zeige- und Mittelfinger beider Hände in der Luft. „…so eine Art Verehrer. Er war mehrere Jahre Privatsekretär, Verwalter und so eine Art Sicherheitschef im Hause meines Vaters.“ Birthe nahm einen Schluck aus ihrem eigentlich schon leeren Glas und fuhr dann fort. „Mit der Zeit wurde er mir gegenüber immer aufdringlicher. Er schwor mir seine große Liebe. Immer wieder. Mehrfach habe ich ihn deutlich abgewiesen – deutlich abgewiesen. Bis ihn mein Vater entlassen hat auf meinen Wunsch und mein Drängen hin vor etwa einem Jahr. Ich habe danach noch ein halbes Jahr im Hause meines Vaters gelebt. Dieser Mensch ließ aber auch nach seiner Entlassung nicht locker. Oft kamen Blumen – die habe ich immer gleich weggeschmissen – und Anrufe. Er rief meist aus Telefonzellen an, damit man auf dem Display nicht sehen konnte, wer es war. Als ich dann vor einem halben Jahr hier ins Viertel zog, hatte ich endlich Ruhe. Bis eben! Ich frage mich, wie er an meine neue Handy-Nummer gekommen ist.“
„Du bist wegen dieses Mieslings zu Hause ausgezogen? Warum hast du nicht die Polizei eingeschaltet? Das Parlament hat erst im letzten Jahr ein Gesetz gegen Stalker erlassen. So heißen diese Widerlinge.“
„Ich bin aus ganz anderen Gründen zu Hause ausgezogen. Dass ich diesen Menschen dadurch losgeworden bin, war nur eine sehr angenehme Begleiterscheinung.“ Sie senkte den Blick und schüttelte leicht ihren Kopf: „Bis eben zumindest. Ich hatte diesen Menschen zum Glück schon fast vergessen. Ich dachte, es sei vorbei. Deswegen bin ich auch nicht zur Polizei. Aber vielleicht sollte ich das sofort tun, wenn er noch mal anruft.“
„Und du solltest dir vor allem sofort eine neue Telefonnummer besorgen – und die neue nur wirklich guten Freunden geben.“
Es ging Anton jetzt schon wieder viel besser. Wahrscheinlich müssen viele schöne Frauen mit solchen Widerlichkeiten leben, dachte er sich. Das machte die Sache zwar kein bisschen besser. Aber die Angelegenheit ließ sich zumindest regeln. Bis zu zehn Jahre können Stalker hinter Gitter wandern, hatte er gelesen. In Anton kam so etwas wie ein Beschützerinstinkt auf.
„Wenn dieses Arsch… Also, ich meine, Entschuldigung, dieser Mensch, wie du ihn nennst…“
„Rieger heißt er…“
„Jürgen Rieger?“
„Nein, Wolfgang Rieger…“
„Nun gut, wenn dieser – lass uns lieber bei dieser Mensch bleiben, damit wir möglichst schnell seinen Namen vergessen –, wenn also dieser Mensch noch mal anrufen sollte, und ich sitze gerade neben dir, dann reiche mir einfach und ohne ein Wort zu sagen das Telefon. Ich bin der deutschen Sprache mächtig und habe jahrelang auf dem Bau gearbeitet. Also, in den Semesterferien zumindest…“
Birthe schmunzelte und gab sich kokett: „Mein edler Bauarbeiter und Beschützer!“
Anton fühlte sich ertappt. Er ergriff erneut die Flucht nach vorn und formulierte im festen Tone eines seiner Sache sicheren Staatsanwalts: „Ich stelle also fest: Du bist eine unglaublich schöne Frau, hast einen steinreichen Vater, der in einem derartigen Palast wohnt, dass er einen Verwalter beschäftigen muss, bist politisch so fit, dass es die Polizei kaum erlaubt, und trinkst Bier…“ Er inspizierte aufgesetzt kritischen Blickes ihre schon wieder leere Bierflasche. „…in einer Geschwindigkeit, dass es selbst mir alten Säufer den Neidesgrimm ins Gesicht treibt. Kombiniere: Heute ist mein Glückstag!“
Birthe lachte so herzlich, dass Anton augenblicklich wieder sein Himmelsschloss bezog, fast noch ein Stockwerk höher als zuvor.
„Na, das erste Bier habe ich getrunken, weil ich so aufgeregt war. Und das zweite vor Freude über deine Heldentat…“
„Und das dritte?“
„Och…“ Sie lächelte verschmitzt. „…von mir aus gerne. Habe nämlich heute auch nichts mehr vor. Nur sollte ich irgendwann etwas essen. Sonst bin ich wirklich gleich betrunken.“
„Die Welt hat schon Schlimmeres erlebt. Oder tendierst du zum Absingen schmutziger Lieder, wenn der Pegel steigt?“
„Pegel?“
Laut schallte eine virtuelle Backpfeife durch Antons Hirn. „Ach, war nur so’n Spruch.“
Er blinzelte über die Schulter ins links anschließende große Souterrainfenster, hob die Linke zum Victoryzeichen und fuchtelte mit der Rechten eine leere Bierflasche durch die Luft. Kurz darauf kam die etwas Grimmige mit zwei Flaschen Bier auf dem Tablett heraus und stellte sie auf den Tisch. Der Umstand, dass nun schon fünf Flaschen Bier, drei leere und zwei volle, auf dem Tisch standen, entlockte der leicht Grimmigen ein verstecktes schelmisches Grinsen, bevor sie wieder abdrehte. Anton wollte ihr fast noch hinterherschicken, dass an diesem Tische Mutantrinken nicht notwendig sei und Schönsaufen am allerwenigsten.
„Hast du keine Familie? Ich meine, lebst du allein? Erwartet dich zu Hause niemand?“ Birthe guckte ihn interessiert an.
„Nein, ich bin solo.“ Sein Gesichtsausdruck verriet ihr, dass Anton einen ihm keinesfalls unangenehmen Sachverhalt kundtat. „Es fehlt mir wohl die rechte Eignung für feste Beziehungen oder gar den festen Bund der Ehe.“ Seine Stimme klang nicht nur leicht ironisch. „Habe zumindest Ersteres immer wieder versucht…“ Anton schüttelte das Haupt. Sein Blick wanderte zu Boden. „…und gelitten wie ein Tier, wenn ich abends oder am Wochenende familiären Pflichten nachkommen musste, also vor der Glotze rumhängen, ins Kino gehen oder einen…“ Er zog ein bemüht dämliches Grienen auf und betonte mit Eunuchenstimme. „…einen netten Abend mit Freunden, also irgendwelchen anderen Pärchen absolvieren sollte – oder wenn ich mich am Wochenende in lange Staus Richtung völlig überfüllter, sogenannter Naherholungsgebiete einreihen und durchquälen musste. Ich hasse diese ganzen Freizeitaktivitöten.“
„Töten?“
„Töten! Nichts geht über ein gutes Buch, einen interessanten Artikel, gute Musik – oder Biertrinken mit Freunden, bis das Auge tränt vor Lachen und der Kopf qualmt nach heftiger, erhellender Diskussion über interessante Themen. Also über das, was die Welt, das Universum und den ganzen Rest zusammenhält.“
Er hatte sich richtig echauffiert.
Birthe sah ihn mit großen Augen an. Ihr Gesichtsausdruck war eine Melange aus etwas Unglaube, vor allem aber starkem Interesse und sogar, wie es Anton schien, verständnisvollem Mitwissen. Sie schmunzelte listig.
„Aber fehlt dir nicht auch etwas dieses – gewisse Etwas?“ Sie tippte sich erstmals wieder auf den Mund.
„Du meinst das Vögeln?“ Anton zog sich umgehend eine virtuelle Keule über.
„Ja.“ Birthe lächelte zwar leicht verschmitzt, gab diese Antwort ansonsten aber ganz trocken und sachlich.
„Nun…“ Er tat etwas verlegen und etepetete: „Es finden sich doch hier und da Gelegenheiten der Abhilfe.“
„Abhilfe?“
„Also, ich meine, der Druckabfuhr.“ Er griff sich an die Stirn. „Nein, also…“ Er hüstelte. „…des dringenden, drängenden Wollens, also, um nicht zu sagen: überbordender…“ Er griff sich an die Nase. „…Paarungsbereitschaft und dergleichen.“ Er guckte leicht dämlich zu Boden. „Viele meiner guten Freundinnen sind auch solo. Und da hilft man sich gelegentlich schon mal aus der Patsche.“
„Patsche?“
„Na, du weißt schon.“
Es war schier unglaublich, schoss ihm durch den Kopf, in welchem Tempo sie in aller Vertrautheit über inzwischen selbst Intimes sprachen.
Birthe schien aber überhaupt nicht verlegen zu sein oder gar unangenehm berührt. „Ist es nicht schier unglaublich, in welchem Tempo wir in aller Vertrautheit über inzwischen selbst Intimes sprechen?“
Anton fiel virtuell vom Hocker und japste elendiglich nach Luft. „Vielleicht sollten wir jetzt wirklich erst mal eine Pause machen. Ist ja fast schon unheimlich!“ Er sah sie kopfschüttelnd an.
„Du willst gehen?“ Birthe glaubte selbst nicht, wonach sie fragte.
„Nein, nein. Aber sagtest du nicht, du wolltest bald etwas essen? Mir wäre auch danach.“
Es war inzwischen früher Abend, aber noch immer sehr hell.
„Was hältst du von einem kleinen Spaziergang durchs Viertel mit nachfolgender Nahrungsaufnahme?“
„Nahrungsaufnahme?“ Birthe schien sich unsicher zu sein, ob er wieder nur spöttelte oder selbst gutes Essen in die Rubrik Freizeitaktivitöten einsortierte.
„Okay, wir können auch gerne gut essen gehen, zum Beispiel ins Olympische Feuer. Ist mein Stammgrieche. Kennst du das O-Feuer?“
„Ja, war schon zwei-, dreimal dort. Netter Laden.“
„Netter Laden? Eine kulinarische und servicetechnische Offenbarung ersten Ranges! Ein Preis-Leistungs-Verhältnis ohnegleichen! Eine Freundlichkeit und Effizienz des Personals, wie ich sie noch nie…“
„Bist du dort am Gewinn beteiligt?“
Jetzt musste erstmals Anton schallend auflachen. „Nein, nein, nein… Ich fühle mich dort nur sehr wohl, alter Grieche, der ich bin. Also, natürlich bin ich kein wirklicher Grieche, aber sehr oft in Griechenland, auf Kreta zumeist.“ Anton äugte kurz besinnlich in sein Bierglas. „Egal, so früh am Abend finden wir im O-Feuer bestimmt noch einen freien Tisch. Und nachdem du inzwischen meine halbe Lebensgeschichte, na ja, zumindest meine halbe Beziehungsgeschichte kennst, kannst du mir dort in aller Ruhe erzählen, was du den ganzen Tag treibst, wenn du nicht gerade von der Polizei verfolgt wirst.“ Er hob beide Hände und machte eine beschwichtigende Geste. „Aber nur wenn’s beliebt!“
„Womöglich wird es belieben.“
Der Schelm in ihrer Stimme gefiel ihm ungemein.
Da Anton sich unsicher war, ob sich ihr „womöglich“ nur auf seine Aufforderung bezog, aus ihrem Leben zu erzählen, oder auf seinen Vorschlag insgesamt, saß er etwas unschlüssig in seinem Stuhl und schaute sie fragend an.
„Wahrscheinlich bin ich völlig verrückt.“ Birthe blinzelte spöttisch. „Wahrscheinlich sind wir beide völlig verrückt. Aber dein Vorschlag gefällt mir gut. Abgemacht! Lass uns zahlen.“
Anton ergriff mit beiden Händen die Lehnen seines Stuhles, erhob sich halb, verharrte dann aber, weil ihm etwas eingefallen war und da Birthe noch in ihrer Tasche nach dem Portemonnaie kramte: „Könnte man aus dem Umstand, dass du anscheinend niemanden über deinen spontanen Entschluss informieren musst, heute Abend nicht zu Hause zu speisen, sondern mit einer unvermittelten, fast könnte man sagen: Straßenbekanntschaft in einem beschaulichen Restaurant zu tafeln, schließen, dass du bislang noch nicht in den Hafen…“ Anton machte eine kleine Pause und runzelte die Stirn.
„Bin gespannt, ob du diesen Satz korrekt zu Ende führen wirst…“ Birthe lächelte schnippisch.
Anton liebte es, wenn Gesprächspartner und Situation stimmten, Sätze zu formulieren, deren fehlerfreie Niederschrift den meisten Menschen Probleme bereiten würde. Ironie und Sarkasmus in seiner Stimme ließen seine Dialogpartner aber in der Regel schmunzelnd verstehen, dass er seine Sprachspielchen nur zur eigenen und allgemeinen Erheiterung betrieb.
„…dass du bislang noch nicht in den Hafen…“ Anton nahm den Satzfaden wieder auf. „…der Ehe eingelaufen oder in die Zwangsjacke einer festen Beziehung gesteckt worden bist? Um nicht zu fragen: Bist auch du solo?“
„Das hast du aber schön formuliert!“ Ihre kleine Stichelei kam bei Anton wohl an. Gleichwohl äffte er den Gepriesenen.
„Um es so zu sagen…“ Birthe sprach im gleichen schwülstigen, aufgesetzten Ton, in dem sich Anton soeben zu formulieren beliebte: „Aus dem Umstand, dass ich zu Hause niemanden anrufen muss, ist erst mal nicht zu schließen, dass ich solo bin. Ich wohne nämlich alleine. Und aus der Tatsache, dass ich mit dem Thema feste Beziehung noch nicht so durch bin, wie du das anscheinend bist, und es auch niemals zu sein gedenke, umgekehrt auf eine derzeitige feste Bindung zu schließen, wäre…“ Jetzt musste sie kurz überlegen, um noch die syntaktische Kurve zu kriegen. „… wäre logisch ebenso nicht zulässig. Gleichwohl…“ Birthe lächelte triumphierend. „…ich bin solo!“
„Na, dann nichts wie weg.“
Sie zahlten, er lud sie ein, am Tresen. Birthe musste noch mal kurz um die Ecke. Als sie zurückkam, sah sie genauso aus wie in dem Moment, als Anton sie vor bald drei Stunden zum ersten Mal sah.
„Vielleicht ist die Polente noch im Viertel. Man kann nie wissen.“ Sie flüsterte Anton im Vorbeigehen und hinter vorgehaltener Hand geheimnistuerisch ins Ohr.
Anton war fast ein bisschen stolz auf sie, als er hinter ihr das Café verließ – und auch auf sich. Mit einer so schönen, polizeilich gesuchten Frau – Letzteres spann er sich zumindest zusammen – durchs Viertel zu flanieren, das hatte schon was. Wenn ihm jetzt nur noch einfallen würde, wer im Film Bonnie war und wer Clyde.
II. Schanzenviertel
Als Anton Mitte der 1980er-Jahre in das Hamburger Schanzenviertel zog, war es ein ganz unspektakulärer, fast ruhiger Stadtteil im Grenzgebiet zwischen St. Pauli und Altona, den beiden zum Hafen hin orientierten Stadtteilen der Hansestadt schlechthin, unweit der etwas weiter östlich gelegenen Universität. Es existierte viel alte Bausubstanz und billiger Wohnraum mit entsprechendem Publikum: Arbeiter, Rentner, Studenten, Migranten. Es gab viele Eckkneipen und einige damals noch sogenannte Studentenkneipen; türkische Imbisse und traditionelle griechische, italienische und portugiesische Lokale, in denen man gut und preiswert essen konnte und noch immer kann: das La Sepia, das Romana oder das Olympische Feuer; viele türkische Gemüsehändler, Allerweltströdler, Gebrauchtwarenläden, Zeitungskioske, eine kleine Druckerei und manches an Kleingewerbe in den Hinterhöfen; schließlich einige besetzte Häuser und eben das autonome Stadtteilzentrum Rote Flora. Das Stadion des FC St. Pauli am Millerntor liegt nur ein paar Hundert Meter von der Südgrenze des Viertels entfernt. Damals war der FC St. Pauli noch eine linkschaotische Tresenmannschaft, wie manch Nostalgiker noch heute behauptet – vielleicht nicht ganz zu Unrecht. Ex-Torwart Volker Ippig wohnte immerhin einige Zeit in den besetzten Häusern der Hamburger Hafenstraße.
Wie auch immer, man war und ist im Viertel multikulturell, liberal und im Zweifelsfalle links. Noch.
Anfang Mitte der 1990er-Jahre wandelte sich der Stadtteil, der sich kurz nach der Jahrtausendwende zu dem Szeneviertel Hamburgs entwickelt hat, zunächst kaum merklich. Viele Chronisten des Viertels behaupten, der Zuzug des Personals der sogenannten New Economy im Kontext des Internet-Booms Mitte bis Ende der 1990er-Jahre sei die Ursache dieses Wandels: Billiger, zentral gelegener Wohn- und Gewerberaum war bei diesem Personal in jenen Zeiten äußerst beliebt, als man noch nicht wissen konnte, auf welch unglaublicher Erfolgswelle man kurze Zeit später reiten würde.
Anton erlebte diesen Wandel aber ganz anders. Der Zuzug der hornbebrillten, glattgescherten, laptopbewehrten Artdirectors und Softwareentwickler war Folge bestimmter vorläufiger Entwicklungen und nicht umgekehrt. Früher gab es im Schanzenviertel nur ein einziges Straßencafé, und das auch erst seit 1982 – das Unter den Linden. Man saß damals im verregneten, nasskalten Hamburg einfach nicht draußen, zumindest nicht im Viertel. Das änderte sich im Laufe der 1990er-Jahre Schritt um Schritt, als ein sogenannter Jahrhundertsommer den anderen zu jagen begann. Südländische Temperaturen ließen schnell südländische Lebensart folgen.
Anton war zwar gebürtiger Berliner. Das Berlinerische beherrschte er noch immer perfekt und sprach es vor allem, wenn er unter Freunden und in lockerer Stimmung war. Aber er war nach der Flucht seiner Familie aus Ostberlin kurz vor dem Mauerbau 1961 in Süddeutschland am Bodensee gestrandet und aufgewachsen und kannte es nicht anders, als von Anfang Mai bis Ende September nach Möglichkeit unter freiem Himmel zu sitzen – nachmittags am See und abends am See oder im Biergarten.