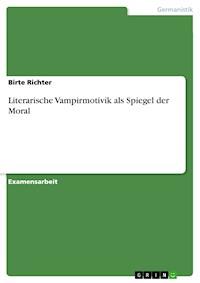Vom Monster zum Teenieschwarm. Der Wandel des Vampirs in "Twilight", "Vampire Diaries" & Co E-Book
Birte Richter
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ScienceFactory
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ob Edward Cullen oder die Salvatore Brüder – die Zeiten sind vorbei, in denen Vampire als schreckliche Monster galten. Die attraktiven Blutsauger aus Büchern, Filmen und TV-Serien wie „Twilight“, „Wir sind die Nacht“ oder „Vampire Diaries“ begeistern ein breites Publikum, vor allem aber die Jugend. Der Vampir ist somit gesellschaftsfähig geworden, er füllt Bücherregale und Kinosäle und erfreut sich einer stets wachsenden Fangemeinde. Dieser Sammelband illustriert den medialen Hype um den Vampir anhand populärer Bücher, Serien und Filme, stellt den historischen Kontext zur Vergangenheit her und zeigt den Wandel einer ehemals gefürchteten Kreatur hin zum Teenieschwarm. Aus dem Inhalt: Der Vampirismus in Literatur und Filmen und seine Fans Was fasziniert Jugendliche am Vampir-Genre? Wie hat sich das Bild des Vampirs über die Jahrhunderte verändert?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 614
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Impressum:
Lektorat: Vanessa Middendorf
Copyright © 2015 ScienceFactory
Ein Imprint der GRIN Verlag, Open Publishing GmbH
Druck und Bindung: Books on Demand GmbH, Norderstedt, Germany
Coverbild: Andrey Kiselev - Fotolia.com
Vom Monster zum Teenieschwarm
Birte Richter: Literarische Vampirmotivik als Spiegel der Moral
Einleitung
Die Texte
Ernährungs- und Konsumverhalten
Religion nach der Aufklärung
Zusammenfassung der Ergebnisse
Ausblick
Literaturverzeichnis
Kristof Beuthner: Blutsauger zwischen Emanzipation und Konservativismus: Umcodierung von Genrekonventionen in den Vampirromanen von Stephenie Meyer und Wolfgang Hohlbein
Einführung
Der Vampir in Literatur und Legende
Präsentation der verwendeten Primärliteratur
Vergleich der beiden Romane
Zur Rezeption der Romane von Meyer und Hohlbein
Fazit und Ausblick
Literatur- u. Quellenangaben
Kathrin Fäller: „And it’s all there” – Intertextual Structures, Themes, and Characters in Stephenie Meyer’s „Twilight“ Series
Introduction
Methodology
Directions in Research
Man of Feeling, Byronic Hero and the Nineteenth-Century Vampire
Intertextual Structures, Themes, and Characters in the Twilight Series
The Twilight Saga – An Intertextual Summary
Conclusion
Bibliography
Jennifer Vogt: The Image of Vampires in the TV Series „The Vampire Diaries“
Introduction
The Image of Vampires in Contemporary Fiction
Plot and Important Characters of The Vampire Diaries
The Image of Vampires in The Vampire Diaries
Conclusion
Bibliography
Einzelbände
Birte Richter: Literarische Vampirmotivik als Spiegel der Moral
2009
Einleitung
Die Belletristik in der ersten Dekade des gegenwärtigen Jahrtausends hat den Vampirismus als Thema in den Blick genommen. Nach dem Erfolg der Bücher von Anna Rice vor der Jahrtausendwende, die dem Thema auch außerhalb der Sparten-Literatur wieder Aufmerksamkeit verschafft haben, steht nun die Reihe Twilight von Stephenie Meyer monatelang unter den ersten Plätzen der Bestsellerlisten.[i] Neu ist diese Präsenz des Vampirismus in der Belletristik nicht. lm Gegenteil, schon vor mehr als 200 Jahren tauchten die ersten Vampire in der Literatur auf, und seitdem haben sie mehrere Hochphasen durchlebt.
Dracula dürfte kaum einem Menschen völlig unbekannt sein und ist inzwischen beinahe ein Synonym für „Vampir“. Was aber ist es, das die Faszination des Blutsaugers ausmacht, ihn einerseits für die wissenschaftliche Rezeption interessant macht, ihm andererseits eine breite Leserschaft beschert, die in Teilen ohne weiteres als Fangemeinde bezeichnet werden kann? Es wird argumentiert, dass es gerade die Vereinigung von teilweise gegensätzlichen Prinzipien sei, die dem Vampir zu seiner Popularisierung verholfen habe; die Vereinigung aller „großen“ Themen, die das Mensch-Sein betreffen: ewiges Leben und Tod; Ekstase, Sexualität und Depression, Melancholie; Religion und Wissenschaftsglaube (Lecouteux 2001, S. 12). Darin inbegriffen sind gerade auch - je nach Zeitalter mehr oder weniger stark – tabuisierte Themen, wie Tod und Sterblichkeit, die durch den Untoten, der andere tötet, stets angesprochen sind und die häufig im Vampir mit einem weiteren Tabu verknüpft auftreten: Sexualität, insbesondere auch von der gesellschaftlichen Norm abweichende, deviante Sexualität. Mit dieser Verbindung zwischen Liebe und Tod greift der literarische Blutsauger ein typisches Topos der Schwarzen Romantik auf. Ebenso sind häufig Parallelen zu den dekadenten Figuren des Fin de Siecle oder den „Helden“ der englischen gothic novel auszumachen. Derartige Epochen- bzw. Genrebezüge werden hier jedoch weitestgehend unbeachtet gelassen.
ln dieser Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit es vor allem das ldentifikationspotential der Vampirfigur für das „moralisch Falsche“, für „das Böse“ ist, das der Mensch in sich selbst findet und fürchtet, das ihn aber gleichzeitig - mal mehr, mal weniger heimlich - fasziniert. Schon hier wäre ein erstes Moment des „falschen“ Empfindens auszumachen: Es gehört sich laut „common sense“ nicht, vom „Bösen“ fasziniert zu sein.
Ein weiteres und vielleicht das bedeutendste Themenfeld ist die Sexualität mit ihren verschiedenen Ausprägungen. Mit Sicherheit ist dies das Thema, das bereits am ausführlichsten durch die Literaturwissenschaft untersucht worden ist. Es wird auch in dieser Arbeit am meisten Raum einnehmen. Welch einen großen Stellenwert die Sexualität (auch unabhängig von Vampiren in der Literatur) in der Moral einnimmt, wird dadurch verdeutlicht, dass der Artikel „Moral und Sitte“ im Lexikon der Ethik von Höffe (Hrsg.) (1997) es für notwendig erachtet, ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass „Moral und Sitte“ keineswegs ausschließlich auf Fragen dieses Themenkomplexes zu beschränken sind:
Moral und Sitte stellen den für die Daseinsweise des Menschen konstitutiven (keinesfalls auf Fragen der Sexualität beschränkten) normativen Grundrahmen für das Verhalten vor allem zu den Mitmenschen, aber auch zur Natur u[nd] zu sich selbst dar. M[oral] u[nd] S[itte] [...] bilden im weiteren Sinn einen [...] Komplex von Handlungsregeln, Wertmaßstäben, auch Sinnvorstellungen (Höffe 1997, S. 204).[ii]
Als weitere Aspekte der Moral neben der Sexualität sollen hier bezüglich des „Verhaltens zur Natur“ Ernährungs- und die Tierethik betreffende Fragen behandelt werden. Bezüglich der „Wertmaßstäbe“ und der „Sinnvorstellungen“ soll auf das Schwinden der Religiosität und die Folgen eingegangen werden. Dabei kann der Begriff der „Moral“ in diesem Zusammenhang natürlich auch auf Vampire (statt Menschen) bezogen werden, was in der oben angeführten Textpassage selbstverständlich nicht angesprochen ist. Die Übertragung ist einfach möglich, weil der Vampir schließlich einmal Mensch gewesen ist und deshalb die als Mensch erlernten Wertmaßstäbe mit in sein untotes Leben, im Folgenden auch als „Unleben“ bezeichnet, bringt. Der jeweilige Stand der Forschung bezüglich vampirischer Literatur wird dabei in die einzelnen Kapitel einfließen, ohne ein jeweils eigenes Kapitel zu beanspruchen. Die Arbeit unterscheidet dabei zwischen den Texten des 18./19. und denen des 20. Jahrhunderts, da sich die moralischen Vorstellungen zu verschiedenen Themen selbstredend geändert haben. Moral und Sitte seien von „inneren Spannungen“ nicht frei, so Höffe (1997, S. 204). Gerade diese inneren Spannungen sind es, die die Thematik für die Literatur interessant machen. Da solche Veränderungen der geltenden Moralvorstellungen sich natürlich nicht schlagartig von einem Jahrhundert zum nächsten vollzogen haben, ist die Unterscheidung eher als grobe Richtlinie zu verstehen. Die Texte, deren Entstehung in das noch sehr junge 21. Jahrhundert fällt, werden dabei der Einfachheit wegen zu denen des 20. Jahrhunderts gezählt. Diese Vereinfachung ist unproblematsich, da die relevanten Wertmaßstäbe in der westlichen Kultur, auf welche hier Bezug genommen wird, sich innerhalb des letzten Jahrzehnts nicht tiefgreifend verändert haben. Die Fülle an Texten, in denen Vampire eine (Haupt)rolle spielen, ist inzwischen nahezu unüberschaubar.
Diese Arbeit stellt also nicht im Entferntesten einen Anspruch auf Vollständigkeit. Gerade die jüngeren Texte füllen häufig gleich mehrere Bände, in denen dieselben Protagonisten wieder auftauchen. Je nach Zusammenhang werden diese Bücher hier dennoch als Einzelwerke oder im Kontext der ganzen Reihe aufgefasst. Ebenso variiert das Bild, das vom Vampir gezeichnet wird, in verschiedenen Texten sehr stark. Pütz (1992, S. 78f) listet einige „Varietäten“ der Körperlichkeit der Vampirfigur auf: Er könne besonders abstoßend aussehen, wie etwa bei Byron (The Giaour) oder auch ganz besonders hübsch sein wie bei Polidori (The vampyre) oder Gautier (La morte amoureuse). Tolstois Upyr hingegen sehe gänzlich unauffällig und keineswegs bemerkenswert aus. ln Turgenjews Prizraki tauche der Vampir überhaupt nur noch als Nebel auf, während er bei Maupassant (Le Horla) schlicht unsichtbar sei. Es ist damit allerdings auch deutlich, dass es schwierig sein kann, abzugrenzen, welche Figuren noch unter den Begriff des Vampirs gefasst werden sollen und welche nicht. Dementsprechend ist es ebenso schwierig, abzugrenzen, welche Texte zur Vampirliteratur gezählt werden sollen und welche einem anderen Zweig zuzuordnen sind. Den „Prototyp“ des literarischen Vampirs hat jedoch sicherlich Stoker mit seinem Dracula geprägt und damit dem überdurchschnittlich gut, wenn auch gleichzeitig unheimlich aussehenden Blutsauger zur größten Popularität verholfen. Diese Arbeit bleibt bei Texten, deren Vampire relative nahe an diesem Bild sind, die also einen eher „klassischen“ Vampir zeichnen. Dazu gehört im Wesentlichen, dass der Vampir Blut trinkt, über einen menschlichen Körper verfügt und sich möglichst nicht dem Sonnenlicht aussetzt. Allerdings weichen selbst von diesen nur wenigen Voraussetzungen bereits einige der hier angesprochenen Untoten ab. Eine genaue Definition dessen, was unter dem Begriff „Vampir“ verstanden werden soll, gestaltet sich also recht schwierig. Sie ist für die Verständlichkeit dieser Arbeit aber auch nicht unverzichtbar. Es ist an dieser Stelle genug, als ausschlaggebendes Merkmal zu akzeptieren, dass die betreffenden Kreaturen irgendwo im Text als „Vampir“ bezeichnet werden oder die oben genannte Mindestmenge an Genre-Regeln für den „klassischen“ Vampir erfüllen.
Zu Gunsten der besseren Lesbarkeit wird bei der Erwähnung von Personengruppen auf das Ausschreiben beider Genera sowie auf ein Binnen-l verzichtet. Soweit es nicht aus dem Zusammenhang anders hervorgeht, ist die Verwendung der maskulinen Formen verallgemeinernd gemeint und das weibliche Geschlecht eingeschlossen. lm Folgenden sollen die ausführlicher zur Sprache kommenden Texte respektive ihre Hauptcharaktere kurz vorgestellt werden.
Die Texte
Dracula
1897 erschien erstmalig der wohl bekannteste Vampirroman überhaupt: Dracula von Bram Stoker. Der Text ist durchweg in Form von Briefen oder Tagebuchaufzeichnungen gefasst. Die Handlung, kurz zusammengefasst: Zunächst reist Jonathan Harker nach Transsilvanien um dort den Grafen Dracula zu besuchen und ihm bei den Vorbereitungen seines geplanten London- Besuches zu helfen. Er muss jedoch bald feststellen, dass er auf dem Schloss gefangen gehalten wird. Außerdem wird er Zeuge seltsamer Geschehnisse: So sieht er den Grafen kopfüber auf allen Vieren eine Mauer hinablaufen, etwa so, wie Spinnen sich an Wänden bewegen. Spätestens als er mit ansehen muss, wie drei auf dem Schloss lebende Frauen vom Grafen mit einem Kleinkind „gefüttert“ werden, ist Jonathan klar, dass er in höchster Gefahr schwebt. Letzlich gelingt ihm jedoch die Flucht und er wird zunächst in ein Krankenhaus eingeliefert. Dem Grafen gelingt derweil seine Reise nach London mittels eines Schiffes. Er trinkt hier über einen längeren Zeitraum mehrmals von Lucy Westenra, welche darauf mit Schlafwandeln und allgemeiner Schwäche reagiert. Lucys Verlobter Arthur Holmwood konsultiert den Arzt Dr. John Seward. Dieser wiederum ruft Professor Abraham van Helsing aus Holland zur Hilfe, zumal Dr. Seward sehr mit seinem Patienten Renfield beschäftigt ist, welcher von dem Gedanken besessen zu sein scheint, an die Spitze einer möglichst langen Nahrungskette zu gelangen. So verbringt er einen guten Teil seiner Zeit damit, Fliegen anzulocken und zu fangen, um sie an Spinnen zu verfüttern, welche er dann selbst verspeist – jedenfalls solange ihm nicht ein Tier, zum Beispiel eine Katze, überlassen wird, welches er mit den Spinnen füttern könnte. Langsam kommen schließlich der inzwischen zurückgekehrte Jonathan und seine Verlobte Mina Murray, die auch eine sehr gute Freundin Lucys ist, Arthur, Dr. Seward und Prof. van Helsing dem Geheimnis des Grafen auf die Spur. Eine wichtige Rolle spielen dabei die zahlreichen Tagebuchaufzeichnungen, Briefe und Tonaufnahmen mittels eines Phonographen, welche ebenfalls verschriftlicht werden. Jonathan und Mina beherrschen die Stenographie, sodass der enorme Aufwand an Schreibarbeit, den sie schon betreiben bevor klar wird, welch wichtigem Zweck er später dienlich sein wird, weniger unwahrscheinlich scheint. Es gelingt ihnen dennoch nicht, Lucy zu retten, obwohl sie gleich mehrmals Blut gespendet bekam. Nach ihrem Ableben wird sie schließlich selbst zum Vampir und muss deshalb getötet werden. Der Graf, der sich nach Lucy nun auch an Mina verköstigt hat, fühlt sich letztlich von der Jagd auf ihn so bedrängt, dass er die Flucht ergreift. Unter anderem deshalb, weil Mina nun geistig mit ihm verbunden ist, gelingt es dennoch, ihn in der Nähe seines Schlosses zu stellen und zu töten. Die drei auf seinem Schloss verbliebenen Vampirinnen werden ebenfalls getötet. Mina, welche bis dahin selbst schon erste Anzeichen der Vampirhaftigkeit zeigte, ist mit dem endgültigen Ableben des Grafen Dracula dagegen gerettet.
Carmilla
Die Novelle Sheridan Le Fanus erschien 1872. Sie erzählt die Geschichte der zum Zeitpunkt des Geschehens 19jährigen Laura, welche mit ihrem Vater und dem Dienstpersonal, aber ohne weitere Familie in guten Verhältnissen - gar in einem Schloss - lebt. Sie fühlt sich jedoch häufig einsam. Zusätzlich verstirbt Bertha, eine junge Frau aus dem benachbarten, aber entfernt liegenden Schloss, die für längere Zeit zu Besuch kommen sollte, unerwartet. Umso mehr erfreut es Laura, als es sich ergibt, dass eine dritte junge Frau namens Carmilla für drei Wochen bei ihr und ihrem Vater leben wird, da Carmilla einen Unfall mit der Kutsche erlitt und nun nicht die Reise mit ihrer Mutter zusammen fortsetzen kann. Carmilla fühlt sich stark hingezogen zu Laura und tut dies ihr gegenüber auch kund, wobei sie oft recht rätselhafte Dinge von sich gibt, im Zusammenhang mit ihrer Zuneigung auch oft von Lauras Tod spricht. Laura sind diese Äußerungen Carmillas unangenehm und auch die körperlichen Zuwendungen ihrer neuen Gefährtin sind ihr eigentlich nicht lieb; sie fühlt sich dennoch nicht in der Lage, diese zu unterbinden. Trotz dieser Umstände werden die zwei Frauen sehr enge Freundinnen. Carmilla fällt jedoch durch einige weitere Eigenarten auf. So ähnelt sie zum Beispiel bis ins Detail der längst verstorbenen Gräfin Mircalla Karnstein, einer Ahnin Lauras. Sie reagiert gereizt auf die Ausübung christlicher Rituale, konkret auf den Gesang bei einer Beerdigungsprozession, in welchen Laura einfällt. Und sie schläft über Tag sehr viel und einem Wanderer, der ins Schloss kommt, um Waren zu verkaufen, fallen ihre besonders scharfen und spitzen Zähne auf. ln der Umgebung des Schlosses häufen sich im Laufe der Zeit, die verging, seit Carmilla auf dem Schloss einzog, rätselhafte Todesfälle junger Frauen, welche oft zuvor von nächtlichen Alpträumen bzw. Heimsuchungen berichteten. Ein Zusammenhang zu Carmilla wird aber hier noch nicht erkannt. Schließlich wird - wie sie glaubt - auch Laura nachts von Alpträumen geplagt, in welchen sie von einer Art großer Katze gebissen wird, die dann zu einer Frau wird und ihr Zimmer verlässt, wobei sie einfach verschwindet, ohne dass die von innen verriegelte Schlafzimmertür entriegelt würde. Von dieser Nacht an fühlt sie sich zunehmend matt und schwach. Eines Nachts träumt sie, von ihrer verstorbenen Mutter vor einer Mörderin gewarnt zu werden. Sie sieht dabei Carmilla blutbesudelt an ihrem Bett stehen. Laura deutet den Traum fehl und glaubt, Carmilla solle ermordet werden. Als sie daraufhin mit einigen Bediensteten das Zimmer ihrer Freundin aufsucht, stellen sie fest, dass Carmilla gar nicht dort ist. Da aber ihre Zimmertür von innen verriegelt war, wie Carmilla es immer zu tun pflegte, ist unklar, wie sie den Raum verlassen haben konnte. Auf einem Ausflug nach Karnstein erfahren Laura und ihr Vater von einer ganz ähnlichen Geschichte: General Spielsdorf, der sich dem Ausflug anschließt, erzählt, dass auch seine Nichte Bertha eine sehr enge Freundschaft mit einer Frau, welche vorübergehend bei ihm und seiner Nicht untergekommen sei, verbunden habe. Diese Frau hieße Millarca. Seine Nichte habe außerdem ganz ähnliche Alpträume gehabt wie nun Laura. Auch die anderen Symptome decken sich mit denen Lauras. Nachdem ihm aber von einem Arzt gesagt worden sei, dass seine Nichte wahrscheinlich von einem Vampir heimgesucht werde, habe er feststellen müssen, dass dies gar keine Alpträume gewesen seien, sondern Realität. Er habe heimlich beobachten können, wie seine Nichte nachts von einem katzenartigen Wesen gebissen worden sei, welches sich dann in Millarca verwandelt und durch die geschlosssene Tür entschwunden sei. Seine Nichte sei kurz nach diesem Ereignis verstorben. Sie suchen schließlich das Grab der Gräfin Mircalla, welches sich in Karnstein befindet. Der genaue Ort ist aber unbekannt. Ein Holzfäller berichtet ihnen von einer früheren Heimsuchung durch Vampire und davon, wie man sie vernichten könne. Schließlich treffen sie Carmilla, die zuvor aufgefordert worden war, den Ausflüglern nachzukommen. General Spielsdorf versucht auf der Stelle sie zu töten, was jedoch misslingt. Bei einem zweiten, besser geplanten Versuch, gelingt dies aber, zumal inzwischen das Grab der Gräfin Mircalla gefunden worden war. Die Gräfin respektive Carmilla respektive Millarca wird gepfählt, geköpft und verbrannt. Laura kann Carmilla niemals ganz vergessen.
Die Braut von Korinth
Die Braut von Korinth ist eine im Jahre 1797 erschienene Ballade von Goethe. Sie erzählt von einem jungen Mann, der zu Gast bei einer Familie ist, deren Tochter er als Mann versprochen ist. Er kommt spät am Abend an und wird von der Hausherrin beköstigt und einem Zimmer zugewiesen. Als er sich erschöpft auf das Bett legt, tritt eine junge Frau in den Raum. Sie ist erschrocken, einen Fremden dort vorzufinden und möchte sogleich wieder gehen. Er überredet sie jedoch zu bleiben, zumal er denkt, die junge Frau vor sich zu haben, die er heiraten wird. Sie erklärt ihm jedoch, dass er ihre Schwester ehelichen werde, während sie, zu ihrem großen Bedauern, ins Kloster geschickt werden würde, um dort ein in jeder Hinsicht enthaltsames Leben zu führen. Dies habe ihre Mutter, die vom „Heidentum“ zu einem neuen Glauben gewechselt sei, ihrem neuen Gott – dem christlichen - als Gegenleistung für ihre Genesung von einer Krankheit geschworen. Der junge Mann verspricht ihr, dies Schicksal nicht zuzulassen und lädt sie ein, die Nacht bei ihm zu verbringen. Es kommt zu Zärtlichkeiten, wobei auffällt, dass sie beharrlich verweigert vom Abendessen zu kosten und außerdem unnatürlich kühle Haut hat. Schließlich tauschen die Liebenden kleine Geschenke aus, die als Versprechen auf Treue zu deuten sind. Unerwartet platzt jedoch die Hausherrin in die Situation, die durch die Geräuschkulisse misstrauisch geworden war. Die junge Frau macht ihrer Mutter sofort Vorwürfe, dass sie sie nicht nur „früh [...] in das Grab gebracht“ (Goethe 1997, S. 19) habe, sondern ihr nun auch noch diese eine schöne Nacht verderben wolle. Sie beklagt, dass die Mutter ihr Wort gebrochen habe, da sie dem Jüngling versprochen gewesen sei. Sie erklärt, dass sie in ihrem Grabe keine Ruhe finde und sich getrieben sehe, das Blut des für sie verlorenen Mannes zu saugen und ihn zu lieben. An eben diesen gewandt erklärt sie weiter, er müsse nun sterben. lhre Mutter bittet sie jedoch darum, ihren Sarg zu öffnen und sie zu verbrennen, um ihr so Ruhe zu verschaffen. So könne sie mit ihrem Geliebten „den alten Göttern zu[eilen]“ (Goethe 1997, S. 20). Goethes namenlose Braut ist nicht ganz klar als Vampir gekennzeichnet. Sie wird an keiner Stelle des Textes als solcher bezeichnet. Die Hinweise, die auf ihre Natur als blutsaugende Untote respektive Wiedergängerin deuten, sind jedoch klar genug, um sie als Vampirin aufzufassen.
Biss zum Morgengrauen und Midnight Sun
Biss zum Morgengrauen (Originaltitel: Twilight) ist der erste Band der insgesamt vierteiligen Twilight-Serie von Stephenie Meyer. Er erschien im Original erstmals 2005. Er erzählt die Romanze der 16-jährigen lsabella Swan und des Vampirs Edward Cullen. Sie besuchen die gleiche Schule im verregneten Forks, wobei Edward die Schule jedoch schwänzt, wenn in Forks doch einmal gutes Wetter herrschen sollte. lsabella ist neu auf der Schule. lhr fallen die Cullens aufgrund ihrer Blässe und ihrer lsolation von den anderen Schülern schnell auf. Von Edward, mit dem zusammen sie einen Biologie-Kurs besucht, ist sie fasziniert, fühlt sich von ihm aber unhöflich behandelt, da er sie ohne jeden Grund ignoriert und abzulehnen scheint. Als sie allerdings bei einem Unfall zu verunglücken droht, rettet er ihr das Leben, indem er ein auf sie zu schlitterndes Auto zum Stehen bringt. Sie ist verwirrt, weil sie sich trotz des Unfalls sehr gut erinnern kann, dass Edward erstens zum Zeitpunkt des Geschehens mehrere Meter von ihr entfernt stand und sie zweitens sicher ist, dass kein Mensch die Kraft haben könnte, ein außer Kontrolle geratenes Fahrzeug auf diese Art stoppen. Edward leugnet ihr gegenüber, etwas Übermenschliches vollbracht zu haben und begegnet ihr zunächst wieder sehr kaltschnäuzig. Von einem Tag auf den anderen ist er aber sehr freundlich zu ihr, was lsabella weiter verwirrt. Edward kommentiert sein Verhalten damit, dass er einfach keine Lust mehr habe, sich von ihr fernzuhalten, was für lsabella natürlich nichts wirklich erklärt. Von einem Bekannten aus einem lndianerreservat erfährt sie jedoch, dass sein Volk daran glaube bzw. früher daran geglaubt habe, dass die Cullens einer Art angehören, die im Prinzip als „Vampire“ bezeichnet werden könne. lsabella beginnt nun, sich über Vampire zu informieren. Da sie sich nun auch immer besser mit Edward versteht, ergibt sich irgendwann die Gelegenheit, ihn vorsichtig darauf anzusprechen. Edward gesteht, schon „eine Weile“ 17 Jahre alt zu sein (Meyer 2009, S. 195) und letztlich wird klar, dass er und seine Familie tatsächlich Vampire sind, die sich allerdings nicht von menschlichem Blut, sondern nur von dem wilder Tiere, die es in den umliegenden Wäldern zu Genüge gibt, ernähren. lsabella und Edward werden ein Paar und er erklärt, dass seine anfängliche Distanz darauf zurückzuführen sei, dass er das starke Bedürfnis gespürt habe, ihr Blut zu trinken und sie dabei zu töten. Nun verlange es ihn immer noch nach ihrem Blut und er könne sehr gut verstehen, wenn lsabella ihn nicht mehr wiedersehen wolle. Er rät ihr sogar dazu, sich von ihm fernzuhalten, obwohl er sie sehr gerne träfe und auch denke, sein Begehren ausreichend im Griff zu haben. lsabella hält jedoch an ihrer Beziehung fest. Edward stellt sie schließlich auch seiner Familie vor. Als lsabella die Cullens eines Tages zu einem Baseballspiel begleitet, welches die Vampire unter sich mit übermenschlicher Geschwindigkeit und übermenschlichem Krafteinsatz spielen, tauchen drei fremde Vampire auf, welche sich „traditionell“, also von Menschen ernähren. Einer von ihnen, James, betrachtet es als eine Art Zeitvertreib sich besonders schwer zu erjagende Opfer auszusuchen und diese dann zu überwältigen und zu töten. Da lsabella von anderen Vampiren geschützt wird, stellt sie eine besondere Herausforderung dar. lsabella muss schweren Herzens ihren Vater belügen und nach Phoenix fliehen. Mittels eines Tricks gelingt es James jedoch, sie in ein Balletstudio zu locken, wo er sie leiden lassen und schließlich töten möchte, wobei er diesen Vorgang auf Video aufnimmt. Er möchte das Material später Edward zeigen, um ihn dazu zu bringen, lsabella zu rächen, was er als unterhaltsam erleben würde. Es gelingt Edward jedoch, lsabella zu retten. Auch kann er sie davor bewahren, in Folge von James' Biss, durch welchen sie mit einer Art „Gift“ infiziert wurde, selbst zur Vampirin zu werden, indem er die Wunde aussaugt, etwa so, wie man bei einem Schlangenbiss Erste Hilfe leisten würde. Er schluckt ihr Blut dabei jedoch nicht. James wird derweil von seiner Familie getötet, sodass alle Cullens und lsabella wieder nach Forks zurückkehren können. Midnight Sun sollte die Ereignisse nochmals erzählen, dieses Mal jedoch aus der Sicht Edwards, während Biss zum Morgengrauen aus lsabellas Sicht geschrieben ist. Meyer schreibt jedoch an dem Roman nicht weiter, da Teile respektive Vorfassungen desselben bereits gegen ihren Willen im lnternet veröffentlicht worden seien. Die bereits verfassten Teile hat sie ihrer Leserschaft auf ihrer Homepage zur Verfügung gestellt (siehe Literaturverzeichnis).
Gespräch mit einem Vampir
Gespräch mit einem Vampir (Originaltitel: Interview with a vampire, auf Deutsch auch unter dem Titel Interview mit einem Vampir erschienen) ist der erste Band der insgesamt zehn Bände umfassenden Reihe Chronik der Vampire von Anne Rice. Das Buch erschien erstmalig 1976. ln dem Roman erzählt der Vampir Louis du Pointe du Lac seine Lebens- und Unlebensgeschichte einem Reporter. Er berichtet, dass er Ende des 18. Jahrhunderts aufgrund eines Schicksalsschlags lebensmüde gewesen sei, aber nie den Mut gehabt habe, sich selbst zu töten. Stattdessen sei der Vampir Lestat de Lioncourt auf ihn aufmerksam geworden und habe ihn schließlich auch zu einem Vampir gemacht. Es sei ihm sehr schwer gefallen, sich damit abzufinden, dass es nun zu seinem Leben gehören würde, Menschen zu töten. Eine Weile lang habe er sich ausschließlich von tierischem Blut ernährt, was ihm aber nie das gleiche gute Gefühl von Erfüllung gegeben habe. Als Louis eines Tages die Kontrolle über sich verliert und ein kleines, verwaistes Mädchen soweit leer trinkt, dass sie sterben würde, macht Lestat das Kind, Claudia, ebenfalls zu einer Vampirin. Louis, Lestat und Claudia leben mehrere Jahrzehnte als „Familie“ zusammen.
Claudia, deren Körper sich nicht weiterentwickelt, wird zunehmend unzufrieden und beginnt Fragen zu stellen. Sie und Louis hegten schon länger den Wunsch, Lestat zu verlassen, doch fehlte vor allem Louis bisher der Mut dazu. Claudia versucht, Lestat zu töten und zunächst scheint den beiden verbliebenen Vampiren, dass es gelungen sei. Sie planen, eine Reise auf unbestimmte Zeit anzutreten, auf welcher sie nach anderen Vampiren suchen wollen, um zu erforschen, wie es kommt, dass es Vampire gibt, wer der erste gewesen ist und welchem Sinn ihre Existzenz dient. Kurz vor ihrer Abreise stellen sie mit Erschrecken fest, dass Lestat keineswegs tot ist, sondern sich an ihnen rächen möchte. lhre Flucht gelingt ihnen, indem sie Lestat in Brand stecken. Ob er damit nun eindgültig tot ist, wissen sie nicht zu sagen.
Sie treffen nach langem Umherreisen in Paris auf eine Sippe von Vampiren, die gemeinsam ein Theater betreiben. Sie lernen den inoffiziellen Anführer, Armand, kennen. Da Claudia fürchtet, Louis an Armand zu verlieren, überredet sie Louis, für sie eine Gefährtin zu erschaffen, Madeleine. Eines Tages jedoch werden die drei von den Vampiren des Theaters überfallen und des versuchten Mordes an Lestat, der inzwischen ebenfalls in Paris eingetroffen ist, angeklagt. Claudia und Madeleine werden dem Tageslicht ausgesetzt und damit getötet. Louis ist tief getroffen und zündet aus Rache das Theater der Vampire an, sodass der größte Teil von ihnen verbrennt. Armand war jedoch von ihm gewarnt worden, sich in näherer Zeit dort aufzuhalten, sodass er bei dem Brand nicht zu Schaden kommt. Armand und Louis reisen nun gemeinsam umher und kehren schließlich in Louis' Heimat Lousiana zurück. Sie haben sich jedoch immer mehr voneinander entfremdet. Kurz bevor Armand Louis zurücklässt, um wieder eigener Wege zu gehen, gesteht er ihm, dass er maßgeblich zur Hinrichtung Claudias beigetragen habe, um sie nicht als Konkurrentin um Louis' Gunst zu haben. Louis war dies jedoch immer schon klar gewesen, auch wenn Armand es bis dato geleugnet hatte.
Der kleine Vampir
Der kleine Vampir ist sowohl der Titel des ersten Teils als auch der gesamten zwanzigteiligen Kinderliteratur-Reihe von Angela Sommer-Bodenburg, wobei die Teile neun bis sechszehn auch unter dem Namen Anton und der kleine Vampir erschienen sind. lm ersten Teil wird geschildert, wie der Menschenjunge Anton Bohnsack das Vampirkind Rüdiger von Schlotterstein und seine Geschwister kennenlernt. Dies geschieht recht unspektakulär dadurch, dass Rüdiger eines Abends, als Anton allein zu Hause ist, ganz einfach durch Antons Fenster in sein Zimmer kommt. Die beiden Kinder unterhalten sich; da Anton sich sehr für Gruselgeschichten und damit auch für Vampire interessiert, fehlt es nicht an Gesprächsstoff. Da Rüdiger beteuert, dass er bereits gegessen habe, legt sich auch Antons anfängliches Misstrauen schnell, obwohl er auch in Zukunft noch häufiger ein gewisses Unbehagen in der Gegenwart des kleinen Vampirs empfinden wird. Rüdiger leiht sich ein Buch von Anton aus, sodass schon allein deswegen feststeht, dass die beiden sich wiedertreffen müssen, damit Anton sein Eigentum zurück erhält. Bei dieser Gelegenheit bringt Rüdiger Anton auch gleich einen Umhang mit, der es auch dem Menschenkind möglich macht, zu fliegen. Von jetzt an stehen regelmäßigen Ausflügen der beiden an Samstagabenden, an denen Antons Eltern fast immer ausgehen, nichts mehr im Wege.
Rüdiger stellt Anton schließlich auch seiner jüngeren Schwester Anna vor und als Anton ihn eines Abends sogar in seine Familiengruft begleitet, lernt er auch seinen älteren Bruder Lumpi kennen, vor dem er allerdings Angst hat. Anna hingegen scheint noch harmloser als Rüdiger, da sie sich nur von Milch ernährt. Dafür bringt sie ihn häufiger durch ihre romantischen Schwärmereien in Verlegenheit. Probleme stellen sich ein, als Antons Eltern Antons neue Freunde kennenlernen möchten und sie zum Tee einladen. Zunächst lädt Anton einfach einen anderen Jungen zu sich ein, den er dafür bezahlt, sich als Rüdiger auszugeben. Der Schwindel fliegt jedoch bald auf. Auf die erneute Einladung seiner Eltern hin, kommen Rüdiger und Anna tatsächlich zum Tee - wenn auch erst nach Einbruch der Dunkelheit. Die Bohnsacks empfinden die neuen Freunde ihres Sohnes zwar durchaus als recht eigenartig und fragen sich auch, in was für Verhältnissen diese Kinder wohl aufwachsen mögen, geben sich aber letztlich mit allen Erklärungen, die Anton abgibt, zufrieden. ln den folgenden Teilen der Reihe meistern Anton, Rüdiger und seine Geschwister verschiedene Schwierigkeiten. Dabei spielt es stets eine Rolle, vor Antons Eltern zu verbergen, dass Rüdiger und Anna echte Vampire sind. Schließlich ist es sicherer für Vampire, wenn keiner an sie glaubt. Noch wichtiger ist es allerdings, die Freundschaft zwischen Anton und Rüdiger sowie seiner Schwester vor Rüdigers Familienmitgliedern zu verheimlichen, da diese zum einen von einem Heißhunger überfallen werden und Anton beißen könnten und da es zum anderen für Vampirkinder verboten ist, mit Menschen befreundet zu sein.
Brennen muß Salem
Stephen Kings Brennen muß Salem (Originaltitel: Salem's Lot) erschien erstmalig 1975. Es erzählt die Geschichte des Schriftstellers Ben Mears, der nach Jahren in seine Heimatstadt Jerusalem's Lot zurückkehrt. Er plant, dort ein altes Haus zu mieten, das den Bewohnern seit jeher als Spukhaus gilt. Auch Ben will dort schon als Kind den ehemaligen Bewohner des Hauses gesehen haben, obwohl dieser zum betreffenden Zeitpunkt schon seit Jahren tot war. Ben stellt zu seinem Erstaunen jedoch fest, dass das Haus trotz seines Rufes schon vermietet ist. Über den Mieter, Mr. Barlow, ist jedoch wenig bekannt. Er und sein Mitarbeiter Mr. Straker scheinen den Bewohnern des Städtchens ebenso unheimlich wie das Haus selbst. Bald darauf kommt es in der Stadt gehäuft zu seltsamen Todesfällen. Außerdem verschwindet ein Kind spurlos. Ben hatte sich bereits zuvor für die ungewöhnlichen Mieter interessiert, zumal sie ihm seine Pläne, das Spukhaus zu mieten, durchkreuzt hatten. Er untersucht nun aber auch die seltsamen Unglücksfälle und stellt bald eine Verbindung her. Jedoch ist er nicht alleine, nach und nach bekommt er Hilfe von verschiedenen Seiten. So machen sich schließlich er, seine Freundin Susan Norton, ein zehnjähriges Kind namens Mark, ein Priester, ein Arzt und ein Lehrer, die inzwischen allesamt an Vampire glauben, an die Bekämpfung des als Vampir enttarnten Mr. Barlows. Es überleben jedoch nur Ben und Mark. Auch die Einwohner Jerusalem's Lots, die sich nicht an der Bekämpfung der Vampire beteiligt hatten, sind inzwischen allesamt tot oder aber selbst zu Vampiren geworden. Ben und Mark fliehen zunächst, kehren aber schließlich in ihre wie völlig ausgestorben wirkende Stadt – bei Tag ist sie es auch - zurück und brennen sie vollständig nieder, um so einer weiteren Ausbreitung des Vampirismus zuvorzukommen.
Sexualmoral und Liebe
Schon Mario Praz (1994, S. 90) geht in seinem Grundlagenwerk zur Schwarzen Romantik Liebe, Tod und Teufel am Rande auch auf den Vampir ein und stellt dabei fest, dass das „Liebesverbrechen“ ein „fester Bestandteil“ von Vampirgeschichten sei. Allein die Wortwahl „Liebesverbrechen“ weist darauf hin, dass Liebe – sowohl im Sinne von Partnerschaft als auch im Sinne von Sexualität – keineswegs von gesellschaftlichen Normvorstellungen und Reglementierungen ausgenommen ist. Die lnhalte dieser Vorstellungen mögen von Jahrhundert zu Jahrhundert sehr unterschiedlich ausgesehen haben, nie aber war die Liebe der Moral egal. Dabei ist jedoch zu beobachten, dass die Grenzen dessen, was gesellschaftlich „erlaubt“ ist, sich stets ausweiten. Zur Zeit der ersten Hochphase der Vampirliteratur, etwa in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, war körperliche Liebe in jeder Form noch ein sehr heikles, aber auch ambivalentes Thema; so sollte es [...] zu einer zunehmenden Verleugnung und Unterdrückung des „Sexualtriebes“ gekommen sein. Kulminieren würde diese Entwicklung in der angeblich umfassenden Prüderie des 19 Jahrhunderts, die einen fast undurchdringlichen Mantel des Schweigens über alles Sexuelle gebreitet hätte. Besonders Frauen galten als Opfer der bürgerlichen Sexualmoral, ihre sexuellen Begierden würden in den „bürgerlichen Jahrhunderten“ grundsätzlich negiert (Eder 2002, S. 11). Eder stellt diesem Bild jedoch ein „unter dem Mantel des Schweigens“ durchaus aktives, sexuelles Leben der Menschen entgegen. Bezüglich des sich wandelnden Frauenbildes schreibt er:
ln den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts [...] verstärkte sich der Druck auf die krisenanfälllige Geschlechts- und Geschlechteridentität des bürgerlichen Mannes.[iii] Bürgerliche und proletarische Frauen beanspruchten nun mehr zu sein als nur Ehegattin, Hausfrau und Mutter. [...] Nicht nur die öffentliche und politische Vormachtstellung der Männer wurde bedroht, auch die „Sexualitäts“-lnsignien der bürgerlichen Männlichkeit kamen unter Beschuss. Zu nennen ist insbesondere die bürgerliche Doppelmoral, die den außerehelichen Geschlechtsverkehr bei Männern zum Kavaliersdelikt erklärte, bei Frauen aber streng sanktionierte. Der rapide Wandel des Frauenbildes verwiese Wissenschaftler nun nicht mehr nur auf die kulturellen und biologischen Geschlechtsmerkmale, sondern auf deren potentielle Antipoden (Eder 2002, S. 168).[iv]
ln Folge dieser gesellschaftlichen Umwälzungen, die sicherlich mit einer Art „Wachstumsschmerzen“ verbunden gewesen sein mögen, bestand hier ein besonders hoher „Abarbeitungsbedarf“. Da gleichzeitig Sexualität aber nach wie vor stark tabuisiert war, brauchte es hier einen Umweg - über die Literatur und den Vampir. Die Geschlechtlichkeit „schlich [...] in die Gruselgechichten zur Hintertür herein - chiffriert, entstellt und pervertiert“ (Meurer 1996, S. 69). Der Biss des Vampirs wurde dabei zum Symbol für einen dem Zeitempfinden nach „verqueren“ und „unnatürlichen“ Sexualakt. Vor allen Dingen Stokers Dracula ist immer wieder in diesem Licht gelesen worden. Daneben werden aber auch andere, von der Norm abweichende Formen von Sexualität im Rahmen des literarischen Vampirismus angesprochen. lndirekt ist in jedem Fall die Nekrophilie angesprochen, insofern, dass ein Vampir ein (un)totes Wesen ist und als Untoter Teil am Tod hat. Nach dem gleichen Muster lässt sich dieses Argument aber entschärfen: Als Untoter hat der Vampir genauso auch Teil am Leben. Zu welcher Seite das Pendel nun ausschlägt, hängt vom jeweiligen Text ab. Gerade weil der Vampir spätestens seit Dracula fest mit Erotik und Sexualität konnotiert ist und daher automatisch in diesem Licht gesehen und gelesen wird, sind auch weitere Formen von gesellschaftlicher Norm abweichender Sexualität, die durch den Blutsauger thematisiert werden, erkennbar. Dies sind zum Beispiel Homosexualität, BDSM, Pädophilie und lnzest.
Heterosexuelle Kontakte unter Erwachsenen und die Rolle der Frau
Lucy
ln der Forschungsliteratur immer wieder angeführt wird die Vampirin Lucy aus Stokers Dracula und mit der Emanzipationbewegung in Verbindung gebracht. Pütz (1992, S. 66) schreibt, dass „konservative Kreise [...] zutiefst erschüttert“ auf solche Bestrebungen der Frauen Anfang der neunziger Jahre des 19. Jahrhunderts reagiert hätten. Dabei seien es weniger die Forderungen nach Emanzipation in Bezug auf Bildungs- und Berufschancen oder das Ausüben von Tätigkeiten, die bis dahin für Frauen nicht gängig gewesen waren, wie zum Beispiel Fahrrad fahren, die „erschütterten“. Vielmehr sei es die „Forderung nach sexueller Gleichberechtigung“ und „die Ablehnung von Ehe und Mutterschaft“ (Pütz 1992, S. 66) gewesen, die den Kritikern als eine Bedrohung der Gesellschaftordnung erschienen sei. So interpretiert Klemens (2004, S. 102) Lucys Schlafwandeln nach dem Biss Draculas als beginnenden Freiheitsdrang; sie suche, das Haus zu verlassen, ihrer geplanten Ehe zu entgehen und damit symbolisch auch den geltenden Werten und Normen zu entfliehen. Das bedeutet, dass sie gemäß den Vorstellungen ihrer Zeit und Gesellschaft unmoralisch handelt. lhr Tun wird deshalb in das Böse, das Dämonische hineingeschoben: Sie ist nicht länger eine Frau, sondern fortan ein Vampir, dessen offenes Begehren und lustvolles Ausleben desselben, nicht toleriert werden kann. So wird ihre Verwandlung von ärztlicher Seite ausschließlich negativ bewertet, gleichzeitig aber auch ausdrücklich auf ihre Sexualität bezogen; Dr. Seward spricht von „voluptuous wantonness“, „voluptuous smile“, „wanton smile“ und „voluptuous grace“ (Stoker 1994, S. 252f, vgl. auch Pütz 1992, S. 55). Nicht ausdrücklich auf Sexualität bezogene Folgen der Emanzipationsbewegung werden hingegen durchaus honoriert; so äußert sich Professor van Helsing zu Minas Leistungen bezüglich ihrer Hilfe bei der lückenlosen Dokumentation der „vampirischen“ Ereignisse positiv, allerdings nicht ohne diese Eigenschaft gleichzeitig als „männlich“ zu markieren: „Ah, that wonderful Madame Mina! She has man's brain [...]“ (Stoker 1994, S. 281, vgl. Pütz 1992, S. 67). Pütz sieht hier bestätigt, dass es speziell die sexuelle, nicht die finanzielle und intellektuelle Emanzipation ist, die verunsichert. Nach Klemens (2004, S. 23) ist der Vampir unter anderem deshalb eine Gefahr für die viktorianische Gesellschaft, weil er Geschlecht als „bloßes soziales Konstrukt“ entlarve. Der Vampir sei quasi eingeschlechtlich, da er sich – egal ob zu Lebzeiten männlich oder weiblich – auf die gleiche Art fortpflanze: mittels Biss. Diesen Gedanken fortführend kann das Gebiss, speziell die vampirischen Fangzähne, als das Geschlechtsorgan des Vampirs betrachtet werden, welches in der Tat bei allen Vampiren gleich ist. Noch dazu sind die Zähne zur Penetration dienlich, (darüber hinaus sogar stets zur Penetration bereit, also gewissermaßen dauer-“erigiert“). Und sie treten paarweise auf, so wie etwa die Schamlippen der Frau. Sie erfüllen damit Definitionsbedingungen beider primärer Geschlechtsorgane und unterwandern so zusätzlich die klare Einteilung in zwei Geschlechter. Brittnacher (1994, S. 143) weist auf das Bild der „Vagina dentata“ hin und darauf, dass die Lippen der literarischen Vampirinnen häufig als „blutrot“ beschrieben werden würden, was an sich eher unschlüssig sei, da Vampire ansonsten einen recht blassen, blutleeren Teint hätten. Das Bild des Ein-Geschlechtsorgans aber wird durch diesen Umstand bestätigt. Gleichzeitig gelingt es aber dem Mann auch, sich mit dem Vampir ein rein weibliches Refugium zu erobern: Das Stillen ihres Nachwuchses (vgl. Klemens 2004, S. 75). Dies ist überall dort der Fall, wo Vampire explizit dadurch geschaffen werden, dass zunächst ein Mensch annähernd „leer“ und bis an die Schwelle des Todes getrunken wird und anschließend vom vampirischen Blut kosten darf oder muss. Aber auch in Dracula, einem Text, der nicht eindeutig sagt, was geschehen muss, damit ein Mensch zum Vampir wird, findet sich eine vergleichbare Szene. Hier ist allerdings nicht Lucy das Opfer, sondern Mina. Der Graf zwingt sie von seinem Blut zu trinken. Dabei öffnet er ihr nicht etwa einfach sein Handgelenk, was wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit wäre, sondern er nützt seine Brust zu diesem Zwecke - „[...], and with his long sharp nails opened a vein in his breast“ - und führt ihren Kopf an die Wunde, das heißt, er legt sie quasi an: „He took my hands in one of his [...] and with the other seized my neck and pressed my mouth to the wound“ (Stoker 1994, S. 343). Die Grenzen dessen, was „weiblich“ und was „männlich“ ist, werden durch den „stillenden“ männlichen Vampir also noch stärker verwischt als dies schon allein der Fall durch die Fortpflanzungsfähigkeit der bezahnten Vampirin ist. Der Eingeschlechtlichkeit und ihrem Status als Wesen, das weder Mensch noch Tier ist entsprechend verwundert es auch nicht, dass Lucy im Text häufiger als „thing“ bezeichnet wird (Stoker 1994, S. 252, 258, vgl. Klemens 2004, S. 116). Auf der Ebene des Textes sind die Gefahren, die von einer Vampirin ausgehen, natürlich handfester: Vampire töten Menschen oder erschaffen andere Vampire. Lucy vergreift sich gar an unschuldigen Kindern, womit sie natürlich die der Frau zugedachte Rolle als liebende, umsorgende Mutter direkt in ihr Gegenteil verkehrt. Folglich muss Lucy - selbstredend durch Männer, denn Mina, die bis zu diesem Punkt bereits ganz selbstverständlich wertvolle Hilfe geleistet hatte, wird explizit ausgeschlossen (Stoker 1994, S. 281, 289) - wieder in das soziale Gefüge eingepasst, das heißt hier: vernichtet werden. Einen Vampir vernichtet man, indem man ihn pflockt. Klemens (2004, S. 114) sieht hier wiederum einen symbolischen Geschlechtsakt, dieses Mal jedoch nicht mit Vampirzähnen, sondern mit einem Pflock, im Text als „mercy bearing stake“ (Stoker 1994, S. 259) bezeichnet, als Phallussymbol. Es fügt sich harmonisch in das Bild, dass die Nacht der Vernichtung Lucys eigentlich ihre Hochzeitsnacht mit ihrem Verlobten Arthur gewesen wäre und dass van Helsing ausdrücklich erklärt, es stehe Arthur zu, den Pflock in Lucys Herz zu treiben (vgl. Stoker 1994, S. 257). Klemens (2004, S. 114) betont die auffällige Ähnlichkeit zwischen der Reaktion Lucys Körper auf den Pflock und einem Orgasmus[v]:
„The thing in the coffin writhed; [...] The body shook and quivered and twisted in wild contortions;“ (Stoker 1994, S. 258f).
Dabei entspräche jedoch Lucys Pfählung einer Vergewaltigung und diese bedeute letztlich das Zurückweisen Lucys auf die angemessene Frauenrolle (vgl. auch Brittnacher 1994, S. 150). Die Tötungsszene Lucys ist deshalb als Vergewaltigung aufzufassen, weil sie dem Geschehen nicht zustimmt und auch nicht in der Lage ist, Zustimmung oder Ablehnung Kund zu tun. Da die Penetration ihres Körpers mit einer Verletzung desselben und sogar mit ihrem Ableben einhergeht, darf angenommen werden, dass sie nicht einverstanden ist.
Wie wichtig es ist, sie wieder gesellschaftlich einzuordnen - selbst um den Preis ihres endgültigen Todes - wird klarer, wenn man bedenkt, dass bei der Entstehung des Textes einige Jahrhunderte hindurch die Vorstellung herrschte, dass „die göttliche Strafe für die 'Unkeuschheit' nicht nur den Einzelnen, sondern das gesamte Kollektiv treffen würde“ (Eder 2002, S. 58). Es ist somit verständlich, dass die Vampirin Lucy auf der Textebene zu einer Gefahr für die Gesamtgesellschaft werden muss, während ihr persönliches Unglück in den Hintergrund tritt. Für den Aspekt der Tötung Lucys lohnt es sich, noch einmal auf die Szene einzugehen: Ganz wie ein Bräutigam seine Braut küsst Arthur seine gepflockte und nun also nicht mehr länger untote „Gattin“ auf Geheiß van Helsings - in der Rolle des Pastors - und ganz als würden Braut und Bräutigam fortan zusammen leben, übergibt van Helsing den Schlüssel zu Lucys Gruft ihrem „Gatten“ Arthur Holmwood (Stoker 1994, S. 260). Aber nicht nur die Forschungliteratur, sondern auch die Belletristik selbst geht im Sinne der lntertextualität auf eine solche Deutung der Tötungsszene Lucys ein. ln dem Roman Das Licht und der Schlüssel. Erziehungsroman eines Vampirs (1984) von Adolf Muschg fasst der Museumswärter van Helsing - nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Figur Stokers - die Handlung Draculas wie folgt zusammen:
Fünf Männer jagen zwei Frauen. Eine Frau wird zur Strecke gebracht, die andere verhaftet - verheiratet wollte ich sagen. Diese fünf Männer kämpfen mit verteilten Rollen. Vier geben sich als feine Leute aus, ein englischer Psychiater, ein englischer Advokat und ein amerikanischer Selfmademan. Für besondere Operationen ziehen sie einen holländischen Wundermann zu, Professor van Helsing. Der fünfte, genannt Dracula, spielt den bösen Feind, das teuflische Ungeheuer. Aber im Grunde wollen sie alle dasselbe: Die Frauen fertigmachen. [...] Das Buch schildert einen Zweifrontenkrieg gegen den wahren Feind, der zwei Brüste hat und einen Schoß: unkontrollierbar, unverzeihlich. Eine einzige Zangenbewegung gegen den verfluchten Sex. Die Frau ist der Wunsch, und Wünsche dürfen nicht sein (S. 290f).
Hier wird auf ironische Weise deutlich gemacht, dass Lucy und Mina mindestens so gut als Opfer einer patriarchalen Gesellschaft wie als gefährliche Dämonen lesbar sind - zumindest wenn man den Text nicht so lese, „wie der Autor meint, es gemeint zu haben“. Denn „geschrieben hat er etwas ganz anderes“ (Muschg 1984, S. 291, vgl. Ruthner 2005, S. 34). Selbst über Tag, wenn die Vampirin sich vollständig passiv verhält, scheint von ihrer bloßen weiblichen Körperlichkeit Gefahr für den Mann auszugehen. So schreibt van Helsing – jetzt wieder Stokers van Helsing - über die drei Vampirinnen auf Draculas Schloss:
[M]any a man who set forth to do such a task as mine, found at the last his heart fail him, [...]. So he delay, and delay, and delay, till the mere beauty and the fascination of the wanton Un-Dead have hypnotise him; and he remain on [...] and the Vampire sleep be over. Then the beautiful eyes of the fair woman open and look love, and the voluptuous mouth present to a kiss - and man is weak (Stoker 1994; S. 439).
So erklärt es sich auch, dass das „fachgerechte“ Pfählen im Falle Draculas den Vampirjägern nicht nötig zu sein scheint. Dracula wird ein Messer, kein Pflock, ins Herz gestoßen. lnsgesamt wird diese Szene von Stoker nicht annähernd so detailliert und ausführlich geschildert wie Lucys Tötung (vgl. Stoker 1994, S. 447). Ein ganz ähnliches Schicksal wie Lucy ereilt auch Carmilla aus der gleichnamigen Erzählung von LeFanu (1872 erstmalig erschienen).
Brennen muß Salem vor dem Hintergrund Draculas
Der Text von King weist eindeutige Parallelen und Bezüge zu Dracula auf. Schon die Tatsache, dass aus Sicht der Menschen geschrieben wird, während die Vampire kaum mehr zu Wort kommen als Dracula auch, weist auf die größere Nähe zu Stokers Roman als zu denen des 20. Jahrhunderts wie die Chronik der Vampire oder Twilight hin. Ganz ähnlich wie bei Stoker wird auch in Brennen muß Salem eine junge Frau, Susan, die zuvor als eine der Hauptcharaktere eingeführt worden war, zur Vampirin gebissen und muss schließlich durch ihren Lebenspartner Ben gepflockt werden. Während in Dracula van Helsing nur symbolisch die Rolle eines eheschließenden Priesters einnimmt, ist im Falle Susans tatsächlich ein Geistlicher, Pater Callahan, anwesend, der Ben treibt und überredet, seiner schönen, untoten Freudin den Pflock ins Herz zu stoßen: „'Seien Sie ihr Liebhaber', sagte Callahan sanft. 'Oder besser, seien Sie ihr Mann. Sie werden sie nicht verletzen, Ben. Sie werden sie befreien.'„ (King 1996, S. 380f). Der Leser wird schließlich durch Bens eigene Worte auf den Bezug zu Stokers Dracula hingewiesen, Ben zitiert gedanklich daraus. Auch Susan reagiert wie Lucy mit heftigen Bewegungen auf das Eindringen des Pflocks, jedoch erinnert hier weniger an einen Orgasmus als dies bei Stoker der Fall ist:
Sie wand sich auf dem Tisch. lhre Hände kamen hoch, flatternd wie Vögel, und schlugen blindlings in die Luft. lhre Füße trommelten ziellos und ratternd ein Muster in das Holz der Plattform. lhr Mund öffnete sich weit und gab erschreckende, wolfsähnliche Fänge frei, und sie begann, einen gellenden Schrei nach dem anderen auszustoßen. Es klang wie die Trompeten der Hölle. Blut quoll in kleinen Bächen aus ihren Mundwinkeln. [...] Die Taschenlampe in Jimmys zitternden Händen wurde zu einem Stroboskop, das Susans verzerrtes, hin und her zuckendes Gesicht in kurze, grelle Blitze tauchte. lhre Zähne durchbohrten die Lippen und rissen sie in Fetzen. Blut spritze auf das frische Leintuch, [...] (King 1996, S. 382).
Die Begriffe „blindlings“ und „ziellos“, sowie der Umstand, dass sie sich, wie der Leser annehmen darf, versehentlich selbst verletzt, das heißt, sich die Lippen „in Fetzen“ reißt, verweisen auf Susans Hilflosigkeit. Sie ist nicht in der Lage, regulierend in das Geschehen einzugreifen. Sie hat nicht einmal über ihren eigenen Körper mehr Kontrolle. Die „gellenden Schreie“, die „wie die Trompeten der Hölle“ klingen, verdeutlichen, dass sie leidet. Dass sie auch aus dem Mund blutet - obwohl ihr dort keine Verletzung zugefügt wird - macht sie etwas menschlicher, da es ihren Organismus als ein zusammenhängendes System, wie man es von Menschen kennt, ausweist, nicht als unbelebtes „Ding“. Entsprechend wird Susan auch weiterhin bei ihrem Namen genannt und nicht als „Ding“ bezeichnet. Zusätzlich verdeutlicht die mehrmalige Erwähnung von Blutungen die Gewaltsamkeit, mit der ihr begegnet wird.[vi] Eine weitere Ähnlichkeit der beiden Romane findet sich darin, dass es jeweils eine ganze Gruppe von Menschen sind, die sich aufmachen, ein „Vampir-Oberhaupt“, Graf Dracula in Dracula und Mr. Barlow in Brennen muß Salem, sowie die „Folgevampire“ unschädlich zu machen. Für Stoker sind dies Arthur, Jonathan, van Helsing, Dr. Seward und Mina als einzige Frau, die jedoch letztlich auch ausgeschlossen wird. Kings Gruppe ist etwas bunter zusammengewürfelt und arbeitet vielleicht deswegen nicht so erfolgreich und fein aufeinander abgestimmt zusammen. Es handelt sich hier um Ben, Susan, Mark, Pater Callahan, Matt Burke und Dr. Cody, also um vier Männer, eine Frau und ein Kind von zehn Jahren. Eben die beiden Personen, deren „Äquivalent“ bei Stoker entweder von der eigentlichen Vampirjagd ausgeschlossen wird oder die schlicht kein „Äquivalent“ haben, sind hier diejenigen, die gewissermaßen am beherztesten vorgehen: Während die Männer noch Pläne schmieden - vergleichbar der Dracula-Jagdtruppe, machen Susan und Mark sich auf den Weg zum Marstenhaus, in dem der mutmaßliche Vampir Mr. Barlow und sein Helfershelfer Mr. Straker leben, um ihnen ein Ende zu bereiten (vgl. King 1996, S. 321ff). Der Erfolg lässt jedoch zu wünschen übrig. Weder Barlow noch Straker werden getötet, dafür wird Susan zum Vampir gebissen. Mark kann nur knapp entkommen. Letztlich überleben aus jeder der zwei „Untergruppen“ - Frauen und Kinder versus Männer - je einer: Ben und Mark.
Trotz der Parallelen zu Stoker kann Kings Roman aber nicht in gleicher Weise verstanden werden. Während in Dracula neben der Titelfigur ausschließlich Vampirinnen thematisiert werden, tauchen in Brennen muß Salem auch andere männliche Vampire und auch Kinder als Vampire auf. Es wird keine solche Beschränkung auf die Begierden von Frauen respektive Vampirinnen vorgenommen. Entsprechend wird deutlich mehr auf das „geheime“, private Leben der Bewohner Jerusalem's Lots eingegangen, in welchem schon vor dem „Einfallen“ der Vampire in die Stadt nicht alles „heile Welt“ gewesen ist. So erfährt der Leser in einer längeren Aufzählung dessen, was die Bewohner des Städtchens alles nicht wissen, zum Beispiel, dass Reverend John Groggins nachts in seinen Träumen „bei der Bibelstunde [...] nackt und feucht vor den kleinen Mädchen steht, die allesamt willig und bereit sind“ und „daß der zehn Monate alte Randy McDougall sich nicht einmal wehrte, als Danny Glick [...] seine Zähne in einen [Randys] Hals grub, der noch grün und blau war von den Schlägen einer [Randys] Mutter“ (King 1996, S. 244). Hier werden also die nicht-ausgelebte sexuelle Phantasie eines Mannes, die tatsächliche Kindesmisshandlung durch die Mutter und das Trinken eines Vampirs in eine Reihe gestellt, wobei die Anwesenheit der Vampire in der Stadt nicht in einem Kausalzusammenhang für die anderen Manifestationen „des Bösen“ zu sehen ist. Der Vampir ist, anders als bei Stoker, nicht das nach außen verlagerte „Böse“, das die bis dato „reinen“ Menschen zum Beispiel mit gesellschaftlich nicht akzeptiertem sexuellem Verlangen „ansteckt“, sondern nur eine von vielen, ganz alltäglichen lnkarnationen „des Bösen“.
Edward und Isabella
Mit der Jugendromanreihe Twilight von Stephenie Meyer hingegen wird eher eine an sich nicht „zu verdammende“ Sexualitiät junger Menschen angesprochen; der Schwerpunkt liegt hier jedoch auf der Wahl des richtigen Zeitpunktes für das „erste Mal“ bzw. das Hinauszögern oder gänzlicher Verzicht desgleichen. So erleben die sterbliche, siebzehnjährige lsabella und der Vampir Edward, im Alter von siebzehn Jahren gestorben und somit äußerlich ebenfalls diesem Jugendalter entsprechend, zwar eine sehr romantische erste Liebe, sind sich jedoch beide einig, dass eine zu große körperliche Nähe oder gar tatsächlich sexuelle Kontakte in jedem Falle Tabu seien, da die Gefahr bestehe, dass Edward sein Verlangen - dem Buchstaben nach sein Verlangen nach ihrem Blut – nicht mehr zügeln und der zarten, zerbrechlichen lsabella Schaden zufügen könne. Da aber ein großer Teil der Faszination ihrer jungen Beziehung in eben diesem Spiel von Nähe und Distanz liegt, kann der Text durchaus als ein „Hoch“ auf die Enthaltsamkeit gelesen werden. lsabella und Edward scheinen sich denn auch unausgespochen einig darüber zu sein, dass Sexualität etwas ist, das in die Ehe gehört. Als lsabella danach fragt, ob Heirat und Ehe unter Vampiren „genauso wie bei Menschen“ (Meyer 2009, S. 325) sei, erwidert Edward: „lch würde sagen, im Grunde ist es dasselbe. Wie gesagt, die meisten menschlichen Verlangen haben wir auch, [...]“ (Meyer 2009, S. 326). Der Text bleibt hier sehr vage. Es wäre denkbar, dass Edward auf typische Hochzeits-Rituale wie das Zerbrechen von Geschirr anspielt. Offenbar ist ihm aber intuitiv klar, dass lsabellas Frage sich nicht auf diese Dinge bezog, sondern, dass dann, wenn - und wie unterstellt werden darf, nur dann - wenn über Heirat und Ehe gesprochen wird, über Sexualität gesprochen werden kann. lsabella bleibt auch weiterhin sehr indirekt, scheint sich zu scheuen, offener über Sexualität zu sprechen. Auf Edwards Frage nach dem Grund für ihre Neugier antwortet sie ausweichend: „Naja, ich hab mich schon gefragt ... ob du und ich ... irgendwann mal ...“ (Meyer 2009, S. 326). Erst im weitereren Verlauf des Gespräches wird deutlicher, dass das junge Paar über erotische, körperliche Nähe spricht - und zu dem Ergebnis kommt, dass sie verzichten müssen. Edward tritt aber nicht nur als Retter vor seinen eigenen Begehrlichkeiten auf, bezeichnenderweise rettet er lsabella auch vor einer drohenden Vergewaltigung durch vier Männer (vgl. Meyer 2009, S. 170ff). Außerdem berichtet er, in ähnlicher Weise bereits früher agiert zu haben: „[...] Was war denn so schlimm daran, dachte ich, wenn ich einem Mörder in eine dunkle Gasse folgte und ein junges Mädchen vor ihm rettete?“ (Meyer 2009, S. 358). Das Motiv des verhinderten Mörders in seinem sexuellen Begehren zu sehen, bleibt hier zwar allein dem Leser überlassen, scheint jedoch naheliegend. Aber nicht nur vor sterblichen Männern, auch vor anderen Vampiren muss lsabella von Edward gerettet werden, auch wenn sie in diesem Falle nicht als Selbstzweck begehrt wird, sondern als Mittel dient, Edward zu „ärgern“ und herauszufordern. lndirekt ist also wiederum Edward selbst der Grund für die Gefährdung lsabellas. Edward ist letztlich ein in sein Gegenteil gekehrter Dracula, insofern, dass er nicht etwa junge Frauen mit „sexuellem Begehren ansteckt“, sondern das gleiche eher zügelt und ausdrücklich vor Gefahren warnt. Die Gefahr geht hier nicht etwa von sexuell aktiven Frauen aus, sondern Frauen sind potentielle Opfer männlicher Gewalttäter - oder enthemmter Vampire. Auch die weiblichen Vampirfiguren in Biss zum Morgengrauen treten nicht als Gewalttäterinnen auf, womit sie vielen anderen Vampirinnen des 20. Jahrhunderts entgegenstehen (vgl. Klemens 2004, S. 305f).
Homosexualität
Begriffsbestimmung
Unter Homosexualität soll hier jede sexuell konnotierte Handlung gefasst werden, die unter erwachsenen Menschen (respektive Vampiren) desselben biologischen Geschlechts stattfindet. Da der Biss des Vampirs stets sexuell konnotiert ist, wird hier also auch jede „vampirische“ Handlung, wie etwa Beißen, von Vampir zu Mann, von Vampir zu Vampir, von Vampirin zu Frau oder von Vampirin zu Vampirin als „homosexuell“ aufgefasst. Dies kann von einer kurzen Begegnung bis zu einer lebens- oder unlebenslangen Partnerschaft reichen. Dass die gleiche Figur an anderer Stelle entsprechende Verhaltensweisen im Umgang mit gegengeschlechtlichen Personen zeigt, soll damit keineswegs ausgeschlossen werden.
Weibliche Homosexualität – Carmilla
Das bisher zu Lucy Gesagte trifft im Wesentlichen ebenso auf Carmilla zu. Sie wird von einer Gruppe von Männern gejagt und schließlich getötet. Sie verfügt mit ihrem vampirischen Gebiss über eine „Vagina dentata“, kann also penetrierend sein, sich selbstständig fortplanzen. Dieser Umstand scheint besonders wichtig, da Eder (2002, Seite 78) schreibt, dass sich in vielen Gesetzestexten des 17. bis 18. Jahrhunderts keinerlei Hinweise auf eine Strafbarkeit homosexueller Handlungen unter Frauen finden - anders als in Bezug auf Männer. Er begründet dies damit, dass Sex ohne Penetration nicht als „richtiger“ Sex gedacht wurde und Frauen, die schließlich über kein „Penetrationsorgan“ verfügten, folglich ohne einen Mann keinen „richtigen“ Sex haben könnten. Erst die Psychologisierung, die die herrschende Kriminalisierung der Homosexualität mehr und mehr ersetzte, habe den Blick im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts auch auf sexuelle Handlungen unter Frauen gelenkt (vgl. Eder 2002, Seite 166). Klemens (2004, S. 175) spricht einen anderen Aspekt an. Sie betont zunächst auch, dass sehr enge, aus heutiger Sicht durchaus als „homoerotisch“ zu bezeichnende Beziehungen zwischen Frauen im Viktorianismus nicht selten und gesellschaftlich akzeptiert gewesen seien. Dies habe sich jedoch in den 1870er Jahren geändert, da Frauen nun anfingen, sich gemeinsam zu bilden. Diese Weitergabe von Wissen sei für das Patriarchat eine sehr viel größere Bedrohung gewesen als die bis dahin als „harmlos“ empfundenen Frauenfreundschaften, die noch nicht in den Verdacht geraten waren, mit der sexuellen Emanzipation der Frau in Verbindung zu stehen, sodass sie nun sehr viel genauer unter die Lupe genommen und kontrolliert werden mussten.
Es macht somit auch Sinn, dass die Vampirin Carmilla (ebenso wie Lucy) nicht nur gepflockt, sondern auch geköpft werden muss - der Kopf stellt den „Hort“ des Wissens dar. Zu der erzwungen Penetration wird ihr nun auch dieses entrissen. Die Frage, ob die Vampirin zur Penetration fähig ist oder nicht, ist also an sich schon von Bedeutung. Carmilla ist darüber hinaus aber eine Frau, deren Begehren und Fordern sich auf eine andere Frau bezieht. lst eine Vampirin an sich schon gefährlich, weil sie dem Weiblichen erlaubt, sich ohne den Mann fortzupflanzen, so ist eine lesbische Vampirin es doppelt, weil sie nun auch zum Lustgewinn nicht mehr auf Männer angewiesen ist. Aus ihrer Sicht ist der Mann vollständig überflüssig geworden. Klemens (2004, S.170) merkt an, dass wahrscheinlich sowohl Lucy als auch Carmilla körperlich stärker sind als ihre Opfer und dennoch bedienen sie sich - zumindest zunächst - lieber ihrer Verführungskünste anstelle von roher Gewalt. Dieser Umstand legt nahe, dass Lustgewinn neben dem „unlebensnotwendigen“ Gewinn von Blut für die Vampirin durchaus erstrebenswert zu sein scheint. Um zu schließen, dass Carmilla lesbisch ist, bedarf es keiner sehr großen Phantasie. Sie selbst spricht an, dass sie sich wenn überhaupt, dann in Laura verlieben werde: „lch war niemals verliebt und werde mich auch niemals verlieben, [...] es sei denn in dich. (LeFanu 1997, S.359).“ Carmilla selbst liefert indirekt eine Rechtfertigung für ihre Existenz und damit auch für die Amoralität ihres verlangenden, aktiv fordernden Wesens: So sei die Welt und alles in ihr nicht etwa von Gott, sondern von der Natur geschaffen. Nichts sei in ihr, das nicht ihren Gesetzen gehorche. Auch Krankheit sei somit eine natürliche Sache. Carmilla bezeichnet aber auch die Schwächeanfälle Lauras sowie ihren eigenen früheren, vergleichbaren Zustand, der, wie der Leser annehmen darf, auf das Wirken eines Vampirs zurückzuführen ist, als Krankheit, also als natürlich (vgl. LeFanu 1997, S.355, vgl. auch Klemens 2004, S. 191). Diese aufgeklärte, „moderne“ Ansicht mag allerdings so manchen ihrer konservativeren Zeitgenossen eher zusätzlich beunruhigt haben. Ebenso wie Mina aus Dracula kann auch Laura gerettet werden. Anders als Carmilla ist Laura sehr passiv und wenig informiert. So erzählt sie, dass ihr Carmillas Avancen nicht genehm sind, sie sich aber auch nicht zu entziehen weiß:
lch gebe zu, daß ich mich diesen törichten Umarmungen, zu denen es übrigens nicht sehr oft kam, gern entzogen hätte; aber mir fehlte die Kraft dazu. lhr Flüstern klang mir wie ein Wiegenlied, lähmte meinen Widerstandswillen und versetze mich in einen tranceähnlichen Zustand, aus dem ich erst erwachte, wenn sie die Arme sinken ließ. (LeFanu 1997, S. 347).
Laura ist manchmal durch Carmillas forderndes Wesen so verwirrt, dass sie gar in Betracht zieht, dass es sich bei Carmilla um einen Mann handeln könnte:
Oder handelte es sich gar um eine romantische Verkleidungsaffäre? ln alten Geschichten hatte ich von solchen Dingen gelesen. Hatte vielleicht ein kindischer Bewunderer, unterstützt von einer alten, schlauen Abenteurerin, den Weg in unser Haus gefunden, um mir in Frauenkleidern den Hof zu machen? (Le Fanu 1997, S. 349).
Dies bestätigt, wie schlecht Carmilla ihre Rolle als Frau erfüllt und sich gleichzeitig Elemente der Männerrolle aneignet. Sie ist in dieser Hinsicht geradezu das Gegenteil zu Laura und muss deshalb sterben.
Louis und Lestat
Ein sehr bekanntes gleichgeschlechtliches „Vampirpärchen mit Tochter“ aus der jüngeren Literatur bilden Louis, Lestat und Claudia aus Gespräch mit einem Vampir von Anne Rice. Allerdings gilt es zunächst zu zeigen, inwiefern die beiden männlichen Vampire als Paar aufgefasst werden können, denn sie werden im Text nicht als solches bezeichnet. Louis weist aber auf eine entsprechende Assoziation seinerseits hin:
„[Lestat] streckte sich neben mir auf den Stufen aus, mit so anmutigen Bewegungen, daß ich an einen Liebhaber denken mußte“ (Rice 1994, S. 23).
Den ersten Tag nach Louis' Vampirwerdung durch den morgendlichen Biss Lestats, der auf dem Hintergrund der stets mitgedachten Assoziation von Vampirbiss und Erotik als Hochzeitsnacht aufgefasst werden kann, teilen Louis und Lestat sich auch prompt einen Sarg - anstelle eines Ehebettes (vgl. Rice 1994, S. 26, vgl. Klemens 2004, S.229). Von Romantik allerdings keine Spur - Lestat scheint eher ein Heiratsschwindler denn ein zärtlicher oder leidenschaftlicher Liebhaber zu sein. So unterstellt Louis ihm, er habe vor allem sein Geld und seine Plantage, also Louis' besseren (Un)lebensstandard haben wollen (vgl. Rice 1994, S. 20, S.22). Mit der Einführung der dritten Hauptfigur, Claudia, werden Lestat und Louis nicht nur zu einer gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft, sondern auch zu einer darauf aufbauenden Familie. Dabei sind jedoch Tendenzen der beiden männlichen Figuren auszumachen, in jeweils eine der zwei möglichen traditionellen Rollen zu schlüpfen, aber zwischen diesen zu springen. Klemens (2004, S. 38) fasst dabei Louis als den Part auf, der in eine „typische Frauenfalle“ geraten sei, was auch auf Lestats Rolle als Heiratsschwindler bezogen werden kann, von Klemens jedoch nicht so gemeint ist, während Lestat als „familiärer Gewalttäter“ zu lesen sei. Auf diesen Aspekt wird das folgende Kapitel zurückkommen.
Weitere Parallelen zu einer sterblichen Menschenfamilie sieht Klemens (2004, S. 230) in der Erschaffung Claudias, an der wie bei einer natürlichen Elternschaft zwei lndividuen beteiligt gewesen seien und darin, dass Claudias Verwandlung in einen Vampir für Lestat mit Schmerzen, Blutverlust und anschließender Erschöpfung verbunden ist - wie bei einer Säuglingsgeburt (vgl. Klemens 2004, S. 222). Darüber hinaus kann festgestellt werden, dass Claudias Erschaffung, (speziell das Trinken ihres Blutes), für Louis hingegen zunächst mit Lustgefühlen einhergeht - wie in der Regel bei der natürlichen Zeugung eines Kindes. Claudias Erschaffung entspricht der Zeugung und Geburt eines Kindes in einem Zug. Schon hier schwankt die Rollenverteilung zwischen Lestat und Louis frei: Louis ist derjenige, der in die „Frauenfalle“ tappt, aber auch derjenige, dem Geburtsschmerzen erspart bleiben. Lestat tritt als „familiärer Gewalttäter“ auf, also in einer Rolle, die im Allgemeinen als männlich aufgefasst wird, ist aber auch derjenige, der den Schmerz einer Gebärenden in Kauf nimmt und erträgt. Um im Bild der Säuglingsgeburt und anschließenden -pflege zu bleiben, kann das Trinken-Lassen Claudias aus seinem Handgelenk als Stillvorgang bezeichnet werden. Er entspricht also in dieser Hinsicht der sorgenden Mutter ganz gut. lm Vorfeld der Zeugung Claudias greift Lestat diesen Aspekt selbst auf:
„lch möchte ein Kind heute Nacht. lch bin wie eine Mutter ... ich möchte ein Kind“ (Rice 1994, S. 86).
Aber auch Klemens Auffassung des – männlich konnotierten – „familiären Gewalttäters“ ist nicht unbegründet. So berichtet Louis davon, von Lestat kurz nach Claudias Zeugung, also ausdrücklich im Kontext von Häuslichkeit und Familienleben, geschlagen worden zu sein:
Als ich [...] versuchte, seine Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, stieß er mich grob zur Seite. Er versetzte mir so einen Schlag, daß ich gegen die Wand taumelte. [...] Noch einmal wollte ich ihn zurückhalten, doch er drehte sich so schnell um, daß ich gar nicht sah, wie er nach mir schlug. lch sank auf einen Stuhl (Rice 1994, S. 89).