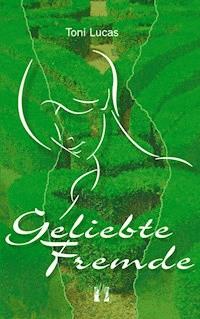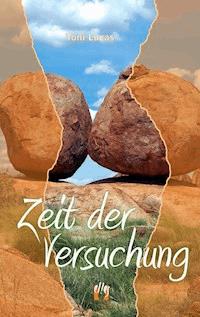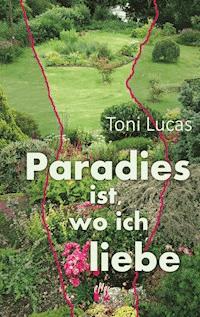Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: el!es-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach einem nicht ganz freiwilligen One-night-stand wird Lea aus ihrer bequemen, langjährigen Beziehung herauskatapultiert. Sie zieht in eine Kleinstadt, die trostloser nicht sein kann. Nur ihre verheiratete Kollegin Lilia bringt Farbe in den Alltag, und nach einiger Zeit mangelt es auch an Erotik nicht. Allerdings scheinen die beiden zunächst doch nicht füreinander geschaffen - oder müssen sie erst einmal auseinandergehen, um schließlich zueinander zu finden?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Toni Lucas
VOM TANZ DER PIERROTS
Roman
Originalausgabe: © 2008 ePUB-Edition: © 2013édition el!es
www.elles.de [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Ich musste weg, einfach nur weg. Raus aus meinem Leben, am besten sogar raus aus meiner Haut. Ich stand vor den Scherben meiner Existenz und war angeblich auch noch selbst schuld daran. Helen, mit der ich mehr als sechs Jahre zusammengelebt hatte, hatte mich mir nichts dir nichts vor die Tür gesetzt, meine Habe fein säuberlich in Kartons verpackt. Zumindest war ihr Ordnungstick einmal für etwas gut.
Dass sie aber auch gleich so ausrasten musste. Ausgerechnet Helen, die einem Flirt grundsätzlich nie abgeneigt war. Sie nannte es dezent »Meine Blicke schweifen lassen«. Nichts anderes hatte ich auch getan. Leider waren meine Blicke, und nicht nur die, hängengeblieben. Für Helens Geschmack offensichtlich ein bisschen zu lange.
Zu meiner Verteidigung kann ich anführen, dass mich lange keine Frau mehr derart angebaggert hatte wie jener corpus delicti. Dabei mag ich blond eigentlich grundsätzlich nicht, und Whiskey vertrage ich sowieso ausnehmend schlecht. Konnte ich denn ahnen, dass sich ausgerechnet die Frau meines Chefs in unserer Stammkneipe amüsieren wollte?!
An sich begann der Abend recht harmlos. Ich hing im Les Mesdemoiselles herum, meine holde Liebste amüsierte sich derweilen auf einem Zahnärztekongress. Der war zwar mit Anhang, aber in Kittelkreisen schien ich noch nicht mal als Anhang existieren zu dürfen. Allerdings konnte ich mich gar nicht offiziell darüber beschweren, galt ich doch an meiner Schule immer noch als die »junge« Kollegin – und das mit fünfunddreißig –, die kaum über ihr Privatleben sprach, anscheinend weil sie keines hatte. Ich war also auch nicht gerade eine Expertin in Sachen Outing am Arbeitsplatz.
Trotzdem wurmte es mich, dass Helen ausgerechnet diesen Abend sausen ließ. Ich hatte doch tatsächlich Karten für die Oper ergattert, noch dazu in der Prinzessinnenloge. Rote Samtvorhänge, nur Platz für zwei, Champagner und . . . seufz. Es hätte wirklich romantisch werden können.
Missmutig hing ich am Tresen, blubberte grantig in mein Rotweinglas und beobachtete die Anwesenden. Irgendwie schienen alle einschlägigen Bars einen fast inzestuösen Charakter zu haben. Jede kannte jede. Jede schien schon mal was mit einer der anderen gehabt zu haben oder kannte doch zumindest eine von denen, mit der die andere im Bett gewesen war. Neuzugänge wurden gierig beäugt, und Scharen von Beziehungssüchtigen stürzten sich auf sie.
Was für ein Glück, dass ich nicht mehr auf der Suche war. Seither saß ich hier viel entspannter. Knurr. Was Helen bloß immer an diesen dentalfixierten Häppchenvertilgern fand. Apropos Neuzugänge – heute gab es hier auffällig viele Damen um die Vierzig.
»Auch allein hier?«
Wow, auf so eine Anmache wäre ich ja nie gekommen. Wie originell. Sah ich etwa aus, als wäre ich mit meinem imaginären Freund Harvey hier?
Ich drehte mich in Richtung Stimme und wollte deren Besitzerin gerade mit Sarkasmus erschlagen, als ich mitten in der Bewegung innehielt. Oh, lecker. Ich schob mir meine obligatorische Schiebermütze aus der Stirn, um freie Sicht zu haben. Tolle Auslage. Appetitlich wölbten sich mir zwei recht ansehnliche Brüste im hautengen Shirt entgegen. Da sage mal einer was gegen Push-Ups.
»Bist du auch das erste Mal hier?«
»Ähhmm, wie bitte?«
Vielleicht sollte ich Frauen grundsätzlich doch zuerst ins Gesicht schauen. Das würde die Konversation unheimlich erleichtern. Das hier jedenfalls sah gar nicht so übel aus. Fein geschnittene, sehr weibliche, wenn auch nicht mehr ganz junge Züge, umrahmt von irrsinnig schräg geschnittener blonder Seide.
Lausbübisch grinste es mir entgegen. »Ich bin Nina, hallo.«
Aha, und was jetzt? Immer noch ein Auge in ihrem üppigen Ausschnitt brachte ich »Lea, hi« hervor.
»Trinkst du was mit mir?«
Nun ja, mein Glas war leer und die Aussicht nicht schlecht, warum also nicht. Im Handumdrehen stand ein doppelter Whiskey vor mir. Nicht der letzte, wie sich bald zeigen sollte. Nina hatte offensichtlich die Fähigkeit, gleichzeitig zu reden und zu trinken, bestens kultiviert. Noch dazu schien sie intelligent und witzig zu sein. Ich fühlte mich ein wenig wie bei einer intellektuellen Frischzellenkur, die noch dadurch aufgepeppt wurde, dass sich Ninas Hand rein zufällig mal auf meiner Hand, auf meinem Arm und schließlich auf meinem Knie auf dem Weg nach oben befand. Mein Gott, war mir heiß. Der wievielte Whiskey war das jetzt eigentlich?
Als ich später, sehr viel später, mit leichten Gleichgewichtsstörungen von der Toilette zurückkam, fing Nina mich mit einem verheißungsvollen Lächeln im Flur ab und legte mir eine Hand um die Taille, die andere auf die linke Brust. »Da bist du ja endlich, ich habe dich schon vermisst!« Sie erschien mir reichlich anschmiegsam. Fast ein wenig zu sehr.
Mit leichten Schwierigkeiten, aber doch leidlich deutlich brachte ich hervor: »Was heißt denn hier ›endlich‹? Schließlich war ich keine zehn Minuten weg!«
Nicht, dass es mir ums Prinzip gegangen wäre, aber ich hatte so Zeit gewonnen, meine Hände ebenfalls strategisch günstig zu platzieren. Nina fühlte sich ausgesprochen gut an. So einen klitzekleinen Genuss durfte man sich ja wohl noch gönnen. Es schien sie auch nicht weiter zu stören, flüsterte sie mir doch samtig ins Ohr: »Jede Minute ist zu viel, wenn du mich fragst. Wann trifft man schon mal eine Frau wie dich!«
Huh, jetzt trug sie aber dick auf. Aber irgendwie machte mich das an. Gänsehaut breitete sich vom rechten Ohrläppchen bis hinunter zum Knöchel aus. Ich griente Nina herausfordernd an. »Kannst du das vielleicht ein bisschen genauer erklären?«
Wieder dieses sinnliche Lächeln. »Aber sicher doch.«
Und wie sie konnte. Ehe ich’s mich versah, landete ich an der Wand und hatte ihre Zunge am Gaumen und ihre Hand unterm Hemd. Oh ja, ich wusste schon, weshalb ich besonders Frauen ab vierzig mochte. Diese hier schien wirklich Feuer zu haben.
Als mir gerade noch ein bisschen heißer wurde, als gut für mein logisches Denken war, hörte ich ein wenig wie durch dichten Nebel: »Können wir zu dir gehen?«
Mein whiskeygebadetes Hirn sah sich nicht mehr in der Lage, irgendwelche Warnsignale abzusondern. Klar, Helen kam erst am nächsten Tag wieder, das Bett war frisch bezogen, die Frau ausgesprochen heiß – war ich eigentlich noch ganz bei mir?
Diese Frage dämmerte mir allerdings erst wesentlich später, leider zu spät. »Nichts, was ich lieber täte!«
Hatte ich diesen Satz wirklich gesagt? Musste ich wohl, denn knutschend und jeden Hauseingang nutzend, zogen Nina und ich wenige Minuten später die zwei Straßen weiter zu meiner Wohnung. Ich hatte diverse Schwierigkeiten, die Tür aufzuschließen, Nina auszuziehen, gelang mir da wesentlich schneller, sogar der Push-Up leistete keinen nennenswerten Widerstand.
Der Sex war dann auch erste Klasse. Diese Frau war wirklich heiß! Sie musste schon lange auf Entzug gewesen sein. Na ja, sie schien mir ein bisschen ungeschickt, aber das schob ich auf den Alkohol.
Nach Luft ringend lagen wir nebeneinander, und Nina sagte mit anerkennendem und einem etwas erstaunten Blick zu mir: »Das war richtig gut. Hätte ich gar nicht gedacht.«
Wie hatte ich das denn bitte zu verstehen? Auf meine diesbezügliche Frage lächelte Nina jedoch nur sibyllinisch, drehte mit fast abwesendem Blick in meinem Fransenhaar herum und streichelte mich dann beinahe andächtig.
Inzwischen war ich fast schon wieder nüchtern geworden. Körperliche Betätigung hilft mir dabei immer ungemein. Ich besah mir das verwüstete Ehebett, linste hinüber zu unserer Kleiderspur, die offensichtlich nicht an der Schlafzimmertür endete, und mir wurde ganz mulmig zumute. Oh Gott, oh Gott. Was hatte ich bloß angestellt!
»Nina, hör mal, könnten wir das hier für uns behalten?« Meine Hand fuhr fast entschuldigend über ihren Körper.
Erschrocken zuckte sie zusammen, sah auf die Uhr und murmelte hastig: »Klar, kein Problem.« Kühl fügte sie hinzu: »Du, ich muss jetzt sowieso gehen. Dank dir. Wir sehen uns.«
Na, das musste ja nun wirklich nicht sein. Ich würde froh sein, wenn Helen wieder da war und sie nichts merken würde. Uh, da stand mir noch etwas bevor.
Plötzlich, Nina wollte gerade das Bett verlassen, flog mit einem Schlag die Schlafzimmertür auf. Im Rahmen tauchte Helen wie eine Rachegöttin auf.
»Helen, was machst du denn hier?« Züchtig raffte ich die Decke über Nina und mich. Was für eine peinliche Szene, wie aus einem Kitschroman.
»Das frage ich dich!« fauchte es zurück.
Ich deutete zu der männlichen Furie, die nun ebenfalls aus dem Schatten des Flurs auftauchte. »Und der da?«
»Hatte ich Ihnen nicht gesagt, Sie sollen draußen warten?« Helen schwang herum wie eine Amazone auf dem Kriegspfad.
Plötzlich fror mein Arm mitten in der Bewegung ein. Meine Augen hatten gerade meinen Chef erkannt, aber mein Hirn nahm diese Botschaft noch nicht so recht an. »Herr Kuczynski?« Wahrscheinlich schaute ich aus wie ein Karpfen, der auf dem Trockenen nach Luft schnappte.
Kuczynski würdigte mich keines Blickes. Er stürzte an Helen vorbei, brüllte nur: »Raus hier!« und zerrte Nina aus dem Bett.
»Helen, was geht hier vor?«
Hatte ich irgend etwas verpasst? War ich Opfer der versteckten Kamera geworden? Helen stand jedoch mit verschränkten Armen im Türrahmen und übte mich mit Blicken zu töten. Nina ließ sich willig, wenn auch kichernd, hinter meinem Chef herziehen und schaffte sogar das Kunststück, im Laufen ihre Sachen aufzusammeln und sich halbwegs anzuziehen.
Hastig raffte ich die Decke um mich und versuchte ihr nachzugehen.
Helen allerdings hinderte mich daran, indem sie mich wirklich nicht sehr zärtlich am Arm packte. »Bleib hier!« zischte sie.
An der Wohnungstür drehte sich Nina noch einmal um, grinste mich schulterzuckend an und winkte mir zu. »Tschüss, Süße, war schön mit dir. Nicht sauer sein.«
Langsam entwirrte sich das Geschehen. Mein Chef und Nina verließen die Wohnung, während Helen im Bad verschwand.
Ich blieb völlig perplex zurück, zog mich an und hämmerte gegen die Badezimmertür. »Helen, mach auf, ich kann das erklären.«
Ungefähr nach dem dreißigsten Versuch flog die Tür auf und brach mir fast das Nasenbein. »Was kannst du erklären? Dass du mit der Frau eines anderen schläfst, während ich einen ganzen Kongresstag sausen lasse, um früher nach Hause zu kommen? Dass du mit Heten in unserem Bett herumschläfst? Dass irgend so ein Kerl hier mitten in der Nacht auftaucht und die ganze Nachbarschaft rebellisch macht mit seinem Gebrüll? Ja, das bitte erklär mir mal.«
Sie sah wirklich anbetungswürdig aus, wenn sie so wütend war. Unvermittelt streckte ich die Hand aus, um ihre Wange zu streicheln.
»Wage es nicht, mich anzufassen!«
Ernüchtert gab ich etwas so Geistreiches wie: »Helen, erklärst du mir bitte mal, was hier eigentlich vor sich geht?« zurück. Ich hörte mich an wie eine Schallplatte mit Sprung.
»Ich dachte, das könntest du mir sagen«, blaffte sie. »Ich komme todmüde nach Hause und will eigentlich nur noch zu dir ins Bett, da tobt vor unserer Tür dieser Kerl herum, brüllt, er wisse genau, dass seine Frau da drin sei und wenn ich ihn nicht hereinlassen würde, riefe er die Polizei. Ich rede auf ihn ein wie auf einen lahmen Gaul, versuche ihn zu beruhigen und mache ihm schließlich das Angebot, mit hereinzukommen, um sich zu überzeugen, dass außer dir hier niemand ist – und dann liegst du tatsächlich mit dieser Frau im Bett. Wer war der Kerl eigentlich?«
Betreten blickte ich zu Boden und murmelte: »Mein Chef . . . Du«, ich hob den Kopf, »ich wusste nicht, dass sie verheiratet ist. Wir hingen einfach so in der Bar herum, und dann hat sie mich abgeschleppt. Du warst ja wieder mal nicht da.«
»Nun bin ich auch noch schuld, dass du fremdgehst. Na toll. Ich will nichts mehr hören. Verschwinde einfach.« Helen schlug die Wohnzimmertür hinter sich zu, und ich vernahm nur noch das Ächzen der Couch, als sie diese auszog.
Ich verschwand in meinem Arbeitszimmer, vom Schlafzimmer hatte ich nun wirklich erst einmal genug.
Die Nacht auf dem Sofa war kurz und unbequem. Ich hatte immer schon gesagt, dass dieses Ding ein Missgriff war. Meine Hoffnung, am nächsten Morgen in Ruhe über alles zu reden, löste sich in Rauch auf, sobald Helen sturmumwölkt in der Küche erschien.
Obwohl sie bereits im Bad gewesen war, konnte ich mühelos erkennen, dass auch ihre Nacht nicht wirklich erholsam gewesen war. Gegen Augenringe halfen selbst ihre dezenten Make-up-Künste nichts.
Ich hatte bereits das Schlafzimmer tiefengereinigt, einen dem Vorfall angemessenen Frühstückstisch gezaubert und sogar Brötchen an der Tanke geholt. Die Rosen hatte ich mir gespart, so schuldig schien ich mir nun auch wieder nicht. Zudem konnte Helen äußerst unromantisch sein.
Dies bewies sie stehenden Fußes, als sie erst mich und dann den Tisch sah. Sie knurrte wie Nachbars Dobermann. »Und du meinst, mit ein paar Stoffservietten ist es getan? Glaubst du wirklich, ich erteile dir für ein paar lausige Tankstellenbrötchen die Absolution?«
»Helen, so lass mich doch erklären.« Ich wand mich wie ein Aal. »Als ob dir das noch nie passiert wäre. Du bist sauer, gehst in eine Bar, trinkst zu viel und machst einen Fehler. Helen, du warst doch auch nie ein Kind von Traurigkeit.«
Noch einmal versuchte ich ihr den Verlauf des vorherigen Abends aus meiner Sicht darzustellen, doch es half nichts. Sie schüttelte nur den Kopf. Fehlte bloß noch, dass sie sich die Ohren zuhielt und »lalala« intonierte, wie das kleine Kinder so tun, wenn sie nichts hören wollen. Immerhin gönnte sie mir ein abschließendes Statement. »Wie soll ich dir denn jemals wieder vertrauen? Ich kann das nicht. Sicher, ich hatte auch schon solche Aussetzer, aber nie während unserer Beziehung. Und das macht den Unterschied. Tu mir einen einzigen Gefallen und zieh aus.«
Noch dachte ich, diese Idee würde sie in wenigen Tagen aufgeben, wenn ein wenig Gras über die Sachen gewachsen wäre. Vielleicht tat uns ja etwas Abstand gut. Also packte ich ein paar Sachen und den Laptop ein. Ursprünglich spielte ich mit dem Gedanken, zu meiner Großmutter zu ziehen, doch dafür nahm ich die Krise nicht ernst genug und zog in ein Pensionszimmer. Vorübergehend, so dachte ich mir, zumindest bis sich die heimischen Rauchzeichen gelegt hatten. Zweifellos erschien mir unser Beziehungsdebakel als das zunächst kleinere Übel.
~*~*~*~
Der Weg zur Schule hingegen wurde am Montag für mich zum Alptraum. So musste sich ein Delinquent kurz vor der Hinrichtung fühlen. Am liebsten hätte ich mich ja krankschreiben lassen, aber das hätte das Unausweichliche nur hinausgeschoben. Ich schlich die Treppen zum Lehrerzimmer hinauf wie ein geprügelter Hund. Nur gut, dass ich so früh dran und noch sonst keiner zu sehen war. Vielleicht bewahrte Kuczynski ja Stillschweigen. Welcher Mann gibt schon gern zu, dass seine Frau fremdgeht, noch dazu mit einer Frau.
Doch kurz vorm Lehrerzimmer fing mich unsere Schulsekretärin spröden Blickes ab. »Sie sollen gleich mal zum Chef kommen.«
Nanu, waren wir nicht mal beim Du?Klasse, sie wusste also schon irgend etwas. Kuczynski lauerte hinter seinem Schreibtisch wie der Großinquisitor. »Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht!?« blaffte er mich zur Begrüßung an.
Gedacht? Seit wann denkt man beim Sex? Lea, hör auf mit dem Quatsch, du musst das hier überleben, und zwar möglichst ohne allzu starke Blessuren. »Tut mir leid, Herr Kuczynski. Aber ich wusste nicht . . .«
»Unsinn.«
Er würgte meinen Satz ab und hielt mir eine Standpauke, die sich gewaschen hatte. Unmoral, sexuelle Abartigkeit und Ehebruch waren dabei wohl noch die harmlosesten Vokabeln. Eine Schande für den Lehrerstand sei ich und als Kollegin untragbar. Kurz, das Gespräch beziehungsweise das monologische Brüllen verlief mehr als unerquicklich.
Da half es auch nichts, dass ich mich bei ihm entschuldigte und nachdrücklich beteuerte, nicht die blasseste Ahnung gehabt zu haben, wer Nina war. »Was würden Sie wohl tun, wenn Sie in einer Bar herumstehen, und plötzlich taucht vor Ihnen eine bildschöne Frau auf, die Ihnen eindeutige Avancen macht? Wäre Ihr Ego nicht auch geschmeichelt? Würden Sie nicht auch das Beste daraus machen?«
Vielleicht war Angriff hier die beste Verteidigung? Offensichtlich nicht. Kuczynski kniff die Augen zusammen und zischte mit gefährlich leiser Stimme: »Im Gegensatz zu Ihnen bin ich durchaus in der Lage, meine Triebe unter Kontrolle zu halten. Tun Sie sich selbst einen Gefallen und stellen Sie mich moralisch nicht auf Ihre Stufe!« Er war puterrot angelaufen, seine Halsschlagader pochte gefährlich. »Und jetzt verlassen Sie umgehend mein Büro. Über die Konsequenzen reden wir noch.«
Wenn er gekonnt hätte, hätte er mich sicher sofort entlassen. Das aber verhinderte immerhin der Beamtenstand. Wenigstens etwas. Als ich Kuczynskis Zimmer verließ, hätte ich um ein Haar die Sekretärin niedergetreten.
Sie blickte mir noch vorwurfsvoll in die Pupille und meinte: »Nun passen Sie doch auf, wo Sie hingehen!«
Dachte sie vielleicht, ich hätte mich voller Verzweiflung aus dem Fenster gestürzt? Dass sie für ihr Alter – sie stand kurz vor der Rente – noch immer erstaunlich gut hörte, zeigte sich dann später im Lehrerzimmer. Leprakranke hatten sicher mehr soziale Kontakte als ich. Wohin immer ich kam, überall machte sich Getuschel breit. Mein ansonsten recht guter Ruf schien auf Ewigkeiten ruiniert, selbst einige Schüler wagten es, mich ziemlich dreist von der Seite anzugrinsen, von einigen »coolen« Sprüchen ganz zu schweigen. Länger als ein paar Wochen würde selbst ich das nicht unbeschadet aushalten.
Verdrossen trabte ich in meine Pension. Weiber!
~*~*~*~
Die nächsten Wochen wurden wahrhaft zum Spießrutenlauf. Selbst im Les Mesdemoiselles wurde über nichts anderes geredet. Hier erntete ich neben amüsiertem Grinsen (»Na, nichts mehr mit Doktorspielen bei Helen?«) allerdings auch anerkennendes Schulterklopfen: »War sie wenigstens gut, die Kleine? Hat es sich denn gelohnt?«
Darauf war ich aber nun wirklich nicht scharf. Dennoch lächelte ich und antwortete nonchalant: »Die Lady schweigt und genießt.«
Wenn ich nun schon die Trophäe hatte, konnte ich sie auch bewundern und mich triumphieren lassen. Ganz nebenbei erfuhr ich dann auch den wichtigsten Teil der Geschichte. Nina hatte bei einem ihrer wöchentlichen Damenkränzchen mit ihren Freundinnen die üblichen Themen durchgeplaudert. Als dann Modetipps, Ehemänner und andere Unsäglichkeiten nichts mehr hergaben und der Sherry fast zur Neige ging, kam man auf delikatere Themen zu sprechen. Der erste Sex, Liebhaber, pubertäres Geknutsche mit der besten Freundin.
Als Nina ihre diesbezügliche Jungfräulichkeit zugab, hatten die gelangweilten Damen endlich ein neues Thema. Sie zogen Nina fortwährend damit auf, und schließlich kam es zu einer Wette. Nina behauptete kühn, sie würde jede Frau bekommen, die sie wolle. Ein Kasten Champagner der verwöhnten Damenwelt war der Einsatz, eine Nacht bei der Eroberung Pflicht.
Unverzüglich machte man sich auf in unsere Bar. Die angeblichen Neuzugänge, die ich wahrgenommen hatte, waren nichts anderes als das flotte Damenkränzchen, welches den Gang der Dinge beäugen wollte. Als sie dann jedoch bemerkten, dass Nina mich wirklich abschleppte, bekam eine der feinen Gesellschaft wohl kalte Füße und rief den zu hörnenden Ehemann an. Dieser war gerade beim Skatabend und musste erst ein Taxi durch die halbe Stadt jagen, bevor er seine Frau zur Rede stellen konnte.
Inzwischen verfolgte uns die Damenbande und behielt das Haus im Auge, während wir uns mehr oder weniger ahnungslos vergnügten. Den Rest kannte ich dann ja aus eigenem Erleben. Leider. Wie trottelig war ich eigentlich?
~*~*~*~
Während in der Schule die Atmosphäre immer kühler wurde, kräuselte sich der heimische Rauch immer dichter. Helen ließ nicht mit sich reden, sie ließ mich nicht mal mehr in die Wohnung, sondern hatte sofort die Schlösser ausgetauscht. Da halfen auch keine Demutsbezeugungen per SMS und E-Mail. Sie meinte, das könnte schließlich immer wieder geschehen, und mit jemandem wie mir könnte sie nicht zusammenleben. Darauf setzte sie mir die besagten Kartons endgültig vor die Tür.
Ich wusste, wann ich verloren hatte, dazu kannte ich Helen zu gut. Trotzdem musste eine Lösung her. Ich brauchte eine neue Stelle und natürlich eine neue Wohnung. Aber als Lehrer wechselte man nicht so einfach die Schule. Da wollten schon noch ein paar andere mitbestimmen. Zähneknirschend bat ich beim Schulamt um meine Versetzung, beamtentechnisch gesehen nennt man das dann aus »persönlichen Gründen«. Allerdings machte man mir keine großen Hoffnungen, schließlich warteten einige der Kollegen schon seit mehreren Jahren.
Unser aller Schöpfer, vielleicht war es aber auch nur ein nachsichtiger Schulrat, ließ jedoch ein Wunder geschehen, und mein Antrag wurde bewilligt. Als ich aber den Versetzungsort auf der Karte zu Gesicht bekam, musste ich schon schwer schlucken – Neuburgstedt, eine Kleinstadt im Nirgendwo, dreißigtausend Einwohner, die nächste Lesbenbar eine halbe Autostunde entfernt. Konnte es schlimmer kommen? Wie lange mochte es dauern, bis der Buschfunk meinen Fehltritt verbreitet hatte? Ich Großstadtwesen, das abhängig war von Kino, Theater, Konzerten, Nachtleben – ich in der Provinz? Na, das konnte ja heiter werden. Es waren schließlich nicht die sieben Todsünden, die ich auf mich geladen hatte. Und das mit dem Ehebrechen sollte man sowieso noch mal überdenken. Eigentlich hätte ich auch gleich in ein Kloster eintreten können.
Mein erster Trip in den Verbannungsort ließ sich allerdings zum Glück besser an als erwartet. Das Städtchen selbst lag recht idyllisch in eine Hügellandschaft eingebettet. Das interessanteste für Touristen schien ein großer Park zu sein, den ein Herzog im neunzehnten Jahrhundert im englischen Stil hatte anlegen lassen. In seinem südlichen Teil fanden sich zudem die Ruinen des alten Schlosses, das besagter Adliger aus ziemlich nebulösen Gründen schon während der Bauzeit nicht gemocht hatte und deshalb nach seiner Fertigstellung wieder verfallen ließ. Des weiteren gab es die obligatorischen Kirchen aller Couleur, ein Heimatmuseum, auf dessen Inaugenscheinnahme ich vorerst verzichtete, sowie Wanderwege ohne Ende.
Auch galt auf dem Lande der Titel Gymnasiallehrer offensichtlich noch etwas. Als ich mit Wohnungsannoncen und Internetangeboten bewaffnet von Immobilienmakler zu Immobilienmakler zog, um mir eine neue Bleibe zu suchen, wurden die Mienen sogleich deutlich heller, wenn ich meinen Beruf nannte. Fast hätte ich schwören können, dass ich sogar Dollarzeichen in den Augen flimmern sah. Hatte es sich eigentlich noch nicht herumgesprochen, dass der öffentliche Dienst die Gehälter rabiat gekürzt hatte?
So trabte ich in der Hoffnung auf eine bezahlbare Unterkunft, die um ein geringes größer war als eine Hundehütte, durch die Straßen der Stadt. Und siehe da, schon nach der neunten Besichtigung, als ich bereits überlegte, vorerst mal wieder die zweifelhaften Freuden einer Pension zu genießen, hatte ich Glück. Die Wohnung war passabel, wenn auch im obersten Stock. Egal, sparte ich mir das Fitnessstudio. Immerhin war die Küche schon eingebaut, weitere Möbel besaß ich sowieso kaum noch. Schreibtisch, Computer, ein paar Bücherregale und stapelweise Bücher. Mit mehr war ich bei Helen nicht eingezogen, und um den Zugewinn zu erstreiten, hatte ich weder Zeit noch Nerven.
Nina hatte sich nie wieder gemeldet. Allerdings hatte ich dies sowieso nicht erwartet, auch wenn ich eine Entschuldigung in gewisser Hinsicht für angemessen gehalten hätte. Oder doch zumindest die Hälfte des Champagners. Schließlich war ich keine Laborratte, an der man mal so einfach seine Triebe ausprobieren konnte. Bei passender Gelegenheit würde ich mir vielleicht noch etwas einfallen lassen.
~*~*~*~
Am Ende des Umzugstages, nachdem ich den letzten von Helen fein säuberlich gepackten Karton die Treppen hinaufgewuchtet hatte, ließ ich mich erschöpft auf mein neues Messingbett fallen. Also fing ich mal wieder von vorn an. Das war meine Chance. Alles konnte nur besser werden, dachte ich. Hätte ich damals gewusst, was auf mich zukommen würde, ich hätte vermutlich mein Heil in der Flucht gesucht. Weshalb schaffte ich es eigentlich dauernd, mein Leben noch weiter zu verkomplizieren?
Nach Umzugsstress und großen Dramen mit meinen Eltern – wie erklärte man ihnen, dass man die heißgeliebte Großstadt hinter sich ließ und freiwillig in die provinzielle Verbannung ging, nur weil man die Frau vom Chef vernascht hatte –, waren die Sommerferien fast vorbei, die Vorbereitungswoche begann.
Ich stand nun also etwas verlegen in der riesigen Aula dieser erstaunlich modernen, auf Bürogebäude getrimmten Schule und wartete ergeben darauf, dass die erste Dienstberatung begann. Nach und nach trudelten die neuen Kollegen ein, die mir zumeist eifrig die Hand schüttelten und deren Gesichter ich mir nicht einprägen und deren Namen ich mir nicht merken konnte. Mein Gesprächsanteil beschränkte sich im Wesentlichen auf: »Guten Morgen! Fiedler. Schön, Sie kennenzulernen.«
Sicherheitshalber lächelte ich nett, während ich versuchte unbestimmt in die Gegend zu schauen. Sehr bald hatten sich kleine Grüppchen gebildet, deren Mitglieder lebhaft miteinander plauderten, den neuesten Klatsch austauschten, einander versicherten, wie gut erholt man aussähe und dass die Ferien wie immer viel zu kurz gewesen seien. Also der übliche Smalltalk, mit dem man versuchte sich langsam an die Schulluft zu gewöhnen.
Währenddessen stand ich verlorener denn je in der Menge – im übrigen kein unbedingt neues Gefühl – und hatte Muße, mir die ganze Gesellschaft zu betrachten. Es gab ungewöhnlich viele männliche Kollegen, doch sahen die meisten recht durchschnittlich aus. Aber vielleicht hatte ich Glück und es gab den einen oder anderen mit Esprit, vor dessen spitzer Zunge man beständig auf der Hut sein musste. Auch wenn ich mir nicht besonders viel aus Männern machte, auf dieses intellektuelle Vergnügen mochte ich denn doch nicht verzichten.
Wichtiger aber waren die Kolleginnen. Nicht dass ich vorhatte, die Frau fürs Leben zu finden. Schließlich war ich auf der Flucht und nicht auf dem Ball der einsamen Herzen. Zudem hatte ich mir fest vorgenommen, Beruf und Privates strengstens zu trennen. Immerhin machte es sich nicht sonderlich gut, wenn in meiner Akte vermerkt würde, dass ich alle zwei Jahre die Schule wechselte, vielleicht gar noch wegen unmoralischen Verhaltens.
An meiner letzten Schule jedoch war ich mit meiner Vorliebe für Sneakers, Schiebermütze, Blazer, Jeans und Designerhemden etwa genauso wenig aufgefallen wie ein blutender Hering im Haifischbecken. Bei dem Gedanken an all die gestylten Kolleginnen, die jeden Tag so aussahen, als wäre die Wahl zur Miss Gymnasium angesagt, und die zwar notfalls ohne Vorbereitungen, aber nie ohne Schminktäschchen zur Arbeit erschienen wären, stahl sich mir ein kleines Lächeln in den Mundwinkel. Das erste Echte an jenem Tag, wenn ich mich recht erinnere.
Die inzwischen anwesenden Frauen machten allerdings nicht den Eindruck, als wäre die Nachricht, dass Modetrends häufiger als alle zehn Jahre wechseln, bereits bis in diese friedliche Kleinstadt vorgedrungen. Die meisten erschienen doch recht mausig in Rock und biederem Twinset. Ein paar jüngere trugen Jeans und T-Shirt, und nur einige wenige bewiesen, dass die Wahl des Outfits eine hohe Kunst darstellt.
Na, bestens, rein äußerlich würde ich hier ganz gut herpassen. Aber trotzdem fehlte mir etwas. Ich sah eigentlich niemanden, dem so richtig der Schalk in den Augen funkelte, der Charme und Charisma ausstrahlte. Dafür hatte ich einen Blick, und solche Frauen brauchte ich wie die vielbeschworene Luft zum Atmen. In ihrer Nähe fühlte ich mich wohl, blühte ich auf, wurde ich witzig, schlagfertig, einfach menschlich. Tja, schade eigentlich. Es würde wohl doch ein ziemlich tristes Leben mit oberflächlichen Gesprächen und bedeutungslosen Arbeitsbeziehungen werden. Die Tatsache, dass die Aula, ähnlich wie das gesamte Gebäude, in einem futuristisch-kühlem Grau-Blau-Ton gehalten war, verbesserte meine sinkende Stimmung auch nicht gerade.
Endlich aber kam Bewegung in die Menge. Üblicherweise strebte jeder einem Platz in den hinteren Reihen zu. Es überraschte mich schon, dass es mir gelang, einen gemütlichen Fensterplatz mit Aussicht auf die Platanen im staubigen Hof zu ergattern. Immerhin hatte ich so eine reale Chance, die drohende mehrstündige Sitzung einigermaßen entspannt zu überstehen. Erwartungsgemäß blieb der Platz neben mir leer. Neue müssen eben erst getestet werden. Vielleicht sind sie ja allgemeingefährlich, leiden an ansteckenden Krankheiten oder verursachen peinliche Zwischenfälle.
Mit einem Mal verebbte das summende Gemurmel, und Stille machte sich breit. Bei diesem blondbehaarten Hünen von Schulleiter, der gerade den Raum betrat, schien das wohl auch angebracht zu sein. Wieder einmal drängte sich mir die Frage auf, warum um alles in der Welt Männer so furchtbar behaart sein müssen. Wir sind doch schon lange im Zeitalter der Mikrofaser – also weg mit dem Pelz! Aber da zeigt sich wie so oft, dass die Evolution um manche Geschöpfe doch einen gewaltigen Bogen schlägt. Wie ich allerdings seit unserem ersten Gespräch neidlos anerkennen musste, schien mein zukünftiger Chef trotz allem recht umgänglich zu sein.
Gerade jedoch als er tief Luft holte, um mit seiner Begrüßungsrede loszulegen, öffnete sich die Tür und sie schlüpfte herein. Wobei »schlüpfte« wohl der falsche Ausdruck ist. Ich wäre, peinlich berührt von meinem Zuspätkommen, eine Entschuldigung murmelnd hereingeschlüpft und hätte mich schleunigst gesetzt.
Sie jedoch hatte den Auftritt einer unbestrittenen Königin. Aufrecht, mit erhobenem Kopf, funkelnde Kobolde in den dunklen Augen und die Wangen vom schnellen Gehen leicht gerötet, betrat sie den Raum. Dem Schulleiter schenkte sie ein strahlendes Lächeln sowie einen hinreißenden Augenaufschlag, den er sichtlich geschmeichelt annahm. Eine Entschuldigung, die sie ihm auch nicht lieferte, schien er jedenfalls nicht zu erwarten. Die übrigen Kollegen wurden mit einem freundlichen Kopfnicken begrüßt, Frotzeleien flogen durch den Raum, und erst dann geruhte sie sich zu setzen.
Erwähnte ich schon, dass der Platz neben mir der einzig freie war? Während sie mir ein undeutliches »Menzel« zumurmelte, zeigte der leichte Anflug eines Stirnrunzelns mehr als deutlich, dass sie eine Sekunde lang ernsthaft grübelte, ob ich ihr schon jemals untergekommen sei. Als ich ansetzte, um wohl zum hundertsten Mal an diesem Tag »Fiedler« zu sagen, kam nur ein heiseres Krächzen über meine Lippen. Erst der zweite Versuch klappte einigermaßen, aber da hatte sie sich schon wieder abgewandt.
Grund für meine überraschende Sprachlosigkeit war ihr Duft, der mich streifte, als sie sich neben mich setzte. Natürlich weiß ich, dass ich für Wohlgerüche sehr empfänglich bin, aber die Wirkung dieser winzigen Duftpartikel war unbeschreiblich. Irgendwie muss mein Geruchssinn in direkter Verbindung mit meiner Lendengegend stehen. Jedenfalls begann dieses herrliche Prickeln, welches mich eigentlich erst dann überfällt, wenn mir eine Frau sanft ihre Hand unter das Hemd schiebt, sie zielstrebig wandern und wie ein Zug Wanderameisen den Rücken hinaufklettern lässt. Meine Brustwarzen stupsten erwartungsfroh gegen das T-Shirt, und ich bemerkte, wie sich all meine Härchen aufrichteten.
Ich fand diese Duftattacke keineswegs lustig. Etwas lief offensichtlich völlig falsch. In meinem Kopf blinkte nicht nur eine rote Alarmglocke, nein, ein ganzes Hupkonzert setzte ein und versuchte mit lautem Gedröhn, mein pheromongeflutetes Hirn aus dem Nebel zu reißen. Als mich der Schulleiter dann auch noch dem Kollegium offiziell vorstellen wollte, verpasste ich um ein Haar meinen Einsatz. Ich hörte gerade noch: ». . . und möchte Ihnen Lea Fiedler vorstellen, die zukünftig an unserer Schule Deutsch und Latein unterrichten wird.«
Ein wenig unsicher auf den Beinen stolperte ich an ihr vorbei nach vorn, in Gedanken wohl zum tausendsten Mal die Entscheidung meiner Eltern, verfluchend, mich ausgerechnet Lea zu nennen. Wie kann man einem niedlichen, wehrlosen, kleinen Menschenwesen nur solch einen Namen verpassen? Wer heißt schließlich schon gern ›Wildkuh‹? Ob ich mich wohl jemals daran gewöhnen würde?
Jetzt jedenfalls nahm ich erst mal den Begrüßungsstrauß entgegen – der Etat war offensichtlich schon wieder gekürzt worden –, lächelte möglichst intelligent in die Runde und murmelte etwas von guter Zusammenarbeit. Noch kurz den prüfenden Blick von zirka siebzig neugierigen Augenpaaren überstehen – mein Gott, wie ich diese Prozedur hasste! Um diesem Übel fürderhin zu entgehen, beschloss ich augenblicklich, nie wieder die Schule zu wechseln.
Endlich durfte ich mich wieder setzen. Dabei musste ich mich wohl oder übel an ihr vorbeiquetschen. »Darf ich bitte mal?«
»Oh, sicher.«
Ihre Stimme klang ein wenig abwesend, aber warm und fest, und sie rückte ein paar Zentimeter mit dem Stuhl nach vorn. Vielleicht weil ich es gerade so sehr vermeiden wollte, berührte ich flüchtig ihren bloßen Arm. Ich hätte schwören können, dass ein paar elektrische Funken flogen. Irgendwie reagierten wohl alle meine Sinnesorgane über. Ob das an der Hitze lag? Schließlich kam es nicht gerade häufig vor, dass ich derartig intensiv auf eine Frau reagierte, die ich erst seit drei Minuten kannte.
Glücklich, wieder sitzen zu dürfen versuchte ich meinen Puls wieder auf normal zu bringen und mich auf die Versammlung zu konzentrieren. Kein leichtes Unterfangen. Zwar würdigte sie mich keines weiteren Blickes, aber das bedeutete ja noch lange nicht, dass ich sie nicht anschauen durfte. Was ich dann auch im Rahmen des Möglichen tat.
Ich schätzte sie etwa sechs Jahre älter als mich, also so Anfang vierzig. Aber sicher war ich mir da keineswegs. Ihr Äußeres war ausgesprochen gepflegt, ihre dunklen Locken, Kleidung, Make-up und Schmuck bis ins Detail aufeinander abgestimmt. Ihr leicht gebräunter Körper, nahtlos wie ich vermutete, strahlte eine Weiblichkeit aus, die mich nervös machte. Ich hatte den Eindruck, dass sie ihn als eine Art Gesamtkunstwerk betrachtete und auch so damit umging. Dabei vollbrachte sie das Kunststück, beeindruckend natürlich zu erscheinen und sich mit einer faszinierenden Mischung aus kühler Arroganz und warmer Erotik zu umgeben.
An diesem heißen Sommertag trug sie ein schwarzes, ärmelloses Top, so dass ich, als sie den Arm bewegte, sehen konnte, wie an den zart sprießenden dunklen Härchen unter ihrem Arm feine Wassertröpfchen perlten. Ich spürte, wie mir bei diesem Anblick der Mund trocken wurde. Gleichzeitig zuckte mir der Gedanke durch den Kopf, wie es wohl wäre, ihr sanft mit der Zunge durch die Achselhöhle zu streifen und dabei vorsichtig einige dieser salzigen Tröpfchen aufzunehmen. Ich schien mir fast sicher, dass sie es mögen würde, und sah sie schon wohlig erschauern.
Ein plötzliches Klingeln, das eher an die Warnsirenen aus dem Zweiten Weltkrieg als an eine Schulglocke erinnerte, riss mich unsanft aus meinen anregenden Träumen. Da es niemand beachtete, ignorierte auch ich es. Immerhin hatte mich das Geschepper jetzt so weit ernüchtert, dass ich dem Rest der Versammlung einigermaßen konzentriert folgen konnte.
Termine, Forderungen, Androhungen, Informationen. Irgendwann hatte ich es dann überstanden. Pflichtschuldig wechselte ich mit einigen zukünftigen Kollegen ein paar belanglose Worte, wobei ich aus den Augenwinkeln heraus sehen konnte, dass sich sehr schnell eine Gruppe um mein neues Objekt der Begierde geschart hatte. Wieder flogen Frotzeleien, ihr Augenaufschlag, den sie reichlich verteilte, war nach wie vor atemberaubend, und sie gab offensichtlich jedem im Kreis das gute Gefühl, ganz allein für ihn da zu sein. Ab und an perlte ihr Lachen in hellen Stakkatotönen, die von niedlichen kleinen Glucksern unterbrochen wurden, zu mir herüber. Immer wieder verschwanden ihre vor Schalk glitzernden Augen in einem Kranz von Lachfältchen. Vielleicht, ja vielleicht konnte mir diese Schule doch mehr bieten, als ich bisher geglaubt hatte. Vergnügt sammelte ich meine Siebensachen ein und trabte fröhlich pfeifend meiner neuen Wohnung entgegen.
~*~*~*~
Gewohnheitsgemäß verliefen die ersten Schulwochen getrieben von jener hektischen Emsigkeit, die mich immer an das scheinbar planlose Hin und Her eines Termitenhügels denken ließ. Da stritten sich zwei Klassen um einen Raum, der doppelt vergeben worden war, da wurden Stapel von Büchern, CD-Playern und anderen Unterrichtsmaterialien, von denen nie genug vorhanden schienen, über die Flure geschleppt, Stundenpläne diskutiert. Das Kopiergerät glühte mit den Kollegen um die Wette, während diese in dem winzigen Kopierraum ein kostenloses Ozonbad nahmen.
Daneben gab es jede Menge Anweisungen, Hinweise und Forderungen, die unbedingt zu beachten waren, sowie Berge von Listen, die eher gestern als heute ausgefüllt werden mussten, so dass ich mich manchmal ernsthaft fragte, ob ich eigentlich Lehrerin oder Bürokratin war.
Ach ja, so ganz nebenbei musste ich natürlich auch unterrichten. Doch das erwies sich als ausgesprochen unproblematisch. Zwar war ich nicht gerade der liebe Muttityp, doch Schüler sind da glücklicherweise flexibel. Sehr bald hatten wir uns aneinander gewöhnt.
Nach den ersten hektischen Wochen begann sich Routine breitzumachen, der Alltag schlich sich ein. Jeder wusste, wann er wo, was und mit wem zu tun hatte – irgendwie ein beruhigendes Gefühl. Die Welt drehte sich wieder in normalen Bahnen, sprich um das Lehrerzimmer und die dort ständig röchelnde Kaffeemaschine. Unweigerlich tauchte fast jeder Kollege hier auf, um seinen zu niedrigen Koffeinspiegel wieder auf Vordermann zu bringen, ein Schwätzchen zu halten und Neuigkeiten zu erhaschen.
Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich diese Szenerie stets genossen habe. Man hatte Zeit und Muße, die Kollegen zu betrachten, herauszufinden, wer nicht nur nett, sondern auch interessant und kompetent war. Man konnte versuchen Freundschaften aufzubauen, feststellen, wem man eher nicht trauen durfte, Netzwerke knüpfen. Manchmal ließ man einfach seinen Geist sprühen, wenn es darum ging herumzuspötteln, sich gegenseitig aufzuziehen und sich zu amüsieren.
Natürlich hatte ich die wundersame Erscheinung der ersten Versammlung bei all meinen Bemühungen, mich einigermaßen anzupassen, nicht aus den Augen verloren. Manchmal sah ich sie für einen Moment wie ein Lichtfünkchen zwischen den drängelnden Schülern auftauchen und wieder verschwinden. Schon allein ihren Gang zu betrachten, war ein Erlebnis. Sie hielt stets den Kopf ein wenig schief zur Seite geneigt und Arme und Füße seltsam nach außen gedreht, während sie mit kleinen, festen Schritten auf gefährlich hohen Hacken vorbeiging. Bei jeder anderen hätte es albern ausgesehen, bei ihr jedoch passte es zu dieser kühlen Distanziertheit, mit der sie sich üblicherweise zu umgeben pflegte.
Überhaupt blieb ihr Eindruck auf mich stets zwiespältig. An manchen Tagen war sie gutgelaunt, wirbelte wie ein frecher Kobold im Lehrerzimmer herum, flirtete mit den Kollegen und alberte mit den Kolleginnen herum. Oft aber saß sie still, ohne eine Regung, blicklos vor sich hinstarrend – die personifizierte Introvertiertheit.
Einmal stand sie am Schwarzen Brett vor mir, um die neuesten Vertretungspläne zu begutachten. Trotz ihrer hohen Absätze konnte ich über sie hinwegsehen. Wieder kitzelte mich ihr Duft verführerisch in der Nase, und wie eine Welle stieg Begierde in mir hoch. Wie gern hätte ich sie von hinten umfasst, ihr einen zärtlichen Kuss auf die warme, weiche Haut ihrer Halsbeuge gegeben. Wie gern hätte ich vorsichtig meine Zunge und Lippen ihren gebräunten Hals hinauf bis zum Ohrläppchen gleiten lassen, es sanft zwischen meine Zähne genommen, um anschließend all die geheimen Stellen ihres Ohres intensiv mit der Zunge zu erkunden. Währenddessen wären meine Hände begehrlich unter ihre Bluse geschlüpft, wären über die einladende Mulde ihres Nabels hinauf zu ihren festen Brüsten gelangt und hätten diese . . .
Mein Gott, womit sprühte sie sich bloß jeden Morgen ein? Eigentlich sollte man dieses Zeug wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit verbieten! War ich denn völlig verrückt geworden, dass ich am helllichten Tag inmitten einer Schar braver Mitmenschen in sinnliche Träumereien verfiel? So lange war Helen ja nun auch wieder nicht her.
Außerdem war Lilia (was für ein Name!) völlig unerreichbar, wie ich inzwischen herausgefunden zu haben glaubte.
Sie war seit knapp zwanzig Jahren mit dem Filialleiter einer der hiesigen Banken verheiratet, hatte einen beinahe ebenso alten Sohn, Tobias, der bereits studierte, ein Häuschen im Grünen und – nicht zu vergessen – die obligatorische Katze. Dies hätte mir eigentlich sympathisch sein müssen, angeblich sollen Lesben ja einen Katzentick haben. Aber entweder war ich keine, was ich sehr stark zu bezweifeln wagte, oder das Stereotyp war falsch. Ich mochte die Biester einfach nicht. Vielleicht waren sie mir zu ähnlich. Ewig auf der Suche nach Freiheit und Unabhängigkeit, aber doch stets einen Platz zum Kuscheln in Sichtweite haben wollen.
Hastig wandte ich mich ab, verstohlen um mich blickend, ob wohl jemand etwas von meinem hämmernden Puls mitbekommen hatte. Aber man hatte anscheinend andere Sorgen. Kribbelig wurde mir auch, wenn ich ihre tägliche Prozedur des Joghurtdeckelableckens mitverfolgen konnte. Jede andere hätte mit einem kräftigen Strich den Deckel gesäubert, aber Lilia schien sich ein besonderes System ausgedacht zu haben, um sich auch ja kein Kleckschen entgehen zu lassen. Zuerst umrundete sie mit spitzer Zunge den Deckel ganz langsam, ja beinahe mit sinnlicher Lust einmal von links und einmal von rechts, um dann die Mitte mit einem breiten Strich zu schmecken. Die übrig gebliebenen Reste schleckte sie hastig wie ein Kätzchen weg. Während der ganzen Zeremonie bewegte sie ihre appetitlich rosa schimmernde Zunge mit solch provozierender Lust, dass ich nicht umhin kam, an die Freuden zu denken, die sie spenden könnte.
Diese und ähnliche Kleinigkeiten trugen natürlich nicht gerade dazu bei, diese Frau aus meinem Denken zu verbannen. Aber zum Glück gab es ja auch noch den Alltag, der sich mit tausend Problemchen hartnäckig aufdrängelte und mehr oder minder meine volle Aufmerksamkeit forderte.
Da mich Lilia – ich schaffte es nun wirklich nicht, sie im Geiste »Frau Menzel« zu nennen – nach wie vor ignorierte, kam unsere »Beziehung« über das allmorgendliche Händeschütteln und hin wieder ein bisschen Fachgeplänkel nicht hinaus. Lediglich in den Fachschaftssitzungen, in denen wir lebhaft, aber genauso oft ohne greifbare Resultate über PISA und seine Folgen diskutierten und uns zuweilen die Köpfe um Nichtigkeiten heiß redeten, bemerkte ich, wie sie mich zuweilen interessiert anblickte. Gelegentlich gab sie mir sogar Unterstützung. Es war immer schön, sie in Aktion zu sehen, ihr vor Eifer gerötetes Gesicht zu betrachten, ihre Stimme zu hören. Als ich spürte, wie sehr sie meine Sachlichkeit und mein Wissen zu schätzen begann, war ich seit langem wieder einmal von der Nützlichkeit meiner Lesewut überzeugt.
~*~*~*~
So schlich Woche für Woche dahin, ebenmäßig und manchmal nervtötend wie das Tropfen eines Wasserhahnes. Der Unterricht lief wie ein gut gewartetes Uhrwerk, das Kollegium war eingespielt und hatte mich problemlos aufgesogen.
Die Oktoberferien hatte ich damit verbracht, meine neue Behausung etwas wohnlicher auszustaffieren, die Stadt zu erkunden und meinen Eltern einen Kurzbesuch abzustatten. Sie hatten sich zwischenzeitlich an den Gedanken gewöhnt, mich in ländlicher Emigration zu sehen, und mein neuester Bericht, dass alles recht gut lief, beruhigte sie vollends.
Auch der November brachte nichts Aufregendes. Nur Niesel, Nebel, Lethargie und Langeweile.
Inzwischen war die Weihnachtszeit herangerückt. Die permanente Einsamkeit, die ich beim besten Willen nicht gewohnt war, brachte mich beinahe um. All dieses Weihnachtsgedudel von Liebe zwischen den Menschen, von Wärme und Geborgenheit erschien mir mit einem Mal wie leeres, hohles Geschwätz. Eine gewinnbringende Erfindung der Werbebranche, ein psychologisches Druckmittel der Regierung, um alle Singles im Land auf ihre verdammte Fortpflanzungspflicht aufmerksam zu machen. Sorry. Nicht mit mir. Sucht euch wen anders für euer Vater-Mutter-Kind-Spiel. Für mich gelten diese Spielregeln nicht. Tut mir leid.
Natürlich war ich auch mit der Hoffnung auf Ruhe in die Provinz gezogen, dass es allerdings so ruhig werden würde, hatte ich nicht gedacht. Es war nicht ganz einfach, meine freie Zeit auszufüllen. Früher hatte ich im Lila Klub Handball gespielt und war häufig mit Helen ausgegangen. Wir hatten einen festen Freundeskreis gehabt, der sich oft im Les Mesdemoiselles getroffen, aber sich auch gegenseitig heimgesucht hatte.
Hier jedoch schien mir buchstäblich die Existenzgrundlage entzogen worden zu sein. Zwar hatte ich bald einen Handballklub gefunden, aber so richtig lustig war das nicht. Im Gegensatz zu unserer buntgemischten lila Truppe, in der von sechzehn bis reichlich sechzig alle mitspielten, die einen Ball halten konnten, waren die Mädels hier alle Anfang zwanzig. Das hatte den enormen Vorteil, dass ich beim Spiel ordentlich ins Schwitzen kam.
Bei den anschließenden – auch hier obligatorischen – Kneipengängen kam ich mir allerdings ein wenig wie die Klub-Omi vor. Was hatte ich mit schicken Typen und Klamotten, mit Hetendiscos, Make-up-Tipps und Kinderwünschen zu tun? Mit Geschichten aus der bunten Lesbenwelt wollte ich hingegen auch nicht aufwarten. Wie gesagt, ich war nicht gerade ein Outing-Spezialist. Folglich spielte ich die große Schweigsame, trank etwas mehr Rotwein und gab es irgendwann auf, nach dem Training noch mit auszugehen. Hin und wieder ließ ich mich noch im Fitnessstudio sehen, aber auch hier blieben die Kontakte eher oberflächlich.
Natürlich hatte ich mich im Internet frühzeitig auf die Suche nach der nächsten passenden Bar gemacht. Das Bella’s lag dutzende Kilometer entfernt und erschien mir einigermaßen akzeptabel. Allerdings dauerte es eine Weile, bis ich mich aufraffen konnte, einen ersten Erkundungsgang zu starten. Ich litt in dieser Hinsicht an merkwürdiger Portalangst, die es mir nicht gerade einfach machte, mich sozial zu involvieren. Eines Freitags jedoch, als ich schon wieder ein grausig langes Wochenende vor mir sah, sprang ich kurzentschlossen in mein Auto und fuhr los.
~*~*~*~
Das Bella’s war nicht schwer zu finden, zumindest, wenn man die Wegbeschreibung dabei hatte. Sogar einen akzeptablen Parkplatz gab es. Mich an knutschenden Teenagern vorbeidrängelnd gelangte ich über eine steile Treppe in die Tiefen eines Kellergewölbes, wo ich an einer großen Eichentür von einem äußerst imposant aussehenden älteren Türsteher aufgehalten wurde, der mich fast um einen halben Kopf überragte.
»Bist du hier verabredet?«
Seine geknurrte Begrüßung sollte vermutlich respekteinflößend wirken. Ich schüttelte nur stumm und scheinbar nervös den Kopf.
»Na Kleine, das dachte ich mir schon. Dich hab’ ich hier schließlich noch nie gesehen. Bist wohl neu hier?«
Was hieß hier eigentlich »Kleine«? Schließlich war ich knapp einsachtzig! Und wie ich diese ewige Duzerei hasste. Verlor man eigentlich, sobald man Teil einer Gruppe war, automatisch alle Persönlichkeitsrechte? Ich holte tief Luft und setzte meinen »Lieber-Onkel-hilf-mir-doch-Blick« auf. »Toll, dass Sie sich so gut Gesichter merken können. Sie haben recht. Ich war noch nie hier. Muss ich Eintritt zahlen?« Ich machte noch ein bisschen auf schüchtern, indem ich ihn arglos anblinkerte und verlegen von einem Fuß auf den anderen trat.
»Nein, nein, das brauchst du nicht. Ist aber nicht viel los heute Abend.«
»Macht ja nichts, wollte nur mal sehen, wie es hier so ist.«
Immer diese Initiationsrituale. Noch einmal überprüfte er mich kritisch auf meine Lesbentauglichkeit. Keine Ahnung, woran er das festmachte, jedenfalls hielt ich seinem bohrenden Blick stand, und er gewährte mir huldvoll Einlass. »Na, dann viel Spaß!«
»Danke, war nett, mit Ihnen zu plaudern!«
Erleichtert schlüpfte ich durch den Türspalt, den er mir öffnete. Hoffentlich wurde der Knabe ein bisschen zugänglicher. Ich hatte keine Lust, jedes Mal diesen Schmus von mir zu geben.
Im Innern lümmelten sich im flackernden Licht einer aus den Achtzigern übriggebliebenen Diskokugel ca. drei dutzend Mädels und Jungs aller Couleur auf abgeschabten Ledersofas und wackeligen Barhockern herum. Die Musik war laut und hämmernd, so dass ich bereits nach wenigen Minuten das Gefühl hatte, auf Grund von Herzrhythmusstörungen einen Kardiologen aufsuchen zu müssen.
Da ich gezwungenermaßen mit dem Auto da war, konnte ich mir den Laden nicht mal schöntrinken. Trotzdem suchte ich mir einen Platz an der Bar, um mich dort an einem Kirschsaft festzuhalten und das Geschehen kritisch durch den dichten Zigarettennebel zu beäugen. Ich kam mir vor, als wäre ich im falschen Universum gelandet. Meine Anwesenheit erhöhte den Altersdurchschnitt um mindestens zehn Jahre. Die schwulen Jungs sahen wie immer ganz nett und niedlich aus. Mit einigen von ihnen kam ich auch schnell ins Gespräch, was natürlich nur ein Nebeneffekt dieses Abends sein konnte.
Viele der Mädels allerdings ließen mich eine Sekunde lang zweifeln, ob ich wirklich meine Sexualität richtig bestimmt hatte. Da gab es kahlgeschorene Fünfzehnjährige, die ihr Anderssein mit Hundehalsbändern, schwarzen Klamotten und klirrenden Ketten demonstrieren mussten. Einige jungenhafte Mittzwanzigerinnen trugen Raspelschnitt, Baggyhosen und Muscleshirts. War das nicht schon eine Weile out?
Am sympathischsten war mir immer noch die Barfrau. Groß, dunkelhaarig, reif und üppig servierte sie mit schnellen Bewegungen die gewünschten Drinks. Wie sich das für eine ordentliche Bardame gehörte, erkannte sie sofort meinen Status als Neuzugang, was bei meinem verlorenen Herumvegetieren sicherlich auch keine besondere Kunst darstellte.
»Na, Schätzchen, neu hier?«
»Schätzchen« hatte mich ja nun auch lange niemand mehr genannt.
»Mmmh, nicht gerade viel los hier«, brummelte ich zurück, »Aber wenigstens ist die Bar gut sortiert.« Frech grinste ich ihr in den Ausschnitt.
»Schätzchen, versuch erst gar nicht mich anzumachen. Der gutaussehende Cerberus da draußen, das ist meiner, und ich habe nicht vor, die Seiten zu wechseln. Ich bin übrigens Bella, und die Bar gehört mir.«
Autsch, hätte ich mir ja denken können, dass so ein Laden seine Übermutter hatte. Es war nie sonderlich clever, sich mit dem Personal anzulegen. Konnte nicht mal eine attraktive Lesbe in meinem Alter hier aufkreuzen?
Also mea culpa. »Ich bin Lea, sorry, falls ich dir zu nahegetreten bin, war nicht so gemeint. Kann ich das irgendwie wiedergutmachen?«
»Nun mach dich mal nicht nass, Schätzchen. Was glaubst du, was ich mir hier manchmal von den jungen Dingern anhören muss. Das ist wohl hier nicht so ganz dein Geschmack, was?« Sie klang fast ein wenig mitfühlend.
»Na ja«, nun bloß nicht wieder ins Fettnäpfchen treten, »sagen wir mal, mein Interesse liegt ein wenig jenseits der pubertären Selbstfindungsphase. Vielleicht sollte ich in zehn Jahren mal wieder vorbeischauen, wenn die Mädels hier erwachsen sind. Oder gibt’s hier auch ein paar Ladys in meinem Alter?«
»Geben gibt’s die schon, nur zeigen sie sich nicht so oft hier. Die meisten kommen nur selten her, weil sie es sich zu Hause mit ihrer Frau gemütlich machen. Einige haben es aber auch aufgegeben, nach der Frau fürs Leben oder wenigstens für eine Nacht zu suchen. Nächsten Freitag machen wir Oldie-Nacht, da kommen dann ein paar mehr in deinem Alter.«
Na prima, ich Oldie ich. Wie würde ich wohl in zwanzig Jahren betitelt werden? Ein wenig enttäuscht verabschiedete ich mich.
Der nächste Freitag verlief auch nicht viel besser. Sicher, das Publikum war etwas ansprechender, aber meistens eben paarweise. Außerdem fehlte mir auch noch ein wenig das richtige Feeling für etwas Neues. Ich tanzte zwar hier und da, aber das erschien mir eher belanglos. Meist plauschte ich mit Bella und den Jungs, für die Damen blieb ich ein wenig der Außenseiter.
So lief das dann meist immer. Ab und zu knutschte ich ein wenig verzweifelt herum, und einmal ging mir eine niedliche Endzwanzigerin auf dem Parkplatz ans Hemd. Das aber hatte zur Folge, dass mir die dazugehörige Freundin um ein Haar ein paar verpasste. Mit der Zeit zog ich es dann vor, zu Hause zu bleiben. Da gab es wenigstens einen ordentlichen Rotwein. Nur hin und wieder, wenn mir die Decke gar zu sehr auf den Kopf fiel, ging ich auf einen Plausch zu Bella.
~*~*~*~
Der letzte Schultag vor den von allen, außer von mir, heiß ersehnten Weihnachtsferien endete traditionsgemäß mit einer feucht-fröhlichen Lehrerfete. Insgesamt gesehen verstand sich nämlich das Kollegium recht gut, und im Feiern sollte es, unbestätigten Gerüchten zufolge, einsame Spitze sein. Zumindest fanden die Partys niemals zweimal im gleichen Restaurant statt.
Da ich von Natur aus neugierig und trinkfest bin und um meiner heimischen Einöde zu entgehen, trabte ich brav mit. Wahrscheinlich hätte ich mich auch einer Gruppe Robbenhaut kauender Eskimos angeschlossen, nur um nicht allein zu sein.
Die Feier selbst verlief ausgelassen und fröhlich mit diversen Spielchen, eindeutig zweideutigen Witzen und natürlich reichlich Alkohol. Zu vorgerückter Stunde beschlossen die verbliebenen Anwesenden im allgemeinen Freudenrausch, dass ich ein durchaus akzeptabler Mensch sei, dem man ohne weiteres das »Du« anbieten könne. Natürlich spekulierten alle auf die nun fällige Runde, die ich auch anstandslos zahlte. Schließlich weiß ich, was sich gehört.
Interessant wurde es allerdings erst bei der unumgänglichen Verbrüderungszeremonie. Ich bin mir nicht sicher, ob schon jemals jemand vor mir versucht hat, sich mit dreißig Leuten auf einmal zu verbrüdern. Man kann dabei jedoch die herrlichsten Charakterstudien betreiben.
Ehe ich den beschwerlichen Weg um die Tafel begann, bewaffnete ich mich mit einem Rotweinglas, dessen Fassungsvermögen mit dem einer Kinderbadewanne durchaus vergleichbar war. Dann galoppierte ich todesmutig los.
Einige Kollegen bestanden offensichtlich auf kultivierte Rituale: Da wurden Arme eingehakelt, Gläser geleert, Küsschen links, Küsschen rechts verteilt. Andere, insbesondere Männer, zogen mich kräftig an ihre oft eher weniger kräftige Brust und nötigten mir herzhaft alkoholhaltige Küsse auf. Dabei kam ich mir ein wenig vor, als wäre ich Testumarmer bei einem Rasierwettbewerb. Da gab es flaumige Jünglingswangen, kratzige Dreitagebärte, kitzelnde Schnauzer, drahtige Vollbartgebüsche und einfach nur schlecht rasierte Stoppelwangen. Ich werde wohl nie verstehen, was Männer für die meisten Frauen so anziehend macht.
Reichlich zerkratzt und mit angebrochener Rippe tauchte ich also wieder aus der Gruppe der holden Männlichkeit auf. Noch kurz mein Glas nachgefüllt, und schon kamen wir zum angenehmeren Teil des Abends. Leider gaben sich die Kolleginnen weniger umarmungsfreudig. Die meisten begnügten sich mit leichtem Gläserklingeln oder einfachem Zunicken. Natürlich nahm mich ausgerechnet die in den Arm, auf deren Umarmung ich im Zweifelsfalle lieber verzichtet hätte. Dauerwelle, Damenbart, Pseudodirndl. Aber was soll’s. Der gute Wille zählte.
Neugierig fragte ich mich, wie wohl mein angehimmeltes Objekt der Begierde reagieren würde. Den ganzen Abend über hatte sich Lilia vertraulich bei ihren Gesprächspartnern eingehakt und saß auch schon mal auf einem Schoß. Wieder kam mir das Kätzchen in den Sinn, das mit allem, was es in die samtenen Pfötchen bekam, spielte und dabei wohlig schnurrte.
Sie sah verdammt verführerisch aus, so leicht angetrunken, mit geröteten Wangen, die einen interessanten Kontrast zu ihrer schwarzen Seidenbluse bildeten. Gern hätte ich diese Frau in den Arm genommen, sie fest an mich gezogen, um jede Faser, jede Kontur ihres geschmeidigen Körpers zu spüren und ihr einen tiefen, prickelnden Kuss gegeben, aus dem sie nach Luft ringend und mit dem Verlangen nach mehr hervorgegangen wäre.
So aber lächelte ich ihr freundlich zu, während unsere Gläser leise klirrten. Ich sah Lilia an, dass ihr diese Duzzeremonie nicht sonderlich behagte. Dazu berührte sie viel zu sehr ihre geheiligte Privatsphäre. »Lilia«, brachte sie trocken, mit schiefem Lächeln hervor.
»Lilia.« Wahrscheinlich zu lateinisch »lilium«, die Lilie, russischer, spanischer, auch italienischer Name, vermutlich mit »Liliana« verwandt. Irgendwie wurde ich den Eindruck nicht los, dass mir Teile meines Studiums streckenweise ziemlichen Schaden zugefügt hatten. Wieso hatte ich bloß diesen Namenstick?!
Im übrigen war es mehr als schwierig, sich Lilia als weiße Lilie vorzustellen. Dazu erschien sie viel zu wenig ätherisch. Als schwarze Lilie passte sie hingegen tadellos. Sie war kultiviert und offensichtlich auf Bequemlichkeit und einen annehmbaren Grad von Luxus angewiesen. Als Nymphe schien sie mir ebenfalls denkbar. Eine, die Zeus den Kopf verdreht und ihn dann abblitzen lässt. Oder als Irrlicht, das sich neckend auf einsame Wanderer stürzt, oder als Kobold, der blitzenden Auges Wegmarkierungen vertauscht, Brücken unbrauchbar macht, Brot in Stein verwandelt.
Spätestens als ich merkte, wie meine Gedanken begannen ihr Dekolleté zu umspielen – also ziemlich schnell –, raffte ich mich auf, um die restliche Prozedur hinter mich zu bringen. Als ich die Runde beendet hatte, war ich ziemlich geschafft und endgültig ein bisschen mehr als angetrunken.
Um so mehr überraschte es mich, als plötzlich mein Chef, der sich bisher vornehm zurückgehalten hatte, an mich herantrat.
»Frau Fiedler, wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich mich gern den Kollegen anschließen. Nehmen Sie noch ein Glas mit mir an der Bar?«
Ich blinzelte kurz irritiert. Die schmerzhaften Erinnerungen an meinen letzten Chef schienen doch noch nicht ganz verheilt. Allerdings hatte ich mich schnell im Griff.
»Gern doch, ich würde mich freuen.« Ich klang plötzlich erstaunlich nüchtern und klar.
»Was darf ich Ihnen bestellen?«
Nach all dem Rotwein brauchte ich erst mal etwas Handfestes. »Einen Whiskey bitte. Wenn’s geht, einen irischen, schottisch geht auch, aber keinen amerikanischen. Die sind mir zu massentauglich.«
Jetzt war es an ihm, überrascht zu sein. »Einen Whiskey?« echote er. Ich konnte förmlich sehen, wie ich in seiner Achtung drei Stufen höher kletterte. Wenn das nur immer so einfach wäre. Aber was tat man nicht alles. Außerdem lief ich hier ja wohl kaum Gefahr, whiskeyumnebelt seine Frau zu verführen. Ich wusste nicht einmal, ob er eine hatte.
Ebenfalls reichlich angeheitert begann er mir umständlich zu erklären, dass er mich fachlich und als Mensch außerordentlich schätzte. Letzteres glaubte ich ihm unbesehen, bearbeitete er doch schon seit geraumer Zeit meine Hand ausgiebig mit der seinen und war gerade dabei, sich zu meinem Ellenbogen vorzustreicheln. So etwas fand ich stets ausnehmend erheiternd. Weshalb bildeten sich Männer ab fünfzig eigentlich immer ein, dass sie bei fast zwanzig Jahre jüngeren Frauen fraglos Erfolg haben würden?
Schon häufiger hatte ich feststellen müssen, dass sich ältere Männer zu mir hingezogen fühlten wie Motten zum Licht. Das war nicht unbedingt unangenehm. Meist erschienen sie höflich, wohlerzogen, gebildet. Man konnte sich gut mit ihnen unterhalten, und sie ließen sich im Normalfall problemlos in ihre Schranken weisen. Amüsiert gönnte ich ihm seinen Spaß, während ich mir meinen gönnte und mir vorstellte, wie ich mich vorbeugte und ihm rauchig ins Ohr flüsterte: »Schatz, wir haben beide etwas gemeinsam. Wir stehen beide auf Frauen!«
Ich hatte dies das eine oder andere Mal in Restaurants meiner Großstadt ausprobiert, als ich auf eine Freundin wartend zudringliche Gesellschaft erhielt. Der Erfolg war jedes Mal beeindruckend. Einer sprang wie von der Tarantel gestochen auf, beschimpfte mich wüst als Hure, Nutte und Schlampe – was ich ja nun beim besten Willen nicht sein konnte, ein anderer schlich unauffällig mit sichtlich eingezogenem Schwanz davon, während ein dritter mir versicherte, ich hätte nur noch nicht den Richtigen gefunden und dass er es mir nur einmal richtig besorgen müsste, um mich auf den richtigen, sprich heterosexuellen Weg zu bringen.
Klischees! Natürlich würde ich dies meinem Chef niemals antun. Zum einen war er viel zu nett und würde sich von diesem Schock trotz seiner kräftigen Statur so schnell nicht erholen, zum anderen legte ich nicht den geringsten Wert auf einen erneuten Schulwechsel. Außerdem ging er gerade zum Kern der Sache über, indem er mir umständlich erklärte, dass auch er sich die Ehre gab, mir das »Du« anzubieten.
Ich versuchte gerührt zu lächeln und abzuschätzen, ob ich mit einem weiteren Rippenbruch zu rechnen hatte. Als Gentleman jedoch hielt auch er sich an die Tradition, wir mussten unsere Arme verknoten, am Whiskey nippen, worauf er mir dann zuhauchte: »Ich küss’ dich jetzt mal aufs rechte Ohr, ja?!«
Ja, klar. Warum denn nicht. Schließlich hatte ich heute schon Schlimmeres durchgestanden. Dagegen erschien dieses Angebot geradezu verlockend.