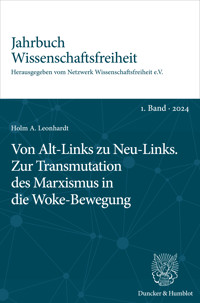
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Duncker & Humblot
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
The new Woke movement claims to have Marxist origins. However, it can be shown that most of the political content of contemporary progressivism has bourgeois origins: individualism, libertarianism, anarchism, cosmopolitanism, religion-like moralism. Overall, the five thematic areas of Marxist doctrine examined show major differences from the Woke ideology: The theory of imperialism, for example, prohibits turning to the American superpower. Proletarian internationalism does not mean accepting every migrant as a refugee. In Marxist thought, social progress did not mean complete reconciliation with nature and animals. Marxism never claimed that women had no duties as mothers. Only anti-fascism corresponds to the claim of origin of the progressivists: this Stalinist technique of isolating political enemies was adopted and further developed. The latest version is known as Cancel Culture. Supported by their adherents in administration, education and the media, the Woke intelligentsia has formed an alliance with big business to dominate society.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
[153]
Jahrbuch Wissenschaftsfreiheit, 1 (2024): 153 – 194https://doi.org/10.3790/jwf.2024.1431601
Von Alt-Links zu Neu-Links. Zur Transmutation des Marxismus in die Woke-Bewegung
Von Holm A. Leonhardt*
Die 1960er Jahre markieren den Beginn einer langen Entwicklung: Die Bewegung des Marxismus, die bis dahin an Klassenverhältnissen und Arbeitswelt orientiert war, fing an sich zu wandeln. Dies geschah vor allem in den wirtschaftlich fortgeschrittenen Ländern des Westens, während der realsozialistische Osten bis um 1990 in dem ihm eigenen Dogmatismus erstarrt blieb. Im Gefolge der 1968er-Bewegung, wesentlich von der akademischen Jugend getragen, entstanden die Neuen Sozialen Bewegungen, u. a. von Schwulen- und Lesben, studentischen Frauen, Behinderten oder Hausbesetzern. Diese traten neben die klassische Arbeiterbewegung und Frauenbewegung. In einem langen Transmutationsprozess absorbierte ein neuer Moralismus verschiedene gesellschaftliche Strömungen, darunter wesentlich den auf materielle Parameter orientierten Marxismus.1 Für die Linke wandelten sich die Paradigmen der politischen Auseinandersetzung: Es ging immer weniger um Klassenkampf oder soziale Rechte und zunehmend um historische Schuldverhältnisse und Identitäten. Neue Rituale politischer Korrektheit und Respektierung kamen auf, mit denen auf die Benachteiligung verschiedenster Gruppen eingegangen wurde. Selbst die scheinbar so sachlogischen Bereiche Natur und Technik wurden schuldtheoretisch aufgeladen. Je länger desto mehr [154] verfiel der Marxismus, während ein neuer moralgetriebener Progressivismus Raum griff. Dieser Wokeismus2 wurde immer mehr zum herrschenden Machtfaktor in Gesellschaft und Staat. Ihm stand eine konservative und rechte Opposition gegenüber, die von den Moralisten als nazistisch skandalisiert wurde.
I. Stand der Forschung
Zum Thema der „Sozialen Bewegungen“3 und der „Neuen Linken“4 ab den 1960er Jahren gibt es zahlreiche Darstellungen. Von einer kohärenten Theoriebildung kann jedoch nicht gesprochen werden. Die Anwendung übergreifender Paradigmen, wie Individualismus, Moralismus, Progressivismus oder Neoliberalismus, ist noch nicht durchgreifend erfolgt. Am weitesten fortgeschritten dürfte der Soziologe Andreas Reckwitz sein, der die Herausbildung eines hochindividualisierten Menschentypus beschreibt.5 Dieser sei das treibende Moment der moralistischen Bewegungen und der Spaltung der Gesellschaft. Während der letzten 70 Jahre habe ein „apertistischer Liberalismus“ vielfältige gesellschaftliche Strukturen aufgelöst, u. a. die frühere Gemeinschaftsorientierung der Lebensformen.6 Beachtenswert sind darüber hinaus Forschungsarbeiten zum Postmaterialismus.7 Auch hier wird eine Werteverschiebung durch Individualisierung beschrieben, wobei der Postmaterialismus die ideologische Gegenposition zum konventionellen Liberalismus darstelle. Den Charakter eines politischen Moralismus beleuchteten Hermann Lübbe und Bernd Stegemann.8 Begrifflich weitergehend, attestierten etliche Stimmen dem Wokeismus den Charakter einer Zivilreligion, die zum kulthaften Handeln neige.9
Über den neulinken Progressivismus insgesamt liegen kaum belastbare Studien vor. Es dominieren stattdessen Kampfschriften für oder gegen ihn. Ansätze zu einer Verwissenschaftlichung zeigen immerhin die programmatischen [155] Werke der Progressiven Lea Susemichel und Jens Kastner (beide Journalisten und Geisteswissenschaftler) sowie Andreas Audretsch (Politologe und Grünenpolitiker).10 Diese Autoren behaupten, ihre Bewegung würde in der Tradition des Marxismus stehen, aber dessen Fehler vermeiden. Sie entwickeln Vorstellungen von einer idealen neuen Gesellschaft, die durch eine „emanzipatorische Identitätspolitik“ und ein Netzwerk von „Allianzen“ in „unbedingter Solidarität“ hergestellt würde. Susemichel/Kastner und Audretsch sehen sich somit als Vertreter einer neuesten Neuen Linken, deren Wurzeln bis zur 1968er Bewegung zurückreichen, welche als eine immer sensibler werdende Bewegung, etwa in Gestalt der Grünen, Fortsetzung fand.
Die Einordnung der Woke-Bewegten als links ist im Übrigen bestritten worden. Traditionslinke erkannten bei diesen eine bürgerliche Haltung und ein Desinteresse für soziale Belange.11 Kritiker des Progressivismus haben ansonsten Befunde zusammengetragen, dass diese Bewegung an die Stelle rationaler Analyse eine tendenzgetriebene Scheinlogik gesetzt habe. Zunächst neige der Progressivismus generell zu einer seherischen Attitüde und zu alarmistischen Forderungen. In Sachfragen berufe er sich auf den neusten Stand der Wissenschaft, irre dabei aber auch. Bereits Anfang der 1970er Jahre sagten Ökologen eine rasche Rohstoff- und Energieverknappung vorher, die nicht eintrat.12 Ende der 1970er Jahre prognostizierten Klimatologen angesichts einer zunehmenden Verrußung der Atmosphäre eine neue Eiszeit,13 was völlig konträr zur heutigen Diskussion über die Erderwärmung steht. Außerhalb der Naturwissenschaften stützt sich die neulinke Moralbewegung auf einen (Sprach- und Sozial-)Konstruktivismus. Dieser ist philosophisch gesehen idealistisch, also unmarxistisch. Er hat allein unter dem Dach der Social-Justice-Theorie mindesten sechs Einzellehren, von Postkolonialismus bis hin zu Gendertheorie und Political Correctness, hervorgebracht.14 Im weiteren Umfeld gehören auch die Human-Animal-Studies dazu.15 Die Grundaussage des Konstruktivismus ist, dass Begriffe durch Sprechakte konstruiert und konnotiert werden.16 Analytisch werden dann negative Zuschreibungen herausgearbeitet, so die unterstellte Minderwertigkeit von „Neger“, „Zigeuner“ und „Frau“ oder eine Bestialität von Tieren. Damit sei Rassismus, [156] Frauenfeindlichkeit und übergriffiger Spezieismus (Vorrang der eigenen Art) nachgewiesen. Diese Logik der Beweisführung ist jedoch nicht zwingend: Zwar werden Begriffe tatsächlich von den Sprechenden konstruiert, aber über den Wahrheitsgehalt der durch sie mobilisierten Klischees wird nichts ausgesagt.17 Frauen und Männer könnten dennoch instinktgeleitet sein, der Wolf blutrünstig und menschliche Subspezies (Rassen) untereinander verschieden. Radikal-Konstruktivisten beugen einer empirischen Überprüfung ihrer Ansichten mittels verschiedener Manöver vor. Die kulturwissenschaftlichen Human-Animal-Studies etwa verabschieden sich unzulässig früh von einem interdisziplinären Abgleich mit den Naturwissenschaften: Man wolle ja nur kulturelle Praktiken erforschen. Das Othern, die Distanzierung vom Gegenüber, wird dann als das Grundübel der Sichtweise des Menschen auf das Tier erkannt und als unmoralisch abqualifiziert.18 So entgeht den Konstruktivisten, dass jedes höhere Lebewesen seine Umwelt instinktiv in Kategorien einteilt: Feind, Futter, Sexualobjekt. Othern wäre dann kein Skandal, sondern Instinkt.
II. Erkenntnisziel und Untersuchungsmethode
Der vorliegende Aufsatz stellt die Frage, wieweit der Marxismus prägend war für den heutigen Progressivismus, dies in Konkurrenz gesehen zu anderen, bürgerlichen Einflüssen. Die ideologische Transmutation, hervorgerufen durch einen Mentalitäts- und Strategiewandel der progressiven Eliten, soll in Grundzügen dargestellt und im Ablauf skizziert werden. Dazu wird, neben übergreifenden Verlautbarungen der Woke-Bewegung, das Parteiensystem der Bundesrepublik zugrunde gelegt mit seinem progressiven Spektrum aus SPD, Grünen und Linkspartei. Im Zweifel wird dabei der Entwicklung der Grünen im Sinne einer pars pro toto-Darstellung gefolgt. Wo ergänzende Befunde über SPD und Linkspartei vorliegen, werden sie berücksichtigt.19 – Der Autor zehrt bei der Ideologieanalyse von seiner Rolle als Zeitzeuge. Er studierte während der 1970er Jahre an linken Fachbereichen und nahm an der politischen Aufbruchsbewegung selbst teil. Wie viele seiner Kommilitonen vertiefte er sich in Marx, Engels und Lenin, rezipierte sie allerdings kritisch. In Diskussionen stieß er vielfach auf ein dogmatisches, irrationales Denken, das er später beim Woke-Progressivismus wiederfand.
[157]
III. Der soziale Wandel durch Individualisierung
Zwischen Marxismus und Wokeismus besteht eine mentale Kluft. Beide Bewegungen sind einem anderen Typ Mensch zuzuordnen, wofür sich in der Sozialstatistik Anhaltspunkte finden. Seit dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg erfuhren die westlichen Gesellschaften einen durchgreifenden Wandel, der die Sozialisationsbedingungen der heranwachsenden Generationen veränderte.20 Einkommen und Konsum hatten zugenommen und die Voraussetzungen für mehr Bildung geschaffen. Die Stellung der Frau hob sich. Die Antibabypille erleichterte die Empfängnisverhütung, was die Geburtenrate bis Mitte der 1970er Jahre unter die Erhaltungsrate von 2,2 Kindern pro Frau drückte. Eine nur minimale Fortpflanzung in Ein- bis Zweikind-Familien wurde in den meisten Ländern der westlichen Welt zur Norm.21 Diese wenigen Kinder wurden familiär oft sehr intensiv betreut, sprichwörtlich waren sie Prinzen und Prinzessinnen mit Helikoptereltern und -großeltern.22 Behütet vor absehbaren Gefahren lernten insbesondere Mittelschichtskinder andere soziale Milieus kaum kennen. Gleichzeitig waren die Verstädterung und die Industrialisierung der Landwirtschaft vorangeschritten. Immer weniger Kinder lernten Naturzusammenhänge aus eigener Erfahrung kennen. Hinzu kamen Veränderungen bei Kommunikation und Medien: zunächst gab es Telefon und Fernsehen, dann Computer, Internet und neue Medien. Trotz Verschiedenheiten, unterlagen alle diese Generationen vergleichbaren Sozialisationsbedingungen: Wohlstand, Mobilität, Bildung und Technik sowie ein deutlicher Mangel an Geschwistern und die Abnahme von (unmittelbaren) Sozialkontakten und Naturerfahrungen prägten die Geburtsjahrgänge ab Anfang der 1970er Jahre. Die nachwachsenden Generationen, jede neue schmaler als die vorangegangene ältere, wiesen Besonderheiten auf, die in der Generationenforschung ermittelt wurden.23





























