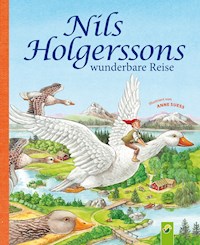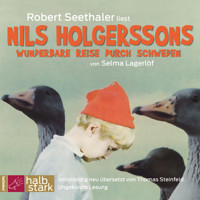3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Geschenkbuch Weisheit
- Sprache: Deutsch
Selma Lagerlöf war die erste Frau, die 1909 den Literaturnobelpreis erhielt. Bei uns ist sie zu Unrecht nur für ihren 'Nils Holgersson' bekannt. Ihr literarisches Schaffen ist eingebettet in das mystische Lokalkolorit der unendlichen Weiten Skandinaviens. In ihren Geschichten erzählt sie von der schicksalsmächtigen Verbindung zwischen den Menschen, der Natur und der in ihr lebenden Geschöpfe. Dieser Band bietet einen idealen Einstieg in das Werk der Gutsherrin mit der sozialen Ader aus dem mittelschwedischen Värmland.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Selma Lagerlöf
Von Trollen und Menschen
Erzählungen
Aus dem Schwedischen von Marie Franzos
Anaconda
Titel der schwedischen Originalausgabe: Troll och människor (Stockholm: Bonnier 1915/21). Die Übertragung von Marie Franzos erschien zuerst 1915 unter dem Titel Trolle und Menschen bei Albert Langen in München. Der Text der vorliegenden Ausgabe folgt der Auflage München 1923 (»8. bis 10. Tausend«) und wurde unter Wahrung von Lautstand und Interpunktion sowie sprachlich-stilistischer Eigenheiten den Regeln der neuen deutschen Rechtschreibung angepasst.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2020 Anaconda Verlag GmbH, KölnEin Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Alle Rechte vorbehalten.Umschlagmotiv: Creative Market / Sunny_LionUmschlaggestaltung: Druckfrei. Dagmar Herrmann, Bad Honnef
ISBN [email protected]
Inhalt
Eine Geschichte aus Halland
Der dienstbare Geist
Eine alte Almgeschichte
Das heilige Bild in Lucca
Das Wasser in der Kirchenbucht
Der Weg zwischen Himmel und Erde
Der Stein im See
Eine Geschichte aus Halland
Vor ungefähr hundert Jahren gab es im südlichen Halland einen alten Bauernhof, der an einer einsamen Stelle nahe der Küste lag. Er bestand aus kleinen, altertümlichen Häuschen mit grauschwarzen Strohdächern, und das Wohnhaus selbst war so uralt, dass es noch Dachfenster hatte.
Dieser Hof hieß Bredane. Es gehörten große Grundstücke dazu; aber nur rings um das Haus konnten sie bestellt werden. Das übrige bestand aus unfruchtbaren Flugsandfeldern.
Alte Leute wussten zu erzählen, dass früher einmal rings um den einsamen Hof ein ganzes Dorf gestanden habe. Das sei zu der Zeit gewesen, als es in Halland noch viele Bäume gab, als gewaltige Eichen- und Buchenwälder von der Meeresküste bis hinauf zur Grenze von Småland wuchsen. Damals hatte das Dorf mit seinen Feldern wie in einer Lichtung gelegen, und die Bäume hatten rings herum gestanden und es beschützt. Aber dann war der Wald gefällt worden, und nicht nur der Wald, der rings um das Dorf stand, sondern alle Wälder in der ganzen Gegend, ja alle Wälder von ganz Halland.
Es heißt, dass die Bauern von Bredane sich zuerst darüber freuten, dass sie den Wald losgeworden waren – nun konnten sie ihre Felder viel weiter ausdehnen und ihre Herden auf offenen Wiesen weiden lassen, wo sie leicht zu hüten waren. Hier und da klagte zwar einer, dass nie ruhiges Wetter sei, seit die Bäume den Wind nicht mehr aufnahmen, und andere jammerten, weil sie bis nach Småland fahren mussten, um Holz zu holen. Aber eigentlich war niemand ernstlich unzufrieden. Niemand glaubte, es könnte eine Gefahr darin liegen, dass der Wald nun dahin war.
Aber das Dorf Bredane lag, wie gesagt, dicht am Meer, und die großen Felder erstreckten sich bis zum Wasser hinunter. Und nun sagt man, es habe sich einige Jahre, nachdem der Wald gefällt war, eines Herbstes begeben, dass der Sturm ein paar verwelkte Grashügelchen unten am Ufer aufriss. Unter diesen Grashügelchen lag feiner, leichter Meersand. Er bestand eigentlich nur aus Schalen von Muscheln und Schnecken, die die große Mühle des Meeres zu feinstem Mehl gemahlen hatte; und der wurde nun vom Wind empor gehoben und begann umherzuflattern. Seitdem war es, als könne der Wind den Strand nicht mehr in Ruhe lassen. Die Grashügelchen waren verdorrt, seit der Wald die Feuchtigkeit nicht mehr festhielt, und sie wurden vom Wind fortgewirbelt, eines nach dem andern. Auf diese Weise kam immer mehr Sand ans Tageslicht und trieb mit dem Sturm fort. Er wirbelte in die Luft, tanzte ein Weilchen und fiel dann in harten weißen Haufen nieder, ungefähr so wie treibender Schnee.
Als die Bauern von Bredane dieses Spiel zum ersten Mal sahen, dachten sie sich nichts Böses dabei. Aber im nächsten Frühling merkten sie, dass die Felder, die dem Meer zunächst lagen, versandet waren.
Es war nur eine dünne Sandschicht, und sie schien der Ernte nicht viel anhaben zu können. Aber der ganze Sommer war ungemein trocken und windig. Das Getreide konnte nicht wachsen, es verwelkte, es verkümmerte zu einem Nichts. Darunter lag die Erde trocken wie Zunder, und jeden Tag riss der Wind ganze Wolken heraus und trug sie fort. Aber unter dieser dünnen Erdschicht lag wieder der leichte Meersand, fein gemahlen wie Mehl und bereit, mit dem Wind zu tanzen. Als der Sommer zu Ende war, hatte der Sturm ganze große Felder, mit denen er sein Spiel treiben konnte. Oben im Dorf Bredane saßen die Bauern und mussten mit ansehen, wie er die Sandmassen emporhob, sie gen Himmel schleuderte, mit ihnen umhertanzte und sie in Haufen und Hügelchen zu Boden warf, die der nächste Tag wieder umformte.
Jahr um Jahr ließ der Wind immer mehr Felder versanden, und die Bauern hatten immer weniger Erde zu bestellen. Sie führten zwar einen Kampf gegen den Sand, sie errichteten Zäune und gruben Deiche, aber nichts schien zu helfen. Wenn sie pflügten und harkten, war es, als hülfen sie dem Wind nur, den Sand aufzuwirbeln. Und ließen sie die Erde in Frieden liegen, dann war sie bald so versandet, dass kein grünes Hälmchen mehr hervorsprießen konnte.
Nicht genug, dass der Flugsand die Felder zerstörte: Er richtete auch sonst allerlei Schaden an. Wenn man am Morgen die Hüttentür öffnete, lag er in Haufen vor der Schwelle, er peitschte einem ins Gesicht, wenn man ausging, er rieselte durch den Schornstein und mischte sich ins Essen – und auf Wegen und Stegen lag er so tief, dass alles Gehen und Fahren unendlich mühselig wurde.
Bald konnten es die Dorfbewohner nicht länger aushalten. Nach einigen Jahren rissen ein paar von ihnen ihre Häuser ein und bauten sie tiefer im Land wieder auf. Jeden Frühling zog jemand fort, und schließlich war vom ganzen Dorf nur noch ein einziger Hof übrig.
Nun glaubte man ja, dass auch dieser Hof nicht lange inmitten der Flugsandfelder stehen bleiben würde. Aber da täuschte man sich. Der Bauer, der ihn besaß, war von jenem Menschenschlag, der sich nicht vertreiben lässt. Nicht, weil er die Gegend so sehr liebte, dass er anderswo nicht hätte leben können, weigerte er sich, seinen Wohnort zu ändern – er konnte es nicht ertragen, dass er gezwungen werden sollte, gegen seinen Willen fortzuziehen. Lieber wollte er da bleiben, wo er war, und mit dem Sand kämpfen.
Und dann kam es so, dass sein Sohn und alle, die nach ihm den Hof besaßen, derselben Gesinnung waren. Sie wollten nichts davon hören, dass der Sand sie zwingen konnte, den Hof zu verlassen, solange sie noch einen Spaten heben konnten, um dagegen anzukämpfen. Und es war kein leichter Kampf, den sie zu führen hatten, vor allem deshalb, weil niemand sie lehrte, wie er geführt werden musste. Niemand sagte ihnen, wie sie den Sand binden sollten, damit er sich still verhalte. Sie begnügten sich damit, dichte Zäune um die Felder zu ziehen, die dem Wohnhaus zunächst lagen, um doch wenigstens diese zu bewahren.
Diese Menschen fragten nicht danach, dass sie um ihres Starrsinns willen in Not und Armut leben mussten. Sich nicht vertreiben zu lassen stellten sie über alles andere. Anstatt der großen Viehherden, die sie früher besessen hatten, hielten sie jetzt nur einige wenige Kühe und ein einziges Pferd. Doch solange sie die füttern konnten, waren sie immerhin imstande, da wohnen zu bleiben.
Was sie bestärkte, war wohl der Umstand, dass ein solcher Kampf ihnen Ansehen brachte. Den Leuten gefiel es, dass sie sich nicht vertreiben ließen. Und wenn der Bauer aus Bredane sich in einer Volksversammlung zeigte, dann drehte sich immer jemand um, um den zu betrachten, der die Kraft hatte, im Flugsand auszuharren.
Aber vor hundert Jahren, als der Kampf zwischen den Menschen und dem Sand am heftigsten tobte, sah es plötzlich aus, als sollte der Sand die Oberhand gewinnen. Der Bauer auf Bredane starb plötzlich im besten Mannesalter, und der Sohn, den er hinterließ, zählte nicht mehr als fünfzehn Jahre, sodass er unter die Vormundschaft seiner Mutter kam. Sie musste also nun den Kampf gegen den Sand führen. Und obgleich sie sich bisher wacker gehalten hatte, glaubte doch niemand, dass sie die Ausdauer haben würde, einen solchen Feind zu überwinden.
Der Sohn hieß Sigurd. Er geriet nach der Mutter, die blond und schön war. Seine Natur war von heiterer Gemütsart, doch solange der Vater lebte, hatte ihm dieser alle seine Sorgen anvertraut, sodass er für sein Alter ein wenig bedrückt und allzu ernst war. Er und die Mutter waren gut Freund. Sie waren darin eines Sinnes, dass sie versuchen wollten, sich auf Bredane zu halten und den früheren Besitzern nicht nachzustehen.
Als der Bauer auf Bredane ein Jahr tot war, kam ein neuer Knecht auf den Hof. Sigurd sah den Knecht erst, als er beim großen Herbstwechsel seinen Dienst antrat. Die Bäuerin hatte ihn im vorigen Sommer auf einer Hochzeit getroffen und ihn sogleich eingestellt, ohne den Sohn um Rat zu fragen. Der Knecht hieß Jan. Er war groß und schlank, hatte braunrotes Haar, blasse Wangen und schwarze Augen. Die Mutter nahm ihn besonders freundlich auf. Als er ins Haus kam, war ein großer Begrüßungsschmaus aufgetischt: Haferkuchen, frisches Brot, frische Butter, Käse, Wurst und Branntwein. Auf dem Tisch lag eine Decke wie am Feiertagsabend. Der Knecht aß unheimlich viel, und Sigurd fand es wunderlich, dass er so zeigte, dass er ausgehungert auf den Hof kam. Während der Mahlzeit und auch später plauderte er unaufhörlich, der Mund stand ihm keinen Augenblick still. Er war sehr scherzhaft, und sowohl die Mutter wie das Gesinde unterhielten sich so gut, dass sie sich vor Lachen gar nicht zu helfen wussten. Auch Sigurd ließ ihn den ganzen Abend nicht aus den Augen, aber er lachte nicht.
Der Knecht ging einen Augenblick in den Stall hinaus, um nach dem Pferd zu sehen. Und da benützte die Mutter die Gelegenheit, Sigurd zu fragen, wie ihm der Neuankömmling gefalle. Sigurd wusste, dass die Mutter sich sehr freuen würde, wenn er sagte, dass er mit ihm zufrieden sei, doch er konnte sich nicht dazu entschließen.
»Ist er nicht ein Zigeuner?«, fragte er nur.
»Ein Zigeuner«, sagte die Mutter. »Warum sollte er ein Zigeuner sein? Weißt du nicht, dass alle Zigeuner dunkel sind? Der hat doch rote Haare.«
»Ja, aber er hat Silberknöpfe an der Weste.«
»Die kann er doch haben, ohne deshalb gleich ein Zigeuner zu sein«, sagte die Mutter und schien erzürnt.
In den nächsten Tagen war Sigurd immer mit dem neuen Knecht zusammen. Was er auch von seiner Abstammung dachte, eines konnte er nicht leugnen: Dass er arbeitete. Er war so flink, dass er an einem Tag mehr ausrichtete als der frühere Knecht in vier. Dazu war er so willig, dass er mehr Arbeit auf sich nahm, als man von ihm verlangte. Nicht genug, dass er das Holz im Holzschuppen hackte, er trug es auch ins Haus. Da war ein Türchen im Stall, das seit Jahr und Tag schräg in den Angeln hing, ohne dass es jemand beachtet hatte – aber nun wurde es instand gesetzt. Er schmierte alte rostige Schlösser, er hämmerte Dauben auf den Braubottich und verstopfte alle Löcher in den Zäunen. Und alle Arbeit ging unter Scherzen und Lachen vonstatten. Es ließ sich nicht leugnen, dass es seit seinem Kommen viel behaglicher im Hause war.
Auf einem Wandbrett in der Wohnstube stand ein alter Kaffeekessel, der schon seit Jahren unbrauchbar war. Eines Tages wandte sich Sigurd an Jan und fragte ihn, ob er ihn nicht vielleicht instand setzen könnte.
»Ich glaube schon. Darf ich ihn einmal ansehen?«, sagte Jan.
Da nahm ihn die Hausmutter vom Wandbrett und reichte ihn Jan, aber sie machte ihm zugleich ein kleines Zeichen. Jan hob den Deckel ab und guckte in den Kessel, stellte ihn aber gleich wieder weg.
»Den wollen wir ausbessern lassen, wenn einmal Zigeuner vorbeikommen«, sagte er. »Es fehlt ihm weiter nichts, er muss nur verlötet werden.«
Bei diesen Worten Jans empfand Sigurd eine große Erleichterung. Er wusste, dass alle Zigeuner dergleichen können; und wenn Jan sich auf diese Kunst nicht verstand, so gehörte er wohl nicht zu ihrem Stamm. Es war so gekommen, dass der Knabe eine große Zuneigung zu dem Knecht gefasst hatte. Darum war er froh, dass Jan kein Zigeuner war und auf dem Hof bleiben konnte.
Aber nach ein paar Tagen wurde Sigurd wieder unruhig, denn da fing Jan an, Geige zu spielen. Die Bäuerin hatte davon gesprochen, welch herrliches Geigenspiel sie in ihrer Jugend gehört hatte, und da hatte Jan seine Geige geholt und angefangen zu spielen. Zuerst hatte er zögernd und unsicher gespielt, als wäre er in der Kunst nicht sonderlich bewandert, doch plötzlich hatte er den Kopf zurückgeworfen, seine Augen begannen zu glänzen, und der Bogen fuhr mit Schwung und Kraft über die Saiten. Es zeigte sich, dass er ein Meisterspielmann war. Wenn er so recht in Fahrt kam, konnten sich die Weibsleute nicht still halten, sondern fingen an zu tanzen. Sigurd hingegen saß regungslos und lauschte nur. Er hatte früher noch keinen so guten Spielmann gehört, und er fand solche Freude an der Musik, dass er nicht tanzen wollte, sondern nur ganz still dasaß und die Töne mit den Ohren einsog. Aber während er so saß und lauschte, geschah ihm etwas Sonderbares. Eine trübe Erinnerung tauchte in seinen Gedanken auf und störte ihn im Genuss. Er sah solch eine Zigeunerbande vor sich, wie sie durch das Land zu ziehen pflegten. Sie kamen in ihren Hof gefahren: ein paar große Wagen, die nur mit Fetzenbündeln beladen schienen und von elenden, ausgehungerten Mähren gezogen wurden. Mit diesen Wagen kamen lange, magere Männer, die Gesichter voll Narben und Schrammen, hässliche gelbe Frauen und eine Unzahl schwarzäugiger Kinder, die überall herumliefen und um alles bettelten, was sie nur sahen. Der Vater war nicht daheim gewesen, als sie gekommen waren, und die Mutter hatten sie eingeschüchtert und sie gezwungen, ihnen alles zu geben, was sie verlangten. Sie mussten ihnen Essen, Branntwein, Heu, Wolle und Kleider geben, sodass das Haus wie geplündert war, als sie endlich ihrer Wege zogen. Und all das fiel ihm jetzt ein, während Jan spielte. Er versuchte, es sich aus dem Sinn zu schlagen, aber es war etwas in dem Spiel, das ihn an die gellenden, schrillen Stimmen der Landstreicher erinnerte.
Ein paar Tage später kam Sigurd in die Wohnstube gestürzt, wo die Mutter saß und spann.
»Nun muss ich dir aber sagen, dass Jan doch ein Zigeuner ist«, rief er.
Die Mutter beugte sich ein wenig vor, aber hörte nicht auf zu spinnen.
»Nein, was du nicht sagst«, erwiderte sie. »Das ist aber eine merkwürdige Neuigkeit.«
Es lag etwas in ihrem Ton, als machte sie sich über ihn lustig.
»Eben jetzt kam ein Wagen voll Zigeuner vorbeigefahren, gerade als Jan und ich im Hof standen. Und sie riefen ihn an, und er antwortete ihnen.«
»Es ist doch nicht verboten, mit Zigeunern zu sprechen«, sagte die Mutter und tat ganz gleichgültig.
»Nein, aber sie haben ihn in der Zigeunersprache angerufen, und er hat ihnen ebenso geantwortet. Ich konnte kein Wort verstehen.«
»Und jetzt meinst du wohl, weil Jan die Zigeunersprache spricht, muss er selber ein Zigeuner sein«, sagte die Mutter in dem sorglosesten Ton der Welt, und ohne mit der Arbeit aufzuhören.
»Glaubst du es denn nicht?«, fragte der Knabe.
Er konnte sich nicht genug wundern, dass die Mutter die Sache so ruhig nahm.
»Musst du ihn denn nicht vom Hof wegschicken?«, fragte er. Denn er hatte immer gehört, dass es unmöglich sei, einen Zigeuner im Dienst zu haben. Er erinnerte sich an die Verzweiflung des Vaters, als die Zigeuner damals dagewesen waren und er bei seiner Heimkehr das Haus geplündert fand.
»Ich glaubte, dieser Hof sei schon heimgesucht genug«, hatte er damals gesagt. »Ich glaubte, es sei an dem Sande genug. Müssen nun auch noch die Zigeuner über uns kommen!«
Später am Abend hatte der Vater Sigurd zu sich gerufen. Er hatte ihn zwischen seine Knie gestellt und angefangen, mit ihm von den Zigeunern zu sprechen. »Merke dir, was ich dir sage«, hatte er gesagt, »und vergiss es nie! Hüte dich, etwas mit Zigeunern zu schaffen zu haben. Denn sie sind nicht wie die anderen, und sie werden nie wie wir. Sie haben etwas Wildes in sich, sodass sie nicht unter einem Dach wohnen können, sondern immer auf der Landstraße herumstrolchen müssen. Sie können nicht so zahm werden, dass sie eine ordentliche Arbeit verrichten, sondern sie wollen nur von Rosstausch und Kartenspiel leben, wenn sie nicht betteln oder stehlen. Und kommt ein Zigeuner so weit, dass er arbeitet, dann wirst du nie sehen, dass er etwas Neues macht, sondern er will immer nur etwas Altes sticken und ausbessern.«
Sigurd sah den Vater ganz deutlich vor sich, wie er damals aussah, als er dies sagte. Er war sehr feierlich gewesen, und die Worte hatten schwer und drohend geklungen. »Merke dir, du sollst nie einem Zigeuner vertrauen, denn sie sind nicht von unserem Stamm, und sie wollen uns immer betrügen! Sie sind mehr dem Troll, dem Nix, dem Nöck verwandt als uns. Darum sind sie auch bessere Wahrsager und Spielleute als wir anderen, aber darum können sie auch nie ehrliche Christenmenschen werden. Sie sind auch darin wie das Hexengesindel, dass sie sich gern ins Dorf schleichen und sich einschmeicheln, sodass sie bei uns Bauern einen Dienstplatz bekommen und später unsere Töchter heiraten und unsere Höfe an sich bringen. Aber wehe dem, der solch einen ins Haus bekommt, denn schließlich kommt doch der Troll in ihm hervor! Sie mögen sich noch so sehr dagegen wehren, schließlich bringen sie Elend über alle, die an sie geglaubt haben.«
Sigurd stand schweigend neben der Mutter und dachte an dies. Sie schwieg auch und zögerte, ihm zu antworten.
»Es wird wohl das Beste sein, wenn ihr Jan ziehen lasst, sobald es sich machen lässt«, sagte er noch einmal.
Jetzt ließ die Mutter die Arbeit sinken, hob den Kopf und sah Sigurd in die Augen.
»Es hat nichts zu sagen, von welchem Stamm Jan ist«, sagte sie. »Ich werde ihn heiraten. Am nächsten Freitag fahren wir zum Pfarrer und bestellen das Aufgebot.«
Sigurd erstarrte zu Eis. Aber was ihn am tiefsten verletzte, war, dass man ihn von allem ferngehalten hatte – dass die Mutter alles bestimmt hatte, ohne nach seiner Meinung zu fragen.
»Wenn zwischen euch schon alles im Reinen ist, so hat es ja keinen Zweck, dass ich noch etwas sage«, brach er los und wandte sich zum Gehen.
Aber als er die Tür aufriss, stand er dem Knecht gegenüber. Jan kam ins Zimmer, mit furchtbar düsterem Gesichtsausdruck. Der hoffnungsloseste Schmerz war in seinen Zügen zu lesen.
»Ich höre, Sigurd will, dass ich von hier fortgehe, weil ich ein Zigeuner bin«, sagte er und ging mit ausgestreckter Hand auf die Bäuerin zu, wie um ihr Lebewohl zu sagen.
»Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als wieder über die Landstraße zu ziehen.«
»Du brauchst dich nicht um Sigurd zu kümmern«, sagte die Bäuerin. »Ich habe ihm schon gesagt, dass wir zum Pfarrer gehen, um unser Aufgebot zu bestellen.«
»Daran ist nicht zu denken«, sagte der Knecht. Er sank auf eine Bank, als hätte er nicht die Kraft, sich aufrecht zu halten, heftete die Augen hartnäckig auf den Fußboden und schlug sich mit der Mütze über die Hand.
»Es hilft nichts, wenn man versucht, davon loszukommen«, sagte er. »Und wenn einer sein Bestes tut, wenn man arbeitet, bis einem das Blut aus den Nägeln spritzt: Immer wird man zurückgestoßen. Wer aus Bauerngeschlecht stammt, der kann sich nicht denken, was es heißt, kein anderes Erbe zu haben als den Landstreicherwagen. Es gibt keine Rettung für mich, ich muss eben wieder davon leben, alten Kram zu verlöten und Pferde zu tauschen.«
Nun ging die Bäuerin auf den Knecht zu. »Ich habe gesehen, welche Mühe du dir gegeben hast. Ich glaube, Sigurd muss es auch gesehen haben. Ich denke, er wird edelmütig genug sein, dir zu vertrauen.«
»Nein, das kann man nicht verlangen«, rief der Knecht.
»Aber vorerst habe ich hier zu befehlen«, fuhr die Bäuerin fort.
»Es ist ganz ausgeschlossen, dass ich auch nur einen Tag gegen Sigurds Willen hier bleibe. Der Hof gehört doch ihm, und es würde nur Zwietracht zwischen Euch und ihm geben, wenn ich bliebe.«
Als Jan dies gesagt hatte, entstand ein langes Schweigen. Sigurd begriff, dass die Mutter jetzt von ihm erwartete, er solle Jan bitten, zu bleiben – und er war selbst so gerührt über dessen Worte, dass er sehr geneigt war, dies zu tun. Aber dann musste er an die Worte des Vaters über die Zigeuner denken. Da entstand ein solcher Kampf und eine solche Unruhe in ihm, dass er kein Wort zu sagen vermochte. Er hätte so gerne gewusst, ob es nicht auch unter den Zigeunern einen ehrlichen, tüchtigen Kerl geben könne, und ob nicht Jan ganz anders geartet sei als die Übrigen.
Jan verhielt sich ganz still. Er hatte aufgehört, sich mit der Mütze über die Hand zu schlagen und starrte mit düsteren Blicken vor sich hin, so als sehe er über endlose Abgründe des Unglücks.
Endlich brach die Mutter das Schweigen.
»Ich weiß, was für ein Mann aus dir geworden wäre, wenn du hier bei uns hättest bleiben dürfen«, sagte sie. »Und ich will nicht, dass du wieder ins Elend gestoßen wirst. Darum will ich mit dir gehen, wenn du uns verlässt.«
»Nein, das dürft Ihr nicht«, rief der Knecht rasch. »Ihr solltet nicht als Landstreicherin umherziehen, Ihr, die Ihr eine Bäuerin gewesen seid!«
»Darein muss ich mich finden, wenn du nicht hierbleiben willst.«
»Nein, darauf gehe ich nie ein«, rief der Knecht. »Habt Dank, dass Ihr das tun wolltet. Aber Euch will ich nicht mit ins Unglück ziehen.«
Sigurd schwieg noch immer. Aber er fing an, sich ein wenig zu schämen: Die anderen beiden waren zu allem bereit, was nur schön und edel war, während er daneben stand und hart und misstrauisch blieb.
Endlich stand der Zigeuner auf, trat auf Sigurd zu und reichte ihm die Hand.
»Lebwohl, Sigurd«, sagte er. »Du darfst nicht glauben, dass ich dir böse bin. Du hast wohl so viel Schlechtes über uns Zigeuner gehört, dass ich es begreife, wenn du keinem von uns etwas Gutes zutraust.«
Sigurd gab ihm nicht die Hand, er sagte auch kein Wort. Er war jetzt so von dem Edelmut der anderen überwältigt und so beschämt über seine eigene Härte, dass er fühlte, dass er im nächsten Augenblick in Tränen ausbrechen müsste. Aber er wollte nicht, dass jemand dies sehe, sondern lief zur Tür hinaus. Schon draußen im Flur überwältigten ihn die Tränen, sodass er laut aufschluchzte.