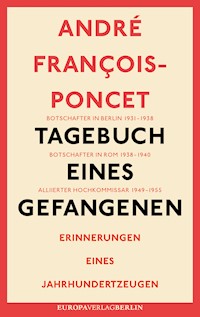Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das deutsche Problem ist für Frankreich so alt wie Frankreich selbst. Es reicht zurück bis zu Karl dem Großen und der Aufteilung des Reiches unter seinen Nachkommen im Vertrag von Verdun 843. Seitdem gibt es ein Frankreich und ein Deutschland, seitdem gibt es Zwistigkeiten, Streit und Kriege, die im 20. Jahrhundert in zwei Weltkriegen mit Millionen Toten und Zerstörungen von nie da gewesenem Ausmaß gipfelten. André François-Poncet, Germanist, Politiker und Diplomat, hat die Entwicklung der deutsch französischen Beziehungen von Beginn des Ersten Weltkriegs bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hautnah erlebt. 1919 fungierte er als Übersetzer für die deutsche Delegation in Versailles, in den 1920er-Jahren war er als Diplomat, von 1931 bis 1938 als französischer Botschafter Deutschland verbunden. Nach seiner Haft als Geisel der SS 1943–1945 wurde er französischer Hochkommissar und schließlich noch einmal Botschafter in Deutschland. In seinem Buch "Von Versailles bis Potsdam" schildert er die verhängnisvollen Entwicklungen in Deutschland nach Abschluss des Versailler Vertrages, die schließlich zum Ende der Weimarer Republik, zur Machtübernahme durch die Nationalsozialisten und zu einem weiteren verheerenden Weltkrieg geführt haben. "Von Versailles bis Potsdam" ist eine spannende Lektüre und ein wichtiges Dokument der Zeitgeschichte – und es ist heute so aktuell wie zu seiner Ersterscheinung 1947, da sich rechtsradikale, nationalistische Kräfte wieder anschicken, Europa und die Freundschaft zu Frankreich infrage zu stellen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ANDRÉFRANÇOIS-PONCET
VON VERSAILLES BIS POTSDAM
FRANKREICH UND DAS DEUTSCHE PROBLEM 1919–1945
Herausgegeben von Thomas Gayda
Der Herausgeber dankt Geneviève François-Poncet für ihr Vertrauen und die Erlaubnis, Einsicht in das Familienarchiv nehmen zu dürfen.
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Titel der Originalausgabe: De Versailles à PotsdamLibrairie Ernest Flammarion, ParisAus dem Französischen übertragen von Dr. Rupprecht LepplaEinziger, vom Verfasser autorisierter deutscher Text (Erstausgabe 1947)
1. eBook-Ausgabe 2020© 2020 Europa Verlag in Europa Verlage GmbH,Berlin · München · Zürich · WienUmschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,unter Verwendung von Fotos von © Bundesarchiv,Abt. Filmarchiv/Transit Film GmbH und Wikimedia Commons,Gryffindor, panorama made by DigonBildnachweis: Archiv der Familie François-PoncetSatz: Danai AfratiRedaktion: Franz Leipold
Konvertierung: Bookwire
ePub-ISBN: 978-3-95890-287-9
Alle Rechte vorbehalten.www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
INHALT
Einführung: Biografische Notizen
Vorwort
Die militärische Niederlage und die deutsche Revolution
Die Nationalversammlung von Weimar
Der Vertrag von Versailles
Der deutsche Widerstand gegen die Durchführung des Vertrages von Versailles
Die Ruhrbesetzung – Stresemann – Der Dawes-Plan
Die Jahre der Illusion – Der Pakt von Locarno – Deutschland im Völkerbund
Von Locarno zum Young-Plan – Das Ende der Zwangsmaßnahmen – Brüning und die Notverordnungen – Der Todeskampf Weimars
Hitlers »Mein Kampf« – Die Fortschritte des Nazismus – Brüning in Ungnade
Papen und Schleicher – Hitlers Machtergreifung
Hitler an der Macht – Die Wiederaufrüstung des Reiches – Das Ende von Locarno
Die Annexion Österreichs – Die Zerstückelung der Tschechoslowakei – Der Angriff auf Polen – Der Krieg
Nach der deutschen Kapitulation – Die Potsdamer Konferenz (I)
Die Potsdamer Konferenz (II) – Die geistige Verfassung der Deutschen – Schlussfolgerungen
André François-Poncet:Ein Europäer der ersten Stunde
Personenregister
EINFÜHRUNG:BIOGRAFISCHE NOTIZEN
Als Sohn einer alteingesessenen Pariser Familie kam André François-Poncet am 13. Juni 1887 in Provins sur Marne (Département Seine-et-Marne) zur Welt. Vater Henri (1851–1925) erlebte das Trauma des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71 mit der Niederlage bei Sédan unter Napoleon III. und dem Verlust von Elsaß-Lothringen. Um die deutsche Mentalität besser einschätzen zu können, animierte er seinen Sohn André – wie viele Väter seiner Generation –, die deutsche Sprache zu lernen, gewissermaßen als Vorsichtsmaßnahme und Voraussetzung, um die zukünftige territoriale Integrität Frankreichs zu sichern. Später wurde Henri Ratsmitglied am höchsten Berufungsgericht in Paris. Sohn André besuchte die führenden Eliteschulen, 1901/02 für ein halbes Jahr die 12. Jahrgangsstufe des Großherzoglichen Gymnasiums in Offenburg, studierte 1907/08 Germanistik in Berlin und München sowie an der renommierten École Nationale Supérieure, wo er seine Dissertation über die Entstehung von Goethes »Wahlverwandtschaften« verfasste und 1909 herausbrachte. Sein Doktorvater war der bedeutendste französische Germanist seiner Zeit, Henri Lichtenberger (1864–1941). Im gleichen Jahr bestand François-Poncet die »L’agrégation d’allemand« als Jahrgangsbester. 1913 veröffentlichte er unter dem Titel »Ce que pense la Jeunesse Allemande« (Was die deutsche Jugend denkt) eine analytische Studie über die Mentalität einer preußisch-militaristisch geprägten Jugend, die zu einer bedeutenden Quelle für das französische Verständnis der wilhelminischen Gesellschaft vor dem Ersten Weltkrieg wurde. 1917 wurde der Kommandant des 304. Infanterieregiments bei Verdun verwundet, wegen besonderer Tapferkeit mit dem Verdienstkreuz ausgezeichnet und daraufhin an die französische Botschaft in Bern abberufen, wo er bis Kriegsende deutsche Geheiminformationen sowie Kriegspropaganda auswertete. Als bereits bekannter Germanist wurde er nach Unterzeichnung des Waffenstillstandes im November 1918 als Dolmetscher zu den Verhandlungen nach Versailles berufen, wo er bis zur Vertragsunterzeichnung im Juni 1919 zugegen war.
Durch die Bekanntschaft mit Robert Pinot (1862–1926), dem Generalsekretär des Interessensverbandes der französischen Kohle- und Stahlindustrie »Comité des Forges«, erhielt er prägende Einblicke in das wirtschaftliche Milieu der Großindustrie. Überzeugt, dass nach dem Krieg wirtschaftliche Fragen im Vordergrund stünden, reifte sein Entschluss, fortan seine publizistischen und militärisch-diplomatischen Erfahrungen in den Dienst der Wirtschaft zu stellen.
1920 erfolgte unter seiner Leitung die Gründung der »Société d’Études et d’Information Économiques« und deren »Bulletin Quotidien«, das er für die nächsten vier Jahre als Chefredakteur leitete. Gleichzeitig verfasste er Kolumnen für die Tageszeitung »L’Avenir«. Im gleichen Jahr heiratete er Jacqueline Dillais (1892–1982) und gründete eine Familie mit fünf Kindern.
Als Delegierter bei der Konferenz von Genua 1922, die die Wiederherstellung der durch den Krieg zerrütteten internationalen Finanz- und Wirtschaftssysteme zum Inhalt hatte, verwies er in einem bemerkenswerten Bulletin auf die Mitschuld der Alliierten an dem finanziellen Zusammenbruch Deutschlands und an den sich daraus ergebenden Zahlungsschwierigkeiten und Wirtschaftsproblemen in ganz Europa. Während der französisch-belgischen Ruhrbesetzung 1923 beauftragte ihn Ministerpräsident Poincaré mit der Leitung des französischen Wirtschaftsnachrichtendienstes in Düsseldorf.
Nach seiner Rückkehr übernahm André François-Poncet wieder die Direktion der »Société d’Études et d’Informations économiques« und verstärkte ab 1924 sein parteipolitisches Engagement: als Mitglied des Abgeordnetenhauses formulierte er das Wahlprogramm des liberal-konservativen »Comité exécutif de l’Alliance Républicaine-Démocratique« (Demokratische Allianz) und kandidierte bei den Wahlen zur Abgeordnetenkammer im Mai 1924 für diese Partei.
1925 fasste er seine politische Philosophie in einer in mehreren Auflagen verbreiteten Programmschrift zusammen: »Réflexions d’un républicain moderne« (Reflexionen eines modernen Republikaners).
In den darauffolgenden Jahren übernahm André François-Poncet zahlreiche parteipolitische Ämter: Er war Unterstaatssekretär in mehreren Kabinetten, Parlamentsabgeordneter für den 7. Pariser Gemeindebezirk sowie ab 1928 Mitglied des Finanzausschusses der Abgeordnetenkammer. Abseits seiner politischen Tätigkeit fand André François-Poncet Zeit, seinem Gönner Robert Pinot eine Biografie zu widmen, die 1927 erschien.
Der Auftrag, in seiner Eigenschaft als Unterstaatssekretär für Volkswirtschaft im Herbst 1930 der Tagung des Völkerbundrates in Genf beizuwohnen, um mit Vertretern Deutschlands über eine engere Zusammenarbeit deutsch-französischer Industrien zu verhandeln, verschaffte ihm internationale Beachtung auf dem politischen Parkett, sodass er bei seiner Ankunft als neu akkreditierter Botschafter Frankreichs in Berlin im September 1931 kein Unbekannter mehr war. Den Untergang der Weimarer Republik und den Aufstieg der Nationalsozialisten erlebte er am Pariser Platz aus nächster Nähe. Er avancierte zur bekanntesten Persönlichkeit auf dem diplomatischen Parkett Berlins, die Französische Botschaft wurde nicht zuletzt auch dank Madame François-Poncet zu einem der gesellschaftlichen »Hot Spots« der Berliner »Society«.
André François-Poncets Engagement, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um die deutsch-französischen Beziehungen auf wirtschaftlicher und kultureller Ebene zu verbessern, ging einher mit warnenden Dossiers an seine Vorgesetzten im »Quai d’Orsay« vor den aggressiv-hegemonialen Ambitionen Hitlers und der immer deutlicher zutage tretenden kriminellen Energie des NS-Systems. Spätestens seit seiner Teilnahme an der Münchner Konferenz im September 1938 – gemäß diplomatischem Protokoll begleitete er den französischen Ministerpräsidenten Edouard Daladier –, die die Zerschlagung der Tschechoslowakei besiegelte, offenbarten sich für André François-Poncet die tödliche Gefahr, die der Nationalsozialismus für die westlichen Demokratien darstellte, und der unvermeidbare Weg in einen Krieg. Da er nicht Empfänger der Kriegserklärung Deutschlands an Frankreich sein wollte, ließ er sich auf eigenen Wunsch im Oktober 1938 nach Rom versetzen, um dort die seit einiger Zeit auf »Eis« gelegten diplomatischen Beziehungen zwischen Italien und Frankreich zu revitalisieren und – in trügerischer Hoffnung – über Mussolini vielleicht doch noch Einfluss auf die immanente Kriegsgefahr nehmen zu können. Mit der Überreichung der Kriegserklärung Italiens an Frankreich durch den italienischen Außenminister Graf Ciano am 10. Juni 1940 endete vorerst seine diplomatische Laufbahn. Er nahm die eindringlichen Warnungen ernst, nicht nach Paris zurückzukehren, wo ihm die Verhaftung durch die Nazis drohte, und suchte mit seiner Familie im mittlerweile zur italienisch besetzten Zone gehörenden Grenoble Zuflucht.
Nach der Besetzung Italiens durch die Alliierten im August 1943 und dem Waffenstillstandsabkommen von Cassibile im September überließen die Italiener die von ihnen besetzte Zone Nazi-Deutschland, woraufhin André François-Poncet im Handstreich von der Gestapo festgenommen und – als sogenannter »Ehrengefangener des Dritten Reiches« – deportiert wurde: zuerst nach Schloss Itter in Tirol und ab November 1943 bis zu seiner Befreiung im Mai 1945 in das Ifen-Hotel in Hirschegg im Kleinen Walsertal. Bewegende Einblicke in diese Zeit der Gefangenschaft vermittelt sein im Jahr 2015 erstmals auf Deutsch erschienenes »Tagebuch eines Gefangenen«.
Bereits wenige Monate nach Kriegsende war absehbar, dass André François-Poncet eine wichtige Funktion beim zukünftigen Wiederaufbau Deutschlands übernehmen würde. Die verbleibende Zeit bis dahin überbrückte er mit schriftstellerischer Tätigkeit: Schon 1946 erschien »Souvenirs d’une Ambassade á Berlin« (deutsch 1947 unter dem Titel »Botschafter in Berlin 1931–1938«) und 1948 »De Versailles á Potsdam« (deutsch 1949).
1948 wurde André François-Poncet dem Oberbefehlshaber der französischen Besatzungstruppen und Militärgouverneur der französischen Militärregierung Pierre Koenig (1898–1970) als diplomatischer Berater zur Seite gestellt. Mit Inkrafttreten des Besatzungsstatutes am 21. September 1949 anstelle der Militärregierung übernahm André François-Poncet die Funktion des Alliierten Hochkommissars über die französisch besetzte Zone. Er war Mitunterzeichner des sogenannten Petersberg-Abkommens vom November 1949, dem ersten wichtigen Schritt der BRD hin zu einem souveränen Staat. François-Poncet behielt diese Funktion bis zur Ratifizierung des Deutschlandvertrages im Jahr 1955. Danach wurde er erster französischer Botschafter in Bonn unter Konrad Adenauer. Parallel zu seiner politischen und diplomatischen Tätigkeit verfolgte André François-Poncet eine literarische und journalistische Karriere, u.a. als Redakteur für den »Figaro« und Autor zahlreicher Bücher, in denen er sich vor allem mit dem »Dritten Reich« auseinandersetzte.
1951 veröffentlichte er seine 1909 entstandene Dissertation über Goethes »Wahlverwandtschaften«. Im gleichen Jahr ernannte ihn die »Cité Internationale Univérsitaire de Paris« zu seinem Präsidenten (bis 1964). 1952 erfolgte seine Aufnahme in die ehrwürdige »Académie Française« als Nachfolger Marschall Pétains und 1961 in die »Académie des Sciences morales et politiques« (Akademie der Moralischen und Politischen Wissenschaften).
Weitere Funktionen, die André François-Poncet im Lauf seines langen Lebens innehatte, waren u.a.: der Vorsitz der ständigen Kommission des internationalen Roten Kreuzes von 1959 bis 1965, Präsident des Französischen Roten Kreuzes von 1955 bis 1967 sowie Präsident der »Cité Internationale Univérsitaire de Paris«, einer Institution zur Förderung von internationalem Austausch, Frieden und Völkerfreundschaft unter Studenten von 1951 bis 1964.
André François-Poncet, Träger zahlreicher Ehrendoktorwürden (wie etwa jener der Universität München) sowie des Großkreuzes des deutschen Bundesverdienstordens und der Französischen Ehrenlegion, starb am 8. Januar 1978. Er fand seine letzte Ruhestätte auf dem Friedhof »Notre-Dame« in Versailles.
Thomas Gayda, im Herbst 2019
VORWORT
Das vorliegende Buch ist eigentlich nicht als ein rein wissenschaftliches Werk zu betrachten; das Beiwort »wissenschaftlich« ist zwar immer ehrenhaft, zuweilen aber ist es eine schwere Bürde. Das Buch erhebt nicht den Anspruch, den behandelten Gegenstand von Grund auf zu erneuern oder zu erschöpfen. Wie hätte es dies auch auf so wenigen Seiten vollbringen können? Es steigt nicht in die Niederungen hinab; es verweilt vorsätzlich auf den Gipfeln der Ereignisse. Es wendet sich nicht an einen Kreis von Historikern und Spezialisten, sondern an das große Publikum, an den wissbegierigen Leser, der sich ohne großen Zeitverlust unterrichten oder seine Kenntnisse auffrischen will, besonders aber an die jungen Menschen, die mit dem Wunsch ins Leben treten, sich über die geschichtlichen Tatsachen klar zu werden, die sich kurz vor ihrer Geburt oder in ihren ersten Lebensjahren abgespielt haben und deren unmittelbare Auswirkungen ihre eigene Existenz in Mitleidenschaft ziehen. Diese Jugend schwebte mir vor, als ich es schrieb. Ich dachte an Guizots Wort, der irgendwo bemerkt, dass »die Geschichte von vorgestern am wenigsten bekannt, die von gestern am meisten in Vergessenheit geraten ist«. Ein Anlass, es zu verfassen, war ferner die Aufgabe, die ich übernommen hatte, den Stoff in einem Dutzend Vorlesungen vor den Studierenden der Pariser Hochschule für Verwaltungslehre vorzutragen. Mithin war mein Bestreben vor allem auf Synthese, auf enge Zusammenfassung und Vereinfachung gerichtet. Ich würde mich belohnt sehen, wenn das auf diese Weise entstandene Werk, dessen Unvollkommenheiten mir keineswegs entgehen, ohne Ermüdung und Langeweile und zugleich mit einem gewissen Nutzen gelesen werden könnte.
Warum wurden die durch den 1918 über das Deutschland Wilhelms II. errungenen Sieg geweckten unermesslichen Hoffnungen so schnell und so schwer enttäuscht? Warum zog Frankreich aus den erdrückenden Opfern, die dieser Sieg es gekostet hatte, so wenig Nutzen? Warum nahm das Problem der deutsch-französischen Beziehungen, von dem man annehmen konnte, es ließe sich nach dem auf die französische Niederlage von 1870 folgenden Zusammenbruch des Reichs einer endgültigen Lösung entgegenführen, von Neuem und so rasch ein ungemein bedrohliches Aussehen an? Wie konnte so früh nach dem Ersten Weltkrieg ein zweiter ausbrechen? Das sind Fragen, die unsere Kinder, wenn sie dereinst erwachsen geworden, an uns zu richten das Recht haben – und die sie auch tatsächlich an uns richten werden.
Ich habe versucht, ihnen Antwort zu erteilen.
Ich habe die Irrtümer, die Fehler, die ihre Väter begehen konnten, nicht verheimlicht. Diese aber sind dafür nicht allein und auch nicht völlig verantwortlich.
Koalitionskriege und gemeinschaftlich errungene Siege erfordern auch gemeinschaftliche Friedensschlüsse. Es sind Kompromissfrieden, in denen sich die Widersprüche zwischen den Siegern spiegeln und die in sich Keime der Auflösung bergen. Das strenge Urteil über den Frieden von Versailles ist zweifellos nicht unbegründet. Aber darf dieses nicht gemildert werden angesichts des Schauspiels, das uns die Sieger von 1945 bieten, die noch heute unfähig sind, sich – selbst in einem schlechten Vertrag – über das Schicksal Deutschlands und Österreichs zu einigen?
Weder 1919 noch im Laufe der folgenden Jahre ist auf die Stimme Frankreichs gehört worden. Seine Ratschläge wurden oft von seinen Verbündeten nicht beachtet. Nachdem die Vereinigten Staaten das Zusammenwirken mit den Alliierten aufgegeben hatten, musste unser Land manches Zugeständnis machen, von dem schwerwiegenden Bedenken geleitet, die Bande der Solidarität und Freundschaft mit Großbritannien nicht zu zerreißen. Es ist heute leicht, den französischen Regierungen vorzuwerfen, nicht genug Energie bewiesen und in der Führung der Außenpolitik nicht mehr Unabhängigkeit bekundet zu haben. Doch sobald sie es zu einer Spannung und Verschärfung der Beziehungen zu London kommen ließen, wurden sie von den parlamentarischen Mehrheiten gestürzt. Dagegen waren sie der Zustimmung der Kammern sicher, wenn sie sich rühmen konnten, um den Preis eines Verzichtes unsere enge Freundschaft mit den Nachbarn jenseits des Kanals gefestigt zu haben. Raymond Poincaré wurde von der Wählerschaft verleugnet und als Ministerpräsident gestürzt, weil er trotz Tadel und Widerstand des britischen Kabinetts dem widerspenstigen Deutschland die starke Hand gezeigt und das Ruhrgebiet besetzt hatte. Und die Erinnerung an diesen Vorgang lastete auf seinen Nachfolgern wie auf ihm selbst.
Somit könnte ein Bericht über die Ereignisse, die sich von 1919 bis 1939 abspielten, leicht zu einer Anklage gegen England werden. Auf diesen Abweg wollte ich mich nicht begeben. Wir müssen die Engländer nehmen, wie sie sind, mit ihren Fehlern und Vorzügen, ebenso wie sie sich mit uns, wie wir nun einmal sind, abfinden müssen. Eine höhere und dauernde Interessengemeinschaft verbindet die beiden Völker. Die Freiheit Europas, wenn nicht der Weltfriede, beruht auf diesem Einvernehmen. Jedes Mal, wenn Europas Freiheit in Gefahr ist, finden sie sich Seite an Seite zu ihrer Verteidigung zusammen. Wir hatten also nicht unrecht, guten Beziehungen zu den Briten einen großen Wert beizumessen. Dank dieser Haltung konnten wir mit ihnen gegen den Ansturm der nazistischen Heere kämpfen, konnten unsere Widerstandsbewegung sogleich nach der Invasion von 1940 auf sie stützen und die entscheidende Hilfe von den Vereinigten Staaten erhalten.
Nichtsdestoweniger ist das Bedauern gestattet, dass nach dem Siege von 1945 die Ansicht Frankreichs bei den Beratungen seiner Alliierten nicht schwerer ins Gewicht fällt, sobald es sich darum handelt, festzusetzen, wie das niedergeschlagene Deutschland sowohl zu einem normalen Leben inmitten der anderen Nationen zurückgeführt als auch für die Zukunft unbedrohlich gemacht werden könnte. Die rassische Verbundenheit führt die Angelsachsen zu dem Glauben, sie seien bessere Kenner der deutschen Psychologie als wir Franzosen. Tatsächlich aber setzt dies sie der Gefahr aus, sich leichter missbrauchen zu lassen. Eine enge Nachbarschaft, jahrhundertealte Berührungen, wiederholte Konflikte und mehrfaches Unheil haben uns reichere Erfahrung beschert. Man täte gut daran, ihr mehr Rechnung zu tragen. Letzten Endes ist es ein psychologischer Irrtum, der die Misserfolge in der Zeit zwischen den zwei Kriegen einleitete. Die Sieger von 1918 beachteten nicht genügend die Deutung, die Deutschland seiner Niederlage vor der Welt und vor sich selbst gab. Sie erforschten die Mentalität der Deutschen nicht gründlich genug, die es Wilhelm II. weniger übelnahmen, dass er eine Politik betrieben hatte, die sie im Grunde billigten, als dass er diese Politik nicht bis zum Erfolg zu führen verstand. Dieses grundlegende Missverständnis wird im Allgemeinen nicht genügend in das rechte Licht gerückt. Alles, was sich in der Folge begab, leitet sich aber daraus ab, in einer Verkettung von Ursachen und Wirkungen, die so lückenlos ist, dass man bei ihrer Betrachtung dem Ablaufen eines unwiderstehlichen Mechanismus zuzusehen glaubt.
Wenn man überdies die Periode zwischen den beiden Kriegen gerecht beurteilen will, muss man einen ihrer charakteristischen Züge berücksichtigen. Vor 1914 kümmerte sich die Öffentlichkeit recht wenig um Außenpolitik. Sie nahm in den meisten Zeitungen einen sehr beschränkten Raum ein. Die ihr vorbehaltene Spalte war zweitrangig. Selten fanden ihretwegen im Parlament Debatten statt, an denen dann meist nur ehemalige Ministerpräsidenten, ergraute Deputierte und Senatoren teilnahmen, die zuvor den Minister von ihrer Stellungnahme in Kenntnis gesetzt hatten. Die Diplomatie stellte sich weder in der parlamentarischen Arena noch auf offenem Markt zur Schau. Sie leistete ihre Arbeit in taktvoller Zurückhaltung, auf die gewohnheitsgemäß Rücksicht genommen wurde.
Nach 1919 nimmt alles einen anderen Lauf. Die breite Masse macht der Diplomatie heftige Vorwürfe, bezeichnet sie als Geheimdiplomatie und klagt sie an, den Krieg heraufbeschworen zu haben. Sie dringt in das Gehege ein, in das sich die Diplomatie zurückgezogen hat. Sie verlangt, alles zu erfahren, äußert sich lärmend über die geringfügigsten diplomatischen Schritte. Jeden Augenblick wirkt sie auf die Entschlüsse der Regierungen ein. Die Außenpolitik tritt in den Vordergrund der Zeitungspolemik. Sie bildet ein Hauptstück der Wahlprogramme. Sie wird zur Parteisache. Sie ist Gegenstand ständiger und leidenschaftlicher Auseinandersetzungen in den parlamentarischen Kreisen. Der mit ihr betraute Minister ist der Erregung, den Stimmungsschwankungen und dem Druck einer eher gefühlsmäßig als überlegt reagierenden Masse ausgesetzt, die bisweilen von außen beeinflusst wird. Ist dies ein Vorteil oder ein Nachteil? Ich fürchte, dass die »Diplomatie der Straße« mehr als einen Anlass bietet, sich nach der sogenannten Geheimdiplomatie zurückzusehnen, dass sie viel mehr Schaden anrichtet als diese und in Wirklichkeit die Verneinung aller Diplomatie ist. Aber sei es, wie es ist, in der Folge dieses Zustandes tragen die Völker mehr als früher die unmittelbare Verantwortung für die Handlungen ihrer Regierungen und die Fehler, die sie diesen zuschreiben, fallen ihnen oft selbst zur Last. Die öffentliche Meinung, nicht nur in Frankreich, gefiel sich in der Vorstellung, der Krieg von 1914–1918 habe den Schlussstrich unter ein Kapitel der Menschheitsgeschichte gezogen und das Zeitalter der Kriege sei nunmehr abgeschlossen. Sie interessierte sich nicht mehr für die Wehrpflicht. Sie setzte ihr ganzes Vertrauen in den Völkerbund, in die Idee der kollektiven Sicherheit und die automatische Ausschaltung des Krieges durch die Organisation des Friedens. Sie verfiel in eine Art Friedenspsychose und machte sich hiervon nur mühsam, ungern und zu spät frei. Sie hörte nicht auf die Warnungen derer, die sie aufzuwecken und ihren Blick auf bedrohliche Erscheinungen zu lenken suchten, die allerdings ihren vorgefassten Ansichten zuwiderliefen. Trotz der Speichelleckerei der Demagogen, die den Massen einreden wollen, sie besäßen alle Tugenden, werden Klugheit und Scharfblick immer Eigenschaften einer nur kleinen Elite sein.
Haben wir, wie uns oft vorgeworfen wird, der Rachsucht die Zügel schießen lassen? Haben wir durch unsere Forderungen und unsere Unnachgiebigkeit dazu beigetragen, die Weimarer Pseudodemokratie in Verruf zu bringen? Haben wir in Deutschland die nationalistische und kriegerische Glut geweckt, die sich in Hitler, diesem plebejischen Wilhelm II., verkörperte? Um die Wahrheit frei zu sagen: Diese Glut war nie erloschen. Sie glomm unter der dünnen Aschenschicht weiter, mit der man sie zugedeckt hatte. Sie verbarg sich so lange, wie es unklug war, sie offen zutage treten zu lassen. Dennoch gab es viele Franzosen, die aufrichtig wünschten, der deutsch-französische Zweikampf möge ein Ende nehmen, die von ganzem Herzen die Versöhnung anstrebten und sich allen Bemühungen um Annäherung anschlossen. Allerdings sollte nach ihrer Ansicht der Versailler Vertrag die Grundlage dieser Annäherung bilden. Sie glaubten nicht, dass seine Bedingungen übertrieben und ungerecht seien. Sie sahen in ihnen eine natürliche Entschädigung für das erlittene Unrecht und eine heilsame Vorsichtsmaßnahme für die Zukunft. Die Deutschen dagegen, die gewöhnt sind, sich als Opfer aufzuspielen, und denen angeboren ist, niemals einen Fehler einzugestehen, meinten, die Beseitigung des Vertrages, besonders seiner Klauseln über Reparationszahlungen und militärisches Statut des Reiches, müsse die Vorbedingung oder die erste Folge der Versöhnung sein. Auf diesem Boden war keine Verständigung möglich. Frankreich ist dennoch Stufe um Stufe auf der Leiter der Zugeständnisse herabgeglitten. Hätte Frankreich etwa bessere Ergebnisse erzielt, wenn es sich diese Zugeständnisse nicht hätte abpressen lassen, sondern sie – vorausgesetzt, dass sein Volk es geduldet hätte – allein, aus eigenem Antrieb und mit einem Schlage in Form der von den Deutschen geforderten »großen Geste« gewährt hätte? Man kann es mit Recht bezweifeln. Es ist nicht sicher, ob die fragliche große Geste nicht für ein Zeichen der Schwäche und der Angst gehalten worden wäre und zum Triumph der Nationalisten geführt hätte.
Aus der Geschichte jener zwanzig Jahre zwischen den beiden Kriegen lassen sich nützliche und treffende Lehren ziehen. Die meisten davon hat man schon aus den Augen verloren. Man würde sich wohl eher daran erinnern, wenn nicht klar wäre, dass das deutsche Problem sich heute in anderer Weise darstellt als gestern. Einerseits spricht die Niederlage von 1945 zu den Deutschen eine weit beredtere und schwerer zu verfälschende Sprache als die von 1918. Die in den Städten aufragenden Ruinen, die Besetzung des gesamten Staatsgebiets durch die fremden Heere, der Zusammenbruch der Industrien, das Verschwinden jeder militärischen Streitmacht, das herrschende Elend – sie reden eine Sprache, der sich das germanische Ohr und das germanische Gehirn nicht verschließen können. Deutschland hat für lange Zeit aufgehört, für sich allein eine Gefahr für den Frieden zu sein. Aber es ist andererseits ein Ereignis von bedeutender Tragweite eingetreten, das die Sieger nicht vorausgesehen hatten. Einer von ihnen, einer von denen, die an ihrer Seite mit der größten Erbitterung und dem größten Heldenmut gekämpft hatten, löste sich von ihnen los. Ja noch mehr, er erhob sich gegen sie. Dem Siege folgte die Zwietracht. Der nationalistisch, militaristisch und panslawistisch gewordene russische Kommunismus erwies sich als expansions- und eroberungslustig. Sowjetrussland riss die Staaten Mittel- und Osteuropas an sich. Es umgab sich mit einem Ring von Satelliten, seinem Willen unterworfen und hinter einem eisernen Vorhang abgesperrt, bildete einen Ostblock, dessen Spitze sich gegen den Westen richtet. Es nahm eine offen feindselige Haltung gegenüber seinen Gefährten von gestern ein, gegen die liberalen Demokratien und besonders gegen die Vereinigten Staaten von Amerika, denen es seine eigenen imperialistischen Herrschaftspläne unterstellt. Es zwang Westeuropa, das eine Abneigung zeigt, den eigenen Augen zu trauen, sich auf seine Verteidigung einzurichten, seine Solidarität aufgrund des Marshallplanes zu organisieren, den ihm Amerika anbot, um dem Kontinent beim Verbinden der Kriegswunden zu helfen. Die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken nahm sogar das Recht in Anspruch, Westeuropa die Annahme dieses Planes zu verbieten. So sind Europa und die Welt in zwei gegensätzliche Gruppen geteilt, und die Organisation der Vereinten Nationen, welche die Harmonie und den Frieden der Welt sichern sollte, bleibt gelähmt. Aber die Trennungslinie, die Bruchlinie zwischen den beiden Blöcken, läuft in Europa mitten durch Deutschland. Sie zerschneidet Deutschland in zwei Hälften. Der eiserne Vorhang der Sowjets fällt vor der russischen Besatzungszone herunter. Wenn auch selbst ohnmächtig, wird Deutschland dadurch ein zusätzlicher Wertfaktor, der im Kampf um die politische Vormacht, den seine Gebieter ausfechten, eingesetzt werden kann. Jeder von diesen versucht, den von ihm kontrollierten Teil Deutschlands auf seine Seite zu bringen und in seinem Lager zu behalten. Russland entwickelt mit der Kommunistischen Partei, von ihm beraten und gelenkt, die hinterhältigste Propaganda. Es wirft sich zum Vorkämpfer der Wiederherstellung der Reichseinheit auf. Es befürwortet die Wahl einer Nationalversammlung für das ganze Reichsgebiet, und diese soll dem Reich ein politisches Statut geben. Von dieser Nationalversammlung hofft Russland, dass in ihr seine Anhänger die Oberhand gewinnen. Russland schmeichelt den patriotischen Gefühlen der deutschen Nationalisten, der ehemaligen militärischen Kreise, die für sich zu gewinnen, es sich während ihrer Kriegsgefangenschaft bemüht hat, der großen Masse der »kleinen Nazis«, die es schont, nachdem es die Führer bestraft und ausgeschaltet hat. Russland verbreitet den Gedanken, Deutschland habe, wenn es sich mit ihm in einem Nationalkommunismus als Nachfolger des Nationalsozialismus verbinde, die Gelegenheit, sich an den kapitalistischen Demokratien zu rächen und seine Stellung als Großmacht wiederzugewinnen. Es gibt keine deutsche Gefahr mehr. Aber an ihrer Stelle ist eine russische Gefahr aufgetaucht, und sofort droht die deutsche Gefahr als Folge der russischen wiederaufzuleben. Um sich dagegen zu verteidigen, können die Westmächte sich nicht damit begnügen, mit der Abneigung zu rechnen, die die meisten Deutschen dem Bolschewismus gegenüber noch empfinden, oder mit dem Hass, den grausame Methoden der russischen Besatzung gesät haben. Sie müssen der Bevölkerung ihrer Zonen ein Dasein schaffen, das dem der Bewohner der Ostzone vorzuziehen ist, bessere Ernährung, größere und lohnendere Verdienstmöglichkeiten, ein sanfteres und liberaleres politisches Klima, die Aussicht auf Gleichberechtigung in der Organisation eines künftigen europäischen Staatenbundes; und außerdem dürfen sie keinen Zweifel darüber lassen, dass sie einem etwaigen Angriff der Slawen Widerstand zu leisten vermögen.
An dieser Aufgabe kann Frankreich in wirksamster Weise mitarbeiten. Seine Lebensformen, der Ideenkreis, in dem es sich bewegt, die Atmosphäre seiner Kultur, seine Überlieferungen machen es ihm leichter als jeder anderen Nation, in Süd- und Westdeutschland Gehör und Verständnis zu finden. Gewiss hätte Frankreich tausend Gründe, in einer radikalen Ablehnung gegenüber jenem Volke zu verharren, das es im Verlauf von noch nicht einem Jahrhundert dreimal überfallen und so vielen seiner Kinder brutalste Misshandlungen und abscheuliche Martern zugefügt hat. Indes lässt sich nicht feststellen, dass Frankreich von Hass und Rachedurst beseelt sei. Zwar vergisst es die Vergangenheit nicht, aber sein Instinkt, seine tiefe Humanität treiben es im Gegenteil dazu, sich noch einmal auf die Suche nach den Wegen einer besseren Zukunft zu begeben und bei den Deutschen eine Entwicklung zu fördern, die es erlaubt, sie in den Kreis der Demokratien des Westens aufzunehmen und dauerhafte gutnachbarliche Beziehungen zu ihnen herzustellen.
Ich habe meinen Abriss der Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen in der Zeit zwischen den Kriegen mit der Potsdamer Konferenz abgeschlossen. Diese stellt in der Tat den letzten Augenblick dar, da die Alliierten noch untereinander einig sind und man glauben kann, es sei ihnen gelungen, gemeinsame Grundsätze für eine gemeinschaftliche Regierung Deutschlands bis zum Abschluss eines endgültigen Vertrages festzulegen. Kaum zwei Monate später ist diese Einigkeit schon hinfällig. Es beginnt ein unruhevoller und dramatischer Zeitabschnitt, die Periode des »Kalten Krieges«, wobei die Sorge um die Zukunft und die Angst wieder in die Herzen einziehen. Sie dauert noch an, reich an überraschenden Wendungen und verschiedenen Zwischenfällen. Ich habe die Probleme angeführt, die diese Periode zu lösen hat, und die Faktoren, aus denen sie sich zusammensetzt.
Wie werden diese Probleme gelöst werden? Niemand vermag es zu sagen. Gleichwohl kann man sich nicht des Eindrucks erwehren, dass das neue Kapitel der Geschichte, das vor uns aufgeschlagen ist, in eigentümlicher Weise dem ähnelt, das wir erlebt haben, und dass der Totalitarismus Stalins seltsam an den Totalitarismus Hitlers erinnert. Muss man daraus den Schluss ziehen, dass aus dem gegenwärtigen Konflikt zwangsläufig ein dritter Weltkrieg entsteht? Nein – wenn wir Nutzen aus den Lehren ziehen, die die jüngste Vergangenheit erteilt hat.
Hier gewinnen die Lehren der Zeit zwischen den beiden Kriegen ihre ganze Aktualität zurück. Die westlichen Demokratien, die Staaten, die das bilden, was man als das »atlantische Europa« bezeichnen kann, sind sich der sie bedrohenden Gefahr bewusst. Sie haben die Grundlage für eine gemeinsame, koordinierte Verteidigung geschaffen. Wenn Sowjetrussland sieht, dass es keine Aussicht mehr hat, sie zu trennen, ihren Widerstand und ihren Zusammenhang von außen zu brechen oder von innen zu sprengen, so ist es möglich, dass es vor der Gefahr eines Weltbrandes zurückschreckt. Wenn es begriffen hat, dass wir ihm gern den Genuss eines Regimes nach seinem Geschmack belassen, aber auch entschlossen sind, uns von ihm nicht verschlingen zu lassen, dann wird es sich vielleicht anschicken, die Formel eines auf der Teilung der Einflusssphären und dem Gleichgewicht der Kräfte beruhenden Friedens zu suchen.
Hätte sich Adolf Hitler einem kompakten und geschlossenen Block gegenübergesehen, so hätte er nicht gewagt, einen Krieg zu entfesseln.
Für das Abendland wäre es die schwerste Gefahr, wenn die Schwäche seiner Regierungen, der Defaitismus seiner öffentlichen Meinung, die Heftigkeit seiner inneren Gegensätze, der Egoismus und die Händel der Völker, aus denen es sich zusammensetzt, aus ihm eine verlockende, leicht zu verschlingende Beute machten.
Durch Einigkeit, Mut, Klarheit einer Interessengemeinschaft, methodische Organisation, Hinnahme der militärischen Notwendigkeiten, Bürgersinn, aber auch, im Innern der Staaten, durch wohlbedachte Verbesserung des Loses der Leidenden durch fortschrittliche Sozialpolitik und den Kampf gegen das Elend, diesen Zutreiber des Bolschewismus und Schöpfer des Aufruhrs, werden die Menschenrechte, die Achtung vor dem Individuum, die demokratischen Freiheiten und alle Errungenschaften am sichersten bewahrt werden, auf denen das Wesen unserer Zivilisation beruht und die ihren Wert ausmachen.
DIE MILITÄRISCHE NIEDERLAGE UND DIE DEUTSCHE REVOLUTION
Das deutsche Problem ist für Frankreich so alt wie Frankreich selbst. Es reicht bis in die Zeit zurück, in der die Nachfolger Karls des Großen sein Reich teilten und in Uneinigkeit gerieten. Recht oft haben mir Deutsche, die witzig sein wollten, gesagt: »Wir sind für die Abschaffung des Vertrages …«, und ehe ich Anstoß an ihrer Äußerung nehmen konnte, fügten sie eilig hinzu: »Für die Abschaffung des Vertrages von Verdun.«
Der im Jahre 843 nach der Niederlage Lothars bei Fontenay und den Straßburger Eiden geschlossene Vertrag von Verdun sprach Ludwig dem Deutschen das Land ostwärts des Rheins sowie Speyer, Worms und Mainz auf dem linken Rheinufer zu, Karl dem Kahlen das Land westlich der Schelde und Maas, während ein Gebietsstreifen zwischen der Schelde und der Weser Lothar zugleich mit der Kaiserwürde zugeteilt wurde.
Seitdem gibt es ein Frankreich und ein Deutschland, seitdem auch einen jahrhundertelangen Streit. Es ist, als zögen sich die beiden Hälften eines früher einheitlichen Ganzen in gleichem Maße wechselseitig an und stießen sich ab, als lebte in ihnen eine verborgene Sehnsucht nach der verlorenen Einheit und als versuchten sie, diese Einheit auf dem Wege der Politik oder der Gewalt wiederzugewinnen. Besonders die Deutschen träumen noch heute wie ihre Altvordern davon, Karl den Großen zu wiederholen. Sie möchten, wie er es war, Nachfolger und Erben des römischen Reiches sein, Europa beherrschen, wie er es beherrschte und wie nach ihm das Heilige Römische Reich deutscher Nation es zu beherrschen strebte.
Die Erinnerung an das heilige Imperium ist im neuzeitlichen Deutschland keineswegs erloschen. Sie wird schon durch das Wort »Reich« heraufbeschworen, das den Deutschen so teuer ist, das, der Vergangenheit zugewandt, Stolz und Bedauern ausdrückt, im Hinblick auf die Zukunft aber eine Hoffnung und ein Programm bedeutet. Franz von Papen sprach gern vom heiligen Reich, wohl wissend, dass er damit den Ohren seiner Hörer schmeichelte. Und eine der ersten Maßnahmen Hitlers nach der Annexion Österreichs und der Besetzung Wiens war es, die Reichsinsignien von dort wegzunehmen und nach Nürnberg zu bringen.
Als an der Spitze des Römischen Reiches Deutscher Nation Österreicher standen, die in Flandern, Lothringen, Italien und Spanien begütert waren, entstand für Frankreich die tödliche Gefahr einer Einkreisung. Es wurde zu seiner Hauptsorge, der Erstickung zu entgehen und seine Sicherheit auf der am meisten bedrohten Seite zu festigen, das heißt im Norden, im Osten und am Rhein. Hieraus ist zum großen Teil die Politik Richelieus, Ludwigs XIV., der französischen Revolution und Napoleons zu erklären.
In uns näherliegenden Zeiten nahm die deutsche Frage ein neues Gesicht an, als Preußen die Bühne des europäischen Theaters betrat. Dieses halbslawische, unter einen für barbarisch erachteten Himmelsstrich entrückte Preußen, das erst seit 1701 ein Königreich war, genoss in Frankreich zunächst große Beliebtheit, da es sich als Nebenbuhler Österreichs erwies. Wir verhalfen ihm zum Aufstieg, indem wir zur Schwächung Österreichs beitrugen, Österreich auf den Schlachtfeldern des Erbfolgekrieges schlugen, später bei Magenta und Solferino, schließlich zuließen, dass es bei Königgrätz besiegt wurde, und indem wir die Bildung der italienischen und der deutschen Einheit begünstigten. Bismarck wollte ein föderatives Deutsches Reich unter preußischer Führung gründen, dem alten österreichischen Kaiserstaat gewachsen, wenn nicht gar überlegen. Die Deutschen nach ihm waren weniger klug. Sie waren von dem Ehrgeiz besessen, die erste Macht des Kontinents zu werden. Verblendet von dem stolzen Bewusstsein, in der Reformation nicht nur die einzige große Ketzerei des Christentums, die gelungen war, verbreitet, sondern auch in der kurzen Spanne von ein bis anderthalb Jahrhunderten die ganze Welt durch Reichtum und Vielseitigkeit geistiger Schöpfungen wie auch durch einen unerhörten industriellen Aufschwung verblüfft zu haben, berauscht von außerordentlich raschen Erfolgen, verfielen die Deutschen zwei Krankheiten, von denen sie auch jetzt noch nicht geheilt sind: dem Verfolgungswahn und dem Größenwahn. Für ihr Streben nach Hegemonie, dieser Kehrseite zurückgedrängter Emporkömmlingsgefühle, erschien Frankreich als Hindernis. Der Krieg von 1870/71 hatte dieses Land nicht ausgeschaltet. Es hatte sich ziemlich rasch wieder aufgerichtet. Mit Russland verbündet, mit England befreundet, war es für Deutschlands Bestrebungen wieder ein Hemmschuh geworden. Das Deutschland Wilhelms II. wollte Frankreich das Rückgrat brechen. Es gelang ihm aber nicht. Jedoch hat es aus Gründen, die wir noch darlegen werden, das durch den Entscheid der Waffen gefällte Urteil nicht anerkannt.
Deutschland fiel in einen nationalistischen Rausch zurück. Es brachte einen Hitler hervor, der auf einer mehr plebejischen Ebene mittels einer verwegenen sozialen Demagogie die Massen für sich gewann. Hitler hat den Versuch Wilhelms II. erneuert. Er ist noch gründlicher gescheitert. Deutschland ist besetzt, zerschmettert, ruiniert und praktisch vernichtet. Dennoch zählt es nicht weniger als siebzig Millionen Einwohner, ein beachtenswertes menschliches Potenzial. Es handelt sich jetzt darum, über sein Los zu entscheiden, ihm ein Statut zu geben, es durch einen Vertrag zu binden, der nach Möglichkeit weniger brüchig ist als der Vertrag von Versailles. Es gilt, die Rolle zu umreißen, die Deutschland hinfort in Europa zu spielen berufen ist. Was wird diese Rolle sein? Und was wird dieses Europa sein? Die Sieger, die sich auf deutschem Boden niedergelassen haben, sind unter sich uneinig. Sie können sich darüber nicht verständigen, wie der vor zweieinhalb Jahren errungene Sieg verwertet werden soll, sodass die deutsche Frage noch immer ungelöst ist. Bei meinem Versuch, zu klären, wie sich das zeitgenössische deutsche Problem vor unseren Augen darstellt, will ich nicht bis auf die Ursprünge dieses episodenreichen und noch nicht abgeschlossenen Dramas zurückgehen. Das Wort »zeitgenössisch« allerdings ist ein dehnbarer Begriff. Ich war Zeitgenosse von Ereignissen, die vor der Geburt der meisten meiner Leser liegen. Die dritte Republik, deren Weg meine Generation nur zur Hälfte oder zu zwei Dritteln miterlebt hat, rechnen die Historiker, wenn ich nicht irre, auch zur zeitgenössischen Geschichte. Es wäre, glaube ich, richtig, als zeitgenössisch die Ereignisse zu betrachten, für die es noch Augenzeugen, wenn nicht gar Mitwirkende gibt, die imstande sind, darüber mindestens das zu berichten, was sie wahrgenommen haben.
Gemäß dieser Auffassung werde ich meine Betrachtung mit dem Ausgang des Ersten Weltkrieges Ende 1918, mit der Stunde des Waffenstillstandes und des Friedens beginnen. Ich werde sie vom Versailler Friedensschluss weiterführen bis zur deutschen Kapitulation, die den Zweiten Weltkrieg beendet, bis zur Konferenz von Potsdam, die nach der Niederlage Deutschlands Schicksal bestimmt hat. »Von Versailles bis Potsdam« kann somit der Titel dieser Studie lauten.
Ich werde mich bemühen, zu zeigen, wie der Versailler Vertrag nicht hielt, was er versprach; wie er weder den deutsch-französischen Gegensatz noch das deutsche Problem löste; wie die Weimarer Republik Bankrott machte, von der man doch erwartete, dass sie demokratische Einrichtungen einbürgerte und Deutschland ein neues Gesicht und eine neue Seele gäbe; wie, so kurz nach der Niederlage, das Reich an Revanche denken konnte; wie Aufstieg, Diktatur und Sturz Adolf Hitlers zu erklären sind; wie sich endlich, nach der Kapitulation und der zweiten Katastrophe, die Lage Deutschlands gestaltet, das von vier fremden Heeren besetzt und von vier fremden Regierungen abhängig ist.
Ich gebe nur eine summarische, in großen Zügen gehaltene Skizze von den rund 28 Jahren, die seit dem Zusammenbruch des Reiches Wilhelms II., des »zweiten Reichs«, verflossen sind. Man findet hier keinen vollständigen Bericht, keine lückenlosen Aufzählungen und Chronologien. Ich bemühe mich vor allem, die allgemeinen Ideen herauszuarbeiten, die meines Erachtens den Tatsachen zugrunde liegen und zu deren Erklärung dienen. Dabei hebe ich die Männer hervor, die ich persönlich kannte, und die Ereignisse, an denen ich irgendwie beteiligt war.
Man wird auf diesem Wege bemerken, dass die Fragen, die uns zur Stunde bewegen, oft sehr verwandt mit den Fragen sind, die uns gestern beschäftigt haben. Die Geschichte ist eine Lehrmeisterin. Aber es wird sich auch zeigen, dass der Mensch sich nicht viel um die Lehren der Geschichte kümmert. Die Erfahrungen seiner Vorgänger zählen in seinen Augen gering. Und er kehrt fröhlich zu den schon begangenen Fehlern zurück. Man kann dies in gewisser Hinsicht bedauern. In anderer Beziehung ist es besser, sich philosophisch damit abzufinden. Denn wenn jede Generation die Früchte aller Erfahrungen erntete, die von allen ihr vorausgehenden Generationen erworben worden sind, befände sich unsere Generation heute auf dem Gipfel einer Pyramide der Weisheit. Aber ihr Selbstvertrauen, ihr Lebensmut, ihre innere Glut, wären dadurch empfindlich herabgesetzt. Ich war stets der Meinung, dass die Ausbreitung der Weisheit den Beginn des Niedergangs der Menschheit bedeutet. Von diesem Standpunkt aus gesehen, ist das sich uns heute bietende Bild der Welt durchaus beruhigend. Es ist uns kein Zweifel darüber erlaubt, dass die Menschheit Aussicht hat, noch viele Jahrtausende zu erleben.
Im Herbst 1918 kamen für viele von uns das Ende der militärischen Operationen, die Unterzeichnung des Waffenstillstandes und die deutsche Kapitulation plötzlich und unerwartet, fast wie ein Wunder.
Das ist nicht erstaunlich, wenn man bedenkt, dass im März 1918 das englische Heer mit knapper Not dem Unheil entging, dass wir selbst im Mai am Chemin des Dames zerschmettert und auf die Marne zurückgeworfen wurden, dass Paris zu dieser Zeit den Granaten des langen Max ausgesetzt war und dass es uns erst Mitte Juli durch einen Gegenangriff in der Champagne gelang, wieder die Initiative zu ergreifen und eine Reihe erfolgreicher Offensiven durchzuführen. Von Juli bis November hatten wir das deutsche Heer zum Rückzug gezwungen. Aber es ging Schritt für Schritt zurück, in voller Ordnung, kämpfend; und es machte den Eindruck, dass es noch in sich gefestigt und furchtbar war. Marschall Foch hatte für November einen Angriff auf Deutsch-Lothringen vorbereitet. Er erhoffte davon bedeutenden Erfolg. Dennoch glaubte er nicht, dass es die letzte Schlacht sein würde. Er rechnete mit einem Winterfeldzug, mit dem Endsieg erst im Frühling 1919. Aber am 11. November 1918 erklärte sich Deutschland besiegt. Es unterzeichnete den Waffenstillstandsvertrag. Vier Monate hatten genügt, um eine völlig veränderte Lage zu schaffen und die gewaltige Kriegsmaschine des Gegners außer Gefecht zu setzen. Man traute seinen Augen nicht. Die Reichweite und die Schnelligkeit dieses Umschwungs erfreuten natürlich die Alliierten, überraschten sie aber auch, denn sie konnten seine Ursachen nicht klar erkennen.
Ihrer Freude, ihrem Triumph war deshalb ein gutes Teil Misstrauen beigemischt. Die Furcht vor Deutschland, seiner verbleibenden Kraft und seinen möglichen Gegenwirkungen überlebte den Waffenstillstand und beeinflusste während der Ausarbeitung des Friedensvertrages den Geist der Unterhändler, nicht nur der Engländer und Amerikaner, sondern auch der Franzosen. Frankreichs Sorge um seine Sicherheit, die in der Folgezeit eine so wichtige Rolle spielen sollte, tritt in demselben Augenblick in Erscheinung, in dem das Reich Wilhelms II. die Waffen niederlegt.
Als das Signal zum Einstellen des Feuers ertönt, sieht es so aus, als seien die Engländer von tiefem Hass gegen die Deutschen erfüllt. Sie bezeichnen sie nur als »Hunnen«. Lloyd George schwört, der Kaiser werde in einem Käfig durch die Straßen geführt und dann gehängt werden, und man werde Deutschland zur Wiedergutmachung der von ihm verursachten Schäden pressen, »bis man die Knochen krachen hört«.
Weniger grimmig sind die Amerikaner. Ohne die Zerstörungen durch den U-Bootkrieg und die Torpedierung der »Lusitania« vergessen zu haben, denken sie eher daran, Schiedsrichter zu spielen, in dieses kleine und doch so zersplitterte Europa Ordnung hineinzubringen und dort eine neue und aufsehenerregende Einrichtung zu schaffen, die unter dem Namen »Völkerbund« den Weltfrieden verbürgen soll. Und obendrein wollen sie so früh wie möglich heimkehren.
Die Franzosen können den »Boches« nicht die begangenen Verwüstungen verzeihen, die Ersäufung der Gruben, die Verstümmelung der Obstbäume und die Deportierung der Bevölkerung der nördlichen Departements. Deutschland soll die Schäden, für die es verantwortlich ist, vollständig wieder gutmachen und die Kosten der Reparationen tragen. Auch soll der Krieg, dessen Lasten Frankreich vier Jahre hindurch getragen hat, der letzte aller Kriege gewesen sein. Das Mittel hierzu ist die Entwaffnung des Reichs. Es soll unter die Aufsicht eines Bundes aller friedliebenden Völker gestellt werden. Wiedergutmachung aller Schäden von gestern und Sicherheit für morgen sind die Hauptforderungen, die sich die französische öffentliche Meinung einhellig zu eigen macht. Sie erkennt nichtsdestoweniger an, dass die Deutschen tapfere Soldaten gewesen sind. Bei allem Abscheu empfindet sie für den deutschen Soldaten insgeheim eine gewisse Achtung, was ihr den Wunsch eingibt, die Ära der deutsch-französischen Konflikte möchte ein für alle Mal beendet sein.
Engländer, Amerikaner und Franzosen sind gleichermaßen überzeugt, dass dieser grausamste und blutigste aller Kriege, den es je gegeben hat und nach ihrer Meinung je geben wird, von Deutschland, seinem Ehrgeiz, Machthunger und Hegemoniestreben gewollt und hervorgerufen worden ist, dass Deutschland schuldig ist und als schuldig behandelt werden muss.
Den Deutschen dagegen hat man ihrerseits eingeredet, und sie haben es gehorsam anerkannt, dass sie nichts anderes taten, als sich in einem Krieg zu verteidigen, der ihnen aus Neid und Hass aufgezwungen wurde, um ihrem Land den gebührenden Platz an der Sonne zu verwehren. Nach Kriegsende wendet sich ihr Groll fast ausschließlich gegen die Engländer. Die Engländer haben das Reich blockiert und die Frauen und Kinder systematisch ausgehungert. Gott strafe England! Das ist das deutsche Schlagwort. Die Amerikaner, die sich auf den Schlachtfeldern als Neulinge erwiesen haben, betrachten sie mit einer recht verächtlichen Ironie. Ihre ganze Sympathie gehört den Franzosen. Sie erkennen an, dass die Franzosen gute Soldaten und würdige Gegner waren. Sie bewundern den »poilu«. Sie beneiden die Franzosen um Clemenceau und Foch und hoffen auf eine Versöhnung mit ihnen.
So stellt sich beim Waffenstillstand das Gefühlsbild der Kriegführenden dar. Es währte nicht lange, so sollte es einschneidende Veränderungen erfahren.
Untersucht man den Zustand der öffentlichen Meinung in Deutschland kurze Zeit danach, fragt man, wie sie in ihrer überwältigenden Mehrheit den Waffenstillstand vom 11. November 1918 und den ihm folgenden Frieden vom Juni 1919 auffasst, wie sie über die entscheidenden Ereignisse unterrichtet wird und darüber denkt, so begegnet man folgender Ansicht, von allen Zeitungen verbreitet, in allen Schulen gelehrt, in jedem Gehirn verankert, lange vor der Machtübernahme durch Hitler und den Nazismus:
Deutschland ist nicht militärisch besiegt worden. Sein Heer wurde nicht im Felde geschlagen und durch eine Niederlage zur Übergabe gezwungen, seine Grenzen wurden nicht verletzt, es erfolgte keine Invasion.
Deutschland ist vor allem ein Opfer der Blockade, eines unmenschlichen Kriegsmittels, demgegenüber der uneingeschränkte U-Bootkrieg völlig gerechtfertigt war.
Deutschland wurde außerdem noch durch die Bekanntgabe der 14 Punkte betroffen, die nach der Erklärung des Präsidenten Wilson in einer Botschaft an den Kongress vom Januar 1918 die Grundlage für den Frieden bilden sollten.
Die ganze Welt war gegen Deutschland verbündet.
Deshalb hat es auf Veranlassung der Zivilregierung und der parlamentarischen Kreise um einen Waffenstillstand gebeten, als notwendige Voraussetzung für die Eröffnung von Verhandlungen über einen Frieden, der nach deutscher Ansicht auf der Basis der Gleichberechtigung zu verhandeln war, da es auf dem Schlachtfeld weder Sieger noch Besiegte gegeben hatte.
Die von den Alliierten auferlegten Waffenstillstandsbedingungen waren indessen so drakonisch und hart wie bei einer Niederlage des deutschen Heeres. Deutschland hätte sie zurückweisen und den Kampf wiederaufnehmen können, aber in diesem Augenblick versetzten Sozialdemokraten, Marxisten und Juden dem Vaterlande einen Dolchstoß in den Rücken. Die Heimat verriet die Front. Sie revolutionierte und machte damit jeden Widerstand unmöglich.
Deutschland rechnete trotzdem auf einen Verhandlungsfrieden. Es hatte die Revolution im Innern niedergeschlagen und sich eine republikanische und demokratische Verfassung nach dem Muster der Alliierten gegeben.
Doch die Alliierten machten sich seine Ohnmacht zunutze, nachdem sie ihm beim Waffenstillstand Waffen und Verteidigungsmittel weggenommen hatten. Sie isolierten in Versailles die deutschen Vertreter, verwarfen ihre Einwände und Gegenvorschläge und lehnten jede Verhandlung mit ihnen ab. Als wahrhafte Betrüger legten sie zunächst den Köder der 14 Punkte Wilsons aus, warfen ihn dann beiseite und zwangen Deutschland unter Drohung mit Invasion einen nicht frei verhandelten, sondern diktierten Frieden, ein Diktat auf. Mit einem besonders hassenswerten Artikel dieses Diktats, dem Artikel 231, zwangen sie Deutschland, sich als schuldig am Kriege zu bekennen. Daraus leiteten sie die Verpflichtung zur Zahlung von Reparationen in astronomischer Höhe ab. Hiernach ließen sie Deutschland nicht einmal zum Völkerbund zu.
Deutschland unterzeichnete diesen leoninischen Vertrag, weil es gefesselt war und nicht anders konnte. Aber diese erpresste Unterschrift verpflichtet es nicht. Und die Deutschen werden, sobald sie können, die Ketten sprengen, mit denen man sie gefesselt hat.
Diese hier kurz zusammengefassten Thesen wurden in Deutschland so stark und eindringlich verbreitet, fanden so allgemeine Annahme und finden auch heute noch überall so viel Glauben, dass es der Mühe wert ist, sie den Tatsachen gegenüberzustellen. Wir wollen für den Augenblick die den angeblichen Betrug durch Wilsons 14 Punkte betreffende Behauptung beiseitelassen, dagegen die These prüfen, wonach das deutsche Heer nicht militärisch geschlagen worden sei, der unter dem Druck der Zivilisten erbetene Waffenstillstand ebenso wie der Friede hätten verhandelt werden können, wenn nicht der sozialistische Dolchstoß und der Verrat der Heimat Deutschland zur Ohnmacht verurteilt hätten.
Als am 11. Dezember 1918 die Truppen der Berliner Garnison in die Hauptstadt zurückkehrten und durch das Brandenburger Tor einzogen, hatten Offiziere und Soldaten ihre Helme mit Eichenlaub geschmückt. Und die Begrüßungsrede, die Ebert, der Präsident der Regierung der Volksbeauftragten, die aus der Revolution vom 9. November hervorgegangen war, an sie richtete, begann mit den Worten: »Ich grüße Euch, die Ihr unbesiegt von den Schlachtfeldern zurückkehrt!«
Der Schweizer Journalist René Payot1 hat kürzlich erzählt: »Ich habe im Dezember 1918 in Berlin den Einzug der Garderegimenter mitangesehen. Nun, ich versichere Sie, dass ich während eines ganzen Nachmittags das Gefühl hatte, einem Vorbeimarsch siegreicher Truppen beizuwohnen, denen man Blumen zuwarf!«
So trägt auch das zu Ehren der auf dem Felde der Ehre gefallenen Berliner Studenten errichtete Mal folgende Inschrift: Invictis victi victuri – den Unbesiegten von gestern die Besiegten von heute, die morgen Sieger sein werden! – In Wirklichkeit verhalten sich die Dinge ganz anders, als sie in der Darstellung erscheinen, welche zu geben die herrschenden, besonders die militärischen Kreise sich hartnäckig und von Anfang an bemüht haben.
In der ersten Juliwoche 1918 besucht Admiral von Hintze, eben zum Staatssekretär des Äußeren ernannt, Ludendorff in Avesnes und stellt ihm folgende Frage:
»Sind Sie gewiss, den Feind entscheidend und endgültig zu schlagen?«
»Auf Ihre Frage«, erwidert Ludendorff, »antworte ich mit einem kategorischen Ja.«
Aber am 3. August, als in Spa ein großer Kronrat stattfindet, an dem Wilhelm II., der österreichische Kaiser, Reichskanzler von Hertling, von Burián, Hindenburg und Ludendorff teilnehmen und jeder, besonders aber der Kaiser von Österreich, Besorgnisse um die Zukunft zu erkennen gibt, sagt Ludendorff zu Hintze: »Jetzt habe ich nicht mehr die gleiche Gewissheit«, und er setzt sich für eine strategische Defensive ein, die den Gegner ermüdet und ihn für Friedensverhandlungen geneigt macht.
Es ist aber das deutsche Heer, dessen Reserven immer knapper werden, das ermüdet ist und an Frieden denkt. Österreich seinerseits zieht sich mehr und mehr zurück. Man beginnt, nach einem Neutralen zu suchen, der den Gegner ausforschen soll.
Am 26. September zieht sich Bulgarien aus dem Kampf zurück.
Am 1. Oktober ruft Ludendorff unter dem Eindruck der wiederholten Schläge, die ihm Fochs Armeen versetzen, zwei Beamte der Wilhelmstraße, Grünau und von Lersner, zu sich und erklärt ihnen: »Es muss augenblicklich ein Friedensangebot gemacht werden. Heute hält die Truppe noch stand, aber man kann nicht voraussehen, was morgen geschieht!«
Und am gleichen Tage, um Mitternacht, ruft er sie telefonisch an: »Das Heer kann keine 48 Stunden mehr warten!«
Prinz Max von Baden, der soeben die Nachfolge des Reichskanzlers von Hertling angetreten und ein parlamentarisches Kabinett nach westlichem Muster gebildet hat, sichtlich um leichter mit den Alliierten zu verhandeln, fordert einen Aufschub und will sich erst informieren. Am 3. Oktober schreibt ihm Hindenburg: »Es besteht keine Hoffnung mehr, den Feind zum Friedensschluss zu zwingen. Die Lage wird von Tag zu Tag kritischer und kann die oberste Heeresleitung zu folgenschweren Entschlüssen zwingen!«
Am 5. Oktober entschließt sich Max von Baden durch Vermittlung der Schweiz an den Präsidenten Wilson zu telegraphieren; er bittet ihn, sofort einen Waffenstillstand abzuschließen und die Kriegführenden zu Friedensverhandlungen auf der Basis der 14 Punkte zusammenzurufen.
An diesem Datum des 5. Oktober 1918 gibt es noch keinerlei revolutionäre Erhebung, keinen Dolchstoß der »Roten«, keinen Verrat der Heimat. Dennoch gibt die oberste Heeresleitung, geben Hindenburg und Ludendorff, die Abgötter des deutschen Volkes, zu, dass die Armee besiegt ist. Sie erklären sich außerstande – freilich nicht öffentlich –,noch länger den Angriffen des Gegners Widerstand zu leisten. Nur ein Gedanke beschäftigt sie noch: durch einen sofortigen Waffenstillstand und Aufnahme von Friedensverhandlungen einen katastrophalen Zusammenbruch der Front und die Invasion zu verhüten.
Sie sind noch mehr besiegt als nach einer Schlacht, da sie nicht einmal mehr das Risiko dieser Schlacht auf sich nehmen und von vornherein gewiss sind, sie zu verlieren.
Und wie es nicht der Verrat der Heimat ist, der sie zur Kapitulation zwingt, so ist es auch nicht die zivile Gewalt, die sie drängt, Frieden zu schließen. Im Gegenteil; sie selbst sind es, die die zivile Gewalt drängen, den Reichskanzler Max von Baden bestürmen, ihnen den bang ersehnten Waffenstillstand zu verschaffen.
Vom 5. bis zum 21. Oktober entspinnt sich ein telegraphischer Dialog zwischen dem Präsidenten Wilson und dem Reichskanzler. Dieser Dialog bezeugt, dass der Präsident der Vereinigten Staaten nicht bereit ist, das deutsche Angebot ohne Abwägen der Aktiv- und Passivposten anzunehmen und zu vermitteln. Er lässt sich auf keine Auseinandersetzung ein und stellt vorläufige Bedingungen. Nach diesem Notenwechsel besteht für Deutschland kein Zweifel mehr. Der Waffenstillstand wird nicht verhandelt. Er kann nur angenommen oder abgelehnt werden. In dieser Beziehung ist Wilson sehr geschickt verfahren, aber in anderer Hinsicht begeht er einen politischen und psychologischen Fehler.
Er teilt mit, dass die Alliierten nicht mit jener militärischen Macht einen Vertrag schließen werden, die den Weltfrieden gebrochen hat. Damit regt er die Absetzung oder Abdankung Wilhelms II. an. Aber er meint gleichzeitig Hindenburg, Ludendorff und den ganzen Generalstab. Dieser ergreift unverzüglich den Vorteil, den er daraus ziehen kann. Er zieht sich aus dem Spiel zurück und versteckt sich hinter den Zivilisten. Übrigens war er infolge der Reformen des Prinzen Max von Baden der zivilen Gewalt unterstellt worden. Er lässt es zu, dass ein sehr rühriger Reichstagsabgeordneter, der schon seit längerer Zeit die Reichspolitik dem Frieden zuzusteuern empfiehlt, Matthias Erzberger, mit dem Vorsitz der deutschen Delegation betraut wird, die die Bedingungen der Alliierten entgegennehmen soll. Hindenburg gibt ihm seinen Segen und dankt ihm später, dass er seine Aufgabe so gut erfüllt habe. Doch die Öffentlichkeit erfährt davon nichts. Und mit außergewöhnlichem Zynismus behaupten die deutschen Militärs später, mit der Kapitulation nichts zu tun gehabt zu haben. Der Schein ist für sie. Man glaubt ihnen, wenn sie aufgrund eines schamlosen Betruges erklären, sie hätten nur dem Willen der Zivilisten gehorcht. Ohne Zweifel wäre es besser gewesen, Hindenburg und Ludendorff selbst wären nach Rhetondes gegangen und hätten dort ihre Namen unter das Dokument gesetzt, um hiernach, ihres Ansehens beraubt und mit dem Brandmal der Niederlage gezeichnet, in die Heimat zurückzukehren.
Wäre es nicht auch besser gewesen, Marschall Foch hätte das Angebot des Waffenstillstandes abgelehnt, die vorbereitete Schlacht geliefert und dadurch die Möglichkeit gewonnen, in Deutschland einzudringen?
Die von ihm aufgestellten Bedingungen enthielten die Räumung Belgiens, Frankreichs, Elsaß-Lothringens, des linken Rheinufers und seiner Brückenköpfe, die Auslieferung von 5000 Geschützen, 25 000 Maschinengewehren, 3000 Granatwerfern, 5000 Lokomotiven, 150 000 Güterwagen, 1700 Flugzeugen, 5000 Lastkraftwagen, 100 U-Booten, 8 leichten Kreuzern, 6 Panzerschiffen, die Aufrechterhaltung der Blockade, den Verzicht auf die Kolonien. Nach einer durch einen vollständigen militärischen Sieg gekrönten Schlacht hätten die Bedingungen des Siegers keine anderen sein können. Man konnte also das Blut einer Schlacht sparen, da man auch so das gleiche Ergebnis erzielte. So urteilte Marschall Foch, als er in Senlis zu Clemenceau sagte: »Den Kampf noch länger weiterzuführen hieße viel aufs Spiel setzen. Wir würden vielleicht 50 000 oder 100 000 Franzosen mehr opfern, ohne die Verluste der Alliierten mitzurechnen, um recht fragwürdige Ergebnisse zu erzielen. Das müsste ich mir mein Leben lang vorwerfen. Es ist leider schon viel Blut vergossen worden. Das genügt!«
Diese Worte gereichen den menschlichen Gefühlen des Mannes zur Ehre, der sie gesprochen hat. Die Tatsache aber, dass Deutschland mit Ausnahme des Rheinlandes nicht von fremden Heeren besetzt wurde und die Hauptstadt Berlin keine alliierten Garnisonen in ihren Mauern sah, trug dazu bei, die für den nationalen Stolz so schmeichelhafte Fabel glaubhaft zu machen, wonach das deutsche Heer nicht militärisch besiegt worden und es seinen Führern gelungen sei, den Feind am Betreten des vaterländischen Bodens zu hindern. Dieselbe Missachtung der Wahrheit findet sich in der gegen die Sozialisten, die Männer der Linken und die Juden erhobenen Anklage, dem Vaterland durch Entfesseln einer revolutionären Bewegung einen Dolchstoß in den Rücken versetzt und hierdurch die militärische Kapitulation unvermeidlich gemacht zu haben. Gewiss hat es im November 1918 in Deutschland eine revolutionäre Erhebung gegeben, der noch zwei oder drei weitere von ungleichem Umfang folgten. Aber der erste dieser Aufstandsversuche brach am 30. Oktober aus. Und wir haben soeben festgestellt, dass seit dem 1. Oktober die vor der Niederlage stehende militärische Führung unaufhörlich einen Waffenstillstand forderte und entschlossen war, ihn unter jeder Bedingung anzunehmen. Sodann wurde das Signal zur Revolte nicht von den Zivilisten, auch nicht von den politischen Parteien gegeben. Vielmehr waren es Soldaten, Matrosen der Hochseeflotte auf Schillig-Reede, die auf den Linienschiffen meuterten, um ihre Offiziere zu hindern, sie zur letzten Seeschlacht gegen England zu führen, die von den Admiralen beschlossen worden war. Nicht die Zivilisten haben die Militärs verführt. Es waren vielmehr die Militärs, die die Zivilisten von ihrer Pflicht abwendig machten. Die deutsche Revolution Anfang November 1918 ist dem Entschluss der obersten Heeresleitung zur Beendigung des Krieges um jeden Preis nicht vorausgegangen, sondern gefolgt. Der Generalstab und die ihm nahestehenden Kreise haben einfach und zynisch die Verantwortlichkeit verschoben, indem sie die Reihenfolge beider Erscheinungen vertauschten und aus der zweiten den Vorläufer und die direkte Ursache der ersten machten. So wälzten sie die Last der Missbilligung, die ihre eigenen Schultern zu bedrücken drohte, auf andere ab. Die hartnäckig und schamlos verbreitete Dolchstoßlegende wird zu einer der wirksamsten Waffen, mit denen – besonders durch Hitlers Leute – die Sozialdemokraten und die deutschen Liberalen bekämpft und diskreditiert werden.
Von den Panzerschiffen der Flotte geht die Revolution auf das Land über, erobert die Häfen, Wilhelmshaven, Kiel, Hamburg, Bremen, in den ersten Novembertagen. Sie lässt Banden entstehen, in denen sich Matrosen, Etappensoldaten, Rekruten aus den Depots, Arbeiter, russische Agitatoren und niedere Elemente mischen. Diese bunt zusammengesetzten, mit Gewehren und Handgranaten bewaffneten Banden nehmen die Eisenbahnzüge im Sturm und ergießen sich in die großen deutschen Städte, Köln, Halle, Dresden. Frankfurt, München und Berlin. Überall, wohin sie den Funken tragen, flammt die Feuersbrunst auf. Überall bilden sie in Nachahmung der russischen Revolution, die lebhaft in den Gemütern gezündet hat, Arbeiter- und Soldatenräte, die sich der örtlichen Gewalt bemächtigen. In wenigen Tagen sind es Zehntausend in ganz Deutschland, von sehr verschiedener Art. Die einen kennen eine Rangordnung, achten die alte Autorität und die Befehlsgewalt und sind gemäßigt in ihren Forderungen. Die anderen sind erhitzt, heftig, Rebellen gegen die alte Disziplin und wirklich revolutionär.
In den Staaten, in denen der Aufstand seine Herrschaft durchsetzt, im Rheinland, im Ruhrgebiet, in Sachsen, Hessen und Bayern, nimmt er ohne Weiteres einen partikularistischen, in Bayern einen offen separatistischen Charakter an. Er vollzieht sich unter dem Zeichen des Misstrauens und des Grolls gegen Preußen. Er gibt seinen Willen kund, sich von der Berliner Vormundschaft zu befreien. Diese Tatsache scheint von den Alliierten nicht genügend beachtet worden zu sein, oder man hat ihr im Augenblick nicht die Bedeutung beigemessen, die sie verdiente. Aber in Deutschland hat man sich darüber keiner Täuschung hingegeben. Die Gegner der Revolution begriffen sofort, dass diese die Einheit des Reichs gefährdete, und das war einer der Gründe, weshalb sie sie schonungslos bekämpften. Diese Tatsache muss nachdrücklich hervorgehoben werden. Sie sollte die Männer erleuchten, welche die Aufgabe haben, Deutschland eine neue Verfassung zu geben. Jedenfalls liefert sie, nach unserer Meinung, die Erklärung für das, was man als einen Irrtum der Verfasser des Vertrages von Versailles ansehen kann, einen Irrtum, von dem wir wünschen, er möchte nicht mehr wiederholt werden.
Die Haltung der Revolutionäre vom November 1918 ist übrigens, wie häufig in Deutschland, widerspruchsvoll. Sie wollen sich von Berlin emanzipieren und daheim die Revolution auf ihre eigene Art machen. Gleichzeitig entsenden die Arbeiter- und Soldatenräte jedoch Delegierte in die Reichshauptstadt, um dort nach dem Rechten zu sehen, sodass Berlin trotzdem Schauplatz der entscheidenden Vorgänge bleibt.
Die Novemberrevolution war ein anarchischer und stürmischer Ausbruch. Sie ist von den grundsätzlich revolutionären politischen Parteien weder vorbereitet noch ausgelöst worden. Diese wurden im Gegenteil von ihr überrascht. Gleichwohl ist es ihnen und ihren Führern, die im Reichstag die Linke bilden, nicht möglich, abseits zu stehen. Sie schließen sich deshalb der Bewegung an und bemühen sich, ihre Leitung zu übernehmen.
Aber diese Parteien und ihre Führer sind in sich selbst gespalten. Seit 1917 hat sich die Sozialdemokratie in zwei Gruppen geteilt: die Mehrheitssozialisten und die »unabhängigen« Sozialisten; und diesen stehen auf der Linken die Spartakisten zur Seite.
Der Mehrheitssozialismus hat seit langer Zeit aufgehört, eine Revolutionspartei zu sein. Er entspricht ungefähr dem Radikalsozialismus in Frankreich. Er stimmte allen Maßnahmen der Kriegspolitik zu. Er begnügte sich damit, zusammen mit den Gewerkschaften das materielle Dasein der Arbeiter zu schützen, und ging rein politischen Auseinandersetzungen aus dem Wege. Er dachte weder an die Revolution noch an die Formen, die sie annehmen könnte. Die Sozialdemokratie erstrebt keine republikanische Staatsform. Was sie wünscht, ist die legale Umwandlung des kaiserlichen autokratischen Regimes in eine volkstümliche parlamentarische Regierung. Die Politik des Prinzen Max von Baden, eines liberalen Geistes, der, wie erwartet, Anfang Oktober 1918 zum Reichskanzler ernannt wird und seine Reformen (u.a. Verantwortlichkeit des Reichskanzlers vor der Volksvertretung, allgemeines Wahlrecht in Preußen, Unterordnung der militärischen unter die zivile Autorität) scheinen ihr ausreichende Errungenschaften zu sein. Sie ist keine Anhängerin eines überstürzten sozialistischen Aufbaus. Sie glaubt, dass diesem eine demokratische Erziehung vorausgehen müsse. Ihre Führer, Friedrich Ebert, Philipp Scheidemann, Gustav Bauer, Otto Wels, Hermann Müller, sind friedliche Kleinbürger, ohne jede Erfahrung in der Regierung und in der großen Politik, durch nichts auf die Übernahme der Regierungsgewalt vorbereitet.
Die unabhängigen Sozialisten, Hugo Haase, Wilhelm Dittmann, Arthur Crispien, Georg Ledebour, Emil Barth, Oskar Cohn, sind genauso unerfahren und ebenso unvorbereitet auf die Verantwortlichkeit in der Regierung, aber sie haben mehr Kraft, Kühnheit und revolutionäres Temperament. Sie haben die Kriegskredite verweigert und 1916, 1917 und 1918 Streiks entfacht, die allerdings schnell erstickt wurden. Sie predigen den offenen Kampf gegen die konservativen und reaktionären Elemente, den Kaiserthron und den Generalstab. Sie fordern die Ausrufung der Republik und die Sozialisierung.
Auf ihrem linken Flügel stehen die Spartakisten, so genannt nach Spartacus, jenem Mann, der im Altertum den Sklavenaufstand gegen Rom anführte, und nach dem Titel umstürzlerischer und geheimer Flugschriften, die in Deutschland seit 1916 umliefen (Spartakusbriefe). Die von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg geführten Spartakisten bekennen sich zu Lenin und der russischen Revolution. Sie wollen sofort die Diktatur des Proletariats errichten und die Arbeiter- und Soldatenräte den Sowjets angleichen. Überdies bezeichnen sie sich bald offen als Kommunisten.
Die Kräfte dieser drei Gruppen sind ungleich. Die Mehrheitssozialisten haben die gemäßigten Elemente der Arbeiterschaft auf ihrer Seite, das heißt die Mehrheit. Die Unabhängigen sind ihnen an Zahl unterlegen, bilden aber eine wagemutigere Minderheit. Die an Zahl noch geringeren Spartakisten haben mehr Einfluss auf aufrührerische Elemente, auf die Straße, und sie zählen in ihren Reihen Emissäre aus dem bolschewistischen Russland.
So eröffnen sich vor der durch die Meuterei der Kieler Matrosen hervorgerufenen Revolution drei Wege. Welchen dieser Wege wird sie einschlagen? Die Partie beginnt und wird sieben Monate dauern, vom November 1918 bis zum Mai 1919.