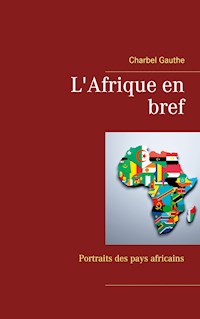Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Dieses Buch erzählt nicht nur die Geschichte eines jungen Mannes, der in eine deutsche Stadt reist, die es nicht gibt, sondern es führt auch durch die unendliche Weltanschauung und Lebensart in vielen Ländern Afrikas. Lustig, wahr und vor allem authentisch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 141
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Der Pass und die Genehmigung
Dem Auge fern, dem Herzen nah!
Die Stadt, die es nicht gibt
Von Geistern und Menschen
Benin oder Berlin?
Vom Wissen und Tun
Im Namen Gottes
Hier und dort
Der Pass und die Genehmigung
»Also Herr Wanilo, Ihr Antrag auf ein Visum ist genehmigt worden. Das Visum wird erst einmal für drei Monate erteilt und wird dann in Deutschland verlängert.«
»Oh schön, das freut mich sehr!«
»Kommen Sie bitte morgen um acht Uhr dreißig ins Konsulat, um Ihre Unterlagen abzuholen!«
»Okay, alles klar, danke!«
»Herr Wanilo, darf ich Ihnen etwas sagen?«
»Ja, bitte.«
»Die Stadt…, ähm... ich meine Bielefeld.«
»Ja?«
»Die gibt es nicht.«
»Wie bitte?«
»Die kennt keiner.«
Die Worte des Botschaftsbeamten klangen in meinen Ohren wie ein leeres Bierfass, das auf dem Oktoberfest in München gerade ausgetrunken worden ist und gerollt wird. Ich konnte ihm nicht glauben. Nachdem ich aufgelegt hatte, fragte ich mich, wieso ich dann ein Visum nach Bielefeld bekomme, wenn es die Stadt nicht gibt?
Am nächsten Tag war ich früh aufgestanden, um nicht zu spät zu meinem Termin bei der deutschen Botschaft zu kommen. Der Himmel war hell wie ein Kristall. Kaum begann die Sonne ihre dreizehnstündige tägliche Reise, als ich mein Zuhause verließ. Ich musste mein Motorrad zwei Minuten lang schieben und dabei den Motorstarter im Zwei-Sekunden-Takt drücken, damit der Motor anging, weil ich keine Antriebskurbel mehr hatte. Die war bei einem Unfall kaputtgegangen. Da ich den Unfall aufgrund defekter Bremse verursacht hatte, hatte ich keine neue bekommen, sondern musste den während des Unfalls zerbrochenen Blinker meines Opfers bezahlen.
Das Opfer war eine Frau und mit Frauen sollte man sich lieber nicht anlegen, sagte mein Vater. Zumindest nicht mit der, in deren Motorrad ich hineingefahren war. Nach dem Aufprall stieg sie so schnell von ihrem Moped, dass ich überhaupt keine Zeit hatte, festzustellen, was ich angestellt hatte. Durch den Aufprall tat mir meine rechte Ferse weh, da ich vergebens die Bremse gesucht und dann die Fahrbahn als Bremse benutzt hatte. Als sie auf mich zukam, tat ich, als ob mein Fuß gebrochen wäre und fing an, nach Schmerzen zu suchen, wo sie nicht waren. Ich war so ungeschickt, dass die Dame es bemerkte und sie fing an, mich anzuschreien, als hätte ich ihr ganzes Vermögen zerstört. Ich begriff die Situation, stand auf und fing auch an, sie anzuschreien. Denn das war nun eine fifty-fifty-Situation. Die Tatsache, dass ich es war, der den Unfall verursacht hatte, spielte jetzt keine Rolle. Wichtig war, aus der Situation herauszukommen und dies möglichst ohne finanziellen Schaden.
Ich hatte sowieso Geld dabei, so viel Geld, dass ich der Dame ein neues Motorrad hätte schenken können. Aber die Regeln waren anders. Jeder kämpfte für sich selbst. Einmal Opfer, immer Opfer. Die junge Dame hatte aber ein eisernes Argument. Sie meinte, dass ich von hinten gekommen sei und sie hätte sehen müssen, als sie an der Ampel anhielt. Für sie war klar, dass ich der Schuldige war und ich deswegen ihren Blinker bezahlen müsse. Zumal der Blinker original aus China war.
Inzwischen hatten sich viele Leute um uns herum versammelt. Einige hatten die Szene gesehen. Andere wollten nur den Aufprall gehört haben. Noch andere hatten nichts gesehen. Je mehr wir uns anschrien und diskutierten, desto weniger verstanden wir uns, die Dame und ich. Als das alles anfing, mir lästig zu fallen, entschied ich mich, den verdammten aus China stammenden Originalblinker zu bezahlen. Ich hob mein Motorrad hoch und schob es von der Fahrbahn. Dann zog ich mein Portemonnaie aus der Hosentasche und gab der Dame zwei Scheine. Diese riss sie mir aus den Händen und sagte, die würden überhaupt nicht reichen und ich sollte genauer in das Portemonnaie gucken. Ich war so wütend, dass ich ohne zu gucken drei weitere Scheine herausholte und sie ihr gab. Wir waren nur noch zu zweit und sie wollte wissen, woher ich das ganze Geld hatte… Als ob das ihr Problem wäre.
Nachdem ich mein Portemonnaie wieder in meine Hosentasche gesteckt und mein Motorrad erneut durch Schieben gestartet hatte, fuhr ich los. Ja, ich fuhr los, ohne Bremse. Aber diesmal fuhr ich etwas langsamer und vorsichtiger. Ich wollte ja nicht das ganze Geld unterwegs verschenken.
Der Weg war lang und mühsam. Es war Regenzeit und die Fahrbahn war überschwemmt. Ab und zu musste ich meine Füße hochheben, damit sie nicht nass wurden, wenn ich durch eine Wasserlache fuhr. Das machten fast alle hier. Trotz all dieser Mühe gab es immer einen Connard, der einen mit Vollgas überholte und die ruhigen Wassertropfen zum Trocknen auf unsere Kleider schickte. Derjenige wurde aber sofort mit Beschimpfungen gesegnet und zur Hölle geschickt. Und der Verkehr nahm seinen lauten Lauf wieder auf, bis ein anderer Connard zur Hölle geschickt wurde.
Und so fuhr ich bis zur Ampel gegenüber der deutschen Botschaft. Sie war rot. Also hielt ich an. Die deutsche Botschaft befand sich am Rande der Straße. Das Haus war gelb gefärbt und mit Stacheldrähten umringt. Ich konnte von der Ampel aus die automatische Tür des Besuchereingangs und das grüne breite Glasfenster sehen, durch das die Wärter einen fragen, was man will.
Ich erinnere mich noch an jenen Tag, an dem ich eingeladen worden bin, um einen Deutschtest für die Vorauswahl zu einem Stipendium abzulegen. Der Wachmann, der auch der Empfangschef war, schaute mich durch das Glasfenster an und fragte mich, was ich da wolle. Ich sagte, dass ich für den Test gekommen war.
»Welchen Test?«, erwiderte er.
»Den Deutschtest!«, antwortete ich und zeigte ihm meine Einladung.
Er warf einen zögernden Blick auf das Papier und drückte auf einen Knopf, um die Tür zu öffnen. Ich ging hinein und befand mich direkt vor einem Schalter, der mit einem Glasfenster verriegelt war. Der Empfangschef fragte mich nach meinem Ausweis. Den holte ich aus meiner Tasche, wusste aber nicht, wie ich ihn ihm reichen sollte, da zwischen ihm und mir eine dicke Glasbarriere war. Als er merkte, dass ich verzweifelt zu sein schien, zog er eine Kurbel zu sich, die vor ihm war und ein Schubfach knallte gegen die vordere Wand des Schalters. Erst in diesem Moment bemerkte ich, dass sich ein Loch in der Mitte des Schalters befand. Ich war von der Technik so fasziniert, dass ich meinen Ausweis fünf Sekunden lang fest in meiner Hand hielt und in die Schublade schaute, bis die raue Stimme des Mannes mich dazu aufforderte, ihn hineinzuwerfen. Das tat ich und er drückte die Kurbel diesmal in meine Richtung und das Fach war beim ihm.
Nachdem er meine Identität kontrolliert hatte, kam er mit einem Handscanner zu mir. Dann forderte er mich auf, meine Sachen auf den Boden zu legen und die Hände zu strecken. Mit dem Handscanner inspizierte er mich von Kopf bis Fuß. Ich war »sauber«. Bevor ich weiterging, musste ich meine Tasche bei ihm liegen lassen und durfte nur ein Heft und einen Kugelschreiber mitnehmen. Dann gab er mir einen Besucherausweis, den ich um den Hals legte und zeigte mir den Weg zum Hauptgebäude der Botschaft. Ich ging durch einen gut gepflegten Garten mit grünem Rasen und einem Kokosnusspalme in der Mitte. Ich konnte spüren, wie reif die Kokosnüsse waren und bedauerte, dass keiner sie pflückte. Allein dieser Gedanke machte mich durstig.
Einmal in dem Hauptgebäude angekommen, musste ich wieder zu einem Schalter, hinter dem sich ein kleiner Mann befand, der mich noch einmal danach fragte, was ich hier wolle. Und wieder musste ich ihm erklären, dass ich den Deutschtest ablegen wolle. Er zeigte auf eine Tür, die sich hinter mir befand und bat mich, im Wartezimmer Platz zu nehmen.
Den Test hatte ich bestanden, schied aber in der letzten Auswahlphase aus, aus Gründen, die ich bis heute nicht weiß.
Heute, zwei Jahre danach, musste ich wieder in die deutsche Botschaft. Diesmal wollte ich aber zum Konsulat, das sich hinter der Botschaft befand, weil ich mein Visum abholen wollte.
Ich hielt also an der Ampel an, weil sie rot war. Beim Anhalten spürte ich Wassertropfen auf meiner Haut. Mein Kopf drehte sich und suchte den Connard, den nächsten Kandidaten für die Hölle. Aber keiner war neben mir. Den Himmel sollte man lieber nicht zur Hölle schicken, weil da Gott lebt. Ich suchte also schnell in meiner Tasche meinen Regenmantel. Aber da war nichts. Ich konnte es nicht fassen. Wie konnte ich ihn vergessen? Gestern hatte ich ihn doch in meine Tasche gesteckt! Und heute war ich doch mit dem rechten Fuß aus dem Bett gesprungen. Ich schwöre es! Ich hatte darauf geachtet. Und das sollte Glück bringen. Wieso passiert mir dann all das?
Es blieb mir nur eine einzige Lösung übrig: über die rote Ampel zu fahren. Aber sie war rot! Ich überlegte kurz: nein, ein solcher Mensch bin ich nicht. Selbst wenn ich versucht hatte, eine Dame zu täuschen, die Opfer meines Unfalls war - und das taten alle hier – selbst wenn ich einen Connard zur Hölle geschickt hatte - und das taten auch alle hier – selbst wenn ich all das gemacht hatte, konnte ich nicht einfach über eine rote Ampel fahren. Nein, das konnte ich nicht. Ich war ein guter Bürger. Ich würde sogar sagen, dass ich ein vorbildlicher Bürger war. Ich sollte geehrt werden. Ich war noch nie in meinem ganzen Leben über eine rote Ampel gefahren und das werde ich auch jetzt nicht machen. Also blieb ich stehen.
Diese Ampel hatte aber den schlechten Ruf, die rote Farbe nicht schnell loszuwerden. Das rote romantische Abenteuer dauerte also eine Weile. Und ich habe lange gewartet.
Obwohl Regenzeit war, kam das Wasser wie aus dem Nichts plötzlich herunter. Und zwar in so einer Masse, die ich mir nie hatte vorstellen können. Es war, als ob Mutter Natur mir meine letzte Dusche vor meiner Reise geben wollte. Man duscht aber nicht angezogen. Und zwar nicht mal so, wie ich angezogen war. Das sollte Mutter Natur wissen.
Ich trug ein graues aus Leinen angefertigtes Hemd. Es war mein Lieblingshemd. Meine schwarze Hose hatte ich bis zum Knie hochgerollt, damit sie nicht nass wurde. Das war aber vergebliche Mühe, denn ich war nass wie ein Pudel. Meine Augen waren rot und hatten sich in die Augenhöhlen zurückgezogen, sodass ich nur noch aus einem reduzierten Blinkwinkel die Welt um mich herum sah. Ich zitterte am ganzen Körper, als ob ich von einer Elektroschockpistole getroffen wäre. Ein Glück, dass ich am Tag zuvor den Ordner mit meinen Unterlagen in eine schwarze Tüte gewickelt hatte. Sonst hätte ich alles verloren. Der rechte Fuß von jenem Tag hatte mir geholfen.
Als die Ampel endlich grün war, merkte ich es nicht sofort, so lange hatte ich auf sie gewartet. Grün schien mir in dem Moment rot zu sein. Als ich noch hoffnungsvoll auf grün wartete und nicht weiterfuhr, wurde ich von tausenden Hupen und Beschimpfungen aus meinem Farbenschlaf geweckt. Ich stieg überrascht vom Motorrad, dessen Motor längst aus war, überquerte die Straße und schob es bis zur Tür des Konsulats, das sich auf der hinteren Seite der Botschaft befand.
Mit schwankendem Schritt ging ich auf den Wärter zu. Sein Häuschen hatte ein Fenster, das auf die Straße hinausging, sodass er mit Besuchern sprechen konnte, ohne dass diese in das Gebäude kamen.
»Guten Morgen, Monsieur!«, sagte ich.
Er tat, als hätte er mich nicht gehört. Ich wiederholte respektvoll meinen Gruß.
»Guten Morgen, Monsieur!«
Da schaute er mich von Kopf bis Fuß an und vergaß mich wieder. Ich fuhr aber fort:
»Monsieur, ich habe einen Termin um acht Uhr dreißig.«
Erst dann öffnete er das Fenster und streckte seine linke Hand in meine Richtung. Wenn die Bewegung bedeutete, dass er meinen Ausweis wollte, deutete die linke Hand auf die Erniedrigung meiner Person hin. Aber in dem Moment spielte das für mich keine Rolle. Ich öffnete schnell meine schwarze Tüte und holte meinen Ausweis heraus. Das war jedoch zu langsam für den Wärter. Als ich meine Hand aus der Tüte zog, war das Fenster schon zu. Ich hätte ausrasten, schreien, schimpfen, ihn für immer in die Hölle schicken können. Für wen hielt er sich? Ich war zwar nass und sah wie ein Schwein aus, aber ich hatte noch alle Tassen im Schrank. Meine Wut ballte sich in meiner linken Faust und ich riss mich zusammen.
»Monsieur, hier ist mein Ausweis. Es tut mir leid, aber da es regnet, hatte ich ihn in meine Tasche gesteckt, damit er trocken bleibt. Monsieur, bitte nehmen Sie ihn. S’il vous plaît!«
Wie ich es schaffte, das alles zu sagen, wie ich es schaffte mich so demütigen zu lassen und wie ich dabei noch ein Lächeln fand, das wusste nur mein rechter Fuß. In diesem Moment dachte ich an die Worte meiner Oma. Meine Oma sagte mir immer, dass es keine Situation gäbe, in der man sich nicht zusammenreißen könne. Es gäbe auch keine Situation, die einen zum Ausrasten bringen könne. Wir könnten uns über alles ärgern oder uns über alles freuen. Was wir täten, wäre uns allein überlassen.
Nach meinen Worten nahm sich der Wärter Zeit, um das Fenster zu öffnen. Ich streckte ihm mit zitternder Hand meinen Ausweis entgegen. Er warf einen Blick darauf und fragte:
»Und du willst ein Visum beantragen?«
»Das habe ich schon gemacht. Ich möchte….«
»Willst du ein Visum beantragen, ja oder nein?«
»Nein, Monsieur«,
»Und was willst du?«
»Ich wollte es nur abholen.«,
»Hast du schon die Bestätigung, dass dein Antrag genehmigt worden ist?«
»Ja, Monsieur, daher der Termin.«
Er schaute auf mich, als ob ich seine Zeit vergeuden würde. Ich konnte ihm nicht in die Augen schauen, denn das war respektlos und würde die Situation nur noch verschlechtern. Mir genügte es, ihn auf der Fensterscheibe zu betrachten, in der sich sein Gesicht spiegelte. Ich konnte nur die rechte Seite seines Gesichts sehen. Das Bild war echter als er selbst. Eine originale Kopie von ihm. Ich konnte seine dicke Nase mit den zwei großen Löchern beobachten. Damit lüftete er die Lungen in seiner großen Brust und hatte bestimmt noch Reserven für vierundzwanzig Stunden. Er hatte eine Narbe auf der Wange. Bestimmt eine, die in manchen Kulturkreisen zur Kennzeichnung der Familie verlangt wurde. Ich guckte noch einmal genauer hin. Nein, er war nicht einer von meinem Stamm. Seine Ohren passten ganz und gar nicht zum Rest des Gesichts. Sie waren so klein und schmal, dass eine Ameise sich quetschen müsste, um hinein zu passen. Ich verstand jetzt, warum er mich nicht hörte, als ich ihn begrüßte.
Als er merkte, dass ich ihn durch die Fensterscheibe anstarrte, zog er sich in seinen Stuhl zurück und verschwand komplett von der Scheibe. Da merkte ich, wie klein er war. Nach einer Ewigkeit tauchte er wieder auf und reichte mir meinen Ausweis. Dann hörte ich das Tor des Konsulats knarren und sich öffnen. Ich schaute den Wärter an und schaute wieder zum Tor, das jetzt weit geöffnet war. Als ich meine Augen wieder auf ihn richten wollte, schrie er mich an:
»Kommen Sie rein! Glauben Sie, ich mache das Tor für Geister auf?«
Ich zuckte zusammen und ging schnell zum Tor. Als ich in das Konsulat hineinging, war ich so wütend auf ihn, dass ich direkt zum Warteraum ging, ohne mich bei ihm zu bedanken. Mir fiel aber auf, dass er mich gesiezt hatte. Hm. Soll ich ihm nun verzeihen? Nein.
Ich war noch nass und nach fünf Minuten schnatterte ich immer noch vor Kälte. Es war sehr kalt in dem Raum. Ich dachte, ich wäre bereits in Deutschland. Das war ich doch, oder? In Deutschland, beziehungsweise auf deutschem Boden. Und die vom Konsulat wollten, dass ich es schon jetzt spürte. Ich wusste, dass die Kälte in Deutschland nichts mit der Kälte hierzulande zu tun hatte. Wir hatten im Dezember manchmal zwanzig Grad. Da musste man sich sehr warm anziehen.
Im Warteraum des Konsulats blieb ich lieber stehen. Die Atmosphäre war wie in einer Arztpraxis. Die einen wollten eine Konsultation und vielleicht Untersuchungen unterzogen werden. Die anderen hatten schon das Ergebnis der Untersuchungen, die Diagnose, und wollten nun ein Rezept bekommen. Ich zum Beispiel.
Vor mir waren vier Leute. Darunter zwei, die nicht aus meinem Land stammten. Der Akzent, den sie beim Französisch sprechen hatten, verriet sie. Und sie waren laut. Beide trugen kurze Hosen und große Armbanduhren. Allein ihre Uhren hatten den Wert von fünf oder sechs Monaten Arbeit als Taxifahrer in meiner Heimat. Sie trugen auch Hüte und kauten Kaugummis. Und einer von ihnen, der größte, hatte es sogar gewagt, mit entblößter Brust in ein Konsulat zu kommen. Wenn bloß seine Brust schön wäre. Die Haare waren ungleichmäßig auf die Brust verteilt und sahen wie ein von Elefanten gejätetes Maisfeld aus. Außerdem wuchsen sie bis zum Hals hinauf, sodass sich die Halskette herauskämpfen musste. Ich glaube, ich höre lieber mit der Beschreibung auf. Aber eine Frage blieb mir im Kopf: Wie hatten sie es geschafft, hier hereinge