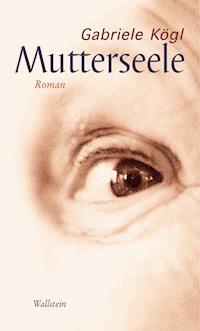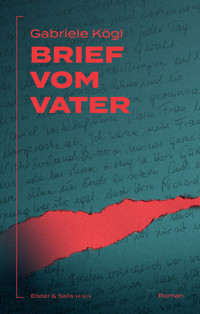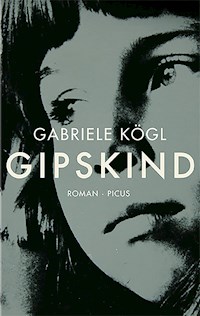Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das ist Heinrich nicht an der Wiege gesungen worden, dass es ihm einmal so gut gehen würde. Ganz weit unten ist er gestartet, ohne Vater und von der Mutter nicht gerade heiß geliebt. Nun sitzt er in einem Sportwagen und fährt immer auf der linken Spur. Aber dafür hat er auch viel tun müssen und muss es immer noch. Früh eigenes Geld verdienen, nebenbei studieren; und die Zahnarztpraxis kam auch nicht von allein ins Laufen. Seiner Frau aus gutem Hause und vor allem seiner über alles geliebten Tochter liest Heinrich jeden Wunsch von den Augen ab. Jedenfalls glaubt er das. Dass er außerdem ein fantastischer Liebhaber ist, kann er leider seiner Ehefrau am wenigsten beweisen. Dafür besucht er (unter anderen) Margot, eine alleinstehende Rundfunkjournalistin, bis eine nicht geplante Schwangerschaft Entscheidungen verlangt. Es sind, wenig erstaunlich, keine gemeinsamen. Mit Kind ändert sich Margots Leben radikal, die beruflichen Möglichkeiten schränken sich ein wie die Einkünfte; und selbst die Suche nach einer neuen Wohnung erweist sich als fast unlösbares Problem. Trotzdem, unterkriegen lässt sie sich nicht. Hingegen ist für Heinrich, was wie eine Erfolgsgeschichte klingt, manchmal zum Heulen. In rasanten Perspektivwechseln zeichnet Gabriele Kögl mit leichter Hand Charakterstudien, die unter die Haut gehen. "Total faszinierend - spannend. Ich war nur noch im Sog, in die Hand genommen und in einem Rutsch durchgelesen." (Hella Winnemuth, Buchhandlung Winnemuth) "Ein außergewöhnlicher und äußerst lesenswerter Roman über Lust und Liebe, Schlichtheit und Luxus und den Sinn des Lebens. Ein großartiger Roman! Sehr empfehlenswert!" (Christian Rößner, Thalia)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriele Kögl
Vorstadthimmel
Gabriele Kögl
Vorstadthimmel
Roman
Er fuhr mit dem Mittelfinger über die Lackschicht. Ganz sanft strich er über die Spalte zwischen Karosserie und Tür. Fein und glatt fühlte es sich an, fein und glatt wie eine Porzellankrone, die perfekt angepasst war. Carbonfaser. Er lächelte mit seinem perfekt sanierten Gebiss. Mit dem Zei gefinger berührte er die kaum sichtbare Vertiefung in der Tür. Der Flügel ging hoch. Heinrich ließ sich in den weißen Schalensitz fallen. Er berührte das Leder. Weich wie Walfischpenisleder. Damit hatten früher die berühmten griechischen Reeder die Barhocker auf ihren Jachten beziehen lassen.
Der Schalensitz war nicht weiter als einen Meter hinter dem verkürzten Frontflügel angebracht. Purismus, Sportlichkeit und Funktionalität, so stand es in einer Autozeitschrift. Die Heckleuchten steigern den Wiedererkennungswert. Heinrich startete seinen Teufel. Schon lange war ihm der Diablo weit mehr als ein Gefährt, er war ihm zu einem Gefährten geworden, er war längst ein Mythos. Mit einer produzierten Anzahl von vierzig Stück nicht einfach käuflich zu erwerben. Heinrich musste viele Beziehungen spielen lassen. Er musste in Erfahrung bringen, ob jemand bereit war, sich von seinem Diablo zu trennen. Solche Verkaufsangebote stehen in keiner Zeitung, auch nicht im Internet. Das erfährt man nur durch persönliche Kontakte und unter der Hand. Heinrich horchte auf den Sound. Der Klang sagte alles. Er genoss diesen Ton, er genoss ihn so sehr wie die Melodie seiner Lieblingsoper. Zwölf Zylinder, ein Evolutionssprung in der Autoentwicklung. Wer einmal einen Zwölfzylinder gefahren hat, kann nicht mehr zurück. Er hörte, wie sein schwarzer Panther schnurrte, wie er auf Gummipfoten dahin schlich, leise, lauernd, als wäre er im Dschungel. Elegant bewegte er sich durch das Cottage, das von uralten Akazien und Gingkobäumen gesäumt war. Der Dschungel des Cottages, der in Steppe überging, wenn er den Savannengürtel überquerte und geschmeidig in die Betonwüste des ersten Bezirkes eintauchte. Plötzlich kreuzte ein Beutetier seinen Weg. Direkt vor Heinrichs Schnauze bog ein Ferrari 308 GTB in die Straße ein. Heinrich drückte kurz drauf, in exzellenten dreikommaacht Sekunden war er auf hundert. Heinrich erledigte den Ferrari, bevor dieser kapiert hatte, wie ihm geschah. Heinrich lächelte in sich hinein. Wie ein Kokainsüchtiger, der sich eine Straße gelegt hatte. Glückselig grinste er vor sich hin, als er den Ferrari geschnupft hatte. Ganz ohne Anstrengung, nur aus dem Handgelenk heraus. Aus seinem Rausch holte ihn erst ein Fiaker, der so gemächlich über den Ring trottete und auf Burgtheater und Rathaus verwies, dass Heinrich die kurze Grünphase für den Abbiegeverkehr verpasste.
Langsam fuhr Heinrich in die Gasse. Hier lag seine Praxis. Er tippte mit dem kleinen Finger die Gangschaltung an, um das Sechsganggetriebe herunterzufahren. Er schlich die Abfahrt zur Garage hinunter und fuhr den Panther in das Dickicht der Nische, die er extra ausgesucht hatte für seinen Gefährten. Er wollte ihm einen geschützten Rastplatz bieten, von mehreren Betonsäulen gesichert, wo kein metallenes Tier ihn streifen konnte. Wieder genügte das Berühren des Türgriffs mit dem kleinem Finger, der geflügelte Panther streckte seine Flanken, er entließ Heinrich aus dem schwarzen Carbonfasergefieder.
Mit dem Lift fuhr er hinauf in die Praxis. Er mochte seine Arbeit und er mochte den Ort seiner Arbeit. Er fühlte sich wohl in der Einrichtung mit den Biedermeiermöbeln. Er hatte sie im Dorotheum ersteigert. Er liebte die Landschaftsbilder an den Wänden, die beruhigend auf die Patienten einwirken sollten, und er mochte die Pflanzen, die er zum Teil selbst gezüchtet hatte. Immer, wenn er Mispeln, Litschi, Orangen oder Kumquats aß, steckte er Kerne in die Pflanzentöpfe, er beobachtete die Erde und wartete, ob seine Saat aufging.
Heinrich mochte die ausgeklügelte Elektronik an seinen beiden Stühlen, er mochte sie dort genauso wie an seinem Lamborghini, und am meisten liebte er es, wenn er perfekte Technik bei der Zahnbehandlung anwenden konnte. Die Technik des schmerzlosen Spritzens genauso wie die Technik eines perfekten Schliffs, wenn er einen Zahn für eine Krone präparierte.
Ich kann das, dachte Heinrich, ich kann das wirklich.
Sie wusste, er würde kommen. Auch wenn er nicht angerufen hatte. Wozu sollte sie das Bettzeug wegräumen, das würde bloß Flecken geben auf der roten Couch. Die war so groß, dass man sie nicht einmal aufklappen musste, man konnte bequem darauf schlafen. Auch zu zweit.
Sie sah auf die Uhr. Erst um die Mittagszeit musste sie in die Redaktion. Er kam am liebsten vormittags zu ihr. Manchmal, bevor er in seine Praxis fuhr, manchmal zwischen zwei Terminen, am liebsten dann, wenn er Komplettsanierungen vornahm und eine Pause von den langwierigen Beschleifungen brauchte.
Margot war längst aufgestanden, sie hatte geduscht, sich mit einer teuren Körperlotion eingecremt und danach ihr leichtes Nachthemd wieder über den Körper geworfen. Er sollte nicht denken, sie würde viel Zeit für Kosmetik verwenden, er sollte denken, dass sie immer so natürlich und frisch war. Als gehörte es zu ihrem Charakter, dass sie zum Anbeißen duftete. Er kannte sie nicht anders, er hatte noch nie eine Nacht mit ihr verbracht, er konnte nicht wissen, wie sie am Morgen roch.
Heinrich sah auf die Uhr, er bog in die schmale Gasse ein. Hier war es immer schwierig, er konnte nur mühsam einen Parkplatz finden, auch tagsüber. Am Abend sowieso, aber das scherte ihn kaum, am Abend hatte er fast nie Zeit. An den freien Abenden, wenn seine Frau Nachtdienst hatte, kam Margot zu ihm ins Cottage, das ging nicht anders, wenn sie ihn sehen wollte. Sie wollte immer, wann er sie auch rief. Sie kam, als hätte sie nie etwas anderes zu tun, als würde sie den ganzen Tag auf seinen Anruf warten.
Heinrich riskierte nichts. Er wollte nicht abgeschleppt werden. Auch wenn es eine Ehre für die Abschleppfahrer gewesen wäre. Sie hätten einmal in ihrem Leben den Teufel in Autogestalt transportieren dürfen. Für elf Uhr hatte er die nächste Patientin bestellt, sie würde viel Geld bei ihm lassen, er musste pünktlich sein. Aber auf seine morgendliche Entspannung wollte er trotzdem nicht verzichten. Er spürte, wie es in den Hoden zog und brannte. Kein angenehmer Zustand. Der Drang nach einer Entladung war groß, es pulsierte heftig, als hätte er einen Eiterherd im Sack. Der gehörte zum Fließen gebracht. Heinrich war Arzt, er wusste Bescheid, wie ein Mann funktioniert. Er hatte den menschlichen Körper genau studiert, er hatte sich erst zum Zahnarzt ausbilden lassen, nachdem er mit der Humanmedizin fertig war. Er hätte auf einen Ausbildungsplatz warten müssen. Heinrich wollte nicht warten.
Endlich hatte er eine Lücke gefunden. Mit seinem Raubtiergebiss ragte der Panther in den Behindertenparkplatz hinein, Heinrich glaubte nicht, dass man ihn abschleppen würde. Aber vorsichtshalber steckte er sein »Arzt im Dienst«-Schild hinter die Windschutzscheibe. Einen Parkschein mit einer Stunde Zeitguthaben riskierte er, mit raschen Kreuzen füllte er Datum und Ankunftszeit aus. Er überlegte, ob er einen zweiten Schein dazulegen sollte, für alle Fälle. Aber welche Fälle, fragte er sich, eine Stunde muss genügen, eine Stunde genügte immer. Im Augenblick hatte er das Gefühl, der kostenlose Zehn-Minuten-Parkschein würde auch genügen. Aber Heinrich wollte nicht lieblos erscheinen.
Margot trug ihr goldfarbenes Seidennachthemd, ein Geschenk eines Freundes vor langer Zeit. Heinrich merkte, dass sie bereits geduscht hatte, er roch es, dass sie frisch eingecremt war, er sah ihre Schminke, auch wenn sie keinen Lippenstift aufgetragen hatte, und das war gut so. Er wollte keine Spuren mitnehmen auf seinem weißen Hemd, auch nicht auf der weißen Hose, die er in der Ordination trug und die er bequemerweise gleich anbehalten hatte.
Margot war die perfekte Geliebte. Sie klagte kaum, wenn er an den Wochenenden keine Zeit hatte, sie beschwerte sich nicht, wenn er abends nicht ausging mit ihr, und sie war jederzeit bereit, in sein Haus zu kommen, wenn er mit der kleinen Tochter allein war, weil seine Frau Nachtdienst hatte.
»Ist alles in Ordnung?«, fragte Heinrich, als Margot aus dem Badezimmer kam.
Sie setzte sich zu ihm auf die Schlafcouch, sie warf ihr frisch gewaschenes Haar in den Nacken. Dabei lächelte sie. Nach wie vor bekam sie eine Gänsehaut, wenn sie Heinrich ansah. Nicht weil er ihr so gut gefiel, sie hatte einiges an ihm auszusetzen, zum Beispiel an seiner Korpulenz, an seinem Ansatz zu einer Glatze, an seinen etwas zu kurzen Armen … aber da gab es noch seine Art, wie er sie ansah, den weichen Griff, mit dem er ihre Hand umfasste, die Mimik, wenn er seufzte und nichts sagte, oder seine schmelzende Stimme, wenn er mit seinem Kind telefonierte. Und natürlich war da noch der Sex. Noch nie war sie so süchtig danach gewesen, noch nie wollte sie so oft mit jemandem ins Bett gehen. Noch nie hatte sie so sehr nach Befriedigung gelechzt. Er ließ sich vollkommen auf sie ein, er war erst dann bereit, selber zu genießen, wenn er sie winseln hörte. Unter seiner Hand, unter seiner Zunge, unter seinem Schwanz. Wenn sie nur daran dachte, durchrieselte sie ein Schauer, der sie zum Zittern brachte.
Es geht mir beschissen, dachte Heinrich, als er wieder in seinem Diablo saß. Da habe ich mich wie Münchhausen am eigenen Schopf gepackt und aus dem Dreck gezogen, wirklich aus dem Dreck, nicht aus dem Sumpf, und jetzt das hier. Er drehte die Arie ab. Er konnte den Liebesschmerz der Callas jetzt nicht ertragen. Sein Leben erschien ihm tragisch genug.
Heinrich war schockiert. So schockiert, dass ihn nicht einmal die Callas in andere Sphären versetzten konnte. Heinrich war schockiert über seine Empfindung und noch mehr über seine Reaktion. Er würde sich anständig verhalten in der Sache. Er würde sie in die Klinik bringen, er würde alles bezahlen. Heinrich war immer korrekt gewesen. Er wollte die Sache aus der Welt haben, so schnell wie möglich. Heinrich schüttelte den Kopf. Er musste zugeben, er hatte noch nie daran gedacht, welche Folgen es haben konnte. Er hatte sich nichts überlegt, wenn er seinen kleinen Panther in die Höhle einer Frau steckte. Naturgetrieben. Ihn interessierte Margots Situation nicht. Es war ihm egal, wie sie darüber dachte. Er war nur damit beschäftigt, sein Leben nicht davon berühren zu lassen. Seltsam, ihn tangierte auch dieses Kind nicht, er dachte, er könnte irgendwie stolz darauf sein, auch wenn er es nicht haben wollte, aber im Augenblick wenigstens hätte er so etwas wie Schöpferfreude empfinden können, rein evolutionsbedingt, vom Prinzip der Samenstreu ung her. So etwas wie einen archaischen Stolz, wozu er in der Lage war, rein theoretisch. Aber er wollte nur weg, weg und heraus aus dieser Situation, so schnell wie möglich, er wollte jene Ordnung wieder herstellen, die er sich mit viel Mühe geschaffen hatte.
Er dachte kurz nach, er überlegte, was sein würde, wenn sie nicht in die Klinik ginge. Er liebte sein Kind. Sein eheliches Kind. Dieses gewollte Wesen, dem er vom ersten Tag an verfallen war, als bei seiner Frau endlich eine Schwangerschaft festgestellt wurde. Aber dieses Kind wollte er nicht. Und deshalb musste Margot in die Klinik gehen. Er war überzeugt davon, er würde sie dazu bringen. Auch wenn sie zögerte, wenn sie vielleicht mit dem Gedanken spielte. Er musste ihr klar machen, dass es nicht ginge. Dass sie ihre Beziehung nicht weiterführen könnten mit einem Kind. Sein Handy läutete. Er sah auf das Display. Es war die Assistentin. Wo er denn bleibe. Die Patientin für das Implantat sei schon hier. Sie selber müsse auch pünktlich weg. Sie habe ihm doch gesagt, dass sie in der Mittagspause einen Arzttermin hätte.
Heinrich war ungehalten, ziemlich unwirsch sogar, er sagte, dass er zwar an vielem leide, aber bestimmt nicht an Alzheimer. Er habe weder ihre Mittagspause vergessen, noch die Patientin, die er implantieren wolle.
Sie nervte. Schon lange nervte sie ihn. Sie nervte, weil sie ihn liebte. Seit Jahren schon. Aber Heinrich sorgte dafür, dass es eine platonische Liebe blieb. Niemals hätte er etwas mit einer Assistentin angefangen. Das sagte ihm sein Hausverstand: keine Frau, die von ihm abhängig war. Keine, die aus einer Affäre ein Gegengeschäft machen konnte, keine, die sich Freiheiten herausnehmen oder ihn erpressen konnte. Seine Ordinationshelferin konnte nur heimlich wütend auf ihn sein, wenn er für eine Stunde die Praxis verließ, wenn er Erledigungen machte, wie er es nannte. Sie spürte genau, wohin er fuhr und von welcher Art seine Erledigungen waren. Manchmal rief sie an, meist wegen Nichtigkeiten, weil sie sehen wollte, ob er ans Handy ging, aber sie musste damit leben, dass er ihr klar und deutlich verschwieg, wo er war. Da konnte sie sich zusammenreimen, was sie wollte, da konnte sie Anspielungen machten, so viele ihr einfielen, mehr als ein freundliches Lächeln hatte sie nie aus Heinrich herausholen können.
Schwanzgesteuert, wie man bei den Rotariern sagte, das war er immer schon gewesen. Aber er kannte kaum jemanden, der sein Familienleben so klar von seinem Sexualleben trennte wie er. Die meisten seiner Clubfreunde waren einmal, manche sogar öfter geschieden. Sie hatten die Hälfte ihres Vermögens zurückgelassen, oft auch das ganze Haus. Heinrich hatte das Gegenteil getan. Er hatte gut geheiratet, und er hatte nie daran gedacht, sich scheiden zu lassen. Nie hätte er diesen Aufwand auf sich genommen, für ein paar Monate aufregendes Sexualleben mit einer Neuen. Es kommt doch bei jeder Frau darauf an, dass man sich mit ihr zusammenrauft, war Heinrichs Standpunkt. Wenn er sich die Geschichten anhörte, mit den alten und den neuen Kindern, mit all dem Neid, den Eifersüchteleien und den Rosenkriegen, die oft erst mit der Scheidung anfangen und nicht dort aufhören, wie viele glauben, dann konnte Heinrich gut darauf verzichten. Er hatte hart gearbeitet, für alles, was er besaß. Er glaubte nicht, dass es eine Liebschaft wert war, den Schlüssel zur Villa abzugeben. Und auch nicht das halbe Monatseinkommen.
Sein Studium hatte sich Heinrich als Dressman verdient. Eine kurze Zeit lang war er sogar das internationale Model von Boss gewesen. Er sah damals verboten gut aus, und er hatte sein gutes Aussehen optimal genutzt. Vor allem sein Charme war es, der ihn auf Fotos unwiderstehlich aussehen ließ. Es gehörte damals zum guten Ton in der Branche, dass man jede Nacht in einem anderen Bett verbrachte, manchmal auch in einem Gemeinschaftsbett, in dem sich mehr als zwei Personen wälzten. Heinrich hatte diese Zeit ausgekostet, und wenn die Nächte lang und heiß waren, hatte er nichts, aber auch gar nichts anbrennen lassen. Aber niemals hätte Heinrich im Traum daran gedacht, eines dieser Models zu heiraten. Für ihn war immer klar gewesen: er wollte eine anständige Frau aus gutem Haus, und er wusste, eine solche Frau wollte einen Mann mit einem anständigen Beruf, mit dem er ihr ein gutes Haus bieten konnte.
Heinrich hatte seine Frau auf der Uni kennengelernt. Ihr Vater war Professor für Kardiologie, ihre Mutter die treue Dienerin ihres erfolgreichen Mannes. Die Tochter aus dieser Ehe ergab die richtige Mischung für Heinrich. Sie hatte die Klugheit ihres Vaters geerbt und das Devote ihrer Mutter. Zumindest hatte sie Zurückhaltung als die ideale weibliche Rolle in der Erziehung erlebt und auch übernommen. Sie hatte eine rasche Auffassungsgabe und ein enormes Gedächtnis, aber sie nutzte ihre Fähigkeiten kaum, sie wollte nicht über Heinrich hinweg Karriere machen. Sie hätte viele Möglichkeiten gehabt, schon aufgrund der guten Beziehungen ihres Vaters. Stattdessen hatte sie dafür gesorgt, dass ihr Vater seine guten Beziehungen für Heinrichs Karriere verwendete. Er besorgte ihm einen Vertrag mit der Krankenkasse, er vermittelte ihm eine gut eingeführte Praxis in der Innenstadt. Heinrichs Frau hatte nur eine Stelle als Anästhesistin in einem städtischen Krankenhaus angenommen. Sie hatte nie großen Ehrgeiz gezeigt, nie wollte sie eine eigene Praxis aufbauen oder eine Forschungslaufbahn einschlagen. Es wäre ihr unangenehm gewesen, sie wollte Heinrich nicht überflügeln. Das tat ihm manchmal ein bisschen leid. Vielleicht hätte er sonst noch mehr Ehrgeiz entwickelt, vielleicht wäre er noch höher geflogen.
Heinrich wusste, dass sein Schwiegervater nicht sehr glücklich über die Herkunft seines Schwiegersohnes war. Zwar gefiel es ihm, was Heinrich aus sich gemacht hatte, aber es gefiel ihm weniger, warum er es tat. Wenn Heinrich bei seinen Schwiegereltern eingeladen war, wusste er, wie man sich in einem solchen Haus benahm, aber es kam vor, dass Heinrich ein Wort verwendete, das ein falsches Wort war in diesem Haus, ein Wort, das seine Herkunft verriet, ein Wort, das man in diesem Haus niemals ausgesprochen hätte. Gut war ihm das Schweigen in Erinnerung geblieben, ein Schweigen, das er nicht gleich zuordnen konnte, als sie einmal über die Bedeutung von Arbeit diskutierten. Es war ein auffälliges Schweigen gewesen, das seinen Worten gefolgt war. Heinrich hatte von »barabern« und »Hacknstaad« geredet, anstelle von »arbeiten« und von »Arbeitslosigkeit«.
Gern hätte Heinrich dieser Familie etwas entgegengesetzt, etwas, das ihn nicht nur beschämt lernen ließ, sondern etwas, mit dem er beweisen könnte, dass er mehr war als ein schlichter Parvenü. Er begann sich immer stärker für seine Herkunft zu interessieren. Wer seine Eltern waren, woher sie wirklich kamen, vor allem interessierte ihn, wer sein Vater war.
Heinrich dachte, wenn doch alle von Adam und Eva abstammen, dann gibt es auch viele Wege zurück zu den Babenbergern oder zu den Habsburgern, zu den Staufern und zu den Hohenzollern. Er musste die Verzweigungen seiner Familie nur lange genug zurückverfolgen, dann konnte er vielleicht aus der dunklen Seite seiner Herkunft Überraschendes ans Tageslicht fördern. Er musste nur alles durchforsten im elterlichen Ahnendickicht.
Bei seiner Mutter war nichts zu holen. Sie war Krankenpflegerin gewesen. Ihre Vorfahren waren, so weit sich seine Mutter überhaupt an Vorfahren erinnern konnte, als dienstbare Geister beschäftigt gewesen, und zwar bei jenen Herrschaften, bei denen Heinrich gerne auf die Welt gekommen wäre.
Sein Vater war immerhin Offizier im Krieg gewesen. Seine stolze und wie Heinrich meinte, arrogante Haltung war das Einzige, was noch daran erinnerte. Zumindest hatte es Heinrich so in Erinnerung. Er hatte seinen Vater lange nicht mehr gesehen. Das letzte Mal, als Heinrich ihn aus dem Sommerhaus hinausgeklagt hatte. Dieses Sommerhaus, das mehr ein Unterschlupf als eine Wohnung gewesen war, ließ sich im Winter nur unzureichend heizen. Nach dem Krieg hatte der Vater als Steinmetz eine Anstellung gefunden. Er arbeitete aber nur kurze Zeit, wurde bald krank und musste mit einer sehr kleinen Frühpension sein Auskommen finden. Entsprechend dürftig waren auch seine Unterhaltszahlungen gewesen. Nach der Zwangsräumung hatte Heinrich ihn nicht mehr gesehen. Er wollte ihn auch nicht mehr sehen. Denn als Heinrich dieses Sommerhaus im Cottage gekauft hatte, in dem sein Vater zur Miete wohnte, weigerte sich dieser, weiter den Zins zu bezahlen. Der Vater wollte nicht einsehen, warum er seinem Sohn Geld geben sollte. Er reagierte nicht auf die Mahnbriefe und er ignorierte sogar die eingeschriebenen Briefe des Anwalts. Heinrich sah sich gezwungen, eine Räumung zu veranlassen. Aber das gestaltete sich schwierig. Der Vater weigerte sich, das Haus zu verlassen. Es musste die Polizei ausrücken. Polizisten trugen den Vater aus dem Haus.
Danach war Heinrich einmal an dem schäbigen Vorstadtmietshaus vorbeigefahren, in das sein Vater nach der Räumung des Sommerhauses gezogen war. Die Adresse hatte er sich von seinem Anwalt geben lassen. Heinrich hatte keinen Anlass gesehen, den Vater noch einmal zu besuchen. Er war kein Befehlsempfänger, der gehorchen musste, wie einst die Soldaten gehorchten, die seinem Vater unterstellt gewesen waren. Heinrich war sein einziger Sohn, für dessen Existenz der Vater die Verantwortung trug, oder sie zumindest hätte tragen sollen.
Die Nacht seines Vaters mit seiner Mutter war eine Sache, die Tatsache seiner Geburt eine andere. Heinrich hatte nie eine herzliche Beziehung zu seiner Mutter gehabt. So lange er bei ihr gelebt hatte, konnte Heinrich ein gewisses Verständnis für das Verhalten seines Vaters aufbringen. Ein Verständnis dafür, dass er seine Mutter nicht heiraten wollte, auch wenn es keine andere Frau gegeben hatte, die ein Hindernis gewesen wäre. Heinrich hatte aber kein Verständnis dafür, dass sein Vater ihn nicht mochte, dass er den Kontakt zu seinem einzigen Sohn, wenn auch zufällig und ohne Willen gezeugt, niemals gesucht hatte. Nie wollte Heinrich werden wie sein Vater. Seit er selbst Vater war, tat ihm die Beziehungslosigkeit zu seinem eigenen Vater noch mehr weh. Er konnte es sich immer weniger vorstellen, dass es Väter gibt, wie sein Vater einer war.
Heinrich warf einen kurzen Blick in das Ordinationszimmer Nummer eins. Die Patientin lag bereits auf dem Behandlungsstuhl. Seine Assistentin warf ihm einen vernichtenden Blick zu. Das hätte sie nicht tun sollen. Für diesen Blick würde er sie bestrafen. Er verschwand in seinem Privatzimmer und nahm sich eine Dose Cola Light aus dem Kühlschrank. Heinrich ließ sich nicht drängen, er würde in Ruhe noch etwas trinken, bevor er mit der Arbeit anfing. Immer wenn er den Kühlschrank öffnete, musste Heinrich daran denken. Es war der Kühlschrank seines Vaters. Er hatte ihn nach der Delogierung im Sommerhaus zurückgelassen. Es war ein alter Kühlschrank aus den sechziger Jahren. Kein nachgebauter, wie sie später wieder modern wurden. Heinrich hatte ihn sorgfältig gereinigt und in sein Privat zimmer gestellt. So konnte er jederzeit etwas Kaltes trinken, zum Beispiel, wenn er in aller Ruhe telefonieren wollte. Er musste nicht an der Assistentin und an der Empfangsdame vorbei in die kleine Küche gehen, er brauchte sich nicht belauschen lassen bei seinen privaten Telefonaten. Er zog den Metallverschluss von der Cola-Light-Dose ab, er warf ihn in den Papierkorb. Dann stellte er sich ans Fenster, er sah hinaus.
Er hätte nichts gehabt gegen einen Sohn. Eine Tochter hatte er schon. Eine Tochter, die sein ein und alles war, für die allein es sich lohnte, seine Ehe aufrecht zu halten. Er wollte auch einen Sohn. Aber nicht auf diese Weise. Nicht irgendwo auswärts, nicht mit irgendeiner Frau, die ihm nichts bedeutete. Heinrich wollte sein Kind erleben, er wollte es aufwachsen sehen. Nein, er war nicht wie sein Vater, der sein Leben lang kein Interesse an seinem Kind hatte, der seinen Sohn nie kennenlernen wollte. Nicht einmal dann, als Heinrich angefangen hatte, sich für seinen Vater zu interessieren. Er hat mich nur benutzt, dachte Heinrich. Er stellte die angebrochene Cola-Dose in den Kühlschrank zurück. Und als ich mich benutzen ließ, hat er mich ausgenützt.
Heinrich war erst vierzehn gewesen. Er hatte eine Lehre als Verkäufer begonnen. Handelskaufmann hatte es damals großspurig geheißen, ob es noch immer so hieß, wusste er nicht. Er hatte seinen Vater das erste Mal aufgesucht. Der Vater war weder überrascht gewesen, noch hatte er sich gefreut. Er hatte nur gesagt: »Ich wusste, dass du eines Tages kommen würdest!« Und dann hatte er Heinrich in das nächste Geschäft geschickt, damit er für ihn einkaufe, weil er krank sei und selber nicht aus dem Haus gehen könne. Er hatte zu Heinrich gesagt, dass er inzwischen bezahlen solle, das Geld für den Einkauf würde er ihm nachher geben. Aber der Vater machte auch nachher keine Anstalten, für die Einkäufe zu bezahlen. Als Heinrich nach dem Geld fragte, beschimpfte ihn der Vater, er fragte, ob er nicht genug für ihn bezahlt habe, all die Jahre, die Heinrich schon auf der Welt sei. Ob er ihm vorrechnen solle, was ihn diese einzige Nacht, was heißt Nacht, eine Stunde war es wohl nur, bestimmt war es nicht mehr als eine Stunde, die er mit seiner Mutter verbracht hatte, was ihn diese Stunde gekostet habe, und ob Heinrich nicht dankbar sein und einmal etwas für seinen alten Vater tun könne.
Der Vater hatte sich nicht dafür interessiert, wie Heinrich seine Kindheit verlebt hatte, nie hatte er danach gefragt, was er tue, ob er zur Schule gehe oder ob er eine Lehre mache, er hatte nur gesagt, wenn Heinrich ihn wieder besuchen komme, könne er auch wieder Einkäufe für ihn erledigen. Sein Kühlschrank stehe immer für ihn offen.
Heinrich lehnte sich nun an diesen Kühlschrank, den er schon als Vierzehnjähriger mit Lebensmitteln vollgestopft hatte. Vollgestopft für jemanden, dem er völlig egal war. Er schüttelte den Kopf, wenn er daran dachte. Wie konnte er den Vater nach dieser Erfahrung wieder besuchen? Aber er war wieder zu ihm gegangen und er hatte alles für den Vater getan. Er hatte diesen Kühlschrank immer wieder mit Wurst, Käse, Obst, Gemüse und Wein gefüllt. Er hatte die Küche und das Badezimmer geputzt, er hatte Fliesen an die Wand geklebt, wenn sie heruntergefallen waren, und er hatte die Zimmer ausgemalt. Heinrich hatte alles getan, was der Vater von ihm verlangt hatte, so als hätte er eine Schuld abarbeiten müssen, eine Schuld dafür, dass er auf der Welt war und den Vater mit seiner Existenz belästigte. Er bettelte wie ein Hund um ein paar Streicheleinheiten. Doch je mehr der Hund bettelte, umso heftiger trat der Vater nach ihm, nach dem hündischen Sohn, den er nie haben wollte, der ihm zugelaufen war und der nicht mehr von seiner Seite weichen wollte.
Heinrich fuhr mit dem Mittelfinger über die weiße Lackschicht des Linde-Kühlschranks. Erstaunlich, wie gut der Lack noch hielt. Erstaunlich auch, dass er immer noch funktionierte.
Heinrich ging in sein Ordinationszimmer. Er kannte die Patientin. Vor etwa drei Monaten war sie mit unerträglichen Zahnschmerzen zu ihm gekommen. Auf dem Röntgenbild hatte er nichts Eindeutiges erkennen können. Mehrere wurzelbehandelte Zähne, hier ein möglicher Schatten, dort eine undefinierbare Verdunkelung, sie konnte etwas bedeuten oder auch nicht. Zu viel war in diesem Mund schon herumgepfuscht worden, Vitales ließ sich von Nekrotischem nur schwer unterscheiden. Die Frau litt an fürchterlichen Zahnschmerzen, aber niemand hatte es gewagt, den entscheidenden Zahn zu entfernen, jenen Zahn, der unerträgliche Schmerzen von Wohlbefinden schied. Niemand war mutig genug gewesen, niemand wollte sich festlegen, welcher Zahn der Verursacher dieser zermürbenden Schmerzen war.
In mehreren Schritten tastete sich Heinrich an das Problem heran. Er wollte es lösen. Er war sich der Tragweite seiner Entscheidung bewusst, falls es doch der falsche Zahn wäre. Einen gesunden Zahn zu extrahieren, das konnte sich kein Zahnarzt mehr leisten, das sprach sich schnell herum. Es war nicht mehr wie früher, dass die Patienten bei einem Zahnarzt blieben wie bei einem Ehepartner. Die Konkurrenz schlief nicht. Die Konkurrenz arbeitete Tag und Nacht, die Konkurrenz arbeitete hier und sie arbeitete noch billiger in Ungarn, nur eine Stunde entfernt. Aber Heinrich wollte nicht feig sein. Nicht so feig wie die anderen. Er wollte sich nicht vor dieser Entscheidung drückten, er wollte die Frau nicht an Kollegen weiterschicken, aus Angst um seinen guten Ruf. Heinrich tüftelte. Lange starrte er auf das Röntgenbild. Er verglich die verschiedenen Schatten miteinander. Er sah sich die vorangegangen Behandlungen genau an. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen nichtvitalen Zahn handelte, war größer als umgekehrt. Ein Zahn erkrankt nicht von der Wurzel her. Ein Zahn bekommt zuerst Karies. Bakterien dringen bis zur Wurzel vor, erst dann kommt es zu einer Entzündung. Heinrich sah sich alle behandelten Zähne genau an, er ließ sich Zeit. Danach studierte er jene, die schon eine Wurzelbehandlung hinter sich hatten. Er spürte die Wut der Patientin. Sie wollte, dass Heinrich sie rasch und endgültig von ihren Schmerzen erlöse. Wenn er das nicht könne, solle er doch resignieren, ihr ein starkes Schmerzmittel geben, so wie alle es vor ihm getan hatten und er solle sie endlich weiterschicken, zu einem, der besser wäre als er.
Es gab aber keinen, der besser war als er, da war sich Heinrich ganz sicher. Was er tat, war reine Strategie. Er hatte noch nichts gegen die Schmerzen unternommen, weil er punktuell vorging, er würde exakt nur dort eine Spritze setzen, wo er den Übeltäter vermutete. Blieben die Schmerzen, musste die Ursache bei einem anderen Zahn liegen. Ein Restrisiko würde bleiben, wenn die Nerven einmal im ganzen Backenbereich angegriffen waren.
Das Einspritzen war eine Kleinigkeit, die Frau spürte es nicht. Es war wie ein Dammschnitt bei einer Geburt. In seiner Ausbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin hatte Heinrich einige Geburten erlebt. Dieser Druckschmerz war ihm vertraut. Die Druckdolenz ist so gewaltig, dass der Schmerz der Geburt nicht gespürt oder sogar als Erleichterung wahrgenommen wird.
Nach der Sedierung ließ er sich Zeit. Viel Zeit. Er wollte das Nachlassen des Schmerzes kontrollieren. Eine kleine Erleichterung war Heinrich nicht genug. Er ließ die Patientin warten. Er wollte ihre Erleichterung nicht nur hören, er wollte sie auch sehen. Er wollte in ihrem Gesicht, in ihrer Mimik lesen, er wollte die Entspannung in ihren Bewegungen erkennen. Selbst als er die Schmerzen der Frau weggespritzt hatte, zögerte er. Es waren zwei wurzelbehandelte Backenzähne, zwischen denen er die Wahl treffen musste. Er fühlte sich, als müsste er über Leben und Tod siamesischer Zwillinge entscheiden, von denen nur einer überleben kann. Und dieser auch nur um den Preis, dass der andere stirbt.
Was er dann tat, machte er gründlich. Er hatte viel Gefühl, er konnte einen Zahn so lockern, dass er ihn mit einem einzigen Schwung aus dem Kiefer drehte. Er hörte schon am Klang der Drehbewegung, ob es gelingen würde oder nicht. Er hörte, wie glatt es diesmal ging. Heinrich konnte sich über einen perfekt extrahierten Zahn freuen wie ein kleines Kind über den leuchtenden Weihnachtsbaum. Er betrachtete das schöne Stück mit der gelbbraunen Wurzel von allen Seiten. An der rechten hinteren Wurzelspitze sah er einen Eiterklumpen pendeln wie eine winzige Christbaumkugel.
»Da, schauen Sie«, rief er voll Begeisterung, er hielt der Frau ihren Zahn vor die Augen. »Wir haben den richtigen, er wird Ihnen keine Schmerzen mehr bereiten.«
Natürlich würde die Patientin noch Wundschmerzen haben. Es dauert, bis so ein Wundloch verheilt ist. In zwei Stunden würde er es genau wissen. In zwei Stunden würden die Betäubungsspritzen ihre Wirkung verlieren, dann klärte es sich, ob er den Haupttäter oder nur einen kleinen Mittelsmann erwischt hatte.
Nun lag diese Frau wieder hier auf seinem Behandlungsstuhl, sie wollte ein Implantat. Sie würde in diesem Leben zu keinem anderen Zahnarzt mehr gehen. Sie würde ihm treu sein wie eine Ehefrau, oder vielleicht noch treuer. Er hatte sie von höllischen Schmerzen erlöst, dafür würde sie ihm dankbar sein bis in alle Ewigkeit. Sie war nicht die einzige. Es gab einige Patientinnen, die ihn liebten, weil er sie so gut behandelt hatte.
Heinrich konnte es so schmerzarm, wie kaum ein anderer. Jahrelang hatte er sich damit beschäftigt, er hatte akribisch nach jenem Punkt im Zahnfleisch gesucht, der am wenigsten empfindlich ist. Er traf ihn fast immer. Er hatte das absolute Gefühl für den schmerzlosen Punkt. Dann wartete er geduldig. Das taten die wenigsten Zahnärzte. Sie wollten Zeit sparen. Schnell, schnell, das Wartezimmer ist voll. Möglichst viele Kassen. Alle müssen durch. Heinrich hatte schon seit längerer Zeit keine großen Kassen mehr. Er konzentrierte sich lieber auf die Technik, die sowieso keine Pflichtversicherung bezahlt. Heinrich nahm sich immer Zeit, er wartete, bis die Spritze ihre volle Wirkung entfaltete. Erst dann spritzte er ausgiebig und mit vielen kleinen Stichen den restlichen Bereich der Nerven ein. Er sparte nicht bei den Mitteln, auch wenn sie teuer waren. Sehr teuer sogar. Aber Heinrich fand, dass es keinen Menschen gibt, der so dankbar ist und einen Arzt so sehr liebt, wie ein Patient, der von seinen Schmerzen erlöst wurde.
Einmal hatte eine Patientin zu ihm gesagt, sie verstehe nicht, warum man in der Renaissance solch bluttrünstige Gräuelbilder gemalt habe, als man die Hölle darstellen wollte. Man könnte glauben, die Maler hätten niemals Zahnschmerzen gehabt.
Frauen sind dankbarer als Männer. Heinrich fragte sich manchmal, warum das so ist. Wahrscheinlich, weil es Männern peinlich ist, Schmerzen zu empfinden, dachte er. Heinrich gab jeder Frau das Gefühl, er behandle sie zärtlicher und liebevoller als es die Situation erforderte. Dann stellten sich Frauen oft die Frage: Warum behandelt er gerade mich so gut?
Heinrich hatte Frauen lieber auf seinem Stuhl als Männer. Aber zwei Frauen gab es, die er nicht gern behandelte, die er am liebsten gar nicht in seine Praxis ließe, die er von seinem Stuhl jagte, wenn er könnte, ein für allemal. Das waren seine Frau und seine Tochter. Ihnen fehlte der nötige Respekt, vor ihm und vor seiner ärztlichen Kunst. Sie jammerten, auch wenn ihnen nichts weh tat, sie stöhnten, sobald sie den Mund aufmachten, sie schrien, sobald er nur einen Zahnspiegel in ihre Nähe brachte. In Wirklichkeit ließen sie ihn ihre Macht spüren. Sie zeigten ihm, wie nahe sie ihm waren. So nahe, dass sie keine Skrupel hatten, sich derartig schlecht zu benehmen, sich aufzuführen, ja ein richtiges Theater zu veranstalten, in einem Stück, das er mit fremden Personen niemals gespielt hätte. Höflich, aber bestimmt hätte er die fremde Person von seinem Stuhl gebeten und weggeschickt. Höflich aber bestimmt hätte er dieser Person gesagt, sie solle den Facharzt einer anderen Sparte aufsuchen, wenn sie an einer Behebung des Zahnproblems nicht ernsthaft interessiert sei.
Der Panther glitt fast lautlos auf seinen samtigen Pfoten dahin. Auch bei diesem Tempo wurde der Diablo seinem Namen gerecht. Wie aus einer anderen Welt kommend, rollte der schwarze Teufel auf dem Asphalt. Aber wenn Heinrich auf die Tube drückte, schoss ihm Pech und Schwefel ein. Dann hob er ab, es blieb nichts zurück als eine feine, rauchige Spur.
Wenn Heinrich nach Hause kam und wenn sich das elektronische Garagentor vor ihm öffnete, hatte er das Gefühl, als wäre er von einem großen Abenteuer zurückgekehrt. Als hätte er im Dickicht des Dschungels gejagt, als wäre er über eine weite Steppe gehetzt. Er fühlte sich glücklich, nach so viel Jagd und Beuteglück, er war zufrieden, er war zu Hause angekommen. Zärtlich strich er dem geflügelten Panther über die Flanke, mit einem leichten Klaps drückte er ihm die Schwinge an den Körper, bevor er sich von ihm trennte, von seinem vierrädrigen Begleiter, den er in diesem edlen Stall zurück ließ. Auto konnte er dieses Wunderwerk der Technik nicht nennen. Wie er sein Haus nicht einfach als Haus bezeichnen konnte, so gelungen wie es war, so perfekt in seiner Gestaltung und Gestalt. In einer der schönsten Gegenden der Stadt hatte er sich diese Villa aus Glas, Beton und Holz bauen lassen. Nach den Prinzipien der Sichtbarkeit des Bauskeletts und in der Ausgestaltung von asketischer Schlichtheit. Besonders die Bauhausarchitekten Walter Gropius und Ludwig Mies van der Rohe haben Pate gestanden. Hell, sonnendurchflutet, mit natürlichen Materialien, und zeitgemäß auch ökologisch nachhaltig. Bei diesem Haus wurde an alles gedacht. Jeden Abend fuhr Heinrich in eine andere Welt, wenn sich das automatische Garagentor hinter ihm schloss, wenn sich der Aufgang aus Sichtbeton von der mit Edelholz verkleideten Garage in den Wohnbereich öffnete. Die Garage war in den Wohnbereich integriert. Einen Lamborghini sperrt man nicht weg wie ein Auto, das seine Schuldigkeit getan hat. Sein schwarzer Panther gehörte zur Familie, der Gedanke an ihn wärmte ihm das Herz wie der Gedanke an den Olivenbaum, der im Atrium des Wohnzimmers stand, und dem Raum etwas Südländisches und zugleich sehr Vertrautes und Geborgenes gab. Heinrich hörte das Klavierspiel seiner Tochter. Sie übte den Eisenbahnerboogie. Sie übte nach der Ganzheitsmethode, sie musste sich nicht mit Czerny-Etüden herumplagen. Sie ging in eine montessoriorientierte Schule, die alle Stücke spielte, und seine Tochter durfte solche Stücke spielen, in denen sie ihre Befindlichkeit ausdrücken konnte. Das Üben selber war schon ein lustvolles Erleben, nicht erst das Ergebnis des Könnens und Beherrschens.
Heinrichs Frau hantierte in der eleganten Küche aus weinrotem Resopal. Sie stand am Küchenblock mit Edelstahlauflage und bereitete das Abendessen zu. Alles erschien Heinrich behaglich und warm, es gab nichts, wogegen er diese Wärme, diese Familie eintauschen wollte. Es war ihm plötzlich nach Weinen zumute, als er die offene Treppe in den Wohnbereich hinaufgegangen war, dort innehielt und auf das Szenario einer glücklichen Familie schaute. Er hatte alles erreicht. Alles, was sich jemand wünschen kann, um glücklich zu sein. Heinrichs Familie war perfekt, so perfekt wie in der Tee-Werbung mit dem »Father and Son-Lied« von Cat Stevens. Nur, dass nicht der Teekessel duftete, wenn er heimkam, sondern dass die Düfte eines richtiges Abendessens das Haus durchzogen, Düfte nach einer Pasta asciutta, Heinrich würde einen Rotwein aufmachen, und für Agnes eine Flasche mit naturtrübem Apfelsaft.
Seine Frau war noch immer schön, mit ihrem dunkelblonden Haar, das sie beim Kochen mit einem Kamm hochgesteckt trug. Agnes lief auf ihn zu, als sie mit dem Boogie zu Ende war. Sie umarmte Heinrich, als wäre er nach einer wochenlangen Expedition heimgekehrt. Dann ging er zu seiner Frau, er küsste sie zur Begrüßung. Agnes hielt ihn noch immer umschlungen, so herzlich, so eng wie eine Geliebte, die ihren Liebsten umschlingt und sich an ihn schmiegt.
Heinrich öffnete eine Flasche Barolo, die er von einer Italienreise mitgebracht hatte. Vorbei waren die Zeiten, in denen er billigen Wein getrunken hatte. Heinrich hatte Geschmack entwickelt. Nicht nur bei Autos, bei Häusern, nein, auch beim Wein. Er musste nicht mehr auf klingende Namen achten, die einen guten Wein von einem schlechten unterscheiden. Heinrich unternahm einmal jährlich mit der Familie und mit Freunden eine Reise ins Piemont und verkostete dort die besten Weine, die in den piemontesischen Kellereien reifen. Von den allerbesten packte er ein paar Kisten ins Auto, in den Kombi, den seine Frau fuhr und den auch er nahm, wenn er mit der gesamten Familie reiste oder wenn er Transporte zu erledigen hatte.
Heinrich roch lange und intensiv am Korken. Der Wein war einwandfrei. Er schüttete eine kleine Menge in einen großen mundgeblasenen Kelch, er kostete, schmatzte, schlürfte, so wie er es bei einem Weinseminar gelernt hatte. Dann dekantierte er. Sorgfältig schüttete er den Wein in eine breitbauchige Karaffe. Er hielt die Flasche schräg und ließ den Rotwein ganz langsam am Bauch der Karaffe entlang rinnen. Möglichst viel Sauerstoff sollte er aufnehmen und sein Aroma entfalten. Nur den Bodensatz in der Höhe von etwa einem halben Zentimeter ließ er in der Flasche zurück, damit er das edle Bouquet nicht trübe.
Agnes erzählte von der Schule, während sie ihre Nudeln auf die Gabel wickelte. Heinrich sah ihr zu und lächelte. Wie geschickt sie das machte. Als sie noch ein kleines Kind war, hatte er ihr schon beigebracht, dass man Spaghetti nicht schneidet und auch keinen Löffel als Wickelhilfe benötigt. Was italienische Kinder von klein auf können, würde auch seine Tochter erlernen. Sie wickelte ihre Nudeln so geschickt auf die Gabel, als wäre sie mit Spaghetti in den Händen geboren. Spaghetti, Barolo, Lamborghini, dolce far niente, dachte Heinrich, er schaute auf das rubinfunkelnde Glitzern des Rotweins, das mit der Farbe des Küchenresopals ebenso harmonierte, wie mit den eleganten italienischen Lederstühlen des Essplatzes.
»Papi, heute hat die Musiklehrerin Carlas Flöte in den Mund genommen und darauf gespielt. Voll grindig. Und dann hätte Carla darauf weiterspielen sollen, aber es hat ihr so gegraust, dass sie nicht konnte.«
»Hat sie die Flöte danach nicht abgewischt«, fragte Heinrichs Frau.
»Doch«, sagte Agnes, »aber verstehst du nicht? Wenn es dir einmal graust, ist es vorbei. Da kann sie putzen und wischen, soviel sie will.«
»Was hätte die Lehrerin denn tun sollen, wenn sie ihr was beibringen wollte?«
»Na, ihre eigene Flöte mitbringen«, antwortete Agnes in einem Ton, als hielte sie ihre Mutter für ein bisschen plemplem.
Heinrichs Frau überging den Ton ihrer Tochter, obwohl er ihr nicht behagte. Sie nippte am Wein. Heinrich wusste, dass sich seine Frau aus Wein nichts machte, sie trank ihm zuliebe ein Glas mit, und immer, wenn er den Wein gut fand, fand sie das auch. Aber sie schmeckte nichts, Heinrich hatte es ausprobiert. Einmal hatte er ihr einen Wein eingeschenkt, der so verkorkt war, dass es zum Himmel stank, aber Heinrich lobte sein kräftiges, vollmundiges Aroma, und seine Frau lobte mit. Heinrich grinste in sich hinein. Heimlich freute er sich. Geschmack hat man oder hat man nicht, dachte er. Da nützt auch die gute Herkunft nichts.
Damals bestrafte Heinrich seine Frau für ihren schlechten Geschmack. Er gab ihr so lange von dem verdorbenen Wein, bis sie die Flasche leergetrunken hatte, während er selber eine neue Flasche öffnete und sich an einem guten Schluck delektierte.
Er würde an diesem Morgen nicht mehr kommen, sonst hätte er angerufen. Margot zog das Leintuch von der Couch. Sie verstand. Sie sah ein, dass er irritiert war, sie war es auch. Ihre Situation hatte sich verändert. Margots Tage waren überfällig, seit zwei Wochen schon. Das kam praktisch nie vor. Wenn sich ihre Periode verschob, dann, weil sie zu früh kam, aber nie kam sie zu spät. Genau genommen hatte Margot einen verkürzten Zyklus, trotzdem rechnete sie immer mit achtundzwanzig Tagen. Sie wollte ihren Zyklus nicht akzeptieren. Die Tage schränkten sie ein, behinderten sie in ihrem Liebesleben, das sowieso nur aus einer schwachen Stunde bestand, in der Heinrich bei ihr sein konnte, an höchstens vier, fünf Tagen in der Woche. Heinrich war dann reduziert in seinen Möglichkeiten. Manchmal hatte Margot Angst, er könnte sie verlassen, weil sie einen kurzen Zyklus hatte.
Margot hatte ihm erzählt, dass ihre Periode überfällig war. Sie wollte sehen, wie er reagierte. Er hatte getan, als ob es nichts bedeute. Als er gestern bei ihr war, hatte er nur gelacht und gemeint, wenn sie schon schwanger sei, dann könne sie es wenigstens nicht mehr werden.
Margot hatte sich einen Test aus dem DM besorgt, einen, auf dem stand, dass auch Gynäkologen ihn verwendeten. Außerdem könne man den Test zu jeder x-beliebigen Tageszeit durchführen, man müsse nicht auf den Morgenurin warten.
Eigentlich wollte Margot warten, bis Heinrich kam. Aber es war elf Uhr, er wusste, dass sie bald weg musste. Sie wollte Gewissheit haben. Sie nahm das Thermometer, das in einer Plastikfolie eingeschweißt war, es sah zumindest wie ein Thermometer aus, sie schälte es aus der Folie heraus, sie las die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Es dauerte etwas, bis sie mit den Begriffen zurechtkam: Urinabsorber, Teststab, Ergebniskappe, drei Felder, großes Fenster, roter Punkt, mittleres Fenster, wenn roter Punkt erscheint, dann schwanger, wenn im linken Fenster der Punkt verschwunden, dann ist der Test abgeschlossen. Ihr Herz pochte. Wenn roter Punkt im mittleren Fenster, dann schwanger, war das einzige, was in ihrem Kopf hängen blieb und ihre Gedanken zum Rotieren brachte. Sie zog die Schutzkappe vom Teststab ab. Ein rotes Schwämmchen kam zum Vorschein. Auf dieses Schwämmchen sollte sie eine Sekunde lang pinkeln, danach die Ergebniskappe draufstecken und vier Minuten warten. Sie wollte sich nicht darauf verlassen, ob sie in der Aufregung das Schwämmchen traf, sie suchte nach einen Becher, in den sie urinieren konnte. Sie hätte jetzt ein Joghurt essen und den Becher anschießend für eine Urinprobe verwenden können, aber es ekelte sie bei der Vorstellung, jetzt ein Joghurt zu essen. Sie überlegte, sie könnte ein Joghurt einfach im Ausguss hinunterspülen, damit sie zu einem leeren Becher kam, doch auch bei der Vorstellung, dass sich Fruchtstückchen im Ausguss verfängen, und überhaupt, die Vorstellung, wie sich diese Soße im Ausguss wände, brachte sie zum Würgen.
Warum nicht ein Glas, dachte sie. Wenn ich es nachher auswasche. Ist doch lächerlich, das ganze Theater mit dem Becher.
Sie nahm ein geripptes Glas aus dem Oberschrank ihrer kleinen Küche, die in das Wohn-Schlafzimmer integriert war. Sie ging ins Badezimmer, in dem sich auch das WC befand. Sie hockte sich über die Muschel und presste. Als das Glas zur Hälfte gefüllt war, drückte sie den Muskel zusammen und unterbrach den Strahl. Sie zog das Glas zwischen ihren Beinen hervor und setzte sich nun entspannt auf die Muschel. Erst jetzt ließ sie den Restharn ohne Druck aus sich herausfließen.
Margot ging ins Wohnzimmer zurück und stellte das Glas auf den Couchtisch. Ihr Herz schlug schneller. Sie wollte auf Nummer sicher gehen. Sie tauchte den Stab mit dem Schwämmchen gute zehn Sekunden in den Urin. Besser länger als zu kurz, dachte sie und sah dabei auf die Uhr. Dann steckte sie die Ergebniskappe darauf und legte das Stäbchen neben das Glas. Im ersten eckigen Feld tauchte sehr bald ein roter Punkt auf. Sie hatte den Test richtig durchgeführt. Vier Minuten würde es dauern, bis er abgeschossen sei. Sie hielt es nicht aus, sie konnte nicht vier Minuten lang auf dieses ovale Fenster starren. Wenn aus dem rechten Fenster die Farbe verschwunden sei und es rein weiß erscheine, dann war auch der Test abgeschlossen.
Margot sah auf die Uhr. Sie stand auf. Wenn im mittleren Fenster ein roter Punkt erscheint, dann sind Sie schwanger, dieser Satz drehte sich in ihrem Kopf. Als vergäße sie ihn sonst, wie eine Telefonnummer, die sie nicht vergessen durfte und die sie immer wieder vor sich her sagte, so hatte sich dieser Satz automatisiert. Was mache ich, wenn ich schwanger bin, fragte sich Margot. Sie ging zur Spüle, sie wusch das Glas sorgfältig mit heißem Wasser aus, sie rieb es mit dem Geschirrtuch trocken und stellte es in den Oberschrank zurück. Sie spürte, dass ihr Mund trocken war. Sie nahm ein anderes Glas und füllte es mit Wasser. Sie trank es leer und stellte es auf das gerippte Nirosta. Ich bin sechsunddreißig, dachte sie. Irgendwie hoffte sie, nicht schwanger zu sein, andererseits war eine Spur Enttäuschung dabei. Ob sie wollte oder nicht, ein Bild drängte sich ihr auf, immer wieder, und in diesem Bild hatte sie ein Kind im Arm, das sie zärtlich wiegte.
Sie ging zur Tür mit der kleinen Terrasse, sie sah hinaus. Draußen regnete es leicht. Der kleine Lavendelstock im Topf zitterte. Ihre Wohnung war klein, aber sie lag im sechsten Stock. Sie war sehr hell und hatte einen schönen Blick auf die Stadt. Margot atmete tief durch. Im mittleren Fenster ein roter Punkt. Sie sah auf die Uhr, sie ging zum Couchtisch zurück. Ihr Herz raste. Sie schloss die Augen, sie setzte sich. Sie drückte ihre Hand auf die Brust, als müsste sie ihr Herz festhalten. Sie zählte mit geschlossenen Augen bis zehn, zuerst wollte sie auf das rechte Feld schauen und sich vergewissern, ob der Test wirklich abgeschlossen sei. Sie öffnete die Augen und starrte auf den roten Punkt in der Mitte. Auf einmal war alles anders. Wie sollte es weitergehen? Sie wollte den roten Punkt wegschauen. Wenn sie nur lange genug hinstarrte, löste er sich vielleicht auf, verschwamm zu einer rosa Fläche, die nichts bedeutete. Vielleicht war der Test fehlgeschlagen. So etwas kommt vor, nichts ist perfekt, nicht einmal ein Schwangerschaftstest. Sie setzte sich an den Laptop, der auf dem Esstisch stand, sie gab »Fem-Test« ein. Sie suchte nach Erfahrungsberichten. Der Test hatte nur vier Sterne in der Bewertung, nicht fünf. Es gab Userinnen, die den Fem-Test nicht weiterempfahlen, weil er eine bestehende Schwangerschaft nicht angezeigt hatte. Margot hoffte. Sie hoffte und las weiter. Sie fand aber kein Testergebnis, keinen Erfahrungsbericht, in dem eine angezeigte Schwangerschaft falsch gewesen wäre.
Heinrich schlief unruhig. Die Balkontür war gekippt, draußen nieselte es, eigentlich war es die ideale Nacht für einen guten Schlaf. So wie seine Frau einen hatte. Er hörte ihre tiefen Atemzüge, er sah ihre Umrisse im Dunkeln. Heinrich musste an Margot denken. Obwohl er sonst wenig an sie dachte. Und schon gar nicht in der Nacht. Aber es beunruhigte ihn, was sie gesagt hatte. Was bedeutete es, wenn sie wirklich schwanger war? Und wenn, wer sagte, dass sie es von ihm sei? Er hatte nie daran gedacht, dass es eintreten könnte. Aber egal, auf die paar Euro kam es ihm nicht an. Er würde sie in die Klinik bringen. Langsam wurde sie ihm zur Last. Wenn Frauen schwanger werden, muss man sie entweder heiraten oder die Finger von ihnen lassen, hatte ein Freund einmal gesagt, als er in eine ähnliche Situation geraten war. Die erste Frage stellte sich zum Glück nicht, aber genaugenommen war er nicht einmal verliebt. Margot war praktisch, weil sie Zeit für ihn hatte, immer, wenn er einen Abstecher zwischen Praxis und Familie machen wollte. Heinrich liebte seine Praxis, und noch mehr liebte er seine Familie. Und am allermeisten liebte er sein Kind. Sein einziges Kind. Es konnte kein anderes Kind für ihn geben. Zumindest kein Kind von einer anderen Frau. Er wollte sein Kind aufwachsen sehen, es abends ins Bett bringen und ihm Geschichten vorlesen. Es schüttelte ihn bei dem Gedanken, es könnte ein Kind von ihm auf die Welt kommen, das er nicht in seine Familie integrieren könnte, das sein Gefüge zerstörte. Er hörte den ruhigen tiefen Atem seiner Frau. Sie schlief fest, sie würde es nicht merken, wenn er aufstand. Sein Mund war trocken. Leise ging er in das große Bad nebenan, mit der Edelholzverkleidung und den Glasfliesen an den Wänden. Von der Sonnenkollektorenbeleuchtung im Garten fiel Licht durch das große Fenster, er fand sich im Dunkeln zurecht. Aus dem Wandspiegel schaute ihn eine Fratze an. Aber er wusste, das lag nur an der Dunkelheit. Bei dem weichen Licht, das sonst von den Spots über dem Spiegel kam, sah alles anders aus.