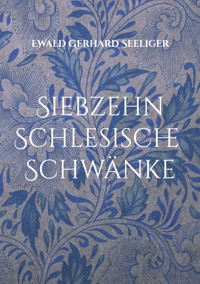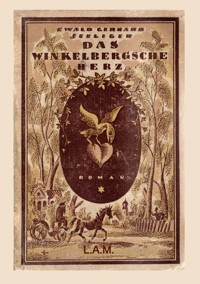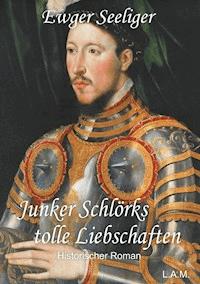Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Schlesien
- Sprache: Deutsch
Zwischen Polen und Böheimb Anschaulich und lebendig beschreibt Ewald Gerhard Seeliger die Geschichte seines Heimatlandes Schlesien vom 1370 bis 1806. Er lässt uns teilhaben an menschlichen Schicksalen, die kein Geschichtsbuch erwähnt, und er lässt Personen und Persönlichkeiten auferstehen, die ihre Zeit mitbestimmten oder Opfer ihrer Zeit waren. Hervorragend recherchiert und dokumentiert erleben wir die Geschichte Schlesiens neu: Der Zweikampf im Brunnen (1370) Der Fall von Wedrau (1430) Warum Görlitz brennen musste (1450) Der babylonische Wolf (1453) Hans Rintfleisch (1459) Der Polak in Glogau (1492) Die Schweidnitzer Pölerei (1522) Als Goldberg in Latium lag (1536) Die Hochzeit der Äbtissin (1610) Wie Adam Wenzel katholisch wurde (1613) Peter und Maria (1631) Die beiden Pappenheimer (1633) Hans Ulrich von Schaffgotsch (1635) Der Hexenrichter (1667) Quirinus Kuhlmann der Prophet (1689) Der Dichters Johann Christian Günther (1723) Der letzte Schwenckfelder (1734) Die Soldatenbeichte (1757) Der Staatsrock des Geheimrats (1793) Graf Pücklers Ende (1806)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1370 bis 1806
Ewald Gerhard Hartmann (Ewger) Seeliger
geboren am 11. Oktober 1877 in Schlesien, zu Rathau, Kreis Brieg, gestorben 8. Juni 1959 in Cham/Oberpfalz, zählte zu den erfolgreichsten Schriftstellern des 20. Jahrhunderts. Zu seinen bekanntesten Werken gehören u. a. „Peter Voß der Millionendieb“ und „Das Handbuch des Schwindels“.
Seine schlesische Heimat beschreibt er in „Siebzehn schlesische Schwänke“, „Schlesien, ein Buch Balladen“, „Schlesische Historien“ und in vielen anderen Romanen.
Zwischen
Polen und Böheimb
Zwanzig Historien
von
Ewald Gerhard Hartmann Seeliger
1911
bearbeitet und herausgegeben von
L. Alexander Metz
Inhaltsverzeichnis
Der Zweikampf im Brunnen
Der Fall von Wedrau
Warum Görlitz brennen musste
Der babylonische Wolf
Hans Rintfleisch
Der Polak in Glogau
Die Schweidnitzer Pölerei
Als Goldberg in Latium lag
Die Hochzeit der Äbtissin
Wie Adam Wenzel katholisch wurde
Peter und Maria
Die beiden Pappenheimer
Hans Ulrich von Schaffgotsch
Der Hexenrichter
Quirinus Kuhlmann, der Prophet
Die zwölf Abschiede des Dichters Johann Christian Günther
Der letzte Schwenckfelder
Die Soldatenbeichte
Der Staatsrock des Geheimrats Werner
Graf Pücklers Ende
Der Zweikampf im Brunnen
1370
Michel, der brave, war vor sieben Jahren in die Dienste des Kaisers Karl IV. getreten, hatte Rom erobern helfen, ließ sich, weil keine Aussicht auf einen neuen Krieg war, in Magdeburg seinen Sold auszahlen und machte sich nach seiner Heimat Schlesien auf. Der Schaft seines Spießes war sein Wanderstab und an der Hüfte trug er das kurze Schwert.
Bis ins Wendenland kam er ohne Gefahr. Als er aber über die Neiße setzte, musste er sich dreier Buschklepper erwehren, die nach seinem Beutel trachteten. Und da er sieben Jahre gekämpft hatte und sieben Narben unter seinem Lederwams trug, schlug er so herzhaft drein, dass die drei Wenden froh waren, mit dem Leben davonzukommen.
Und Michel wanderte weiter. Je näher er der Heimat, dem kleinen Dörfchen Konradswaldau beim Zobtenberge kam, umso heftiger schlug ihm das Gewissen. Denn er war vor sieben Jahren seiner Ehefrau Jadwiga davongelaufen, weil ihm das Leben unter des Kaisers Fahnen angenehmer dünkte als der junge Ehestand. Er hatte mit Jadwiga nicht ins Reine kommen können, denn sie war und blieb eine Polin. Trotzdem ihm die Ältesten des Dorfes dringend abgeraten hatten, war er damals doch seinem dicken Kopfe gefolgt und hatte sich die Jadwiga aus Schidlagwitz geholt, weil sie ein glattes Gesicht hatte und wie keine andere zu schmeicheln verstand. Kaum aber saß sie im warmen Nest, wurde sie trotzig und faul, und das bisschen Schönheit war bald verflogen. Darum hatte er sie ohne Abschied verlassen und war ein Kriegsmann geworden.
Vielleicht ist sie in den sieben Jahren umgänglicher geworden, dachte er und schritt rüstig weiter.
Schon winkte ihm der blaue Zobtenberg. Am späten Nachmittag erreichte er die letzte Erdwelle und blieb bei dem alten, blühenden Hanbuttenstrauch stehen. Das Dorf, das im tiefsten Frieden zu seinen Füßen ruhte, hatte sich nicht verändert. Nur ein paar Strohdächer waren frisch geflickt worden. Gleich am Anfang der Straße lag sein Häuschen. Hinter dem niedrigen Dache ragte der schräge Baum des Ziehbrunnens in die Höhe. Diesen Brunnen hatte Michel selbst gegraben und die tiefe Röhre mit derben Steinen geräumig ausgemauert. Und er sah von ferne, wie sich der schräge Brunnenbaum senkte, und freute sich, dass das Werk seiner Hände in den sieben Jahren nicht verfallen war.
Aber sein Fuß zögerte noch immer. Hier oben auf der Höhe hatte er ein kleines Feldstück zu eigen. Er fand es bald wieder und sah einen Mann darauf arbeiten. Schnell trat er näher und erkannte seinen Nachbar Wenzeslaus, dessen breiter Mund in den sieben Jahren nicht schmäler und dessen struppiges Haar nicht gehorsamer geworden war. Er war ein tschechischer Eindringling und bei den Deutschen, die das Dorf gegründet hatten, nicht wohl gelitten.
„Gelobt sei Jesus Christus!“, rief ihn Michel an.
„In Ewigkeit, Amen!“, erwiderte Wenzeslaus und schielte argwöhnisch an dem Fremdling empor.
„So kennst du mich nimmer, Nachbar Wenzeslaus?“, fragte Michel verwundert. „Ich bin Michel, der vor sieben Jahren mit dem Kaiser in den Krieg zog.“
Jetzt riss Wenzeslaus seinen breiten Mund auf, recht wie ein Scheunentor, ließ den Spaten fallen und glotzte daher, als stände das siebenköpfige Tier aus der Apokalypse vor ihm.
„Das ist brav von dir, dass du dich des Meinigen annimmst“, fuhr Michel fort. „So du einmal in den Krieg ziehst, will ich dir Gleiches mit Gleichem vergelten.“
Da machte Wenzeslaus auf der Stelle kehrt und lief ins Dorf hinunter, als sei ihm die ganze Hölle auf den Fersen.
Michel schaute ihm kopfschüttelnd nach, hob den Spaten auf, schulterte ihn und stieg hinab. Mit festen Tritten schritt er über seinen Hof und stieß die Tür seines Häuschens auf. Aber von Jadwiga wurde ihm kein freundlicher Empfang zuteil.
„Was wollt ihr?“, grimmte sie ihn an, als sei er ein Fremdling.
„Ich bin hier daheim!“, sprach er ruhig und setzte sich hinter den Tisch. „Sieben Jahre bin ich mit dem Kaiser durch die Länder gezogen. Nun aber ist der Friede aufgerichtet.“
„Jetzt kommst du heim!“, schrie sie erbost und ließ die Maske fallen. „Sieben Jahre hast du dich herumgetrieben und dich nicht um das Deine gekümmert. Und nun willst du mir auf der Tasche liegen und weiter faulenzen?“
„Bist in den sieben Jahren nicht gerade zahmer geworden!“, lachte er und stellte auf den Tisch einen von Talern straffen Beutel, dass er klirrte. „Tummle dich, ich habe Hunger! Und lade mir den Nachbarn Wenzeslaus zu Gaste!“
Da wurde Jadwiga bleich wie der Kalk an der Wand. „Wenzeslaus?“, stotterte sie. „Ich soll Wenzeslaus laden?“
„Er ist ein braver Nachbar!“, nickte Michel treuherzig und legte sein Schwert ab. „Ich fand ihn auf meinem Felde arbeiten. So er dir aber beigestanden hat in den sieben mageren Jahren, warum soll ich ihn nicht ehren, da nun die sieben fetten beginnen! Bringe aber zuvörderst einen Krug Bier, denn ich habe von der langen Wanderung einen grausamen Durst bekommen!“
Nun eilte sie mit hastigen Sprüngen in den Keller und brachte das Bier. Dann aber lief sie zum Nachbarn Wenzeslaus und hielt mit ihm hinter dem Hause heimlich Zwiesprache, worauf sie leichteren Mutes das Mahl richtete und den Krug von neuem füllte.
Michel aber freute sich, dass er wieder in seinen vier Pfählen saß, und trank nach Herzenslust, bis sich Wenzeslaus scheu in die Tür drückte.
„Nur herein, Nachbar!“, rief Michel froh gelaunt. „Und tu mir Bescheid.“
Wenzeslaus setzte sich ihm gegenüber, aber das Bier wollte ihm nicht munden. Unauffällig schielte er nach Jadwiga, die hin und her ging und Brot, Schinken, Käse und scharfen Rettich auftischte.
„Hast dich wohl erschrocken, Nachbar“, fragte Michel fröhlich, „als ich so plötzlich vor dir stand? Meintest wohl, ich würde überhaupt nicht wiederkommen?“
Wenzeslaus sagte kein Wort, nickte zuweilen oder schüttelte den eckigen Schädel, ganz wie es die Rede heischte. Mit tief geducktem Nacken saß er da und würgte mühsam das Bier hinunter.
Als sich Jadwiga endlich an den Tisch setzte, begann Michel von seinen Kriegszügen zu erzählen und geriet, da ihm das Bier die Zunge löste, alsobald ins Prahlen. Tapfer hieb er dabei in den Schinken ein, und Jadwiga füllte ihm unablässig den Krug.
„Sieben Jahre ist eine gar lange Zeit!“, rief er und trank in langen Zügen. „Sie sind mir dahingegangen wie im Fluge. Nun aber habe ich genug von der Welt gesehen und will daheimbleiben und wie ein rechter Bauersmann mein Feld bestellen. He, Jadwiga, was sagst du dazu? Brauchst fürderhin nicht mehr als Witib zu hausen.“
„Meinethalben hättest du siebenzig Jahre wegbleiben können!“, zischte sie böse und streifte den Nachbarn mit einem kurzen Blick.
„Ei“, lachte Michel laut, „so muss ich dich zähmen, bis du deine Wildheit lässt. Wird ein fröhliches Tanzen werden hier im Hause. Ich hab im Land Italia gelernt, wie man die stürmischen Weiber kirrt.“
Dabei aß und trank er und war guten Mutes. Er sah auch nicht, dass Jadwiga mit dem Nachbarn ein heimliches Einverständnis hatte, merkte nicht, dass sie sich unter dem Tisch anstießen, und blieb beim Trinken und beim Prahlen.
So hielt er es bis tief in die Nacht hinein. Jadwiga steckte, ohne zu murren, einen Kienspan an dem anderen an.
Plötzlich, kurz bevor es dämmerte, sprach sie: „Gehe und holte mir einen Eimer Wasser!“
Wenzeslaus erhob sich sofort, als sei er gewöhnt, den Befehlen zu gehorchen.
„Bleibe!“, herrschte sie ihn an. „Michel mag zum Brunnen gehen, so er überhaupt noch gehen kann.“
„Nur Gemach!“, lachte Michel, erhob sich und ging ohne Wanken zur Tür. „Wenn es sein muss, schöpfe ich dir noch dem ganzen Brunnen leer.“
Aufrecht schritt er zum Brunnen hinaus, der in einer Ecke des Gartens gegraben war. Aber er merkte nicht, dass ihm Wenzeslaus auf den Zehen nachschlich. Weit beugte sich Michel über den niedrigen Brunnenzaun. Aus der schwarzen Tiefe grüßte ein Stern. Er verschwand sofort, als Michel mit kräftiger Faust den Eimer hinabstieß. Glucksend füllte er sich mit dem kalten, klaren Nass. Weiter beugte sich Michel über die Brüstung, um die Last heraufzuholen. Da sprang Wenzeslaus lautlos heran und stieß ihn hinunter.
Michel stürzte, fasste aber im Fallen den Eimer, riss ihn mit hinab und behielt so den Kopf über Wasser. Sofort verflog sein Rausch. Seine Gedanken wurden klar. Er gab sich selbst die Schuld an dem Unfall. Denn in seiner Trunkenheit hatte er von Wenzeslaus‘ Stoß nichts gespürt. Er hatte sich wohl zu weit übergebeugt und war so aus dem Gleichgewicht gekommen. Also tastete er mit den Füßen nach dem Quellstein und fand den Grund. Vom Himmel sah er nur ein kleines, rundes Loch, in dem ein heller Stern stand.
Wozu sollte er erst um Hilfe rufen? Jadwiga und der Nachbar würden doch bald kommen, um ihn herauszuziehen. Das kalte Wasser reichte ihm bis ans Kinn, der halb gefüllte Eimer hing ihm dicht vor der Nase.
So wartete er geduldig und lauschte. Doch es blieb alles still. Da verlor er allmählich die Geduld und schöpfte Argwohn. Schon griff er nach der langen Eimerstange, um sich daran hinaufzuschwingen, doch ließ er sie eilends wieder fahren. Schleichende Schritte kamen näher, und plötzlich verschwand der glänzende Stern. Wenzeslaus und Jadwiga streckten ihre Köpfe über die Brüstung. Michel hielt den Atem an und hörte deutlich ihr Flüstern.
„Er bewegt sich noch“, sprach Jadwiga, „du musst hinabsteigen und ihm den Rest geben.“
„Da hinunter?“, fragte Wenzeslaus ängstlich und kratzte sich hinter dem weit abstehenden Ohrlappen.
„Ist das deine Liebe zu mir?“, fuhr sie ihn an.
„Ja, ich will es tun“, gab er klein bei. „Aber ich kann ihn nicht mit den Händen erwürgen. Denn er ist stärker als ich.“
Da lief sie und holte Michels kurzes Schwert.
„Hier hast du sein Schwert!“, drängte sie ihn. „Du fährst im Eimer hinab und schlägst ihn tot. Dann ziehen wir ihn heraus und verscharren ihn hinten im Garten. Und morgen erzählen wir den Leuten, dass er wieder davongewandert sei.“
Darauf zog sie den Eimer vorsichtig empor.
Komme nur erst herunter, dachte Michel in der Tiefe und straffte seine Muskeln.
Mit innerem Widerstreben bestieg Wenzeslaus das schwankende Gefährt, hielt sich mit der Linken an der Zugstange fest und fasste mit der Rechten das Schwert, bereit zum Zuschlagen. Jadwiga ließ ihn langsam hinunter. Mit luchsenden Blicken suchte Wenzeslaus das Dunkel des Brunnens zu durchdringen. Da war Michelskopf! Immer näher kam er ihm. Als der Eimer den Wasserspiegel berührte, schlug Wenzeslaus zu und zielte gut. Aber er traf ins Wasser. Michel hatte seinen Kopf nach der einzigen Seite, die ihm blieb, nämlich nach unten, vor dem wuchtigen Streich in Sicherheit gebracht. Schon aber tauchte er wieder empor, riss den Eimer herunter und zerrte Wenzeslaus am dichten Haarbusch unter das Wasser. Der ließ das Schwert fahren und setzte sich mit den Fäusten zur Wehr. Aber Michels rechte Hand hielt ihn eisern fest, während er mit der Linken nach seines Gegners Gurgel tastete. Doch er griff daneben. Wenzeslaus schlug ihm alle seine Zähne tief in die Hand. Trotz des rasenden Schmerzes gab Michel ihn nicht frei und ließ ihn nicht wieder an die Luft. Und er fühlte deutlich das Nachlassen des Bisses, wie Wenzeslaus allmählich von Kräften und vom Leben kam. Und es ward stille in der Tiefe des Brunnens.
„Ist er tot?“, fragte Jadwiga leise von oben.
„Er rührt sich nicht mehr!“, erwiderte Michel mit verstellter Stimme, bedeckte sich mit Wenzeslaus‘ Kappe, die auf dem Wasser schwamm, und bestieg den Eimer.
„Zieh an!“, befahl er kurz.
Und Jadwiga gehorchte. Langsam weitete sich für Michel das runde Loch, und der Himmel wuchs, bis er den Brunnenrand greifen konnte. Mit einem Satz war er wieder auf dem Boden. Als ihn Jadwiga erkannte, fiel sie vor ihm nieder. Der Angstschrei erstickte ihr in der Kehle.
„Ich bin ohne Schuld!“, stöhnte sie und wand sich winselnd zu seinen Füßen.
„Es ist keiner da, der dich Lügen strafen kann“, sprach Michel ruhig. „Steige hinab und hole mein Schwert herauf.“
Da sie sich sträubte, setzte er sie mit Gewalt in den Eimer. Sie wagte nicht zu schreien. Und schon fuhr sie hinab in die Tiefe. Hinein musste sie in das kalte Wasser, wo ihr treuer Nachbar schwamm und kein Glied mehr rührte.
„Ich kann das Schwert nicht finden!“, keuchte sie voller Angst und Grauen.
„Fühle danach mit den Füßen!“, befahl Michel von oben. „Es muss auf dem Grund liegen. Und wenn du es fühlst, so tauche danach.“
Und wiederum gehorchte sie ihm und suchte, bis sie es gefunden hatte.
„Ich habe das Schwert in der Hand!“, sprach sie zitternd.
„Lege es in den Eimer!“, gebot er ihr.
Sie gehorchte, und er zog es herauf und gürtete es an seine Hüfte.
Nun verzog er sich eine Weile, bis die Sonne heraufkam, und ging ins Dorf hinab, die Ältesten zu rufen. Und sie kamen gar bald, als sie hörten, was geschehen war, traten an den Brunnenrand und sahen hinunter. Hinter ihnen drängte sich das übrige Volk.
Michel aber hob an zu sprechen: „Ich bin sieben Jahre mit dem Kaiser gezogen und habe ihm Kriegsdienste geleistet. In diesen sieben Jahren hat Wenzeslaus, mein Nachbar, an meinem Tische gegessen und in meinem Bette geschlafen.“
„Wir wissen es!“, sprachen die Ältesten betrübt. „Warum nahmst du ein Weib, das nicht deines Volkes ist?“
„Darum auch klage ich niemand an“, fuhr Michel fort, „weil ich darin nicht ohne Schuld bin. Als ich aber gestern heimkam, stieß mich Wenzeslaus in den Brunnen und kam danach im Eimer herabgefahren, um mich zu erschlagen.“
„Bist du eines Zeugen sicher?“, fragten die Ältesten.
„Jadwiga wird es bezeugen!“, rief Michel in den Brunnen hinab.
„Ich zeuge, dass er die Wahrheit spricht!“, wimmerte Jadwiga, der vor Frost und Todesfurcht die Zähne klapperten.
Und das Volk verwunderte sich darüber, dass sie im Brunnen saß und wider Wenzeslaus zeugte.
„Was soll mit Wenzeslaus geschehen?“, fragte der Älteste.
„Er soll des Todes sterben!“, erwiderten die Ältesten wie aus einem Munde.
„Lege Wenzeslaus in den Eimer!“, befahl Michel und stieß die Brunnenstange hinunter.
Stöhnend machte sich Jadwiga ans Werk, und Michel zog nach einer kleinen Weile den Toten herauf. Das nasse Haar klebte ihm im Gesicht und zwischen den bleckenden Zähnen stand ihm die blau geschwollene Zunge.
„Er soll auf den Schindanger geworfen werden, dass ihn die Raben fressen!“, geboten die Ältesten.
Und er wurde ohne Verzug auf einer Pflugschleife an seinen Ort gebracht.
„Was aber soll mit der geschehen, die ihn dazu angestiftet hat?“, fragte Michel unerbittlich weiter.
„Wer ist es, den du dessen beschuldigst?“, fragte der Älteste.
„Jadwiga, die im Brunnen sitzt“, erwiderte Michel.
„Bist du auch eines Zeugen sicher?“, forschte der Älteste.
„Jadwiga wird es selbst bekennen!“, rief Michel drohend in den Brunnen hinab.
„Ich bekenne, dass er die Wahrheit spricht!“, kam es von unten wie ein erstickter Todesschrei.
„Man soll sie steinigen!“, entschieden die Ältesten, nachdem sie sich leise miteinander besprochen hatten.
Darauf ging ein jeder der Ältesten und holte einen Stein herbei, so schwer er ihn tragen konnte. Und einer nach dem andern warf seinen Stein in den Brunnen hinab. Das Volk aber tat gleich also und fuhr damit fort, bis der Brunnen bis obenhin gefüllt war. Dann ging ein jeglicher still nach Hause.
Michel aber begann am nächsten Morgen in der entgegengesetzten Ecke seines Gartens einen neuen Brunnen zu graben.
Der Fall von Wedrau
1430
Schon dreimal waren die Hussiten verwüstend durch Schlesien gezogen, als sich Kutlibozy von Skutsch, der Sohn einer Magd, den die Woge des Kriegsglücks emporgehoben hatte, im Hummelschlosse bei Reinerz festsetzte. Hier bewachte er mit seinen wilden Taboriten den Grenzpass nach Glatz und hielt ihn offen für weitere Einfälle. Seine zuchtlosen und beutegierigen Banden schweiften durch das ganze schlesische Gebirge, ohne dass sich ihnen jemand entgegengestellt hätte. Denn auf dem ganzen schlesischen Volke lastete der hussitische Schrecken wie ein Bann. Viele adlige Herren paktierten heimlich mit dem Feind, um sich das Ihrige zu erhalten. Einige sogar, wie der Herzog von Oppeln, bekannten sich offen zu der Ketzerei und mehrten in diesen grenzenlosen Zeiten ihr Gut nach Kräften.
Die meisten aber trugen auf beiden Schultern, seufzten unter der schweren Last und stellten die Rettung dem Herrgott anheim. Der aber schien seine frommen Schlesier ganz und gar vergessen zu haben.
So einer von den Kleinmütigen war auch Herrmann von Zettritz, der auf dem Fürstenstein saß. Weißhaarig, und vorzeitig von der Mühsal der allgemeinen Landesnot gebeugt, war er nicht mehr rüstig genug, das Schwert zu schwingen. Seine verschüchterten Knechte und Bauern entliefen, wenn der Feind kam, in die Wälder, anstatt sich zur Wehr zu setzen. Auch von den benachbarten Städten war keinerlei Hilfe zu erwarten. Sie verrammelten die Tore und begnügten sich damit, hinter den Mauern zu trotzen, wenn die böhmischen Heerhaufen mit Rossen und Wagenbüchsen herangezogen kamen.
So stand ihnen das flache Land überall offen. Heerend und sengend verderbten sie es und berannten die festen Burgen, raubten sie aus und zerbrachen sie, wenn sie es nicht geratener fanden, sich darin einzurichten. Denn wie Kutlibozy auf dem Hummelschlosse, so saßen Peter Pollack von Wolfina in Nimptsch und Jan Kolda von Zampach nebst Plichta von Zierotin auf dem Zobten.
Zwischen diesen drei Burgen lag der Fürstenstein am steilen Grunde des rauschenden Leisebachs, wo Hermann von Zettritz jeden Morgen und Abend betete, dass ihn der Herr in Gnaden vor dem bösen Feind bewahren möge. Näherte sich seiner Burg ein Haufe plündernder Böhmen, so ging er ihnen entgegen und begann zu unterhandeln. Immer gelang es seiner geschickten Rede, denn er war des Tschechischen mächtig, und seiner Bereitwilligkeit, die Brandschatzung zu erlegen, die Gefahr von seinem Haupte abzuwenden. Darüber schwand der Inhalt seiner Schatzkammer zusehends dahin. Mit Sorge gedachte er des Tages, wo er nichts mehr zu geben haben würde, und zitterte schon jetzt für seine Tochter Gudula, die trotz aller Bitten bei ihm ausharrte und nicht von ihm weichen wollte.
Nur wenn die beiden jungen Herren von Reibnitz, zwei Vettern, die in Wedrau an der Straße zwischen Bolkenhain und Jauer in einer festen Doppelburg verträglich nebeneinander hausten, zum Fürstenstein geritten kamen, vermochte Hermann von Zettritz wieder ein wenig Mut zu fassen. Denn das waren zwei kernige, wehrhafte Gesellen, die keine Furcht kannten. Wohlfahrt von Reibnitz, der jüngere von beiden, wusste sich stattlich zu tragen und hatte ein feines, höfisches Benehmen. Auch überragte er seinen Vetter Kunz um Haupteslänge. Der nämlich war etwas mehr in die Breite gewachsen, trug einen braunen, staubigen Bart und war von raueren Sitten. Seine Rede war derb, auch liebte er den Sport und stellte am Zechtisch seinen Mann, während der schlankere Wohlfahrt mehr für den Minnedienst geschaffen war.
Und doch kamen die beiden nur wegen Gudula von Zettritz nach Fürstenstein geritten. Es wollte aber keiner dem anderen vorgreifen, so sehr liebten und ehrten sie sich, und darum ließen sie einstweilen das Freien in der Schwebe. Gudula fühlte sich zu beiden gleichmäßig hingezogen, denn auch unter Kunzens gröberer Schale hatte sie längst das gute Herz und das treue Gemüt derer von Reibnitz entdeckt.
Auch Herrmann von Zettritz tat nichts, die Entscheidung herbeizuführen, da ihm jeder der beiden Vettern als Eidam gleich willkommen war.
Da meldete sich eines Tages Kutlibozy von Skutsch vom Hummelschlosse an und folgte dem Boten mit seiner stattlichen Leibwache von zwanzig Mann auf dem Fuße. Wie es einem so kriegsgewaltigen Nachbarn geziemte, wurde er in allen Ehren empfangen. Und schon streckte er seine raue Faust nach dem letzten Kleinod des Fürstenstein aus. Als er am anderen Tag schied, ließ er keinen Zweifel darüber aufkommen, dass er bald wiederkehren würde, um Gudula als seine Braut zu begehren.
Denn Kutlibozy von Skutsch hatte gar hochfliegende Pläne. Um den hussitischen Glauben war es ihm längst nicht mehr zu tun. Sein Streben ging vielmehr darauf, sich im Glatzer Gebirge eine Herrschaft zu erkämpfen. Und vornehmlich, um sich bei dem schlesischen Adel einen festen Rückhalt zu verschaffen, trachtete er danach, der Eidam des Fürstensteiners zu werden.
Der aber schickte in seiner Herzensangst einen schnellen Boten nach Wedrau hinüber.
„Wir müssen ihm zuvorkommen!“, rief Wohlfahrt und gab Befehl, seinen Rappen zu satteln.
„Willst du mir zuvorkommen?“, sprach Kunz ernst.
Da wurde Wohlfahrt bleich und schwieg.
„Wohl an!“, fuhr Kunz fort und kämpfte schwer mit sich. „Wir wollen um sie reiten. Wer zuerst auf dem Fürstenstein ist, der mag um sie werben.“
Dann ging er in seine Burg hinüber, die hinter der seines Vetters lag, und ließ sich den lahmen Schimmel satteln. Zusammen ritten sie aus dem hohen Tor, das sich zwischen den beiden Burgen wölbte. Wohlfarth sah nur das lockende Ziel in der Ferne und merkte nicht, dass Kunz auf dem Schimmel saß, gab seinem feurigen Rappen die Sporen und sauste davon.
Aber Kunz hatte die Rechnung ohne den Ehrgeiz des Schimmels gemacht. Kaum sah er den Rappen davonfliegen, stürmte er mit langen Sätzen nach und blieb dicht hinter ihm. Erst in Freiburg, wo es schärfer bergauf ging, gab er das Rennen auf. Kunz stieg ab und zog das treue Tier hinter sich her. Als er auf dem Fürstenstein eintraf, fand er Hermann von Zettritz mit dem jungen Paare bereits am Tische sitzen.
„Gott zum Gruße, Jungfrau Gudula!“, rief Kunz frohgelaunt, obschon ihm das Herz blutete. „Bedankt Euch bei meinem Schimmel, dass Ihr den feinen und nicht den groben Reibnitz bekommen habt.“
„Ei, lieber Herr Kunz“, sprach Gudula errötend, „so Ihr mir darum nicht böse seid, freue ich mich doppelt. Ihr sollt mir dafür ein Freund und Bruder sein und bleiben immerdar.“
„Du bist auf dem Schimmel geritten?“, rief Wohlfarth, trat auf den Vetter zu und breitete seine Arme aus. „Herzbruder, das will ich dir nimmer vergessen!“
„Bleib mir vom Halse!“, knurrte ihn Kunz an und flüchtete hinter den Weinkrug. „Umarme deine Braut und nicht deinen Vetter! Bedanke dich bei ihr, dass ich dir überhaupt noch das Leben lasse!“
„Auf dem Schimmel!“, sprach Wohlfahrt leise und ließ die Arme sinken. „Ich hätte es nicht über mich gebracht.“
„Jetzt reitest du auf dem Schimmel herum!“, lachte Kunz und ergriff seinen Becher „Krieche herunter und steige in die Kanne!“
Aber trotz Kunzens Bemühungen, der sich den Schmerz mit Scherzen vom Halse schaffen wollte, kam keine rechte Fröhlichkeit auf. Durch Gudulas plötzliche Brautschaft waren Herrmann von Zittritzens Sorgen ins Riesenhafte gewachsen. Und da er zu schwach war, den geraden Weg zu gehen, sann er auf einen krummen.
„Was wird nun geschehen?“, fragte er bekümmert.
„Wenn der Tscheche wieder kommt“, erwiderte Kunz kurz und bündig, „dann lasst Euch höflich empfehlen und heißt ihn wieder davonziehen.“
„Er wird es mich büßen lassen!“
„So kommt mit nach Wedrau hinüber!“, schlug Wohlfarth vor. „Unsere Häuser sind fest und mit allem wohl versehen. Auch sind unsere Knechte und Bauern im Waffenwerk geübt und von erprobter Treue.“
Aber Hermann von Zettritz weigerte sich standhaft, die Burg seiner Väter zu verlassen.
„Ich bleibe bei dir!“, rief Gudula entschlossen und trat an seine Seite.
„Das leid ich nicht, mein liebes Schwesterlein!“, entgegnete Kunz. „Hier ist keine Sicherheit für dich. So du hierbleibst, wird der böse Tscheche den Fürstenstein berennen und dich entführen. In Wedrau aber bist du sicher wie das Kindlein in einer Wiege. Solange ich lebe, wird kein Hussit den Saum deines Gewandes berühren. Um deinen Vater sorge dich nicht. Wenn er auch nicht mehr die Zähne des Wolfes hat, so ist ihm doch die List des Fuchses eigen.“
„Was hilft die List, wenn die Truhen leer sind?“, meinte Hermann von Zettritz betrübt.
„Ich will sie Euch wieder füllen“, rief Wohlfarth schnell. „Der Edelstein, den ich Euch nehme, soll Euch schon morgen tausendfach aufgewogen werden.“
„Fein stille und folgsam sein, Schwesterlein Gudula!“, mahnte Kunz die Widerstrebende. „Der Vater ist sicher ohne dich, und du bist sicher ohne ihn. Lass sie nur kommen, die Ketzer! An unseren Mauern sollen sie sich die Schädel einrennen. Und steht uns der Herr nicht bei, sind wir um einen Ausweg nicht verlegen. Ein heimlicher Gang führt von meinem Keller weit unter der Erde dahin, bis in den Wald auf dem halben Wege nach Jauer.“
Das leuchtete Gudula ein, und sie entschloss sich, ihrem Bräutigam nach Wedrau zu folgen.
„Was aber wird aus mir?“, rief Hermann von Zettritz ängstlich.
„Ei, so muss sich auch für Euch denken!“, rief Kunz wohlgemut. „Klopfet der Tscheche bei Euch an, so vermeldet ihm mit Bedauern, dass Euer Töchterlein wegen der unsicheren Zeiten zu Euern Verwandten ins Preußenland gereist ist.“
„So habt Ihr sie meinethalben hinweggebracht, wird der Tolle sagen!“, warf Herrmann von Zettritz bekümmerten Herzens ein. „Und wird es mich umso ärger büßen lassen.“
„Also bleibt nichts übrig, als die holde Jungfrau stracks zu entführen!“, entschied Kunz und hatte gar schnell einen gar feinen Plan gesponnen, der schließlich auch Herrmann von Zittritzens Beifall fand.
Kunz ritt am Nachmittag nach Freiburg hinab und kam gegen Abend mit einem verkleideten Kaplan zurück. Der gab das Brautpaar in der Schlosskapelle heimlich zusammen. Gegen Mitternacht, als Herrmann von Zettritz schon schlief, tat sich das Seitenpförtchen der Burg auf, und es traten vier vermummte Gestalten heraus, die auf raschen Pferden der Ebene zustrebten. Einer blieb hinter ihnen zurück; das war der treue Kunz, der den Schimmel ritt.
Schon am nächsten Morgen sandte Wohlfarth von Reibnitz nach dem Fürstenstein eine Truhe mit harten Talern. Nun atmete Herrmann von Zettritz, der sein Kind in guter Hut wusste, wieder etwas auf.
Nach kaum zwei Wochen erschien Kutlibozy von Skutsch, mit fürstlichem Schmuck und Gepräng umgeben, zum zweiten Male auf dem Fürstenstein, wurde von Herrmann von Zettritz mit einem Steigbügeltrunk empfangen und an eine festliche Tafel geleitet. Er aß und trank und sah sich suchend um.
„Wo bleibt Euer Töchterlein?“, fragte er endlich.
„Ach, liebster Nachbar!“, begann Hermann von Zettritz zu jammern. „Ich sitze allhier vergnügt bei Euch und sollte doch trauern in Sack und Asche. Gudula, mein ungeratenes Kind, ist auf und davon!“
„Ihr scherzet wohl?“, sprach Kutlibozy von Skutsch, und das Blut stieg ihm brandrot ins Gesicht.
„Und ist doch bitterlicher Ernst!“, stöhnte Hermann von Zettritz weiter. „Zwei lose Buben haben sie betört, dass sie alle meine Bitten in den Wind schlug. Und eines Morgens war das Nest leer. Sie hat sich entführen lassen und ist längst über alle blauen Berge.“
Keuchend schaute der Tscheche auf seinen Gastgeber. Die Nachricht war zu sonderbar. Da aber fuhr sich Herrmann von Zettritz über beide Augen, als könnte er sich der Tränen nicht länger enthalten, und setzte mit zitternder Stimme hinzu: „O Kindesdank! Welcher Vater darauf harret, der ist genarrt sein ganzes Leben. Und ich habe das Mägdlein gehegt und gepflegt wie eine kostbare Blume. Nun sitze ich hier in der Einsamkeit. Sagt an, lieber Nachbar, wie habe ich solches verdient um sie?“
Da sprang Kutlibozy von Skutsch von seinem Sitz und stampfte zornig den krummen Säbel auf den Estrich.
„Wo sind diese Buben?“, schrie er, dass es durch die ganze Burg hallte.
„Das weiß nur Gott allein!“, fuhr Herrmann von Zettritz fort. „Sie sind gekommen bei Nacht und Nebel und waren vor dem Morgengrauen davon.“
„Und Ihr habt keine Nachricht von Eurer Tochter?“
„Nichts!“, heuchelte Hermann von Zettritz und sank gebrochen in den Lehnstuhl. „Nicht eine Zeile. Das ist ja eben, was mich so über alle Maßen traurig macht!“
„Verzaget nicht!“, tröstete ihn Kutlibozy von Skutsch und hob den blanken Säbel zum Schwur in die Höhe. „Ich will nicht eher ruhen, bis ich die beiden Buben gefunden habe. Und ich werde sie finden und sollten sie bis ans Nordmeer geritten sein. Mit ihrem Blute sollen sie es büßen, was sie an mir und an Euch verbrochen haben!“
Auf der Stelle sandte er sechs von seinen Leuten als Kundschafter aus, nahm von Herrmann von Zettritz Abschied und zog mit den anderen Begleitern nach dem Hummelschlosse zurück.
Wie Spürhunde nahmen die sechs Hussiten die Fährte auf, fanden sich hinter Freiburg wieder, und schon am dritten Tage hatten sich zwei von ihnen bis Wedrau herangepirscht. Hier trafen sie in der Herberge den krummen Müllerlump aus Neiße, dessen Gesicht einmal des Teufels Tanzplatz gewesen und der von einer solchen Verworfenheit war, dass er seine eigene Mutter um einen Heller verraten hätte. Er war Wohlfarth von Reibnitz zugelaufen und diente ihm, indem er das Handgeld mit den beiden Hussiten verprasste. Und von ihm erfuhren sie, wo Gudula von Zettritz war. Sie gaben ihm Geld und versprachen ihm noch mehr, wenn er ihnen bei der Berennung der Burg behilflich sein wolle. Und das sagte er ihnen mit Freuden zu.
Dann eilten sie, Kutlibozy die Meldung zu bringen. Der brach sofort mit seinen zuchtlosen Banden und sechs Büchsenwagen auf, fuhr wie ein Hagelschlag quer über das Gebirge und fiel zuerst den Fürstenstein an. Herrmann von Zettritz verteidigte sich nicht, da es doch keinen Zweck gehabt hätte, konnte sich von dem Verdacht, den Kutlibozy gegen ihn hegte, nicht reinigen und wurde davongeführt, jedoch mit Schonung behandelt.
Nun ergoss sich der wütende Schwarm in die fruchtbare Ebene hinein. Das Landvolk verließ die Dörfer und brachte sich hinter die Mauern von Schweidnitz und Striegau in Sicherheit. Kutlibozy nahm sich kaum Zeit, die verödeten Dörfer anzustecken, und eilte auf Wedrau zu.
Dort war man zu seinem Empfang aufs Beste gerüstet. Rund um die beiden Burgen, die auf einer Anhöhe lagen und mit trotzigen Mauern und eichenen Pfahlzäunen umgürtet waren, führte ein breiter, tiefer Wallgraben. Über die Mauern hoben Büchsen und Schlangen ihre runden Mäuler, reisiges Volk wies Schwert, Lanze, Streitaxt und Morgenstern und auf den Brüstungen standen Tonnen von Pech und Öl, um die Stürmenden mit Feuer zu begrüßen.
Kutlibozy stutzte und sandte einen Unterhändler, der die Herausgabe von Gudula heischte. Doch Kunz von Reibnitz schickte ihn mit einem großen, verdeckten Zinnkelch zurück. Als Kutlibozy von diesem den Hussiten heiligsten Gefäß den Deckel hob, musste er sich schleunigst abwenden, so deutlich war die darin enthaltene Antwort.
Wutentbrannt ließ er die sechs Büchsen auffahren und beschoss die Burgen von allen Seiten Tag und Nacht ohne Unterlass. Zugleich wurde das Wasser des Wallgrabens abgeleitet und mit Faschinen ein Übergang gebaut.
Am dritten Tage hatten die weittragenden böhmischen Büchsen eine klaffende Bresche geschossen. Nun begannen die Hussiten Sturm zu laufen. Allein sie wurden jedes Mal mit blutigen Köpfen zurückgeworfen. Wer nicht wich, dem sprang das flammende Pech auf den Hals, dass er jämmerlich ersticken und verbrennen musste.
Da aber kam der krumme Müllerlump aus Neiße den Hussiten zu Hilfe. Er warf ein brennendes Ölfass um, dass das Feuer wie ein wehender Purpurmantel über die eichenen Pfähle floss und sie entzündete. Darauf sprang der Verräter durch die Bresche zu den Feinden über.
Die Verteidiger mussten sich mit allen Kräften gegen die wachsende Feuersbrunst wenden. Doch alles Mühen war vergeblich. Der frische Wind warf die Flamme ins Gebälk der Häuser.
„In die Keller hinunter!“, befahl Kunz von Reibnitz.
Die wenigsten hörten auf ihn. Viele Knechte und Bauern flüchteten aus den brennenden Burgen, warfen die Waffen weg, um sich dem Feinde auf Gnade und Ungnade zu ergeben, und wurden allesamt niedergemacht.
Dreißig Bauern aber stiegen in den Keller der vorderen Burg und waren entschlossen, sich bis auf den letzten Blutstropfen zu verteidigen. Im Keller der hinteren Burg, aus dem der unterirdische Gang ins Freie führte, saßen sechzehn Bauern. Mitten unter ihnen stand der Pfarrer und bereitete sie auf einen christlichen Tod vor. Als Kunz, der aus drei leichten Wunden blutete, mit Wohlfarth und Gudula unter sie trat, lagen sie auf den Knien und beteten.
„Folgt mir!“, gebot Kunz und wies auf den Gang, der schwarz im Hintergrunde gähnte. Doch die sechzehn gedachten an das jämmerliche Schicksal ihrer Brüder und blieben vor ihrem Herrgott liegen.
„Geht voran!“, sprach Kunz und drückte Gudula eine Fackel in der Hand.
Wohlfahrt umschlang sie fest und führte sie rasch davon. Kunz, der treue, deckte ihnen den Rücken. Fest gewölbt war der Gang. Allmählich verengte er sich so sehr, dass eins hinter dem andern gehen musste. Wohlfahrt nahm Gudula die Fackel ab und schritt mit gezücktem Degen voraus. Kunz folgte ihr auf dem Fuße und horchte scharf hinterwärts. Doch nur der dumpfe Ton ihrer eigenen Fußtritte und das klingende Fallen der Wassertropfen, die zahlreich von den Wänden fielen, störten die tiefe Stille. Endlich erreichten sie eine aufwärtsführende Wendeltreppe.
„Lasst mich voran!“, flüsterte Kunz und drängte sich vor.
An der letzten Biegung der gewundenen Treppe dämmerte ein blasser Lichtstrahl. Vorsichtig schob sich Kunz empor; der Ausgang der rettenden Röhre war nicht besetzt. Sie mündete in einem hohlen Eichbaum, in dessen Stamm eine niedrige, türähnliche Öffnung klaffte, durch die man nur tief gebückt schreiten konnte. Dicht davor gähnte ein steiler, mit Gestrüpp bewachsener Abhang.
„Schließt die Augen!“, sprach Kunz, der auf dem schmalen Steige hielt, und reichte Gudula die Hand, also dass sie ohne Schwanken ins Freie kam. „Nun eilt und schaut nicht zurück! Bis Jauer ist‘s ein gutes Stündlein.“
„Du willst nicht mitkommen?“, rief Wohlfarth.
„Zwei entkommen leichter als drei“, erwiderte Kunz und stellte sich mit bloßem Schwert neben die Treppenöffnung. „So Gott will, finden sie den Gang nicht, und ich bin am Abend bei euch.“
Darauf schieden sie voneinander.
Unterdessen hatten die Flammen die beiden Burgen erobert. Das Gebälk krachte unter ihrer Wucht zusammen, die Glut sank und erstickte an ihrem eigenen Dampf. Nun wagten sich die Hussiten in die rauchenden Trümmer, um Beute zu machen und die Keller auszuräumen. Die dreißig Bauern im vorderen Keller wehrten sich wie die Verzweifelten, bis sie erdrückt, erstickt und niedergemetzelt waren. Der krumme Müllerlump führte die Hussiten in den zweiten Keller, wo sie sich auf die sechzehn Bauern warfen und nicht einen am Leben ließen. Den Pfarrer zog man hinter einem Fasse hervor.
„Pfaff!“, schrie Kutlibozy von Skutsch wütend. „So du weißt, wo Gudula ist, wird man dir nur den Kopf abschlagen. Weißt du es nicht, wird man dich langsam über dem Feuer rösten!“
Da entschlüpfte es dem Pfarrer in seiner Todesangst, dass die beiden Burgherren mit der Herrin in dem finsteren Kellerloch verschwunden seien.
„Hei, nun haben wir sie!“, schrie der Verräter aus Neiße. „Und ich will euch führen.“
Schon stürmte er, mit einer Fackel bewehrt, in den Gang hinein. Kutlibozy von Skutsch und die zwanzig Leibtrabanten hängten sich an seine Fersen. Die anderen Hussiten blieben zurück, marterten den Pfarrer langsam zu Tode und plünderten die Erschlagenen.
Kunz aber wachte mit bloßem Schwert. Fast eine Stunde stand er vor dem Türschlitz der Eiche und horchte. Doch es regte sich nichts. Das setzte er sein Schwert ab und schaute nach Jauer hinüber, dessen Türme fern über den Wald emporragten.
Schon wollte er sein Schwert an der Hüfte bergen, als sich von drinnen der dumpfe Hall eiliger Schritte meldete. Er hob sein Schwert, und sausend ließ er es fallen, als der krumme Müllerlump seine Fratze herausstreckte. In weitem Bogen sprang sein Kopf den Abhang hinunter und spießte sich mit dem rechten Auge an einem spitzen, langen Schlehdorn auf. Der Körper sank vornüber und rollte dumpf aufschlagend nach.
„Bist du draußen?“, ließ sich eine keuchende Stimme von drinnen her vernehmen.
„Nur heran!“, rief Kunz und schlug zum zweiten Male zu.
Kutlibozys Kopf mit den hochfliegenden Plänen rollte wie eine Kegelkugel durch die Lattichblätter und kam in einer Pfütze zur Ruhe. Kopflos schoss sein Körper nach vorn und stürzte dem Kopfe nach.
Fast jeder der neunzehn Leibtrabanten, die ihrem Hauptmann auf dem Fuße folgten, fragte von drinnen her, ob der Gang zu Ende sei, und Kunz antwortete einem jeden für seinen kopflosen Vordermann, den er soeben in die Tiefe gefördert hatte. Zwanzigmal schlug er so aus allen Kräften zu, bis ihm der einundzwanzigste Streich missglückte. Der vorletzte Hussit zog den Kopf mit einer breiten Streifwunde zurück und wandte sich rückwärts. Kunz verfolgte ihn, stach ihn nieder, stürmte über die Leiche hinweg und suchte den letzten Feind zu erreichen, der durch den Gang in den Keller zurückraste. Hier geriet Kunz an den Feind, musste aber bald vor der Übermacht zurückweichen und strebte, fortwährend kämpfend und rückwärts schreitend, wieder dem Ausgang zu.
Allein die Hussiten hatten inzwischen ihren toten Hauptmann gefunden, die hohle Eiche entdeckt und drangen nun racheschnaubend von draußen ein.
So wurde Kunz mitten in dem unterirdischen Gange von beiden Seiten angefallen und niedergehauen.
In der Verwirrung, die währenddessen im hussitischen Lager herrschte, gelang es Herrmann von Zettritz zu entweichen und nach Jauer zu entfliehen, wo er mit Gudula und Wohlfarth von Reibnitz blieb, bis die Glocken den Frieden über das gepeinigte Land hinsangen.
Wohlfarth von Reibnitz aber kehrte mit Gudula nach Wedrau zurück und baute die Burg seiner Väter wieder auf.
In den letzten Jahren des Krieges hatten noch zwei andere hussitische Bandenführer versucht, sich in Schlesien festzusetzen und ein Reich zu gründen, so Korybut in Gleiwitz und Puchala in Kreuzburg. Aber es war ihnen ebenso wenig gelungen wie dem Kutlibozy von Skutsch, und keiner von ihnen fand ein so rühmliches und ritterliches Ende wieder treue Kunz von Reibnitz.
Warum Görlitz brennen musste
1450
Nach den Hussitenkriegen lebte in Thomaswaldau bei Bunzlau ein reicher Bauer namens Jakob Fechner. Er war ein fleißiger und frommer Mann, der sich mit seinen Nachbarn vertrug, seine Wirtschaft in Ordnung hielt, Würfeln und Wein abhold war und seinen einzigen Sohn Gottfried in christlicher Zucht und Vermahnung aufzog. Der glich, als er erst herangewachsen war, in allen Stücken dem Vater, nur dass er ein noch besserer Haushalter zu werden versprach. Eifriger als der Vater war er hinter den Gulden und Talern her, obschon er darüber sein Herz nicht verhärtete, sondern jedem Armen sein Scherflein gab. Nur sich selbst gönnte er nichts, war unermüdlich bei der Arbeit und ehrte seinen Vater, der in allem sein Vorbild blieb.
Das wurde plötzlich anders, als sich die alte Bäuerin hinlegte, um nicht wieder aufzustehen. Jakob Fechner begrub sie, trauerte drei Tage und ging über Land. Als er nach etlichen Tagen heimkehrte, war seine Tasche leer und sein Kopf schwer vom Trunk. Und über ein kleines war er wiederum verschwunden. In den Schenken lag er herum, verstreute sein Gut mit schlechten Gesellen und schwang den Knobelbecher und die Spielkarten, als hätte er von Kindesbeinen an nichts Anderes getan.
Gottfried ließ den Vater eine Zeit lang gewähren, schaffte in Hof und Feld für zwei und vermochte doch nicht den Rückgang der Wirtschaft aufzuhalten. Was der Sohn einbrachte, führte der Vater doppelt und dreifach auf und von dannen. Kam er nach Hause, so blieb er auf einem Fleck sitzen, stierte trübselig vor sich hin, rührte weder Speise noch Trank an und lief plötzlich wieder fort.
„Vater!“, bat ihn Gottfried eines Tages. „Wie könnet Ihr also tun und das Gut verderben? So Ihr weiterhin dabei bleibet, werden wir in Schulden geraten.“
Da begann der Vater zu wehklagen und den bösen Geist seines Geschlechtes zu verfluchen, der in ihm saß und ihn verführte, und Gottfried fasste bei diesen Worten wieder einige Hoffnung.
Am nächsten Morgen aber hatte der Vater alles vergessen, denn der Geist hatte wieder Gewalt über ihn gewonnen, und heischte von seinem Sohne mit harten Worten Geld.
„Ich habe keines!“, sprach Gottfried.
„Du lügst!“, schrie ihn der Vater an.
„Ich lüge nicht!“, erwiderte der Sohn. „Ich habe Euch alles, was ich hatte, schon vordem gegeben. Und nun habe ich nichts mehr.“
Darauf lief der Vater schnurstracks auf die Weide, führte die beste Kuh davon, verkaufte sie in Bunzlau und brachte am vierten Tage nur den Strick heim.
„Vater!“, rief Gottfried traurig. „Warum habt Ihr das getan, dass Ihr mich der besten Milchkuh beraubet?“
„Es ist nicht deine Kuh!“, begehrte der Vater auf. „Alles ist mein, was auf dem Hofe ist. Und mit dem Meinen kann ich machen, was ich will. Da hat mir keiner einzureden, auch du nicht!“
„Wohl ist alles Euer, was hier auf dem Hofe ist“, erwiderte Gottfried, „und der Herr behüte mich, dass ich Euch etwas abdringen wolle. So Ihr aber auf diesem Leben weiter beharrt, wird Euch bald nichts mehr auf dem Hofe gehören. Wenn ich nicht mit meiner Arbeit die Wirtschaft zusammenhielte, hätten wir längst den Bettelstab in die Hand nehmen müssen.“
„Deine Arbeit ist für die Katz!“, schrie der Vater erbost. „Du bist alt genug. Warum beweibst du dich nicht? Eine Bäuerin gehört auf den Hof. Suche dir eine Jungfer, aber eine mit Geld, dann brauche ich meine Kühe nicht zu verkaufen.“
Als gehorsamer Sohn ging Gottfried daran, sich eine Bäuerin zu suchen. Doch die reichen Mädchen wollten alle nichts von ihm wissen. Endlich fand er Debora Seidel, die es mit ihm trotz seines Vaters wagen wollte. Sie war die Tochter eines armen Häuslers und brachte außer ihrer Redlichkeit und ihrem treuen Fleiße nicht viel mehr mit, als sie auf dem Leibe trug.
Und Gottfried sagte es kurz vor der Hochzeit dem Vater an.
„Was? Die Debora!“, polterte er los. „Die Seidel Debora? Sie hat nichts. Das könnte mir grade passen.“
„Ich hab auch nichts!“, wies ihn Gottfried zurück.
So stritten sie wohl eine Stunde, und es fielen von beiden Seiten harte Worte. Der Vater beharrte auf seinem Trotz, und der Sohn wollte nicht nachgeben.
„Tu, was du willst!“, schrie endlich der Alte. „Ich tue auch, was ich will.“
Und stracks lief er auf die Weide und führte die zweitbeste Kuh davon.
Gottfried aber schlich ihm nach und schnitt ihm heimlich den Strick durch, also dass die Kuh stehen blieb und von selbst in die Hürde zurücklief. Der Alte merkte erst kurz vor Bunzlau, dass ihm der Strick ledig in der Hand hing und die Kuh verschwunden war. Er vermeinte nicht anders, als dass sie ihm unterwegs gestohlen worden sei, und getraute sich darum nicht gleich heim.
Inzwischen hielten Gottfried und Debora Hochzeit. Der alte Bauer aber streifte durch die Dörfer in der Runde und erschien erst am achten Tage wieder auf dem Hofe. Debora, die junge Bäuerin, empfing ihn mit kräftigen Scheltworten. Die hatte er wohl verdient. Und er duckte sich, denn sie fuhr überaus scharf mit ihm daher. Ein paar Wochen hielt er sich in seiner Stube, bis er eines Tages die Kuh fand, die ihm vom Strick abgeschnitten worden war. Listig erspähte er einen günstigen Augenblick, schlang eine Kette um ihre Hörner und wollte sie aus dem Hofe führen. Allein Debora hatte ihre Augen überall und erhob sofort ein großes Geschrei. Schon kam Gottfried herbeigesprungen, fasste die Kette und hielt die Kuh fest.
Der Vater begann zu toben, als sei er von Sinnen. Und Debora blieb nicht stille.
„Die Kuh ist mein!“, schrie der alte Bauer. „Mir gehört der ganze Hof. Ich kann mit dem Meinigen tun, was ich will.“
Da sah Gottfried, dass er kein Recht hatte, dem Vater die Kuh vorzuenthalten, und ließ die Hand von ihr.
„Die schöne Kuh, die schöne Kuh!“, jammerte Debora. „Ich geb die schöne Kuh nicht her!“
„Lass ihn!“, tröstete sich Gottfried. „Wenn er wieder kommt, muss er uns die Wirtschaft übergeben, oder wir werfen ihm die ganze Arbeit vor die Füße.“
Jakob Fechner aber zog mit der Kuh nach Bunzlau davon und lachte grinsend.
„Die schöne Kuh!“, schluchzte die Bäuerin. „Die beste Milchkuh im ganzen Dorfe. Die jagt er jetzt auch durch die Gurgel!“
Gottfried beruhigte sie, so gut er konnte.
„Du hättest es nicht leiden sollen!“, rief sie und trocknete ihre Tränen. „Du bist sein Sohn. Du wirst ihn doch zwingen können!“
„Kann ich meinen eigenen Vater zwingen?“, erwiderte er betrübt. „Aber gib dich zufrieden, diese Kuh ist das letzte Stück, das er wegbringt.“
Diesmal blieb Jakob Fechner noch länger fort. Völlig verwahrlost und an Leib und Seele gebrochen, kehrte er drei Tage nach Pfingsten heim. Heftiglich klagte er über sein schlechtes Leben, von dem er nicht lassen zu können vermeinte, und fand sich endlich dazu bereit, den Hof gegen einen jährlichen Zins und ein gutes Ausgedinge an Gottfried zu verkaufen. Und Debora drang darauf und gab nicht eher Ruhe, bis dieser Kauf gebrieft und gesiegelt war.
Denn schon am anderen Tage packte den Alten die Reue. Aber es half ihm nun nichts mehr. Er musste in das kleine Auszugshaus auf der anderen Seite des Hofes übersiedeln und fraß Groll und Ärger in sich hinein.
Debora ließ es ihm an nichts fehlen. Nur mit den Talern hielt sie ihn knapp. Das Bier dagegen maß sie ihm sehr reichlich zu. Doch das Trinken in seinem Stübchen behagte ihm nicht lange. Er sehnte sich nach seinen Zechgenossen und Knobelbrüdern. Doch die ließ Debora mit keinem Schritt auf den Hof.
Wohl lief der Alte zuweilen fort, doch da er kein Geld hatte, kam er bald wieder. Dann tobte er in seinem Stübchen, als sei er vom Satan besessen, und stieß schreckliche Drohungen und Verwünschungen aus.
Debora hatte einen schweren Stand mit ihm, denn Gottfried ging dem Vater geflissentlich aus dem Wege, schaffte von morgens bis abends und brachte die Wirtschaft zusehends in die Höhe. So verlief das erste Jahr in ziemlicher Ruhe.
Um die Osterzeit schenkte Debora ihrem Manne einen Knaben, der in der Taufe den Namen Christian erhielt. Er gedieh zu seiner Eltern Freude. Nur Jakob Fechner wollte sich nicht mit ihm befreunden. Darüber kränkte sich die junge Mutter und suchte den Alten zu gewinnen, indem sie ihm einen neuen Tuchrock schenkte. Und sofort ging er hin und verkaufte ihn für ein paar Groschen, die er vertrank.
Als Deborah diese Schändlichkeit erfuhr, war ihre Geduld zu Ende. Mit Gottfrieds Einwilligung hielt sie den nächsten Erbzins zurück, gab dem Alten aber Essen und Trinken reichlich wie zuvor, so dass er keine Not litt.
Nun schien er zur Besinnung kommen zu wollen. Er war, als wenn der böse Geist, der mit dem Tode seines Weibes in ihn gefahren war, allmählich an Kraft verlöre. Er begann sogar, hin und wieder einen Handgriff zu tun, ohne dass man mit ihm zu schelten brauchte. Auch dem kleinen Christian, der schon hurtig auf dem Hofe herumlief, schien er weniger gram zu sein. Wer aber dem Alten recht in die tiefliegenden, flackernden Augen sah, der wusste, dass der böse Geist immer noch in ihm wohnte und nur auf eine günstige Gelegenheit harrte, aufs Neue hervorzubrechen.
Und die Gelegenheit kam schnell genug. Gottfried hatte sich in den drei Jahren, da ihm der Hof gehörte, so in die Höhe gearbeitet, dass er sich zwei Pferde kaufen konnte. Sie waren sein stolz, und er hielt sie in einer weiten Hürde neben den Kühen.
Und eines Morgens, noch vor Sonnenaufgang, nahm der alte Bauer eines von den Pferden, schwang sich darauf und ritt schnurstracks davon.
Aber er wurde gesehen, und man sagte es Gottfried an.
„Reit ihm nach!“, rief Debora. „Schnell, reit ihm nach und hol ihn zurück!“
Aber Gottfried überwand sich, obschon ihm der Verlust des Pferdes sehr naheging.
„Lass ihn!“, sprach er traurig. „Er ist nicht bei Sinnen. Und ich kann das Pferd verschmerzen.“
„Du kannst es verschmerzen!“, rief sie zornig, „dieweil es dir nicht gehört. Wie aber willst du es vor dem verantworten, dem der Hof zu Erb und Eigen ist, so er es einmal von dir fordert?“
Dabei wies sie auf ihren dreijährigen Knaben, der vor ihnen stand verwundert auf den Streit schaute.
Gottfried schwankte.
„Hast du nicht schwer darunter gelitten“, fuhr sie eifriger fort, „dass dein Vater das Deine verstreut hat? Denn wer dies tut, der ist nicht wert, dass er Kinder hat. Und so du duldest, dass man deinem Kinde sein Erbteil verkürzt, wie willst du über deinen Vater den Stab brechen!“
„Du hast recht!“, sprach Gottfried stöhnend. „Ich will ihn zurückholen.“
Und er schwang sich auf das andere Pferd und sprengte dem Vater nach. Die Leute auf den Feldern wiesen ihm den Weg. So kam er am Nachmittag nach Görlitz und ritt sofort auf den Rossmarkt. Hier fand er das Pferd, das ihn der Vater entführt hatte, in den Händen eines Händlers.
„Ich hab es gekauft um fünfzig Gulden!“, sprach er ruhig. „Gebt sechzig und es ist Euer.“
„Es ist auch ohne sechzig Gulden mein!“, antwortete Gottfried. „Denn es ist mir heute Morgen von der Weide genommen worden.“
„Das kann jeder sagen“, meinte der Händler mit Gleichmut.
„So Ihr mir nicht glaubet“, erwiderte Gottfried, „so kommt mit vor die Schöffen.“
Also gingen die beiden zum Rathaus, banden das Pferd an einen Ring neben der Pforte und traten in die Schöffenstube, wo sie ihren Streitfall vorbrachten.
Die Görlitzer Schöffen aber suchten damals ihren Ruhm darin, dass sie ihre Gerichte rein und scharf hielten. Sie hörten die beiden Parteien mit Gelassenheit an.
Darauf sprach Gregor Selige, der Schöffenobmann, zu dem Pferdehändler: „Hole den Mann herbei, von dem du das Pferd gekauft hast.“
„So ich ihn aber nicht mehr finde?“, gab der Händler zur Antwort.
„Dann wird man an dir tun, was Rechtens ist.“
„So er mir aber nicht folgen will?“
„Dies mag deine eigene Sorge sein“, belehrte ihn der Obmann und sandte seinen Ratsdiener vor die Pforte, das Pferd in Verwahrung zu nehmen.
Nun machte sich der Pferdehändler eiligst davon, während Gottfried angewiesen wurde, ein wenig auf die Seite zu treten. Er hörte aufmerksam zu, wie andere Sachen verhandelt und geschlichtet wurden. Die Schöffen suchten und fanden das Recht schnell und ohne zu irren, und war es auch noch so tief versteckt. Ihre Sprüche waren gerecht, aber weit entfernt von jeder Milde. Darum auch waren die Görlitzer Schöffensprüche weit über die Grenzen des Landes berühmt, und gar viele Städte und Herren kamen, um sich an dieser Stelle in schwierigen Fällen Rats zu holen.
Unterdessen fand der Pferdehändler den Mann, von dem er das Tier gekauft hatte, in einer Herberge und lockte ihn durch das Versprechen, ihm einen besseren Trunk zu bieten, auf das Rathaus. Wie Gottfried seine Augen aufhob, sah er seinen Vater vor sich, und erschrak.
„Hast du diesem Händler das Pferd verkauft, das jener Mann als das seinige erkennt?“, fragte Gregor Selige, der Obmann.
„Ich habe ihm heute ein Pferd verkauft um fünfzig Gulden!“, bestätigte der alte Bauer kopfnickend.
„Jener Mann aber sagt, dieses Pferd sei ihm heute Morgen in der Frühe von der Weide genommen worden. Hast du dieses getan?“
„Dieses habe ich auch getan!“, sprach Jakob Fechner, ohne Schlimmes zu ahnen. „Er ist mein Sohn.“
Hier machte der Obmann eine Pause und schaute sich die acht Schöffen an. Und sie wussten, was er wollte, und nickten ihm zu.
„So bist du ein Pferdedieb und sollst es mit dem Strange büßen!“, fällte er das harte Urteil.
Jakob Fechner stand, als hätte ihn der Schlag gerührt. Es wollte ihm nicht in den Kopf, dass er sein Leben verwirkt hatte. Er begriff gar nicht, wessen man ihn beschuldigte. Und er stand, öffnete den greisen Mund und schwieg.
„Ach, edle Herren!“, rief da Gottfried. „Nehmt es nicht so strenge mit ihm, dieweil er doch mein Vater ist!“
„Wir sprechen das Recht ohne Ansehen der Person!“, erwiderte der Obmann und sandte einen Ratsdiener, den Angstmann zu holen.
„O ihr Herren!“, flehte Gottfried unter Tränen und rang die Hände. „Lasst es dem alten Manne nicht entgelten, denn er wird von einem bösen Geist regiert. Ich will all das Meine dahingegeben, nur bewahrt seine weißen Haare vor dieser Unehre. Lasst Gnade walten, ihr edlen Herren!“
„Gott allein ist gnädig!“, erwiderte Gregor Selige, ohne mit der Wimper zu zucken.
„So nehmet mein Leben dahin!“, schrie Gottfried verzweifelt und fiel vor den harten Richtern auf die Knie. „Lasst mich an seiner Statt sterben. Was kann mir das Leben noch sein, wenn ich meinen eigenen Vater an den Galgen bringe?“
„Das hättest du früher bedenken sollen!“, sprach der unerbittliche Obmann. „Das Recht ist wie eine Kugel, die du von dir wirfst. Ist sie erst einer Hand entflohen, so nimmt sie ihren eigenen Lauf, und du kannst sie nicht mehr zurückholen. Also auch das Recht. Sobald du es durch eine Klage in Bewegung gesetzt hast, muss es den Schuldigen suchen und darf nicht eher stille stehen, bis ihm Genüge geschehen ist. Dir wurde, was du wolltest. Also bescheide dich!“
Gottfried zitterte am ganzen Leibe. Jetzt aber tat der alte Bauer den Mund auf. Er hatte inzwischen erkannt, dass es ihm an den Kragen gehen sollte, stieß zuerst einige undeutliche Laute hervor, darauf kamen abgerissene Worte, und endlich sprudelte ihm die Rede wie ein Strom.
„Ihn sollt Ihr strafen, Ihr Herren, meinen Sohn Gottfried. Er enthält mir das Meinige und zahlt mir den Zins nicht pünktlich. Sein Weib verkürzt mir das Ausgedinge, wo sie nur kann. Ihn sollt ihr strafen am Leib und am Gut, dass er seinen alten Vater so in der Armut sitzen lässt, während er im Reichtum dahinlebt. Darum habe ich ihm das Pferd von der Weide geführt, die doch mir gehörte und die ich ihm geschenkt habe. Bin ich darum ein Dieb? Also gebet mir mein Recht, das mir zukommt!“
„Das soll dir werden!“, sprach Gregor Selige ernst. „Gehe mit diesem da!“
Damit wies er auf den, der eben zur Tür hereingetreten war.
Und als sich Jakob Fechner umwandte, siehe, stand der Angstmann hinter ihm, hatte einen roten Mantel um und trug ein zweihändiges Schwert an der Hüfte. Und er fasste den alten Mann an der Schulter und führte ihn hinaus. Gottfried aber schlug mit einem lauten Schrei zu Boden und rührte sich nicht. Und während zwei Ratsdiener den Bewusstlosen in die Herberge trugen, fuhr der Henker mit Jakob Fechner, dem Pferdedieb, zum Neißer Tor hinaus und knüpfte ihn an das Galgenquerholz, dass er in drei Augenblicken ein toter Mann war. Und viel Volks stand herum und schaute zu.
Als Gottfried am Abend aus seiner Ohnmacht erwachte und hörte, dass sein Vater am Galgen hing, nahm er einen Spaten und ging durch das Neißer Tor hinaus zum Rabenstein. Mit bebenden Fingern durchschnitt er den Strang, trug den Toten zum nächsten Eichenbusch und grub ihm da ein Grab. Es war ein hartes Schaffen, denn die Eichenwurzeln waren fest und zahlreich, und der Tag war schon im Verscheiden.
Bei dieser Arbeit schlug Gottfried mit dem Spaten durch die Luft, als müsste er etwas Zudringliches von sich scheuchen. Denn der böse Geist, der seinen Vater an den Galgen gebracht hatte, schwirrte nun unsichtbar um den Sohn, um sich eine andere Wohnung zu suchen. Wie er sich auch wehrte, schließlich musste er den Spaten weglegen, um den Toten in die Grube zu betten. Und diesen Augenblick ersah sich der böse Geist und fuhr in seine neue Behausung.
Nun schaute er aus Gottfrieds Augen wild und flackernd. Böse Gedanken raunte er ihm zu und zwang ihn, sie auszuführen.
Und er eilte nach der Herberge zurück, nahm um Mitternacht, als alles schlief, einen Feuerbrand vom Herde, blies ihn an, dass er loderte, und schlich auf den Dachboden. Hier fuhr er mit dem Scheit ins Heu, dass es hell aufflammte. Durch eine Luke kletterte er aufs Nachbardach. Auch hier legte er Feuer.
Und der böse Geist trieb ihn an, über die lange Zeile der spitzen Dächer zu springen, und hielt ihn, dass er nicht fiel. Ohne zu schwindeln, lief er die schmalen Wasserrinnen entlang und über die Drachenköpfe, die bei Regenwetter das Wasser auf die Gassen spien. Nun aber waren sie leer und salztrocken.
Er sprang und sprang und kletterte hinauf und hinab und steckte an, wo es nur brennen wollte. Endlich gelangte er mit einem Riesensatz über die Apothekergasse auf das Dach des Rathauses. Hier setzte er sich rittlings auf den scharfen First, schwang das feurige Scheit wie ein Schwert und schrie dazu, dass es über die ganze Stadt gellte.
Und Görlitz brannte wie niemals zuvor. Über die ganze Stadt breitete sich das Flammenmeer. Wie in einem Höllenkessel wogte es zwischen den Stadtmauern, und der Wind rührte in der Brunst herum wie ein zorniger Hexenmeister. Und er rührte und rührte, dass das Feuer über den Rand floss und vieles verzehrte, was noch vor den Toren lag.
Haus um Haus zerkrachte und brach zusammen. Zuletzt stürzte das alte Rathaus ein und riss mit einer riesigen Lohe, die weit hinauf in den Himmel langte, den Brandstifter herunter, dass er zu Staub und Asche verbrannte.
Debora, sein Weib, harrte zu Thomaswaldau vergeblich auf ihn und seinen Vater. Erst nach zehn Tagen wurde ihr kund, dass die beiden nicht mehr heimkehren würden. Um Gottfried trug sie tiefe Trauer ihr ganzes Leben lang und zog seinen Sohn Christian auf in der Furcht und Vermahnung des Herrn. So wurde er ein Seidel und kein Fechner, also dass der böse Geist keine Macht über ihn gewann.
Der babylonische Wolf
1453
Im Jahre 1452, als die beiden frommen Herren Valentin Haunold und Anton Hornig in den Breslauer Rat gekürt wurden, brachte man zu dem alten Rabbi Pinchas, der inmitten der zahlreichen jüdischen Gemeinde auf der Ursulinergasse wohnte, ein achtjähriges Mädchen, das bei der Augsburger Judenvertreibung seine beiden Eltern verloren hatte. Das Mädchen hieß Mirjam und war des Rabbis Enkelkind. Es lebte bei ihm aber schon ein Knabe mit Namen Nathanael. Das war der Sohn seiner Nichte, die mit ihrem Manne vor elf Jahren in Prag ums Leben gekommen war, als man dort die Häuser der Juden geplündert hatte. Nathanael zählte zwölf Jahre, war geweckten Geistes und las fleißig in den heiligen Büchern.
Und Rabbi Pinchas seufzte über die schweren Drangsale, die allerorten über das auserwählte Volk hereinbrachen, und hegte die beiden Kinder, die aneinander hingen wie Bruder und Schwester, mit seinen frommen und getreuen Händen.
Die Hiobsposten, die mit den Handelsbriefen von allen Seiten in die Breslauer Gemeinde kamen, häuften sich von Tag zu Tag. Die deutschen Fürsten und Städte wetteiferten miteinander, den Samen Abrahams zu berauben, zu vertreiben, und zu verderben. Denn der Kaiser war viel zu schwach, um seine Kammerknechte vor diesen Verfolgungen zu schützen.
Zudem goss der Papst Öl in das Feuer. Er sandte als apostolischen Kommissar und Generalinquisitor ketzerischer Verderbtheit den zelotischen Minoritenmönch Johannes Capistranus nach Deutschland und machte es ihm besonders zur Pflicht, die östlichen Ländereien, wo die hussitische Ketzerei und die türkische Schande eingerissen waren, zu bereisen und zu reinigen. So predigte er in Wien, Olmütz und Brünn, in Eger und Leipzig gewaltiglich das Kreuz. Da er aber den Hussiten und den Türken nicht so leicht beikommen konnte, richtete sich sein Eifer zumeist gegen die Juden, als die ältesten und vornehmsten aller Ketzer. Überall, wohin er kam, gründete er Klöster des von ihm geschaffenen Ordens der Bernhardiner, als Hoch- und Zwingburgen gegen die Verderbtheit des Glaubens. In Scharen strömte ihm das Volk zu, lauschte seiner Predigt und bestaunte seine Wundertaten.
Schon lange Zeit bemühten sich die beiden frommen Ratsherren Anton Hornig und Valentin Haunold, den heiligen Mann nach Breslau zu laden. Aber er sagte nicht eher zu, bis ihm der Rat einen geräumigen Platz für eine Kirche und ein Kloster bewilligt hatte.
Das geschah Ende des Sommers des Jahres 1452, und Rabbi Pinchas war der erste der jüdischen Gemeinde der durch einen Brief aus Görlitz davon erfuhr. Und es war am Tage vor dem Versöhnungsfest.
Schwerfällig stieg er am nächsten Morgen die steile Treppe seines schmalen, spitzgegiebelten Häuschens hinunter. Sein weißer Bart, der ihm weit über die Brust herabrann, wankte unter seinen keuchenden Atemzügen. Die Last von siebenzig Jahren lag auf seinem greisen Haupte, und keines dieser Jahre war ohne Not, Angst und Bedrückung dahingegangen. Da fiel sein Blick auf Mirjam und Nathanael, die am Fuße der Treppe miteinander spielten. Sie waren festtägig gewandet und schauten ehrfurchtsvoll zu dem Rabbi empor.
„Hüte sie gut!“, sprach er zu Nathanael, indem er auf Mirjam wies und fuhr ihm mit der zitternden Hand über das krause Haargelock.
Der schlanke Knabe ergriff Mirjam bei der Hand, legte seinen Arm um ihre zarte Gestalt und drückte sie an sich.
„Haltet die Tür gut verschlossen!“, warnte der Rabbi. „Und tut sie nicht eher auf, bis ich zurückkomme.“