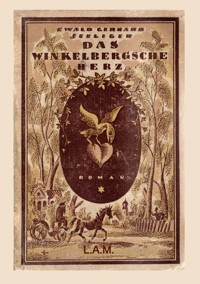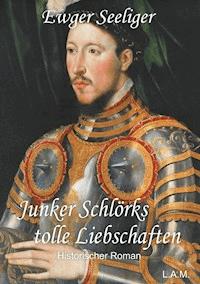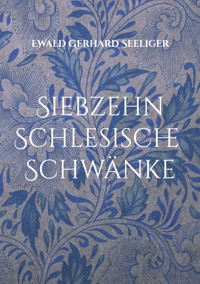
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ewger Seeligers Siebzehn Schlesische Schwänke sind Geschichten vom alten Schlesien und den Schlesiern, die in keinem Geschichtsbuch stehen. Sie erzählen von Helden und Deserteuren, Kavalieren und Jungfrauen, von Gaunern und Schelmen, von Liebe, Lust und Leidenschaft. Von 1275 bis 1813: Die Hahnkrähe (1275) Der Breslauer Bierkrieg (1380) Das Fest der Käthemägde (1520) Die Pfaffenhochzeit zu Görlitz (1524) Die Liegnitzer Geisterei (1525) Frau Ziporas Witwenschaft (1569) Die Braut wider Willen (1579) Wie der tolle Tarnau warb (1594) Friedrich von Logaus erste Liebe (1615) Die kaiserlichen Quartiermacher (1636) Die vierzehn kurbrandenburgischen Nothelfer (1654) Das Schweidnitzer Narrenhäusel (1676) Die Kammerjungfer des Grafen Maltzan (1681) Rübezahl als Laborant (1738) Cäsar Müßigbrot, der Deserteur (1760) Das Quaritzer Gespenst (1763) Wie Großglogau befreit wurde (1813)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ewald Gerhard Hartmann (Ewger) Seeliger
geboren am 11. Oktober 1877 in Schlesien, zu Rathau, Kreis Brieg, gestorben 8. Juni 1959 in Cham/Oberpfalz, zählte zu den erfolgreichsten Schriftstellern des 20. Jahrhunderts.
Zu seinen bekanntesten Werken gehört u. a. „Peter Voß der Millionendieb“. Seine schlesische Heimat beschreibt er in „Siebzehn schlesische Schwänke“, „Schlesien, ein Buch Balladen“, „Schlesische
Historien“ und in vielen Romanen.
Inhaltsverzeichnis
1. Die Hahnkrähe (1275)
2. Der Breslauer Bierkrieg (1380)
3. Das Fest der Käthemägde (1520)
4. Die Pfaffenhochzeit zu Görlitz (1524)
5. Die Liegnitzer Geisterei (1525)
6. Frau Ziporas Witwenschaft (1569)
7. Die Braut wider Willen (1579)
8. Wie der tolle Tamau warb (1594)
9. Friedrich von Logaus erste Liebe (1615)
10. Die kaiserlichen Quartiermacher (1636)
11. Die vierzehn kurbrandenburgischen Nothelfer (1654)
12. Das Schweidnitzer Narrenhäusel (1676)
13. Die Kammerjungfer des Grafen Maltzan (1681)
14. Rübezahl als Laborant (1738)
15. Cäsar Müßigbrot, der Deserteur (1760)
16. Das Quaritzer Gespenst (1763)
17. Wie Großglogau befreit wurde (1813)
Nachwort
1. Die Hahnkrähe (1275)
Von der Hahnkrähe, einer uralten Weichbildsäule, die noch heute am Ende der Friedrich-Wilhelm-Straße steht, erzählten sich die alten, guten Breslauer eine Geschichte, die sowohl ihrer Leichtgläubigkeit als auch ihrer Einbildungskraft alle Ehre macht. Jenes Steinmal, das nichts anderes ist als das Grenzzeichen zwischen der alten polnischen Siedlung Scepine und dem kühn aufstrebenden deutschen Kaufplatz Breslau, soll nämlich ein Rittersmann gestiftet haben zum Andenken an seine wunderbare Errettung aus den Klauen des Satans. Seine junge Gemahlin harrte damals jahrelang auf seine Rückkehr aus dem gelobten Land. Und als sie bestimmte Nachricht von seinem Tode zu haben glaubte, gab sie dem Drängen ihrer Familie nach und willigte ein, einem anderen Manne die Hand zu reichen. Das aber erfuhr der Ritter durch den Satan, der schon lange nach dieser frommen Seele Gelüsten trug, und er bot ihm an, ihn durch die Luft in einer Nacht nach seiner Heimat zurückzuführen. Dafür aber musste ihm der Ritter seine Seele verpfänden. Sofort hub ein Fliegen an, dass ihm Hören und Sehen verging. Als sie aber in der Morgendämmerung über Breslau waren, krähte der Hahn, die Nacht war vorbei, und mit einem fürchterlichen Fluch ließ der Satan den Ritter zur Erde fallen, genau an der Stelle, wo die Hahnkrähe steht. Die Hochzeit wurde vereitelt, die holde Gemahlin fiel dem Totgeglaubten um den Hals, der Nebenbuhler drückte sich in das Dunkel, aus dem er aufgetaucht war, und die Hölle war wieder einmal gründlich betrogen.
Nun aber hat sich nach den neueren historischen Forschungen diese Geschichte ganz anders abgespielt, durchaus nicht so heldenhaft und wunderbar, sondern ganz natürlich und überaus vernünftig.
Um die Zeit, als die Kreuzzüge im Sterben lagen und die Mongolen nach der Schlacht von Wahlstatt dem bis auf die Dominsel verbrannten Breslau für immer den Rücken kehrten, zogen zwei frische Knappen Heinrich und Konrad, kurzweg Hinze und Kunze genannt, aus der Maingegend nach Schlesien. Sie hießen nichts ihr Eigen als Rüstung, Gaul und ihre Blutsbruderschaft. In Nürnberg pfändete man ihnen die Gäule, die Rüstung mussten sie in Prag zurücklassen, und so behielten sie nichts anderes als ihre Freundschaft und ihren Durst, mit dem sie endlich im „Letzten Heller“ vor Breslau landeten. Hier hörten sie zum ersten Mal von dem reichen Edelfräulein Pelagia, die in Scepine auf dem Herrenhofe wohnte und irgendeines Freiers harrte. Der Hellerwirt, der den Schalk im Nacken hatte, schilderte sie als ein Muster aller fraulichen Tugenden, so dass die beiden fränkischen Burschen sofort entschlossen waren, den Gang zu wagen. Vorher aber machten sie aus, dass der Auserwählte den Verschmähten niemals im Stich lassen sollte.
Als sie auf den Hof kamen, schauten sie sich schon bedenklich an, denn die polnische Wirtschaft, die dort herrschte, war ihnen etwas Ungewohntes.
„Es soll nicht guttun, Herzbruder“, sprach Hinze, der Bedächtigere, „wenn ein Deutscher eine Polin freit.“
„Quarkspitzen!“, erwiderte Kunze kurz entschlossen. „Wenn sie nur nicht zu hässlich ist.“
Davon überzeugten sie sich denn, als sie kurz darauf vor der Jungfrau Augen traten. Sie war über die erste Jugend hinaus, von fraulicher Fülle, ihre Kleidung war reich, und auch sonst schien es ihr an nichts zu fehlen. Nur um den Mund hatte sie einige scharfe Fältchen, die Hinzes Misstrauen bestärkten. Er stieß seinen Freund heimlich an, um ihn zu ermuntern, denn der war etwas verstört, und plötzlich platzten sie beide gleichzeitig mit ihrem Begehren heraus.
Jungfrau Pelagia musterte beide eingehend und hieß sie am nächsten Morgen wiederkommen. Doch sobald entschied sie sich nicht, ließ sich vielmehr von beiden den Hof machen und prüfte sorglich, wer der für sie der Geeignetste sei. Sie verlangte von ihrem zukünftigen Gemahl vor allen Dingen Unterwürfigkeit und Gehorsam; auch gab sie gar viel auf Frömmigkeit, außerdem war sie von einem niederen Geize besessen, sobald die Kirche nicht in Frage kam. Dieses weltlichen Geizes wegen hatte sich auch bisher keiner an sie herangewagt. Wie sie auch forschte, Hinze und Kunze taten es sich in Dienstbereitschaft und Gehorsam zuvor, dass sogar ihre Eifersucht darüber zu erwachen begann. Da sie aber ihre Freundschaft höher hielten, drangen sie in Pelagia, endlich eine Entscheidung zu treffen. Der aber gefiel es sehr gut, sich von zweien hofieren zu lassen, die beide jung und in gutem Safte waren, so dass sie die Wahl immer wieder hinausschob.
Darum setzten sich die beiden im „Letzten Heller“ hinter einen großen Krug der mit echt Leubuser Gewächs gefüllt war. Eine bessere Sorte wollte der Wirt nicht wagen, dieweil ihm die Aussicht auf die Mitgift noch nicht sicher genug war. Hinze und Kunze tranken bis Mitternacht und wurden nicht einig wer die Jungfrau freien sollte. Jeder überbot den andern durch seinen Edelmut, jeder wollte dem andern den Vortritt lassen, bis sie endlich übereinkamen, den Zufall entscheiden zu lassen. Wer zuerst den Hahn krähen hörte, der sollte der Erwählte sein. So saßen sie bis in die Morgenfrühe, und der Hahn krähte zum ersten Male.
„Ich hab ihn gehört“, rief Hinze freudig.
„Auch ich hab ihn gehört“, schrie Kunze wütend.
Bald wären sie sich darüber in die Haare geraten, doch wieder siegte ihre Freundschaft.
Nun beschlossen sie, einen Gang durch die Stadt zu machen. Wer dabei den ersten Hahn sehen würde, der sollte Jungfrau Pelagia freien dürfen. Und als sie aus dem „Letzten Heller“ traten, ging gerade die Sonne auf und beschien die Weichbildsäule, in deren Krönungsnische das Relief eines krähenden Hahnes ausgemeißelt war.
„Ich sehe einen“, rief Hinze.
Kunze aber sah ihn nicht und musste sich erst von seinem Freund zurechtweisen lassen.
„Das soll ein Hahn sein?“, fragte Kunze verwundert. „Das ist ein steinerner Hahn.“
„Aber es ist ein Hahn!“, entgegnete Hinze, und so musste ihm Kunze wohl oder übel den Vortritt lassen.
Seitdem kam er Hinze bei Jungfrau Pelagia nicht mehr in die Quere, so dass bald darauf die Hochzeit gefeiert werden konnte. Kunze ritt im Hochzeitszuge voraus, leitete ihn nach Breslau in die Magdalen en-kirche und lenkte dann zum „Letzten Heller“ zurück, wo er mit Ungeduld auf das gute Leben wartete, dem er sich mit Hilfe seines nun reich gewordenen Freundes mit ganzer Seele hingeben wollte. Aber für Hinze, den Ehemann, waren die guten Tage für immer vorbei. Seine Ehegemahlin quälte ihn mit ihren unerträglichen Launen und hielt den Daumen so fest auf den Beutel, dass sich auch kein Gröschel herauswagte. Nur wenn einer ihrer zahlreichen Beichtväter erschien, oder die frommen Frauen von Santa Clara ihren Besuch ansagten, dann kamen die Goldgulden in ganzen Rudeln herausgehüpft. Hinzes Taschen aber waren und blieben stets leer, und gar oft kam er in Versuchung, sich bei Kunze ein paar Kupferflecke auszuleihen. Doch er hielt an sich aus Scham und lobte seine Frau über alles, nur um seinen Reinfall zu verschleiern. Dabei machte er Schulden über Schulden für sich und Bruder Kunze, der nichts von all dem Unglück ahnte, bis es dem Hellerwirt zu viel wurde. Er drohte, Frau Pelagia reinen Wem einzuschenken, und Hinze sah keinen anderen Ausweg als die Flucht. Und er baute seinen Plan auf ihre Frömmigkeit.
„Liebste Ehefrau“, sprach er eines Tages und schlug die Augen zum Himmel auf, „mir ist im Traum ein Engel erschienen und hat mir befohlen, alsobald eine Fahrt ins Heilige Land zu tun.“
„So will ich Euch begleiten, lieber Herr“, erwiderte sie, „damit auch ich des Segens teilhaftig werde.“
„Das darf nicht sein“, rief Hinze schnell gefasst, „denn der Engel hat mir auf die Seele gebunden, die Fahrt ganz allein zu vollbringen. Dagegen soll ich an jedem heiligen Ort drei von Euem Goldgulden niederlegen.“
Frau Pelagia traute ihm nicht, machte ein Gesicht wie zwei Tage Hagelwetter und hüllte sich in Schweigen.
Noch dreimal musste der Engel wiederkehren und zuletzt mit den schärfsten Höllenstrafen drohen, ehe sie mit den Goldgulden herausrückte, und es waren deren nicht wenige nötig, denn die Reise sollte über Rom gehen. Er nahm zärtlichen Abschied von seiner holden Gemahlin, aber nicht von seinem Herzbruder Kunze, den vergaß er in seiner Freude, und war froh, als er dem Gaul die Sporen geben konnte. Erst in Prag machte er Rast.
Hier ließ er mehr als drei Gulden davonspringen, erzählte in einer Herberge, wo die Kaufleute einkehrten, dass Herr Hinze aus Scepine unter die Türken geraten und wahrscheinlich des Lebens verlustig gegangen wäre, und zog mit einer jungen, frischen, rotblonden Dime, die ihm besser behagte als Frau Pelagia, in das schöne Land Italia, wo der Wein süßer und feunger floss als der saure Krätzer im „Letzten Heller“.
Dort saß Kunze als Pfandstück für die gemeinsam gemachten Schulden ganz auf dem Trocknen. Er schalt auf Hinze, der ihn so schnöd im Stich gelassen hatte, und der Wirt tat desgleichen. Dann aber fluchten die beiden gegeneinander los.
„Zahlt Ihr nicht auf der Stelle“, schrie der Wirt, „so müsst Ihr in den Turm!“
„Macht Euch mit dem Satan bezahlt!“, trumpfte Kunze auf.
Nun ging der Wirt schnurstracks zu Frau Pelagia und legte ihr die lange Rechnung vor. Aber da geriet er an die Unrechte. Sie zieh ihn der Unredlichkeit und keifte so gefährlich hinter ihm her, dass er froh war, mit heiler Haut davonzukommen. Darauf schloss er mit Kunze einen Pakt, dass er so lange im „Letzten Heller“ Einlager halten solle, bis Hinze aus dem Heiligen Land zurückgekehrt sein würde. Des war Freund Kunze zufrieden, und er vertrug sich mit dem Wirt ein halbes Jahr. Da traf in Breslau die Nachricht ein, dass Herr Hinze unter die Türken geraten und seines Lebens ganz und gar verlustig gegangen sei. Darüber erhob Frau Pelagia einiges Trauern und Wehklagen und tröstete sich bald an den Wohltaten der Kirche. Aber im „Letzten Heller“ rief diese betrübliche Kunde große Bestürzung hervor. In die Haare jedoch gerieten sich Kunze und der Wirt nicht mehr, sie hatten sich inzwischen nach ihrem Durst schätzen gelernt, und der war nicht gering. In stiller Nacht hockten sie beieinander und berieten einen feinen Plan. Kunze sollte sich stracks aufmachen, die Witwe zu trösten und zu versuchen, Hinzes Nachfolger zu werden.
Und es geschah also. Kunze wartete ihr mit geziemender Ehrfurcht jeden Morgen auf und kam allmählich seinem Ziel näher und näher.
Um diese Zeit lag Hinze in einer Herberge zu Ravenna. Frau Pelagias Golddukaten und die rothaarige Dirne waren längst über alle blauen Berge. Sein Kopf brummte wie ein Bienenkorb, denn er trank den schweren Südwein wie den Leubuser Krätzer. Er hatte den letzten Abend zu viel an Frau Pelagia denken müssen, und dann war sein Trunk immer besonders hastig. Nun blieb ihm nichts anderes übrig, als reumütig zu ihr zurückzukehren oder bei Kaiser Friedrich in Neapel Kriegsdienste zu nehmen.
So ruhte er denn auf seinem Lager und schlief wieder ein. Da erschien ihm im Traum ein Engel und erinnerte ihn an sein Versprechen, nach dem gelobten Lande zu ziehen und bei jedem heiligen Orte drei Golddukaten niederzulegen.
„Ach du heiliger Engel", stöhnte der arme Hinze, und die Schweißtropfen rannen ihm über die geschlossenen Augenlider, „das Gelübde tat ich aus Not."
Da wurde der Engel zornig und verschwand. Hinze erwachte, zitternd vor Fieber, und schlief wieder ein.
Nun erschien ihn im Traum der Satan und erbot sich, ihn in einer Nacht zu Frau Pelagia zurückzubringen, wenn er ihm dafür seine unsterbliche Seele verschriebe.
„Hebe dich hinweg von mir, Satan!", rief Hinze entsetzt.
Doch der Böse wich nicht vom Fleck und tat ihm weiter kund, dass Frau Pelagia im Begriff stände, zum zweiten Mal in den Stand der heiligen Ehe zu treten, und zwar mit seinem Blutsbruder Kunze.
Darob ergrimmte Hinze über die Maßen, dass er seinen leeren Weinkrug gegen den Verführer schleuderte, der fluchend und stinkend davonfuhr. Hinze erwachte wiederum, sah das Gefäß an der Wand in Stücke gehen, und sein Schädel dröhnte ihm jetzt wie ein Hornissennest. Nun erst kam ihm zum Bewusstsein, wie schnöde er an seinem Freund gehandelt hatte. Unverzüglich machte er sich mit Hinterlassung der Zeche nach Norden auf, schlug sich recht und schlecht durch und eilte nach Kräften, auf dass er nicht zu spät käme. Unerkannt traf er an einem späten Sommerabend im „Letzten Heller" em. Kunze saß mit dem Wirt hinter dem größten Krug, und sie stießen immer wieder auf das gute Gelingen des neuen Ehebundes an. Denn schon für morgen war die Hochzeit gerichtet.
„Kunze“, rief Freund Hinze und trat an den Tisch in den schwachen Lichtkreis der Lampe, „kennst du mich nicht? Lass ab von deinem Vorhaben, du rennest ins Verderben. Ich bin Hinze, dein Freund und Bruder!“
„Du bist mein Freund Hinze nicht“, sprach Kunze mit schwerer Zunge, nachdem er den Fremdling gemustert hatte, und stieß die leere Kanne auf den Tisch. „Mein Freund Hinze ist tot. Und wärst du auch der, für den du dich ausgibst, so wärst du doch tot für mich, denn du hast mich verraten und schnöde verlassen!“
Da begann Hinze sich zu verfluchen und zu verwünschen und beschwor seinen guten Freund Kunze um Jesu und aller Heiligen willen, von der Hochzeit abzustehen, berichtete haarklein von den teuflischen Launen der Aus erwählten, von ihrem Geiz und ihrer Herrschsucht, von ihrer echten Falschheit und ihrer unechten Frömmigkeit, dass Kunze das Blut zu Kopf stieg und er mit Hilfe des Wirtes den unverschämten Lügner kurzerhand zum Hause hinauswarf.
Traurig irrte Hinze umher, bis er zur Hahnkrähe kam. Und da er kein Obdach hatte, und die Nacht mild und warm war, legte er sich zu Füßen des steinernen Hahnes, dem er sein Unglück zu verdanken hatte, ins hohe Gras und schlief, von der beschwerlichen Reise übermüdet, bis an den hellen Tag.
Eine fröhliche Musik von Zinken, Trompeten und Pauken weckte ihn. Es war der Hochzeitsreigen, mit dem das Brautpaar nach Breslau zur Trauung zog. Jetzt wollte Hinze den letzten Versuch wagen. Er sprang aus seinem Versteck hervor und fiel den beiden Pferden in die Zügel.
„Haltet ein!“, rief er mit lauter Stimme. „Ich bin Hinze und lebe und bin nicht tot!“
„Das kann jeder sagen“, meinte Frau Pelagia hochmütig, nachdem sie ihn flüchtig gemustert hatte, gab ihrem Zelter die Gerte, dass er stieg, und ritt weiter.
Kunze aber, der inzwischen nüchtern geworden war, hielt seinen Gaul an und besah sich den Fremdling genauer.
„Du gibst vor, mein Freund Hinze zu sein“, forschte er zweifelnd. „Wie willst du es beweisen?“
„Sieh diese Säule“, rief Hinze und wies mit der Hand zu der Krönungsnische hinauf, die gegen Osten lag. „Dieser Hahn hat über unsere Freundschaft gekräht, da sie in Stücke ging.“
„So mag er wieder krähen“, entgegnete Kunze und umhalste seinen wiedergefundenen Herzbruder vom Sattel aus, „so mag er auch krähen, da wir uns jetzt wieder zusammenfinden.“
Eine Weile lagen sie sich wortlos in den Armen, und die Hochzeits-musik klang ferner und ferner.
„Was tun wir nun“, fragte Kunze endlich.
„Wir reiten nach dem Lande Italia und ziehen mit Kaiser Friedrich in den Krieg“, schlug Hinze vor und schwang sich hinter ihm auf den Gaul, und sie ritten in einem Aufsitzen bis Liegnitz und wurden in Schlesien nie wieder gesehen.
Frau Pelagia kam ohne Bräutigam zur Kirche, legte sich seitdem ganz auf die Frömmigkeit und vermachte ihr gesamtes Vermögen den Claris sinnen. Der Hellerwirt war der Einzige, der ihr nachtrauerte, aber nicht im Guten, sondern im Bösen.
2. Der Breslauer Bierkrieg (1380)
I
Am Niklastage des Jahres 1380, da die Welt zwei Päpste und Breslau keinen Bischof besaß, dieweil der junge Böhmenkönig Wenzel einem seiner Günstlinge den goldnen Stuhl versprochen hatte, das Domkapitel aber damit nicht einverstanden war, saßen Konsuln und Schöffen der guten Stadt in ihrer neuen Kammer und hielten heimlichen Rat. Bitterernst waren ihre Gesichter, als sich Peter Beyer, der erste Konsul, erhob, um die Wichtigkeit der unerwarteten Besendung darzulegen.
„Ihr lieben Herren!“, begann er und seufzte tief, „die Wirrnisse dieser Zeiten sind groß und schwer, und mich dünket, wir sollten die Hände nicht länger in den Schoß tun. Das Domkapitel ist wie ein störrischer Hengst, und ist kein Bischof da, der ihm Halfter und Zügel anlege. Dieses aber tut bitter not, wenn anders die Stadt und das gemeine Beste nicht einen ewigen Schaden davontragen sollen. Drum merket wohl auf das, was Herr Otto von der Neißen, der Schöffe, der über den Schweidnitzer Keller gesetzet worden ist, euch wissen lassen wird!“
„Es ist eine Schande!“, polterte der dicke Schöffe mit seinem mächtigen Bierbass los. „Der Keller ist leer. Kaum dass ein Fremder, der nichts davon weiß, sich hinein verirrt. Alles Volk läuft hinüber zu den Pfaffen. Da schenken sie den Schöps um zwei Heller billiger. Und dagegen sollen wir nicht einmal mucken, wie der Herr Archidiakonus Nikolaus gesagt hat. Der und kein anderer hat uns den Brei eingerührt. Man sollte ihm von Rechts wegen das große Maul stopfen!“
Nach dieser langen Rede setzte sich Otto von der Neißen nieder und wischte sich den Schweiß von der rotglühenden Nase.
„Mich dünket“, nahm jetzt Georg Steinmüller, der ehrwürdige Schöffenobmann, das Wort, „mich dünket, wir lassen solches bleiben, dieweil der Sand und der Dom nicht unter unsere Gerichtsbarkeit fällt. Wohl sitzt die ganze Pfaffei dicht an unserm Leibe, aber wir haben kein Messer, dies Geschwär aufzustechen. Bleiben wir fest auf unserm Recht. Wir haben das Privilegium des Schrotamtes, wonach dem Rate allein zusteht, fremdes Bier zu schenken. Und wir haben zudem das Privilegium des Meilenrechts, wonach in unserer Bannmeile kein Bier verzapft werden darf. Dies soll der Stadtschreiber in ein Memorandum fassen mit allen Beschwerden und Klauseln, damit man es nach Prag an den König sende.“
„Mitnichten bin ich der Ansicht“, erwiderte Peter Beyer schnell, „dass wir unsere guten Privilegien in die Hände eines schwachen zwanzigjährigen Knaben legen, da keiner sagen kann, von wem er sich morgen leiten lassen wird. Seine Räte sind Böhmen und uns gram von Anbeginn. Helfen wir uns nicht selbst, so wird uns keiner helfen!“
Da durchlief ein Beifalls murmeln die beiden Bänke.
„Zehn Staupenschläge jedem, der seinen Durst drüben löscht!“, schrie jetzt Otto von der Neißen, und mit dem Rat war‘s ihm ernst.
„So werden die Staupenbesen gar teuer werden!“, wies ihn Georg Steinmüller kühl zurück. „Und mich dünket, die Räte des Königs sind billiger zu kaufen!“
„Man soll die Tore schließen und keinen hinüberlassen!“, schrie der dicke Schöffe, und mit diesem Vorschlag war's ihm nicht minder ernst.
„Macht böses Blut in der Bürgerschaft!“, ließ sich Paul Jonsdorff, der zweite Konsul, vernehmen. „Die Zünfte tragen die Köpfe schon viel zu hoch, als dass wir sie mit Gewalt dämpfen könnten. Lasset uns vielmehr mit List zu Werke gehn, auf dass wir ihren Zorn ablenken auf die Pfaffen. Schließen wir aber die Tore, so haben wir alle wider uns, und nur die Kretschmer und Brauer werden uns beistehen. Was sind aber die gegen den tollen Haufen der Tuchmacher?“
„Mit List!“, sprach Otto von der Neißen und legte seinen Finger an die knollige Nase. „So sollten wir den Schöps auch um zwei Heller billiger aus schenken. Gehen sie aber drüben noch weiter herunter, so geben wir eben noch ein paar Heller daran. Wir werdend schon aushalten!“
Wieder stritt Peter Beyer heftig dagegen, dieweil ein solches Beginnen gegen die Würde der Stadt und des Rates sei. Aber Otto von der Neißen fand unter den Schöffen lauten Beifall. Wacker wurde hin und her geredet, ohne zu einem Ziel zu kommen. Bis sich Paul Jonsdorff, der dazu geschwiegen hatte, erhob. Da wurde es still.
„Ihr lieben Herren“, begann er freundlich, „der letzte Rat ist gut, daran soll kein Zweifel rühren, bis wir einen besseren gefunden haben. Vielleicht dass uns ein tüchtiger Schluck Schöps auf die rechte Fährte bringt.“
Damit waren alle einverstanden, allen voran Otto von der Neißen, der alsobald den Ratsdiener zu Henlin Jäschkittel, dem Kretschmer des Schweidmtzer Kellers, hinunterschickte.
Der fuhr sofort aus seinem Mittagsschläfchen auf und weckte die beiden Kellerknechte, die sich's auch bequem gemacht hatten. Denn die langgewölbten Räume waren leer wie hohle Tonnen. Friedlich hing in der Mitte des Kreuzganges das Lümmelglöckchen gegenüber der Schankstätte, und der Klöppelstrick züngelte vergeblich nach einem ungeschickten Gemäßzerbrecher, um ihn dem wohlverdienten Spott der übrigen Gäste auszusetzen. Auch diese fehlten. Nicht einmal ein paar Fremdlinge waren bisher eingefallen, den ratsherrlichen Schöps zu schlürfen.
„Sabine!“, rief Meister Henlin und band sich schnell ein sauberes Schurzleder um die Hüften. Dann spreizte er die Storchbeine vor einem frischen Fass und stach es mit drei kunstgerechten Schlägen an. Obschon er es im Trinken mit jedem Kretschmer aufnehmen konnte, war sein Leib dürr wie der eines Schneiders, seine Arme waren schlank wie Zaunlatten, und sein Gesicht war faltig und rau wie halbgegerbtes Ziegenleder. Zum Überfluss trug er noch einen langen, grauen Bocksbart. Aber Kräfte hatte er, wie es seinem Stande zukam. Das schwere Gebinde nahm er liebevoll in die Arme und legte es spielend auf den Schankblock.
„Sabine, tummle dich!“, rief er noch einmal durch die Tür ins Wohngewölbe hinein. „Bring die Ratskannen. Die Herren plagt der Durst. Hurtig, hurtig, ihr Burschen!“
Die standen schon mit den Bechern bereit, als Sabine erschien, beide runden Arme voll schöngeschweifter, mit Wappen, Spruch und neckischem Zierrat geschmückter Kannen. Von Meister Henlin Jäschkittel, ihrem Vater, hatte sie zum Glück nichts weiter als die gerade stolze Nase und die munteren Braunaugen geerbt. Sie war so schön, dass sich Frau Sonne vor ihr schämte und nur selten durch die schönen, bunten Butzenscheiben des Kellers zu lugen wagte. Wer fragte auch da unten nach der Sonne! Wem Sabine einen freundlichen Gruß bot, wen sie mit ihren schöngeschwungenen Lippen anlächelte, der wollte von der Sonne nichts mehr wissen und blieb im Keller hocken. Und wenn Sabine unter die Lümmelglocke trat, dann wurde es nicht nur im ganzen Keller bis in den letzten Winkel hell, sondern auch im Kopf des Allerbezechtesten dämmerte dann sofort ein lichter Morgen. Dabei besaß sie bei ihren achtzehn Jahren einen gar schlagfertigen Geist und wusste die rechten Worte zu finden und gut zu setzen. Und trotzdem war sie züchtig in Werken, Worten und Gedanken. Mit schnellen Griffen begann Henlin Jäschkittel die Kannen zu füllen. Schwarz und schäumend rann der edle, ölige Schöps aus dem Hahn. Sabine sank auf einen Schemel, legte die schlanken Hände in den Schoß, überschaute den leeren Keller und seufzte.
„Nur Geduld!“, rief Meister Henlin. „Keine drei Tage, und es ist hier wieder wie ehedem. Der Rat wird sich doch wohl nicht von der tollen Pfaffschaft auf der Nase herumtanzen lassen!“
Gleich darauf pochte er an die Tür der Ratskammer, öffnete und ließ die beiden Knechte vorangehen, die schnell jedem der Herren die rechte Kanne hinstellten. Dann verschwanden sie. Meister Henlin aber blieb ehrerbietig an der Tür halten, neuer Wünsche gewärtig. Die Herren schwenkten Kannen und Becher und prüften unter gedämpftem Zuruf den Trank.
„Am Biere liegt es nicht!“, behauptete Otto von der Neißen und sah sich herausfordernd um.
Keiner widersprach ihm, und Meister Henlin wollte sich schon verabschieden, als ihn Paul Jonsdorff anredete.
„Meister Henlin!“, rief er und winkte ihn heran. „Habt Ihr etwas Neues in Erfahrung gebracht?“
„Nicht eben viel, ehrbare Herren“, erwiderte der Kretschmer und verneigte sich. „Aber doch etwas, das auf keine guten Absichten raten lässt. Sie haben da drüben jetzt einen zünftigen Mann aus Schweidnitz in Lohn genommen. Er heißt der lange Elias, ist ein großer, ungefüger Kerl, ein rechter Grobian und Schlagetot. Soll ein tüchtiger Bierbrauer sein und hat auf dem Neumarkt geprahlt, dass er da drüben Schöps brauen wird. Lacht überdies den Rat und die ganze Stadt aus und geht, wie er sich selbst verschworen hat, für den Herrn Archidiakonus durchs Feuer.“
„Keine gute Zeitung!“, ließ sich Georg Steinmüller vernehmen und wiegte das Haupt. „Warum hängt dieser Mann so an der Geistlichkeit?“
„Scheint nichts anderes zu sein als der Lohn!“, antwortete der Meister achselzuckend. „Zahlen ihm doppelt so viel als ein zünftiger Gesell anderwärts erhält.“
„Man sollte den Mann abspenstig machen!“, schlug Paul Jons dorff vor.
„So werden sie zwei neue Leute annehmen“, wies ihn Peter Beyer zurück, „und wir haben den Schaden davon. Was ist Eure Meinung über den Handel, Meister Henlin?“
„Ginge es mir nach“, sprach der Kretschmer und fasste Mut, „so ließe ich eine Mauer aufführen, rund um den Dom und den Sand herum, in der keine Tür oder Fenster ist. Und die Mauer müsste so hoch werden, dass keiner herüber und hinüber kommen könnte.“
„Wir danken“, rief Otto von der Neißen und lachte laut heraus, „wir werden Euerm Rate folgen, wenn Ihr uns die Steine dazu liefert.“
Damit war Henlin Jäschkittel entlassen, erstieg würdevoll zum Keller hinunter, band das Schurzfell wieder ab, denn Gäste ließen sich noch immer nicht blicken, und prahlte gar stark vor Sabine, als ob er den Rat auf den rechten Weg gebracht hätte. Die lächelte zu feinen tönenden Reden und widersprach nicht, obschon sie ihn durchschaute. Denn sie war ihm von Herzen zugetan.
Als aber nach zwei Stunden der Ratsdiener draußen auf dem Markt die Glocke schwang, wurde es offenbar, was Konsuln und Schöffen beschlossen hatten. Mit schwerer Strafe wurde jeder bedroht, der den Geistlichen auf dem Dome Bier zuführte.
„Siehst du!“, rief Henlin Jäschkittel stolz. „Das ist die hohe Mauer.“
„Ei gewiss, Herr Vater!“, lachte ihn Sabine aus. „An Euch ist ein Ratsherr verloren gegangen!“
II
Auf diesen feinen Hieb des Rates rührte sich nichts. Das Domkapitel konnte es schon eine ganze Weile ohne Zufuhr aushalten. Aber der Durst der Breslauer, der sich mit der nahenden Weihnachtszeit stetig hob, riss immer bedenklichere Breschen in die Vorräte der Domschenken. So dass Archidiakon Nikolaus, kein finsterer Zelot, sondern ein weltgewandter Mann, endlich zum Gegenschlag ausholen musste. Wie er aber forschte und horchen ließ, kein Breslauer Fuhrmann wollte ihm zu Willen sein. Bier karren wollte ein jeder, aber nicht ohne die Erlaubnis des Rates. Denn der fackelte nicht lange und hatte schon bei viel geringfügigeren Gelegenheiten den Staupenbesen schwingen lassen. Doch der geistliche Herr, der das Domkapitel beherrschte und die Einnahmen des bischöflichen Stuhles verwaltete, gab nicht nach. Denn einmal dünkte er sich im Recht zu sein, zum andern floss ihm als Vertreter des Bischofs ein stattlicher Teil der Einnahmen in seine Tasche. Diesen angenehmen Zufluss war er auf jede redliche Art und Weise zu verstärken bemüht.
Und da er denn keinen fand, der das Bier herankutschieren wollte, so verfiel er auf den langen Elias, den er, weil ihn die Schweidnitzer Chorherren als fromm und getreu gerühmt hatten, in den Dienst des Kapitels genommen hatte.
Als der riesige Braugeselle hereintrat, fuhr er mit dem Kopf gegen die obere Türschwelle, dass sie krachte. Ihn aber scherte das weiter nicht. Er beugte sich, so gut es ging, und küsste dem Archidiakon die Hand. Trotz seiner Länge war der große Elias in seinen Gedanken ein reines Kind. Sein Glaube stand felsenfest, dieweil ihm in seiner herzinnigen Einfalt das Himmelreich mehr galt als das irdische Jammertal. Jeder, der einen geistlichen Rock trug, war ihm der Inbegriff aller guten menschlichen Eigenschaften. Vornehmlich aber den Herrn Archidiakon Nikolaus hielt er für überaus gerecht, kraftvoll und mutig. Gegen dessen Tapferkeit, die es mit dem mächtigen Breslauer Rat aufnahm, dünkte sich der lange Elias ein Schwächling und Duckmäuser, und war doch die Feigheit das Allerletzte, was man ihm vorwerfen konnte. Hatte er doch den seltenen Mut besessen, unzünftig zu werden und ein Pfaffenknecht zu sein.
„Gelobt sei Jesus Christus!“, grüßte er zaghaft.
„In Ewigkeit Amen!“, dankte der Archidiakon salbungsvoll und machte das Kreuzzeichen über ihn. „Hör, Elias. Es mangelt uns an Bier. Traust du dich, welches hier zu brauen?“
„Hochwürdige Gnaden!“, erwiderte Elias unterwürfig. „Wenn man mir Zeit lässt, will ich es wohl vollbringen.“
„Zeit ist eben nicht übrig“, meinte der Kirchenherr. „Sieh zu, dass du es noch vor dem heiligen Christfest zustande bringst!“
„Hochwürdige Gnaden“, druckste der lange Elias heraus, „solches ist mir unmöglich, dieweil es ein Gebräu geben wird, das keiner saufen mag.“
„Ganz gleich!“, wies ihn Herr Nikolaus zurecht. „Lange gut für die Breslauer.“
„Hochwürdige Gnaden, mit Verlaub“, sprach der lange Elias. „Aber nicht für mich. Ich habe gelobt, kein schlechtes Bier zu brauen.“
„Kraft meines Amtes entbinde ich dich dieses Schwurs!“, rief der Archidiakon ärgerlich und machte wieder das Kreuzeszeichen über ihn. „Gehe hin, mein Sohn, und tue, wie ich dir geboten. Man wird dir alles Nötige zureichen.“
Damit aber haperte es bedenklich. Und als nach vier Tagen harter Brauarbeit der erste Probekrug zum Herrn Archidiakon geschickt wurde, kannte er nur feststellen, dass der Trank wie dünngemälztes Oderwasser von der Domseite schmeckte. Das konnte und durfte man den Breslauer Gästen nicht vorsetzen. Man hätte sie sonst für immer verjagt. Um aber dieses Gebräu nicht ungenutzt zu lassen, hieß Herr Nikolaus den langen Elias, die vorhandenen Schöpsvorräte damit zu verdünnen.
„Hochwürdige Gnaden!“, rief der lange Elias in tiefster Seele erschrocken, „solches ist eine Sünde.“
„Das lass nur meine Sorge sein, mein Sohn!“, erwiderte der hohe Kirchenherr mit feinem Lächeln. „Die Kirche kann binden und lösen. Gehe hin und tue, wie ich dir geboten!“
Diesmal erwachten in dem langen Elias die ersten Zweifel an dem Kirchenrecht, den Schöps zu verwässern, und er war froh, dass ihm zwei Laienbrüder die Sünde abnahmen. Die durstigen Breslauer merkten vorerst nichts davon, denn das Gemisch stieg ihnen viel schneller in die Köpfe.
Doch das war für das Domkapitel nur eine Galgenfrist von wenigen Tagen. Da kam plötzlich Hilfe von auswärts. Herzog Ruprecht von Liegnitz, ein gar frommer Herr, der den reichen, hochmütigen Breslauer Ratsherren durchaus nicht hold gesinnt war, schickte an seinen Bruder, den Domdechanten Heinrich die erfreuliche Botschaft, dass er ihm als Christgeschenk eine Ladung Schweidnitzer Bier senden wolle. Bis Canth sollte dem Wagen ein Fuhrmann entgegengeschickt werden. Dazu wurde der lange Elias bestimmt, und er machte sich auch sofort auf den Weg, froh, den verwässerten Schöps nicht mehr schenken zu müssen. Getrunken hatte er ihn erst recht nicht. Herr Nikolaus schärfte ihm ein, die Ladung beim Rate zu melden und ausdrücklich zu sagen, dass es ein herzogliches Christgeschenk aus Liegnitz sei. Auch das Liegnitzer Schreiben, in dem die Gabe angekündigt worden war, wurde ihm mitgegeben.
Der lange Elias erreichte das fromme Canth um die Abendstunde, fand in der Finsternis den hochbepackten Bierwagen hinter dem Rathause und setzte sich mit dem Schweidnitzer Kutscher hinter den Krug. Und da es ein unverfälschtes Getränk war, was er enthielt, hockten sie bis Mitternacht zusammen. Elias schüttete dem Landsmann das Herz aus.
„Ist ein schwerer Dienst bei den Klerikern“, seufzte er und labte sich. „Geld zwar gibt's genug. Aber man weiß nie, woran man ist. Sie binden und lösen, so wie‘s ihnen gefällt.“
„Komm heim!“, riet der andere. „Einem Schweidnitzer ist es in Breslau noch nie geglückt. Gehe mit mir und werde wieder zünftig.“
„Ich hab dem Herrn Archidiakon in die Hand gelobt, bis Michaeli zu bleiben“, sprach der lange Elias. „Und mich dünkt, davon wird er mich nicht lösen. Und ich würde mir lieber die Zunge abbeißen, als ihn darum zu bitten. Mir ist nicht die Gewalt gegeben, mich zu lösen, wo ich mich gebunden habe.“
Also fuhr am nächsten Morgen, dem Tage des heiligen Thomas, der lange Elias allein nach Breslau und wurde mit seiner Ladung am Leichnamstor angehalten. Er ließ den Wagen in der Hut der Torwächter zurück, scherzte noch ein wenig mit ihnen und schritt aufs Rathaus, seinen Brief vorzuzeigen. Und da er nach dem Konsul fragte, wurde er in die Kammer geführt, wo der ganze Rat versammelt war. Die Herren schwiegen und machten so ernsthafte Gesichter, dass es dem langen Elias eiskalt den Rücken entlanglief. Überdies wurde er plötzlich von einem bärenstarken Durst angefallen.
„Bist du der lange Elias?“, fragte ihn Peter Beyer, der erste Konsul.
Der riesige Braugeselle bejahte aufatmend. Seine Ängstlichkeit fiel von ihm ab, als er erkannte, dass diese Herren wie gewöhnliche Menschen daherredeten. Nüchtern war hier alles und unfeierlich, kein Heiligenschein glänzte, und kein Weihrauchnebel wallte. Auch hatten die Herren nicht die Kraft zu binden und zu lösen. Und das Verhör lief weiter.
„Weißt du nicht, dass du dich strafbar gemacht hast?“
„Hier ist ein Schreiben vom Herrn Herzog Ruprecht aus Liegnitz, woraus der Rat ersehen kann, dass das Bier ein Christgeschenk ist.“
Das Schreiben lief langsam die beiden Bänke entlang, wo es fast überall Kopfschütteln erregte.
„Das Schreiben hilft dir nichts, dieweil der Herzog den Rat nicht um freie Durchfuhr gebeten hat.“
„So mag der Rat bei dem Herrn Archidiakonus Nikolaus anfragen.“
„Dazu hat der Rat nicht Notdurft“, wies ihn Peter Beyer zurück. „Und da du dich gegen den Rat vergangen hast, so müssen wir dich in Gewahrsam halten, bis uns Sühne wird.“
Der lange Elias stand da und öffnete Mund und Augen, soweit es ging.
„Einsperren?“, würgte er sich endlich heraus, und seine Risenfauste ballten sich zu Kloben. „Ihr wollt mich einsperren?“
„Sei ohne Furcht!“, beruhigte ihn der erste Konsul, „Es wird dir kein Leid geschehen und an nichts mangeln, sobald du dich fügst. Über ein Weilchen bist du wieder frei und magst ungekränkt von dannen gehen.“
Da öffneten sich die Fäuste wieder, doch der Zorn war noch nicht ganz gedämpft.
„Der Herr Archidiakonus wird es nicht zugeben!“, rief er laut.
„Darum sorg dich nicht“, lachte Otto von der Neißen und hieb auf den Tisch, dass es dröhnte.
„So werdet Ihr es ihm zu wissen tun?“, fragte der lange Elias leise.
„Er wird es bälder erfahren, als ihm lieb ist!“, vertröstete ihn der dicke Kellerschöffe und rief den Rats diener.
Und der lange Elias folgte dessen Wink wie ein gehorsames Kindlein. An der Tür aber wandte er sich noch einmal um.
„Das Bier aber?“, rief er zögernd. „Der Herr Archidiakonus wartet drauf!“
„Es wird den rechten Weg schon finden!“, sprach Herr Otto von der Neißen, und die anderen Herren lachten fröhlich dazu.
Da vermeinte der lange Elias nicht anders, als dass es nicht viel mehr als ein kleiner Scherz sei, machte vor dem Rate einen Kratzfuß und ließ sich in das Zeisgenbauer bringen. Nun war aber das Rathaus noch nicht fertiggebaut, und den Hauptgang versperrten die Maurer und Steinmetzen mit ihrem Gerät. Darum musste der Ratsdiener seinen Gefangenen über den Ring geleiten, um die Ecke des Rathauses, vor der die Staupensäule stand. Und so kamen sie auch an der breiten Treppe zum Schweidnitzer Keller vorüber. Vor ihr aber stand der Bierwagen mit dem herzoglichen Christgeschenk, und Meister Henlins beide Bierknechte waren damit beschäftigt, den Wagen zu entlasten. Sie hatten eine lange Bohle über die Treppenstufen gelegt, und schon rollte das erste Fass, von einem langen Tau gezügelt, in die kühle Kellertiefe. Schwer waren die Gebinde, und die beiden breiten Gesellen hatten wacker mit ihnen zu schaffen.
Mit einem Wutschrei sprang der lange Elias dem fliehenden Fass nach, erhaschte es, stemmte es hoch und warf es wieder auf den Wagen. So tat er mit allen andern, die sich danach noch auf die schiefe Bahn wagten. Der Ratsdiener wollte ihn hindern und packte ihn am Rock. Aber der lange Elias kümmerte sich um die Klette nicht und schleifte sie mit sich, wohin er sie haben wollte. Ernster wurde es erst, als die beiden rüstigen Bierknechte in den Kampf eingriffen. Sie fielen den langen Elias von hinten an und wollten ihn hindern, das letzte Gebinde auf den Wagen zu stemmen. Das war ein hartes Drücken, Drängen und Stoßen, das nun vor der Kellertreppe anhub.
Die neugierigen Breslauer liefen herbei und schauten schmunzelnd zu.
Eine ganze Minute wohl wogte der Kampf hin und her. Die Bierknechte fluchten, was das Leder hielt, der Ratsdiener konnte es noch besser, aber den langen Elias, der immer noch das letzte Fass auf den Armen wiegte, kriegten sie doch nicht klein. Er fluchte nicht, dieweil es eine Sünde war und ihm auch zu viel Kraft weggenommen hätte, hielt den Mund geschlossen, und sein Antlitz wurde allmählich blaurot. Wie dunkelblaue, zerknotete Wollfäden lagen die Adem auf seiner Stirn. Und nun, als die drei Feinde an seiner Zähigkeit zu ermatten begannen, reckte er sich wie ein Klotz in die Höhe, und das letzte Gebinde polterte wieder auf den Wagen zurück.
Nun hatte der lange Elias beide Hände frei und machte davon Gebrauch, dass der Ratsdiener vorsichtig zurückwich und die umstehenden Bürger zum Eingreifen aufforderte. Aber die steckten die Hände in die Taschen und freuten sich allesamt, dass einer stärker war als drei Starke. Die beiden Bierknechte hatten sich in eine Ecke zurückgezogen und verteidigten sich, so gut sie konnten.
In diesem Augenblick schoss Henlin Jäschkittel die Treppe empor und griff, ohne sich lange zu besinnen, den langen Elias im Rücken an. Aber ein einziger Schlag genügte, scharf in die Magengrube gezielt, um Meister Henlin in die gegenüberliegende Pfeilerecke zu werfen. Er stieß einen lauten Jammerschrei aus, dann blieb ihm der Atem für eine ganze Weile weg, und er schnappte auf dem Piaster nach Luft, wie ein Fisch auf dem Trocknen. Die Zuschauer stießen ein Jubelgeschrei aus, denn es sah wirklich sehr komisch aus, wie Meister Henlin gekrümmt in der Ecke hockte, die Hände auf den Bauch presste und den Schlag doch nicht hinunterwürgen konnte. Der Ratsdiener hatte inzwischen Kraft gesammelt und rückte von neuem vor. Aber der lange Elias war auf der Hut. Er fing ihn, trotz des Geplänkels mit den Bierknechten, waidgerecht ab und hätte ihn mit einem Hieb zur Strecke gebracht, wenn nicht plötzlich Sabine vor ihm gestanden hätte. Auf den Schrei des Vaters war sie herbeigeeilt und stand nun, ein Bild der Angst, auf der obersten Treppenstufe.
„Vater!“, rief sie und schlug verzweifelt die Hände zusammen.
Henlin Jäschkittel machte eine matte Bewegung mit dem linken Arm, zum Zeichen, dass er noch lebe.
Der lange Elias aber rührte sich nicht und starrte Sabine, die er zum ersten Male sah, wie eine Heilige an, seine Arme sanken, seine Fäuste, die soeben erst wie ein paar Schmiedehämmer gearbeitet hatten, öffneten sich und begannen vor innerer Erregung zu zittern. Aber es war nicht mehr die Wut. Das Blut wich so schnell aus seinem Gesicht, dass es im Zusehen bleich wurde. Er schämte sich, dass er den alten Mann so hart getroffen hatte.
„Jungfer, verzeiht!“, stotterte er, „es war nicht so arg gemeint!“
Aber sie warf ihm einen Blick des Abscheus zu, und ihre Augen füllten sich mit Tränen.
„Du Grobian!“, stöhnte jetzt Meister Henlin und ballte im Sitzen die Faust. Sonderlich furchterregend sah das nicht aus.
Da fühlte sich der lange Elias vom Ratsdiener am Kragen gefasst. Schon wollte er seine Bärentatze wieder heben, um dem Wagehals eine Maulschelle zu versetzen. Da traf ihn wieder Sabines entsetzter Blick, und er ließ sich abführen, ohne zu mucken. Auch der Durst war ihm plötzlich vergangen.
Meister Henlin humpelte mit Sabines Hilfe in den Keller zurück. Bei der Niederlage blieb seine einzige Genugtuung, dass es ein Mann seines Gewerbes gewesen war, der ihn zu Fall gebracht hatte.
Jetzt erst kletterten die beiden Bierknechte wieder auf den Wagen, befühlten sich gegenseitig die erhaltenen Beulen und ließen zwischendurch die Fässer der herzoglichen Christgabe in den Schweidnitzer Keller rollen, damit sie dort verschänkt würden, wie es der Rat in seiner Weisheit beschlossen hatte.
III
Der erste Krug des bischöflichen Schöpses wurde Herrn Otto von der Neißen vorgesetzt, der nach der Ratstagung herunterkam, seinen Abendschoppen zu trinken. Und das Bier fand seinen vollen Beifall. Auch nahm er mit Wohlbehagen wahr, dass sich der Keller allmählich bevölkerte. Denn wo es was zu horchen und zu schwatzen gab, dahin strömten die alten Breslauer in Scharen. Und gar bald hatte sich die Kunde von der Bierschlacht und von Meister Henlins unerwarteter Fällung herumgesprochen. Kretschmer Jäschkittel war wieder obenauf. Er war viel zu zähe, als dass ihm der Schlag in die Magengrube schädlich gewesen wäre. Nur eine Wut kochte in ihm auf den langen Elias, und er belegte ihn nicht gerade mit Schmeichelnamen. Sabine hatte Mühe, ihn zu beruhigen, als sie den Kellerherrn eintreten sah.
„Meister Henlin!“, sprach der, setzte sich, trank und strich sich schmunzelnd den Bart. „Den Häftling sollt Ihr mit dem Besten versorgen, was Ihr in der Küche habt, so hat der Rat beschlossen. Auf dass er uns nicht nachsagen kann, wir hätten ihm einen Leibes schaden verursacht. Gebt ihm gut zu essen und reichlich. Den Krug aber füllt Ihr ihm mit Wasser. Das soll seine Strafe sein, bis er kirre wird.“
Freudigen Herzens sprang Meister Henlin in die Küche, ließ eine Mahlzeit richten, die für drei gewöhnliche Menschen langte, und sandte damit den einen Kellerknecht zum Zeisgenbauer hinaus. Den Wasserkrug füllte er selbst.
Inzwischen hatte sich der lange Elias in sein Schicksal gefügt. Das Bauer, in dem er saß, war fest und sicher. Tür und Fenstergitter widerstanden seinen wuchtigen Fäusten. Hunger hatte er zwar, aber sein Durst war noch mächtiger. Da fiel die Klappe in der Tür, und der Kellerknecht schob ihm das Essen herein. Auch den Krug stellte er daneben, wobei er halb gutmütig, halb spöttisch grinste. Dann schloss er die Öffnung von draußen, und der lange Elias war wieder allein. Lechzend langte er nach dem Krug, hob ihn hoch und nahm einen langen Schluck. Aber in demselben Augenblick spie er ihn wieder von sich. Wut, Staunen, Schreck und Verwunderung rangen in ihm, bis die Wut siegte, und er den Tonkrug mit Zomgebrüll durch das Fenstergitter warf. Mitten auf dem Ring zerplatzte er mit einem dumpfen Knall.
Wasser wagten sie ihm vorzusetzen! Wollten sie ihn stracks verdursten lassen! Und seine Wut wuchs so sehr, dass sie Hunger und Durst überwand. Das gute Mahl rührte er nicht an, hockte sich auf die Pritsche nieder, stützte den Kopf in die Fäuste und ließ seinen Grimm anschwellen, bis er von ihm erfüllt war. Dann erst schlief er ein. Am Morgen nahm er einige Bissen, doch sie mundeten ihm nicht, dieweil sein Durst über Nacht gewaltig ins Kraut geschossen war. Als ihm der Knecht das Frühstück brachte und wieder mit breitem Grinsen einen Wasserkrug daneben stellte, griff ihn der lange Elias und sandte ihn, ohne zu proben, dem ersten nach. Diesmal gab es nur einige grobe Beulen, denn er war aus Zinn. Der Kellerknecht reckte verblüfft den Kopf durch die Türluke und riss den Mund auf. Als ihm aber der lange Elias an die Kehle fahren wollte, brachte er sich schleunigst in Sicherheit. Nun steckte der lange Elias den Kopf und die beiden Arme durch das Gitter und begann so laut zu brüllen, dass der ganze Ring und die angrenzenden Straßen aufhorchten.
„Sie wollen mich verdursten lassen! Zu Hilfe, ihr Leute! Zu Hilfe! Sagt es dem Herrn Archidiakonus. Ich bin unschuldig. Zu Unrecht hat mich der Rat eingesperrt!“
So lärmte er und winkte dabei mit den Fäusten, dass immer mehr herbeieilten. Und nach einer Weile stand eine große Menge Volks unter seinem Fenster. Sie lachten ihn aus und fluchten zu ihm hinauf, zeigten dabei viel Lust, seinetwillen einen kleinen Tumult zu erregen, aber ein rechtes, inniges Mitleid hatte keiner mit ihm. Meister Henlin auch nicht, als er den Rumor vernahm. Schnell füllte er einen Wasserkrug und sprang damit die Kellertreppe hinauf.
„Liebe Leute!“, schrie er, drohte mit dem Krug zum Fenster empor und brach sich Bahn. „Hört nicht auf den Lügenpeter! Er mag kein Wasser saufen, der Gauch! Beim Wasser ist noch keiner verdurstet! Willst du wohl Ruhe geben, du Grobian! Störst du die Herren in der Ratskammer, so werden sie dich in die schmerzhaftige Mutter stecken.“
Das schreckte den langen Elias anscheinend nicht. Er brüllte weiter, und die Menge johlte ihm zu. Meister Henlin musste flüchten. Durch eine Nebenpforte gelangte er zur Tür des Gefängnisses. Wütend riss er die Klappe herunter, steckte den Kopf hindurch und schalt, was das Leder hielt.
„Hier sauf Wasser, du Schreihals!“
Der lange Elias ließ von seinem ruhestörenden Tun, kam mit rollenden Augen heran, nahm den Krug mit beiden Händen und goss das kalte Oderwasser Meister Henlin in den Nacken. Der zog prustend und knurrend davon wie ein begossener Pudel. Des langen Elias Rache war etwas gekühlt. Er hielt mit dem Gebrüll inne, aß ein paar Bissen und trank dazu den kümmerlichen Wasserrest, der im Krug zurückgeblieben war. Dann wartete er, bis die Konsuln und Schöffen aus der Ratskammer kamen.
Meister Henlin ward kein schöner Empfang bereitet. Ein schalkhafter Gast erkannte sofort, woher die triefende Nässe stammte, und zog das Lümmelglöckchen. Da kamen sie alle herbeigelaufen, die in den Hallen saßen, und lachten ihn weidlich aus. Scham und Zorn röteten sein Gesicht und ließen kein Wort aus seiner Kehle. Em dichter Kreis machte ihm die Flucht unmöglich, und das Lümmelglöckchen läutete unermüdlich, bis Sabine kam und den Vater mit leichter Mühe befreite. Sie schalt den Lümmelglöckner tüchtig aus, dass er die Glocke zu Unrecht gezogen hatte, und ließ ihn von den beiden Kellerknechten mit drei guten Groschen büßen.
Um die Mittagszeit sichtete der lange Elias einige Ratsherren und erhob sofort sein Gebrüll. Herr Otto von der Neißen schwenkte darum zum Schweidnitzer Keller hinüber, hörte von Meister Henlins Wasserbad und von des langen Elias Krugzertrümmern und gebot, ihm nicht eher einen Tropfen Wasser zu geben, bis er höchst inständig darum bitten würde.
Das wurde ihm am Mittag von dem einen Kellerknecht mitgeteilt. Aber der lange Elias wollte es lieber mit dem Brüllen erzwingen. Die Heiserkeit schien er nicht zu fürchten. In der Nacht ruhte er sich aus. Am nächsten Morgen zeitig in der Frühe setzte er sein Toben fort. Unterdessen stellte man auf der andern Ringseite die Buden für den Kindelmarkt auf. Nun mehrte sich das Volk, und die Aufläufe unter dem Zeisgenbauer nahmen immer bedenklichere Ausdehnungen an. Und da der lange Elias durchaus nicht zu beruhigen war, weder durch Güte noch durch Drohungen, so ließ der Rat das Fenster von draußen mit eichenen Bohlen verschlagen.
Jetzt saß er im Finstern. Aber am Mittag des Heiligen Abends wichen diese dicken Bretter samt ihren beiden Querriegeln den Anstrengungen des Häftlings und hingen rechts und links von dem Gitter gar trübselig herunter.
Und der lange Elias setzte sein Konzert fort. Aber es klang jetzt schon gar kläglich. Vier Tage hatte er nun keinen Tropfen getrunken, und er hätte an seinem Eigensinn verdursten müssen, wenn nicht Sabine, die großes Mitleid mit ihm hatte, ein wenig für ihn gesorgt hätte. Sie ließ von den Speisen alle Gewürze weg, machte lange Suppen und legte überreichlich allerhand saftige Früchte bei.
Und kurz danach, als die Bohlen sich lockerten, eilte Sabine mit schnellen Schritten zum Kindelmarkt hinüber, um etwas für das Fest einzukaufen. Noch niemals war sie seit des langen Elias Gefangensetzung an der Seite des Zeisgenbauers vorbeigegangen. Heute aber, wo sie es eilig hatte, wollte sie es wagen. Und plötzlich schlugen ihr des langen Elias Worte ans Ohr. Sie erschrak aufs tiefste über die Kraftlosigkeit und Schwäche, die sich darin kundtat. Er war bald mürbe. Doch er hätte sich lieber die Zunge abgebissen, als seine Peiniger um einen Trunk Wasser zu flehen. Alle, die vorbeikamen, schauten zu ihm hinauf. Das war er gewohnt, und besonders heute, wo er den Fensterladen zerbrochen hatte. Nur Sabine schaute nicht hinauf. Das verwunderte ihn. Sie hielt züchtig den Blick zu Boden gesenkt. Ein Zittern war in ihrem Herzen, und sie wurde rot vor Scham, Angst und Mitleid mit dem gefangenen Mann. Und da erkannte er sie.
„Jungfräulein!“, flehte er jämmerlich. „Habt Erbarmen mit mir! Bringt mir einen Trunk Wasser!“
Und sofort begann ihr Herz so heftig zu pochen, dass sie ihre Schritte mäßigen musste, obschon sie am liebsten ans Ende der Welt geflüchtet wäre. Als sie aber über den Naschmarkt wieder nach Hause kam, hatte sie ihre alte Sicherheit wiedergewonnen. Heimlich holte sie einen Zinnkrug, noch heimlicher füllte sie ihn, barg ihn unter der Schürze und schlich sich durch die hintere Kellertür zum Zeisgenbauer hinauf. Hier klopfte sie zaghaft an die Tür, und der lange Elias hörte es.
„Wer pocht da!“ rief er unwirsch. „Wär freilich ein ander Ding, wenn ich den Schlüssel zu dieser Tür hätte. Schiebt den Riegel der Klappe zurück, so Ihr noch nicht hier wart!“
Mühsam wurde draußen der Riegel zurückgestoßen, der lange Elias saß auf der Pritsche und rührte sich nicht. Wer konnte es anders sein als der andere Kellerknecht, der ihm das Essen brachte?
Und da erschien plötzlich im engen Rahmen der Öffnung ein liebliches Bild. Wie im Traum erhob er sich, fuhr sich durch das wirre Haar und über die Augen, tastete sich furchtsam an der Mauer entlang, und seine Knie bebten.
„Nehmt schnell!“, flüsterte sie hastig und reichte ihm den Krug herein. „Nur schnell! Ich muss den Krug wieder mitnehmen!“
Aber der lange Elias war wie verzaubert von dem sanften Blick der großen braunen Augen. Mitleid und Trotz und Furcht sprachen daraus.
„Was zögert Ihr!“, drängte sie ihn hastiger. „Ihr habt mich um einen Trunk gebeten. Hier ist er! Eilt, damit man mich nicht erblickt. Es weiß niemand darum!“
Jetzt löste sich etwas im Herzen des langen Elias. Die Starrheit fiel von ihm ab. Mit einem Satz war er an der Tür, riss das Gefäß an sich und tat einen langen, überlangen Trunk. Dann war der Krug leer. Glückselig schaute er auf sie und zögerte, ihr das Gemäß zurückzugeben. Vor Wonne schloss er die Augen. Nun erst kam er dahinter, dass es kein Wasser war, was er getrunken hatte.
„Schöps!“, stöhnte er freudig auf. „Echter Schweidnitzer Schöps! Jungfräulein, habt Ihr gehört, wie es gezischt hat!“
Em Geräusch war draußen vernehmbar. Angstvoll schaute sie sich um, aber es kam niemand.
„Gebt her!“, flüsterte sie drängend. „Wollt Ihr, dass man mich hier erblickt?“
„Da sei Gott vor!“ sprach er und zögerte noch immer. ,,Aber mit Verlaub, schönes Jungfräulein, mein Magen ist wie ein glühender Stein, und dies war nur ein winziges Tröpflein darauf.“
„Ich komme wieder!“, nickte sie hastig. „Nur stille müsst Ihr sein und nicht mehr rumoren und wilde Reden am Fenster führen!“
„Still will ich sein, ganz still wie ein Lämmlein!“, versprach er ihr und hob die beiden Schwurfinger, wobei er den leeren Krug zärtlich an die breite Brust presste. „Schönes Jungfräulein, Ihr seid über alle Maßen gut zu mir, und ich hab solches nicht verdient. Solange Ihr mich versorgt, will ich anhier fein stille halten und mag's auch eine Ewigkeit wahren!“
Dabei erhaschte er ihre weiße Hand und küsste sie so zärtlich auf das feine Gelenk, wie man es einem solch täppischen, groben Riesen niemals zugetraut hätte. Mit fiebernden Wangen huschte sie lautlos davon und blieb eine ganze Weile vor der Kellertür stehen, um ihr Antlitz zu kühlen. Der lange Elias schloss die Türklappe, legte sich auf die Pritsche und strampelte mit beiden Beinen in der Luft herum. Am liebsten hätte er laut aufgeschrien vor Freude. Aber er hatte versprochen, fortan keinen Rumor zu machen und hielt Wort. Als einer der Kellerknechte mit dem Abendbrot kam, wunderte er sich über das überaus vergnügte Gesicht des Gefangenen. Auch dass er nicht hart angefahren wurde, überraschte ihn sehr. Und deshalb wagte er eine Frage, die ihm schon seit ein paar Tagen auf dem Herzen lag. Denn er war im Grunde ein gutmütiger Kerl und hatte hohe Achtung vor dem Zunftgenossen, der ihm an Kraft und an Ausdauer im Dürsten so weit überlegen war.
„Heut ist Weihnacht!“, begann er etwas kleinlaut und stellte Brot und Fleisch und ein Kännlein auf die Klappe. „Da hab ich Euch heimlich ein Schlücklein Wasser mitgebracht. Verratet mich aber nicht.“
„Wasser?“, lächelte selig der lange Elias. „Sauf dem Wasser selbst. Bei mir ist heute das heilige Christkind gewesen und hat mich mit Schöps gelabt!“
In diesem Augenblick fingen die Glocken von Maria Magdalena zu singen an von der frohen Botschaft.
„Hörst du!“, sprach der lange Elias feierlich weiter, denn er hatte einen kleinen Rausch, wies in die Höhe und bekreuzigte sich fromm. „Sie läuten die Christnacht ein. Und grüß mir den Herrn Archidiakonus Nikolaus, wenn du ihn triffst. Er soll sich nicht um mich sorgen. Anitzo behagt es mir im Zeisgenbauer besser als auf dem Dom. Mit dem Wasser aber fahre zum Satan!“
Ganz verschüchtert berichtete der Knecht, was er erlebt hatte. Meister Henlin wiegte bedenklich das Haupt.
„Der Durst ist ihm aufs Gehirn geschlagen!“, sprach er etwas ängstlich.
„Ei, Väterchen!“, lächelte Sabine fein. „Warum soll zu ihm nicht das Christkind kommen, so es doch zu allen Armen und Verlassenen kommt?“
Mit der Erklärung aber war Meister Henlin nicht zufrieden, und er begab sich stracks zu Herrn von der Neißen, der in seinem Stammwinkel saß und wacker zechte. Denn nun war der Sieg des Rates offenbar. Der Keller war voll von Dürstenden, und die Domschenken waren leer. Der Ratsherr ließ Meister Henlins Bericht geduldig über sich ergehen.
„Ihr mögt recht haben!“, erwiderte er endlich und labte sich. „Der Durst ist das größte Übel, was einem Christenmenschen anfallen kann. Gebt ihm Wasser, auch wenn er nicht darum bittet. Wir dürfen den Mann nicht zu Schaden kommen lassen.“
Meister Henlin wollte sich mit einem Kratzfuß zurückziehen, aber der Ratsherr, der heute am Christabend besonders versöhnlicher Laune war, winkte ihn noch einmal heran.
„Und sollte er von seinem Wahn nicht lassen“, fuhr er gütig fort, „dass er weiterhin Gesichte und Erscheinungen hat, so gebt ihm Bier in die Kanne. Wasser ist ein Gesöff fürs Vieh. Vielleicht wird er davon noch verrückter. Versuchtes aber immerhin damit bis über die Feiertage.“
Und es geschah also. Der lange Elias bekam einen Krug mit Wasser und warf ihn nicht auf den Ring hinaus. Aber er trank ihn auch nicht leer. Nicht einen einzigen Tropfen nahm er daraus. Und trotzdem war er niemals durstig und allemal froh wie ein unschuldiges Kindlein, ob schon er doch gefangen saß.
Woher aber diese Fröhlichkeit kam, das wussten nur zwei in ganz Breslau. Und diese beiden schwiegen wie das Wasser im Krug. Meister Henlin aber fasste darüber alsbald die Angst, dass ein Mensch, der dazu noch ein Bierbrauer war, sich ohne Trunk acht Tage im Gefängnis zu sitzen vermaß, und er füllte am neunten Tag den Krug mit Schöps. Den schickte der lange Elias aber nicht leer zurück! Da atmete Meister Henlin auf und berichtete es Herrn Otto von der Neißen. Der war damit zufrieden, und so kam das neue Jahr 1381.
IV
Unterdessen hatte das Domkapitel den Rat mehrmals aufgefordert, das feuchtsüße Christgeschenk des Liegnitzer Herzogs und den langen Elias herauszugeben, doch ohne Erfolg. Konsuln und Schöffen, des leicht errungenen Sieges froh, labten sich an dem billigen Schöps und ließen die Kleriker dürsten und toben. Da griff der Archidiakonus Nikolaus zum letzten Mittel und belegte die Stadt mit dem Interdikt.
Am Fest der Heiligen Drei Könige läuteten noch alle Glocken und vor jedem Altar wurde die Messe gelesen. Doch schon am nächsten Tag lag dumpfes Schweigen über der ganzen Stadt. Alle kirchlichen Handlungen unterblieben, und die frommen Breslauer schauten sich betroffen an. Doch nur einige Tage, dann hatten sie ihren alten, frischen Mut wiedergewonnen. Denn mit der römischen Kirche war zur Zeit der Kirchenspaltung wirklich kein Staat zu machen. Die beiden Päpste taten sich gegenseitig in den Bann. Solch Ärgernis war dem Volke noch nie geboten worden. Und der Breslauer Rat behielt trotz des Interdikts sein ruhiges Blut. Wollten die Pfaffen keine Messen lesen und verschlossen sie die Kirchentüren, nun gut, so hielt man seine Andacht eben im Schweidnitzer Keller ab. Hochzeiten und T außen konnte man anstehen lassen, darüber ging kein Liebesbund und kein Säugling zugrunde. Und für die Toten sorgten die Minoriten von St. Jakob, die ihren Sitz innerhalb der Stadtmauern hatten und sich deshalb mit dem Rate wohl oder übel vertragen mussten. Zudem bestand eine tiefe, innere Abneigung zwischen diesen armen Bettelmönchen und den reichen Domgeistlichen. Da alle gütlichen Vorstellungen des Rates, das Interdikt aufzuheben, nichts fruchteten, wurde dem Dom alle Bierzufuhr abgeschnitten, auch die des einheimischen Bieres. Darüber zeterten zwar die Brauer und Kretschmer, aber das übrige Volk stand treu und fest auf Seiten des Rates. Überdies kamen nun die niederen Leute vom Dom und Sand in die Stadt, um hier ihren Durst zu löschen. Das Domkapitel aber musste sich seitdem an den Wein halten, der in den Domkellern lagerte.
Somit waren alle heimischen Waffen erschöpft, und man ging von beiden Seiten aus, fremde Hilfs truppen anzuwerben, zuerst die Räte des jungen Böhmenkönigs, der sein Land zumeist mit dem Jagdspieß und dem Humpen regierte. Der Rat war nicht arm, aber auch die Kleriker hatten Geld, dieweil sie den Peterspfennig so lange zurückhielten, bis sich die babylonische Verwirrung zwischen Rom und Avignon geklärt haben würde. Und sie sandten heimliche Unterhändler nach Prag, die den Günstlingen des Königs und solchen, die es noch werden konnten, brav und unauffällig die immer hungrigen Taschen spickten. Darüber wurde das Osterfest in Breslau ohne Glockengeläut gefeiert. Doch die guten, frommen Bürger waren nicht minder fröhlich.
Endlich kam von Prag die Nachricht, dass der König Wenzeslaus binnen kurzem in eigener Person zu Breslau einreiten würde, um die Huldigung der schlesischen Stände entgegenzunehmen und den Bierstreit zu schlichten. Die Vorsicht der königlichen Räte sorgte schon dafür, dass sich jede Partei den zukünftigen Sieg zugute schrieb. Bis dahin schröpften sie wacker auf beiden Seiten. Auch wussten sie selbst nicht, wohin sich der König wenden würde, denn er war bei aller Gutmütigkeit seines Herzens hochfahrend, jähzornig und gar selten Herr seiner blitzschnellen Entschlüsse. Dem Domkapitel zwar war er nicht hold gesonnen, da es seinen Günstling nicht zum Bischof gekürt hatte. Doch der Schaden konnte noch immer gutgemacht werden. Und der Archidiakon Nikolaus ließ durchblicken, dass sich das Domkapitel, falls es im Bierstreit obsiegte, gern einen Bischof von des Königs Gnaden gefallen lassen würde. Im Grunde seines Herzens jedoch dachte dieser verschlagene Kleriker ganz anders.
Der Rat aber erwog nun in Ansehung des königlichen Besuches die Freilassung des langen Elias. Es hatte jetzt, nachdem der Streit so weit gediehen war, keinen Zweck mehr, den unschuldigen Bierbrauer weiter in Gewahrsam zu halten. Und so öffnete sich eines Morgens sein Gefängnis, und Herr Otto von der Neißen forderte ihn auf, die Gastfreundschaft des Rates nicht länger in Anspruch zu nehmen. Das ging dem langen Elias bös gegen den Strich. Denn er saß sehr gern im Zeisgenbauer. Nirgends bekam er von so schöner Hand Freischöps kredenzt wie hier.
„Ich bleibe da, wo ich sitze!“, rief er trotzig steckte die Fäuste in die Taschen und stieß die Beine von sich. „Unschuldig bin ich in das Zeisgenbauer gesetzt worden. Und ich gehe nicht eher daraus hervor, bis mir vom Rat Sühne wird!“
Herr Otto von der Neißen war über diese Frechheit sprachlos. Zornröte stieg ihm unter die Augen und sein Atem ging schnaufend wie ein Blasebalg. Da lenkte der lange Elias ein, denn er sah, dass mit dem Rate, insonderheit mit dem Kellerschöffen, nicht zu spaßen war.
„Gönnet mir bis morgen Frist!“, bat er und zog die Beine an sich, ohne aber von der Pritsche aufzustehen. „Ich will mir das Ding noch einmal beschlafen.“
„Sitz, bis du schwarz wirst, du Narr!“, schrie der Schöffe erbost, besann sich aber schnell eines Besseren. „So du morgen Mittag noch hier bist, werden dich die Büttelknechte hinaus kehren!“
Damit stampfte er wütend davon und ließ die Tür offenstehen. Der lange Elias zog sie leise zu, dass sie angelehnt war, und lachte sich heimlich ms Fäustchen, legte sich auf die Pritsche und wartete. Es wurde Mittag doch der Kellerknecht, der ihm sonst Speise und Trank gebracht hatte, blieb weg. Auch am Abend ließ sich keiner blicken. Als aber die Mitternacht heranzog öffnete sich sacht die Klappe in der Tür, und Sabine schaute herein. Ein schwaches Lämpchen, das sie trug, beleuchtete rötlich ihre lieblichen Züge. Wie jeden Abend brachte sie auch diesmal einen Krug schäumenden Schöps.
„Jungfräulein!“, flüsterte der lange Elias, ließ den Krug stehen und haschte nach ihrer Hand. „Heut müssen wir voneinander Abschied nehmen. Doch fürchtet Euch nicht. Über eine kleine Weile bin ich wieder bei Euch als ein freier Mann!“
„So seid Ihr frei?“, sprach sie schnell, entzog ihm hastig die Hand, und ihre Augen schimmerten feucht. Freude und Bedauern kämpften in ihrer schwankenden Stimme.
„Nicht also!“, tröstete er sie. „Von nun an bin ich Euer Gefangener mit Leib und Seele.“