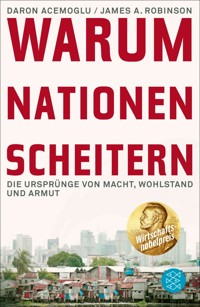
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der Klassiker – von den Wirtschaftsnobelpreisträgern 2024, eine Pflichtlektüre! Warum sind Nationen reich oder arm? Starökonom Daron Acemoglu und Harvard-Politologe James Robinson geben eine ebenso schlüssige wie eindrucksvolle Antwort auf diese grundlegende Frage. Anhand zahlreicher, faszinierender Fallbeispiele – von den Conquistadores über die Industrielle Revolution bis zum heutigen China, von Sierra Leone bis Kolumbien – zeigen sie, mit welcher Macht die Eliten mittels repressiver Institutionen sämtliche Regeln zu ihren Gunsten manipulieren - zum Schaden der vielen Einzelnen. Ein spannendes und faszinierendes Plädoyer dafür, dass Geschichte und Geographie kein Schicksal sind. Und ein überzeugendes Beispiel, dass die richtige Analyse der Vergangenheit neue Wege zum Verständnis unserer Gegenwart und neue Perspektiven für die Zukunft eröffnet. Ein provokatives, brillantes und einzigartiges Buch. »Dieses Buch werden unsere Ur-Ur-Urenkel in zweihundert Jahren noch lesen.« George Akerlof, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften »Eine absolut überzeugende Studie.« Gary S. Becker, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften »Ein wirklich wichtiges Buch.« Michael Spence, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften »Acemoglu und Robinson begeistern und regen zum Nachdenken an.« Robert Solow, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften »Ein wichtiges, unverzichtbares Werk.« Peter Diamond, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften »Ein wichtiger Beitrag zur Debatte, warum Staaten mit gleicher Vorrausetzung sich so wesentlich in wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen unterscheiden.« Kenneth J. Arrow, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften »Diese faktenreiche und ermutigende Streitschrift lehrt uns, dass die Geschichte glücklich enden kann, wenn ihr kein Mensch mehr als Versuchsobjekt dient.« Michael Holmes, NZZ am Sonntag »Anderthalb Jahrzehnte Arbeit eines Pools von Wissenschaftlern, auf 600 Seiten zusammengefasst durch zwei Forscher von Weltrang – und dies kommt heraus: eine Liebeserklärung an Institutionen, die im Sinne ihrer Bürger funktionieren. […] bestechend.« Elisabeth von Thadden, Die Zeit »Sie werden von diesem Buch begeistert sein.« Jared Diamond, Pulitzer Preisträger und Autor der Weltbestseller »Kollaps« und »Arm und Reich« » Ein höchst lesenswertes Buch.« Francis Fukuyama, Autor des Bestsellers »Das Ende der Geschichte« »Ein phantastisches Buch. Acemoglu und Robinson gehen das wichtigste Problem der Sozialwissenschaften an – eine Frage, die führende Denker seit Jahrhunderten plagt – und liefern eine in ihrer Einfachheit und Wirkmächtigkeit brillante Antwort. Eine wunderbar lesbare Mischung aus Geschichte, Politikwissenschaft und Ökonomie, die unser Denken verändern wird. Pflichtlektüre.« Steven Levitt, Autor von »Freakonomics«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 806
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Daron Acemoglu | James A. Robinson
Warum Nationen scheitern
Die Ursprünge von Macht, Wohlstand und Armut
Über dieses Buch
Schon jetzt ein Klassiker - von fünf Wirtschaftsnobelpreisträgern empfohlen, eine Pflichtlektüre!
Warum sind Nationen reich oder arm?
Starökonom Daron Acemoglu und Harvard-Politologe James Robinson geben eine ebenso schlüssige wie eindrucksvolle Antwort auf diese grundlegende Frage. Anhand zahlreicher, faszinierender Fallbeispiele – von den Conquistadores über die Industrielle Revolution bis zum heutigen China, von Sierra Leone bis Kolumbien – zeigen sie, mit welcher Macht die Eliten mittels repressiver Institutionen sämtliche Regeln zu ihren Gunsten manipulieren - zum Schaden der vielen Einzelnen. Ein spannendes und faszinierendes Plädoyer dafür, dass Geschichte und Geographie kein Schicksal sind. Und ein überzeugendes Beispiel, dass die richtige Analyse der Vergangenheit neue Wege zum Verständnis unserer Gegenwart und neue Perspektiven für die Zukunft eröffnet. Ein provokatives, brillantes und einzigartiges Buch.
»Eine absolut überzeugende Studie.«
Gary S. Becker, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften
»Ein wirklich wichtiges Buch.«
Michael Spence, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften
»Acemoglu und Robinson begeistern und regen zum Nachdenken an.«
Robert Solow, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften
»Ein wichtiges, unverzichtbares Werk.«
Peter Diamond, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften
»Ein wichtiger Beitrag zur Debatte, warum Staaten mit gleicher Vorrausetzung sich so wesentlich in wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen unterscheiden.«
Kenneth J. Arrow, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften
»Sie werden von diesem Buch begeistert sein.«
Jared Diamond, Pulitzer Preisträger und Autor der Weltbestseller »Kollaps« und »Arm und Reich«
» Ein höchst lesenswertes Buch.«
Francis Fukuyama, Autor des Bestsellers »Das Ende der Geschichte«
»Dieses Buch werden unsere Ur-Ur-Urenkel in zweihundert Jahren noch lesen.« George Akerlof, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften
»Ein phantastisches Buch. Acemoglu und Robinson gehen das wichtigste Problem der Sozialwissenschaften an – eine Frage, die führende Denker seit Jahrhunderten plagt – und liefern eine in ihrer Einfachheit und Wirkmächtigkeit brillante Antwort. Eine wunderbar lesbare Mischung aus Geschichte, Politikwissenschaft und Ökonomie, die unser Denken verändern wird. Pflichtlektüre.«
Steven Levitt, Autor von »Freakonomics«
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Daron Acemoglu ist Professor für Wirtschaftswissenschaften am renommierten Massachussetts Institute for Technology (MIT). Er gehört zu den zehn meist zitierten Wirtschaftswissenschaftlern weltweit und ist Träger der John-Bates-Clark-Medaille, die oft als eine Art Vorstufe zum Nobelpreis betrachtet wird.
James Robinson ist Politik- und Wirtschaftswissenschaftler und Professor an der Harvard University. Er gilt weltweit als der Experte für Lateinamerika und Afrika. Er arbeitete in Botswana, Mauritius, Sierra Leone und Südafrika.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel
»Why Nations Fail. The Origins of Power, Psoperity, and Poverty«
im Verlag Crown Business, Crown Publishing Group, Random House, Inc., New York.
© 2012 Daron Acemoglu und James A. Robinson
Für die deutsche Ausgabe:
© 2013 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Karten © Peter Palm, Berlin
ISBN 978-3-10-402247-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Vorwort
1. So nah und doch so verschieden
Die wirtschaftliche Situation am Rio Grande
Die Gründung von Buenos Aires
Von Cajamarca …
… nach Jamestown
Eine Geschichte aus zwei Verfassungen
Einen Einfall haben, eine Firma gründen und einen Kredit aufnehmen
Pfadabhängiger Wandel
Wie man ein oder zwei Milliarden erwirbt
Ansatz für eine Theorie der Weltungleichheit
2. Theorien, die nicht funktionieren
Die Lage der Dinge
Die Geographie-Hypothese
Die Kultur-Hypothese
Die Ignoranz-Hypothese
3. Die Schaffung von Wohlstand und Armut
Die Ökonomie am 38. Breitengrad
Extraktive und inklusive Wirtschaftsinstitutionen
Wohlstandsmotoren
Extraktive und inklusive politische Institutionen
Warum entscheidet man sich nicht immer einfach für den Wohlstand?
Die lange Agonie des Kongo
Wachstum unter extraktiven politischen Institutionen
4. Kleine Unterschiede und Umbruchphasen: Die Last der Geschichte
Die Welt, die von der Pest geschaffen wurde
Die Schaffung inklusiver Institutionen
Kleine Unterschiede, auf die es ankommt
Der Unwägbarkeitspfad der Geschichte
Wie man die Lage der Dinge verstehen kann
5. »Ich habe die Zukunft gesehen, und sie funktioniert«: Wachstum unter extraktiven Institutionen
Ich habe die Zukunft gesehen
An den Ufern des Kasai
Der Lange Sommer
Die instabile Extraktion
Was geht schief?
6. Auseinanderdriften
Wie Venedig ein Museum wurde
Römische Tugenden …
… und römische Laster
Niemand schreibt aus Vindolanda
Divergierende Pfade
Konsequenzen des frühen Wachstums
7. Die Wende
Probleme mit Strümpfen
Ständiger politischer Konflikt
Die Glorreiche Revolution
Die Industrielle Revolution
Warum in England?
8. Nicht in unserem Revier: Entwicklungsschranken
Drucken verboten
Ein kleiner Unterschied, auf den es ankam
Furcht vor Industrie
Transport verboten
Der Absolutismus des Priesterkönigs Johannes
Die Kinder von Samaale
Nachhaltige Rückständigkeit
9. Umkehr der Entwicklung
Gewürze und Völkermord
Die allzu übliche Institution
Die duale Wirtschaft
Umgekehrte Entwicklung
10. Die Verteilung des Wohlstands
Ganovenehre
Überwindung der Barrieren: die Französische Revolution
Export der Revolution
Die Suche nach der Moderne
Wurzeln der Weltungleichheit
11. Der Tugendkreis
Der Black Act
Der langsame Marsch der Demokratie
Zerschlagung von Trusts
Die Richterernennungen
Positives Feedback und Tugendkreise
12. Der Teufelskreis
Es fahren keine Züge mehr nach Bo
Von der encomienda zum Landraub
Von der Sklaverei zu Jim Crow
Das Eherne Gesetz der Oligarchie
Negatives Feedback und Teufelskreise
13. Warum Nationen heute scheitern
Wie man in Simbabwe in der Lotterie gewinnt
Ein Kinderkreuzzug?
Wer ist der Staat?
El Corralito
Der neue Absolutismus
King Cotton
Die Verzerrung der Wettbewerbsbedingungen
Warum Nationen scheitern
14. Den Rahmen sprengen
Drei afrikanische Chiefs
Das Ende der südstaatlichen Extraktion
Wiedergeburt in China
15. Wohlstand und Armut verstehen
Historische Ursprünge
Der unwiderstehliche Charme des autoritären Wachstums
Wohlstand lässt sich nicht konstruieren
Das Scheitern der Auslandshilfe
Empowerment
Danksagung
Bibliographischer Essay und Quellen
Vorwort
Kapitel 1: So nah und doch so verschieden
Kapitel 2: Theorien, die nicht funktionieren
Kapitel 3: Die Schaffung von Wohlstand und Armut
Kapitel 4: Kleine Unterschiede und Umbruchphasen
Kapitel 5: »Ich habe die Zukunft gesehen, und sie funktioniert«
Kapitel 6: Auseinanderdriften
Kapitel 7: Die Wende
Kapitel 8: Nicht in unserem Revier
Kapitel 9: Umkehr der Entwicklung
Kapitel 10: Die Verbreitung des Wohlstands
Kapitel 11: Der Tugendkreis
Kapitel 12: Der Teufelskreis
Kapitel 13: Warum Nationen heute scheitern
Kapitel 14: Den Rahmen sprengen
Kapitel 15: Wohlstand und Armut verstehen
Quellen für die Karten
Literaturverzeichnis
Für Ada und Asu – DA
Para María Angélica, mi vida y mi alma – JR
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Während wir dieses Vorwort schreiben, ist Europa im Aufruhr. Die Krise der Eurozone setzt sich fort, und das Ausmaß der Konflikte sowohl innerhalb der europäischen Staaten als auch zwischen ihnen ist alarmierend. Überall fragt man sich, ob der Euro – und vor allem die Europäische Union – die Krise überleben wird. Viele sind davon überzeugt, dass der gesamte europäische Vereinigungsprozess ein Fehler war oder dass er zumindest mit der Währungsunion zu weit gegangen ist.
In solchen Momenten der Ungewissheit und Besorgnis kann leicht vergessen werden, was Europa in den vergangenen 65 Jahren erreicht hat – und warum.
Als der Zweite Weltkrieg am 8. Mai 1945 endete, lagen große Teile Europas in Trümmern, und Deutschland wurde zuerst von der Roten Armee, die es auf Zerstörung und Rache abgesehen hatte, und dann von den alliierten Streitkräften überrollt. Aber schon vorher war es verwüstet. Hamburg, Köln, Düsseldorf, Dresden und viele andere Städte waren durch Flächenbombardements dem Erdboden gleichgemacht worden. Allein in den letzten beiden Wochen der Schlacht um Berlin feuerte die Rote Armee dort ca. 40000 Tonnen Granaten ab, wonach kaum noch ein Viertel der Gebäude bewohnbar war. Rund 20 Millionen Deutsche waren obdachlos, und 10 Prozent der Vorkriegsbevölkerung hatten den Tod gefunden. Bald darauf trafen zudem Wellen vertriebener und meist mittelloser Deutscher aus Osteuropa ein. Frankreich, Belgien und den Niederlanden erging es nach den Blutbädern und Plünderungen während der deutschen Besatzung nicht besser, und Großbritannien sollte Jahre benötigen, um sich von seinen gewaltigen Kriegsaufwendungen und den Folgen der deutschen Bombardierungen zu erholen.
Auch die wirtschaftliche Lage war katastrophal. Am Kriegsende war Europa zurückgefallen, und kaum jemand verfügte über Kühlschränke oder über Zentralheizungen oder hatte Wasserklosetts, die in den Vereinigten Staaten selbstverständlich waren. In Großbritannien hatte man nur in der Hälfte der Häuser fließendes heißes Wasser oder eine Innentoilette, in etwas mehr Wohnungen verfügte man über ein eingebautes Bad, und die 40 Millionen Einwohner besaßen nur 5000 Fernsehapparate. Der Kapitalbesitz war durch den Krieg vernichtet worden, und für die zivile Industrie existierte kaum noch hinreichend Investitionskapital.
Auch in politischer und sozialer Hinsicht hatten die Menschen wenig Grund zum Optimismus. Viele dachten, dass die Demokratie im größten Teil Europas nicht Fuß fassen könne und dass manche Länder konservativ-autoritär und andere kommunistisch werden würden. Zudem schien die Geschichte darauf hinzuweisen, dass ein weiterer Krieg bevorstand.
Aber zur allgemeinen Überraschung kam es in Europa nicht erneut zum Krieg, sondern die europäischen Demokratien gediehen und wurden stärker. Vielleicht am verblüffendsten ist, dass Westeuropa bis zum Ölpreisschock von 1973 die wirtschaftlich erfolgreichsten drei Jahrzehnte seiner Geschichte erlebte. Obwohl viele europäische Staaten in den späten 70er und frühen 80er Jahren diverse Krisen meistern mussten und einige unter beängstigend hohen Arbeitslosenzahlen litten, haben sich auch die vergangenen dreißig Jahre als recht positiv für Europa erwiesen. Es hat sein Wachstum fortgesetzt, auch wenn der Abstand zwischen ihm und den reicheren Ländern wie den Vereinigten Staaten und Kanada gewachsen ist.
Wie erklärt sich diese erstaunliche Wende im Schicksal Europas?
Über den Erfolg oder das Scheitern von Nationen wird viel geschrieben. Manche behaupten, dass die Geographie der entscheidende Faktor sei: Gewisse geographische Faktoren, etwa ein gemäßigtes Klima und ein ungehinderter Zugang zum Meer oder Bodenschätzen wie Kohle, seien förderlich für das Wirtschaftswachstum, andere dagegen nicht. Manche betonen kulturelle Faktoren: Bestimmte Werte und Verhaltensweisen, beispielsweise die protestantische Ethik oder vielleicht judäisch-christliche Ideale oder das nordische oder deutsche Arbeitsethos, seien hilfreich für die Wirtschaftsentwicklung, während südeuropäische oder afrikanische Einstellungen eher ein Hindernis bildeten. Noch andere sehen die Ursache bei einer aufgeklärten oder unaufgeklärten politischen Führung: Manche Regierungen würden in ihrem Staat für Wohlstand sorgen, weil sie die Probleme durchschauten oder den richtigen Rat erhielten, während andere überholten Ideen oder Ratgebern mit veralteten Theorien folgten und ihren Staat dadurch ruinierten.
Aber keiner dieser beliebten Ansätze gibt Aufschluss über die bemerkenswerte Wende in Europa. Die Geographie hat sich natürlich nicht geändert, weshalb geographische Theorien auch nicht erklären können, warum die europäische Demokratie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts so zerbrechlich und die europäischen Ökonomien so angeschlagen waren und wieso sich all das in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts umkehrte. Das Gleiche gilt für die Kultur. Man kann darüber diskutieren, ob es eine typisch französische oder deutsche Kultur gibt, doch selbst wenn das der Fall ist, lassen sich damit die Entwicklungen dieser Staaten vor 1945 und nach 1945 nicht plausibel erklären.
Selbstverständlich kommt es auf die politische Führung an. Hitler brachte nicht nur Tod und Gemetzel über Europa, sondern auch Ruin und Schande über Deutschland. Aber er wurde nicht aus dem Weltraum an die Macht katapultiert, sondern viele gewöhnliche Bürger und eine große Zahl von Unternehmen unterstützten ihn. Vor allem jedoch gaben sich zahlreiche Angehörige des Establishments in Deutschland große Mühe, die Weimarer Republik zu unterminieren. Leider waren die Eliten und ihre Parteien sowie die Kommunisten, welche die Demokratie gleichermaßen ablehnten, letztlich erfolgreich. In der Nachkriegszeit dagegen kam es zu keinem derart konzertierten Angriff auf die Demokratie – oder auf das, was wir als inklusive politische Institutionen bezeichnen und wodurch umfassende politische Gleichheit und Restriktionen der Macht sichergestellt werden. Dies hat nichts mit aufgeklärter Führung oder mit der Weisheit oder Ignoranz von Politikern zu tun. Man kann nicht behaupten, dass die Vorkriegspolitiker über die Maßnahmen im Unklaren gewesen wären, die ihren Staaten Wohlstand oder Vernichtung brachten. Doch sie hatten andere Ziele, die in den Entscheidungen, welche sie für ihre Länder trafen, zum Ausdruck kamen.
Es ist kein Zufall, dass diese Theorien uns wenig Aufschluss über den europäischen Erfolg geben. Überhaupt teilen sie uns wenig über den Erfolg oder das Scheitern von Staaten mit.
Im vorliegenden Buch wird ein anderer Ansatz zur Untersuchung der Ursachen des Erfolgs und des Scheiterns von Nationen vertreten. Unserer Meinung nach sind es die von den Staaten gewählten Regeln – oder Institutionen –, die darüber bestimmen, ob sie wirtschaftlich erfolgreich sind oder nicht. Das Wirtschaftswachstum wird von Innovationen sowie vom technologischen und organisatorischen Wandel angetrieben, die sich den Ideen, den Begabungen, der Kreativität und der Energie von Individuen verdanken. Aber dazu bedarf es entsprechender Anreize. Zudem sind Fähigkeiten und Ideen breit über die Gesellschaft verstreut, weshalb ein Staat, der große Teile der Bevölkerung benachteiligt, kaum das vorhandene Innovationspotential nutzen und vom wirtschaftlichen Wandel profitieren dürfte. All das legt eine einfache Schlussfolgerung nahe: Den Schlüssel zu nachhaltigem wirtschaftlichem Erfolg findet man im Aufbau einer Reihe von Wirtschaftsinstitutionen – inklusiver Wirtschaftsinstitutionen –, welche die Talente und Ideen der Bürger eines Staates nutzbar machen können, indem sie geeignete Anreize und Gelegenheiten bieten, dazu gesicherte Eigentums- und Vertragsrechte, eine funktionierende Justiz sowie einen freien Wettbewerb, so dass sich die Bevölkerungsmehrheit produktiv am Wirtschaftsleben beteiligen kann.
Inklusive Wirtschaftsinstitutionen sind in der Geschichte jedoch durchweg die Ausnahme und nicht die Regel. Viele heutige und frühere Staaten stützen sich auf von uns als extraktiv bezeichneten Wirtschaftsinstitutionen, die keine sicheren Eigentumsrechte bieten, nicht für Gesetz und Ordnung und die Einhaltung von Verträgen sorgen und Innovationen nicht belohnen. Auf keinen Fall sorgen sie für faire Wettbewerbsbedingungen, sondern sie werden von den Herrschenden gestaltet, die auf Kosten der übrigen Gesellschaft aus den von ihnen geschaffenen Verhältnissen Gewinn ziehen.
Inklusive oder extraktive Wirtschaftsinstitutionen entstehen nicht als vorherbestimmte Resultate spezifischer geographischer Umstände. Sie sind auch nicht das Produkt spezifischer Kulturen oder kluger Ökonomen, auch wenn intellektuelle Innovationen genauso wichtig sind wie technologische. Vielmehr sind Institutionen das kollektive Ergebnis politischer Prozesse. Mithin ist die Schaffung inklusiver Wirtschaftsinstitutionen ein politischer Akt, und auch ihr Überleben hängt ausschließlich von der Politik ab.
Zum Beispiel müssen inklusive Wirtschaftsinstitutionen von inklusiven politischen Institutionen unterstützt werden, die politische Gleichheit und eine breite Beteiligung der Bevölkerung am politischen Geschehen sowie die Macht von zentralisierten Staaten zur Regulierung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten erfordern. Ein freier wirtschaftlicher Wettbewerb kann ohne diese breite Beteiligung am politischen Geschehen nicht überleben, und ein Mangel an politischer Zentralisierung macht die Entstehung sicherer Eigentumsrechte, einer verlässlichen Justiz sowie die Wahrung von Recht und Ordnung schwierig oder unmöglich.
Extraktive Wirtschaftsinstitutionen hingegen werden zumeist ihrerseits von extraktiven politischen Institutionen unterstützt, unter denen sich die politische Macht auf eine kleine Elite konzentriert, deren Machtausübung kaum Kontrollen unterliegt (manchmal wird auch nicht einmal ein Mindestmaß an Recht und Ordnung garantiert). Schließlich würde sich eine unter inklusiven politischen Institutionen gestärkte Bevölkerungsmehrheit nicht für das Überleben von Wirtschaftsinstitutionen, von denen sie ausgebeutet wird, einsetzen.
Das vorliegende Buch erläutert, wie inklusive und extraktive Institutionen funktionieren, welche Auswirkungen sie auf die wirtschaftlichen Ergebnisse haben und wie sie sich im Lauf der Zeit entwickeln, in ihrem Zustand verharren oder sich ändern.
Was also verlief im Licht dieser Rahmenbedingungen nach dem Krieg richtig in Europa?
Bis zu einem gewissen Grad ist die Antwort ganz einfach. Die politischen europäischen Institutionen sind seit dem Krieg zunehmend inklusiv und demokratisch, was sich in einer breiten Beteiligung an den Wahlen und am politischen Geschehen auf nationaler und lokaler Ebene ausdrückt. Zudem sind sie im Umgang mit Konflikten und Herausforderungen viel robuster geworden und haben die Fallstricke vermieden, die jungen Demokratien wie der Weimarer Republik zum Verhängnis wurden. Wirtschaftlich garantieren sie Stabilität, sichere Eigentums- und Vertragsrechte, eine zuverlässige Justiz sowie, was das Wichtigste ist, einen freien Wettbewerb in ganz Westeuropa. Wenn man beispielsweise verstehen will, warum Deutschland Erfolg hatte, sollte man zunächst die Stärke und Intensität der wirtschaftlichen und politischen Institutionen im Westdeutschland der Nachkriegszeit zur Kenntnis nehmen.
Aber genauso wie lokale Wirtschaftsinstitutionen – auf regionaler, städtischer und dörflicher Ebene – nicht unabhängig von ihren nationalen Pendants sind, existieren diese im Kontext internationaler Institutionen. Die Weimarer Republik wurde nicht nur durch die Feindschaft vonseiten der traditionellen Eliten und durch die verschiedenen von ihnen kontrollierten Institutionen vernichtet, sondern auch durch den europäischen Kontext. Und das Naziregime, das sich aus der Asche der Weimarer Republik erhob, zerstörte die sich abmühenden Regierungen in Belgien, Frankreich, den Niederlanden, der Tschechoslowakei und Polen. Damit war klar, dass es in Westeuropa nicht zur Bildung inklusiver politischer und dann wirtschaftlicher Institutionen kommen würde, ohne dass internationale Einrichtungen für Frieden und Stabilität sorgten.
All das wurde letztlich Aufgabe einer einzigen zentralen Institution: der Europäischen Union. Es begann 1951 mit dem Vertrag von Paris über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, der sechs Staaten – Westdeutschland, Frankreich, Italien, Belgien, die Niederlande und Luxemburg – angehörten. Sie wurde 1957 durch den Vertrag von Rom zu dem ehrgeizigeren Integrationsprojekt der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und 1993 schließlich zur Europäischen Union erweitert.
Und es funktionierte: Europa ist seit 1951 einem Krieg nicht einmal nahegekommen, und die Mitgliedsländer sahen ihre Demokratien nie bedroht. Die Ausnahme bestätigte die Regel, denn Spanien entging 1981, nach Francos Tod, nur knapp einem Militärputsch; doch das geschah, bevor es sich 1986 der Europäischen Gemeinschaft anschloss. Zwar fand auf dem Kontinent, nämlich in Jugoslawien, ein blutiger Bürgerkrieg statt, aber er entwickelte sich außerhalb des Einflussbereichs der Europäischen Union.
Die Europäische Union und das von ihr geschaffene Bündnis bewirkten nicht nur, dass die inklusiven Institutionen in den sechs Gründerstaaten überlebten und gediehen, sondern sie dienten auch als Fundament für den Übergang zu inklusiveren Institutionen in Ländern wie Griechenland, Portugal und Spanien, die sich von ihren repressiven Diktaturen erholten und, nach 1989, in den osteuropäischen Staaten, die sich vom Kommunismus lösten.
Folglich ist es keine Übertreibung, die Europäische Union als Bollwerk für Frieden und Stabilität zu bezeichnen, auf das sich die inklusiven nationalen Institutionen und der umfassende wirtschaftliche Wohlstand im Nachkriegseuropa gründen.
Wenn es stimmt, dass die Institutionen den Schlüssel zum Verständnis des Wachstums der Nachkriegszeit liefern und die Europäische Union das Zentrum der kontinentalen Institutionen bildet, stehen wir dann kurz davor, das ganze Gebäude zusammenbrechen zu sehen?
Zurzeit kann man beim Gedanken an die Zukunft Europas verzweifeln. Es sind schwerwiegende Wirtschaftsprobleme entstanden, und es scheint an dem politischen Willen zu fehlen, den Euro zu retten oder die Europäische Union zu stärken, indem man glaubwürdige Schritte zur fiskalischen und politischen Zentralisierung, einschneidende Reformen der verbliebenen extraktiven wirtschaftlichen und politischen Institutionen alten Stils sowie kurzfristige makroökonomische Maßnahmen unternimmt, um das Abgleiten mehrerer Randstaaten in eine umfassende Depression zu verhindern. Gleichwohl stimmen uns die Lektionen, die man aus diesem Buch lernen kann, optimistisch.
Jegliche Institutionen, sogar durch und durch inklusive, können durch Krisen und Herausforderungen geschwächt werden – ähnlich wie die Weimarer Republik von ihren Gegnern und denen, die sich vor inklusiven Institutionen fürchteten, vernichtet wurde oder wie die inklusiven politischen Institutionen Venedigs den wirtschaftlich mächtigen Familien zum Opfer fielen, welche die Wettbewerbsbedingungen zu ihren eigenen Gunsten verzerren wollten (siehe sechstes Kapitel). Doch ihrem Wesen nach erzeugen inklusive Institutionen ein Feedback, eine Art Tugendkreis, der sie in den Stand versetzt, auszuhalten und sich Herausforderungen zu stellen. Wenn weiten Kreisen der Gesellschaft wirtschaftliche Anreize und Chancen geboten werden, dann gilt das Gleiche auch für Einkommen, Wohlstand und politische Macht. Dadurch wird die politische durch die wirtschaftliche Inklusivität gestärkt. Auf ähnliche Art sorgt die Verteilung politischer Macht auf breite Bevölkerungskreise in der Regel dafür, dass Wirtschaftsinstitutionen inklusiv werden. Im elften Kapitel zeigen wir, wie amerikanische und britische inklusive Institutionen im 19. und frühen 20. Jahrhundert mit großen Herausforderungen fertig wurden.
Die Herausforderung in Europa ist nicht durch fundamentale strukturelle Mängel oder durch die Inklusivität seiner Institutionen entstanden, sondern durch die Finanzkrise und die sich anschließende schwere Rezession, durch welche die bereits bestehenden Verwerfungen noch vertieft wurden. Ein bedeutender Teil des Problems besteht in den tatsächlichen oder von den Finanzmärkten so wahrgenommenen impliziten Garantien für die Staatsschulden sämtlicher europäischer Länder – als wären all diese Schulden so sicher wie die der Bundesrepublik, selbst wenn die dortigen Politiker gewaltige Schuldenberge aufgehäuft haben. Dies förderte eine unhaltbare Expansion der Kapitalströme in Richtung von Ländern, in denen noch keine inklusiven Institutionen Fuß gefasst haben und wo die politischen Eliten weiterhin in der Lage sind, die Regeln zu ihrem eigenen Vorteil und dem ihrer Anhänger zu verdrehen.
Die Beschäftigung mit diesen Problemen wird schmerzhaft sein und unzweifelhaft zum Aufstieg aller möglichen populistischen Politiker, von links wie von rechts, führen, die versuchen werden, die Inklusivität umzukehren. Trotzdem bleiben wir optimistisch, denn die inklusiven Institutionen der europäischen Staaten und der Europäischen Union leisten den Hauptwiderstand gegen ihr eigenes Verderben und stellen die Basis dar, auf welcher die für die Stärkung Europas erforderlichen Entscheidungen getroffen werden können.
Was getan werden muss, ist kein großes Geheimnis, doch es kommt darauf an, den geeigneten politischen Weg zu finden. Die Parallele zu den Vereinigten Staaten zwischen den Konföderationsartikeln von 1781 und der Ratifizierung der US-Verfassung von 1788 liegt auf der Hand. Damals waren die Gemeinwesen in den Vereinigten Staaten, genau wie heute in Europa, unter einer schwachen Zentralregierung ohne die Macht, Steuern zu erheben und eine Fiskalpolitik zu betreiben, zu einer Währungsunion zusammengeschlossen. Vor 1788 wäre das amerikanische Problem einem Beobachter genauso ausweglos erschienen. Aber der Sumpf wurde mit Hilfe der US-Verfassung trockengelegt, die der Zentralregierung die (beschränkte) Macht verlieh, Steuern zu erheben und Geldmittel über die Staatsgrenzen hinweg zu verteilen, während die Verschuldung der Staaten gleichzeitig auf die Zentralregierung übertragen wurde. Im heutigen Sprachgebrauch: Man rettete Staaten, die sonst zahlungsunfähig geworden wären. Diese neue institutionelle Regelung erwies sich als stabiler, weil es die Trittbrettfahrerprobleme vermied, die für ein System mit gemeinsamen Geldmitteln, doch mit einer unabhängigen einzelstaatlichen Fiskalpolitik typisch sind. Entscheidend war jedoch, dass sich die US-Regierung weigerte, den Finanzmärkten eine pauschale Garantie für die Staatsschulden zu geben. Nach 1829, als viele Staaten steigende Defizite aufwiesen, ließ die Regierung Zahlungsausfälle zu. Dies führte nicht zu einer untragbaren Arbeitslosigkeit und einer Einfrierung von Geldern auf den Finanzmärkten, weil es sich im Rahmen einer funktionierenden fiskalischen und politischen Union abspielte.
Der gleiche Weg steht Europa offen. Aber es ist auch wesentlich, dass dies nicht als ein weiteres Manöver von cleveren Bürokraten in Brüssel empfunden wird. Die Entscheidung für eine größere fiskalische und politische Zentralisierung ist fraglos eine politische, und sie kann und soll nur dann erfolgen, wenn sie über eine breite Unterstützung verfügt. Wenn es einen Punkt gibt, an dem es auf Führung ankommt, dann ist es der, an dem man sich der Situation gewachsen zeigt, die machbaren politischen Alternativen formuliert und die für den politischen Wandel erforderliche breite politische Koalition schmiedet. Hoffen wir, dass die heute in Europa maßgebenden Politiker die nötige Weisheit und den nötigen Mut aufbringen. Im vorliegenden Buch untersuchen wir Fälle, in denen die Regierenden einen solchen Mut hatten.
Vorwort
Dieses Buch handelt von den gewaltigen Unterschieden im Einkommen und Lebensstandard, die zwischen den reichen Ländern der Welt, zum Beispiel den Vereinigten Staaten, Großbritannien oder Deutschland, und den armen, etwa im subsaharischen Afrika, in Zentralamerika oder in Südasien, bestehen.
Während wir dieses Vorwort schreiben, wird der Nahe Osten vom »Arabischen Frühling« erschüttert, ausgelöst von der Jasmin-Revolution in Tunesien, die ihrerseits am 17. Dezember 2010 durch die öffentliche Empörung über die Selbstverbrennung des Straßenhändlers Mohammed Bouazizi eingeleitet wurde. Am 14. Januar 2011 trat Präsident Zine el-Abidine Ben Ali zurück, der Tunesien seit 1987 regiert hatte. Doch der revolutionäre Eifer, der sich gegen die Herrschaft der privilegierten Eliten in Tunesien richtete, flaute keineswegs ab, sondern wurde stärker und hatte bereits auf die anderen Länder des Nahen Ostens übergegriffen. Hosni Mubarak, der Ägypten seit fast dreißig Jahren mit fester Hand regiert hatte, wurde am 11. Februar 2011 aus dem Amt entfernt. Das Schicksal der Regime in Bahrain, Libyen, Syrien und Jemen ist während der Niederschrift dieses Vorworts noch unbekannt.
Die Wurzeln der Unzufriedenheit in diesen Ländern liegen in der Armut. Der Durchschnittsägypter hat ein Einkommensniveau von rund 12 Prozent des Durchschnittsbürgers der Vereinigten Staaten und eine Lebenserwartung von zehn Jahren weniger. Zwanzig Prozent der dortigen Bevölkerung leben in tiefster Not. Obwohl diese Unterschiede erheblich sind, erscheinen sie gering im Vergleich mit denen, die zwischen den Vereinigten Staaten und den ärmsten Ländern der Welt wie Nordkorea, Sierra Leone oder Simbabwe bestehen, wo weit über die Hälfte der Bevölkerung arm ist.
Warum ist Ägypten so viel ärmer als die Vereinigten Staaten? Was hindert die Ägypter daran, wohlhabender zu werden? Ist die Armut Ägyptens unveränderbar, oder ließe sie sich beseitigen? Es ist nur natürlich, mit den Aussagen der Ägypter selbst über ihre Probleme und über ihren Aufstand gegen das Mubarak-Regime zu beginnen.
Noha Hamed, vierundzwanzig, Angestellte einer Werbeagentur in Kairo, meinte während ihrer Demonstration auf dem Tahrir-Platz: »Wir leiden unter Korruption, Unterdrückung und schlechter Ausbildung. Wir leben in einem bestechlichen System, das sich ändern muss.« Ein zwanzigjähriger Mitdemonstrant, der Pharmaziestudent Mosaab el-Shami, stimmte ihr zu: »Ich hoffe, dass wir bis Jahresende eine gewählte Regierung haben, dass die Grundfreiheiten gelten und wir der Korruption, die von diesem Land Besitz ergriffen hat, ein Ende setzen können.«
Die Protestierenden auf dem Tahrir-Platz äußerten sich einmütig über die Bestechlichkeit der Regierung, ihr Unvermögen, öffentliche Dienstleistungen bereitzustellen, sowie über die Chancenungleichheit in ihrem Land. Vor allem beklagten sie sich über Repressionen und das Fehlen politischer Rechte. So schrieb Mohammed el-Baradei, der frühere Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, am 13. Januar 2011 auf Twitter: »Tunesien: Repression + Fehlen sozialer Gerechtigkeit + Verweigerung der Mittel zu friedlichem Wandel = eine tickende Bombe.« Ägypter wie Tunesier waren der Ansicht, dass ihre Wirtschaftsprobleme im Wesentlichen auf ihren Mangel an politischen Rechten zurückzuführen seien. Als die Demonstranten ihre Forderungen systematischer vorbrachten, konzentrierten sich die ersten zwölf unmittelbaren Wünsche auf den politischen Wandel. Veröffentlicht hatte sie der Programmierer und Blogger Wael Khalil, der zugleich einer der Führer der ägyptischen Protestbewegung war. Fragen wie die Erhöhung des Mindestlohns erschienen lediglich unter den Übergangsregelungen, die später verwirklicht werden sollten.
Die Dinge, welche die Ägypter nach ihrer eigenen Einschätzung bremsen, sind ein ineffektiver und korrupter Staat sowie eine Gesellschaft, in der sie ihre Begabung, ihren Ehrgeiz, ihren Einfallsreichtum und die ihnen zugängliche Ausbildung nicht nutzen können. Sie wissen, dass die Wurzeln dieser Probleme politisch sind. Alle wirtschaftlichen Hindernisse im Lande entstehen durch die Art, wie die politische Macht in Ägypten durch eine kleine Elite ausgeübt und monopolisiert wird. Ihnen ist klar, dass sich das als Erstes ändern muss.
Doch damit weichen die Protestierenden auf dem Tahrir-Platz stark von der gängigen Meinung zu diesem Thema ab. Die meisten Wissenschaftler und Kommentatoren verweisen auf völlig andere Faktoren, wenn sie erörtern, warum ein Land wie Ägypten arm ist. Manche meinen, dass die Armut Ägyptens in erster Linie von seiner geographischen Lage abhänge, von der Tatsache, dass das Land hauptsächlich aus Wüste bestehe, wo keine ausreichende Regenmenge falle, und dass seine Böden und sein Klima keine ertragreiche Landwirtschaft zuließen. Andere unterstreichen die kulturelle Prägung der Ägypter, die der Wirtschaftsentwicklung und dem Wohlstand angeblich schaden würden. Die Ägypter, behaupten sie, hätten nicht die Arbeitsethik und die kulturell geprägten Eigenschaften, durch die andere erfolgreich gewesen seien; vielmehr hätten sie islamische Überzeugungen akzeptiert, die dem wirtschaftlichen Erfolg widersprächen. Eine dritte Betrachtungsweise, die unter Ökonomen und Politikexperten vorherrscht, beruht auf dem Gedanken, dass die Herrscher Ägyptens schlicht nicht wüssten, wie sie ihrem Land zu Wohlstand verhelfen können, und in der Vergangenheit untaugliche Taktiken und Strategien eingeschlagen hätten. Wenn die richtigen Experten diesen politischen Führern die richtigen Ratschläge erteilten, so die Annahme, dann werde der Wohlstand folgen. Solchen Wissenschaftlern und Politikexperten scheint die Tatsache, dass Ägypten von kleinen Eliten beherrscht worden ist, die ihr Schäfchen auf Kosten der Gesellschaft ins Trockene gebracht haben, für das Verständnis der Wirtschaftsprobleme des Landes bedeutungslos zu sein.
Im vorliegenden Buch werden wir den Standpunkt vertreten, dass die Ägypter auf dem Tahrir-Platz und nicht die Mehrheit der Wissenschaftler und Kommentatoren recht haben. In Wirklichkeit ist Ägypten genau deshalb arm, weil es von einer kleinen Elite beherrscht wurde, welche die Gesellschaft auf Kosten der großen Mehrheit der Bevölkerung zu ihrem eigenen Vorteil organisiert hat. Die politische Macht konzentrierte sich in wenigen Händen und diente dazu, Reichtümer für die Regierenden zu schaffen, etwa ein Vermögen in Höhe von 70 Milliarden Dollar, das Expräsident Mubarak anscheinend anhäufte. Die Verlierer waren die ägyptischen Bürger, wie sie nur zu gut wissen.
Wir werden zeigen, dass diese Deutung der ägyptischen Armut durch das Volk eine allgemeine Erklärung dafür liefert, warum sich notleidende Länder in ihrem gegenwärtigen Zustand befinden. Ob Nordkorea, Sierra Leone oder Simbabwe – wir werden nachweisen, dass sie aus demselben Grund arm sind wie Ägypten. Länder wie Großbritannien und die Vereinigten Staaten sind reich geworden, weil ihre Bürger die Machteliten stürzten und eine Gesellschaft schufen, in der die politischen Rechte viel breiter verteilt sind, in der die Regierung den Bürgern Rechenschaft schuldet und auf ihre Wünsche reagiert und in der die große Mehrheit des Volkes ihre wirtschaftlichen Chancen nutzen kann. Ferner werden wir zeigen, dass wir, um die Ungleichheit in der heutigen Welt verstehen zu können, die Vergangenheit erforschen und die historische Dynamik von Gesellschaften untersuchen müssen.
Wir werden darlegen, dass Großbritannien deshalb reicher als Ägypten ist, weil es (oder, genauer gesagt, England) 1688 eine Revolution erlebte, durch welche die Politik und mit ihr die Wirtschaft des Staates umgewandelt wurde. Die Menschen kämpften erfolgreich für mehr politische Rechte, um ihre wirtschaftlichen Chancen zu erweitern. Die Folge war eine grundsätzlich andere politische und wirtschaftliche Entwicklung, die ihren Höhepunkt in der Industriellen Revolution fand.
Die Industrielle Revolution und die von ihr freigesetzten Technologien erfassten Ägypten nicht, da es sich unter der Kontrolle des Osmanischen Reiches befand, welches das Land ähnlich behandelte, wie es später die Familie Mubarak tat. Die osmanische Herrschaft in Ägypten wurde 1798 von Napoleon Bonaparte beendet, doch dann geriet das Land unter den Einfluss des britischen Kolonialismus, der genauso wenig Interesse wie die Osmanen daran hatte, den Wohlstand Ägyptens zu fördern.
Obwohl sich die Ägypter von der Herrschaft des Osmanischen und des Britischen Reiches befreiten und 1952 ihre Monarchie stürzten, handelte es sich nicht um Revolutionen wie die von 1688 in England. Statt die Politik in Ägypten radikal zu ändern, brachten sie eine weitere Elite an die Macht, die das gleiche Desinteresse am Wohlstand des Durchschnittsägypters hatte wie früher die Osmanen und die Briten. Folglich lebte Ägypten weiter in Armut.
Im vorliegenden Buch werden wir untersuchen, wie sich solche Muster im Lauf der Zeit wiederholen und warum sie sich manchmal ändern wie durch die Revolutionen 1688 in England und 1789 in Frankreich. Auf dieser Basis wird es möglich zu beurteilen, ob sich die Situation in Ägypten inzwischen gewandelt hat und ob die Revolution, die Mubarak stürzte, zu einer Reihe neuer Institutionen führen wird, die gewöhnlichen Ägyptern zu Wohlstand verhelfen können. Ägypten hat etliche Revolutionen hinter sich, durch die sich nichts änderte, weil die Drahtzieher schlicht die Zügel von den ehemaligen Machthabern übernahmen und wieder ein ähnliches System schufen.
Für den Normalbürger ist es generell schwierig, wirkliche politische Macht zu erringen und die Funktionsweise seiner Gesellschaft zu verbessern. Aber es ist möglich, und wir werden untersuchen, wie es in England, Frankreich und in den Vereinigten Staaten sowie in Japan, Botswana und Brasilien dazu kam. Grundsätzlich ist ein politischer Wandel dieser Art erforderlich, damit eine arme Gesellschaft reich werden kann. Manches deutet darauf hin, dass sich ein ähnlicher Prozess in Ägypten vollzieht. Reda Metwaly, ein weiterer Demonstrant auf dem Tahrir-Platz, erklärte: »Jetzt sieht man Muslime und Christen zusammen, jetzt sieht man Alte und Junge zusammen, die alle das Gleiche wollen.«
Wir werden aufzeigen, dass derartige von der Mehrheit der Bevölkerung getragene Bewegungen eine Schlüsselrolle für jene anderen politischen Transformationen spielten. Wenn wir verstehen, wann und warum solche Wandlungsprozesse stattfinden, können wir besser abschätzen, ob derartige Bewegungen, wie so oft in der Vergangenheit, scheitern müssen, oder ob wir hoffen dürfen, dass sie Erfolg haben und das Leben von Millionen Menschen verbessern werden.
1. So nah und doch so verschieden
Die wirtschaftliche Situation am Rio Grande
Die Stadt Nogales wird in der Mitte durch einen Zaun getrennt. Wenn man davorsteht und nach Norden blickt, sieht man Nogales, Arizona, im Santa Cruz County. Das Durchschnittseinkommen der dortigen Haushalte beträgt ungefähr 30000 Dollar im Jahr. Die meisten Teenager besuchen die Schule, und die Mehrheit der Erwachsenen hat die Highschool absolviert. Trotz aller Klagen über die angeblichen Mängel des US-Gesundheitswesens ist die Bevölkerung relativ gesund und hat, global betrachtet, eine hohe Lebenserwartung. Viele der Einwohner sind über fünfundsechzig Jahre alt und haben Zugang zu der bundesstaatlichen Krankenversicherung Medicare. Dies ist nur eine der zahlreichen von der Regierung bereitgestellten Dienstleistungen, welche die meisten der dortigen Bürger für selbstverständlich halten, wie etwa auch Elektrizität, Telefon, Kanalisation, Gesundheitsbehörden, ein Straßennetz, das die Menschen mit anderen Städten in der Gegend und mit dem Rest der Vereinigten Staaten verbindet, und – nicht zuletzt – die Wahrung von Recht und Ordnung. Die Bürger von Nogales, Arizona, können ihrem Tagewerk nachgehen, ohne um ihr Leben fürchten und ohne ständig Angst vor Diebstahl, Enteignung oder anderen Dingen haben zu müssen, die ihre Investitionen in ihre Unternehmen und Häuser gefährden. Was genauso wichtig ist: Die dortigen Bewohner halten es für selbstverständlich, dass die Regierung trotz aller Ineffizienz und gelegentlicher Korruption ihre Interessen vertritt. Sie können ihre Bürgermeister, Kongressabgeordneten und Senatoren abwählen; sie nehmen an den Präsidentschaftswahlen teil, durch die bestimmt wird, wer ihr Land regiert. Die Demokratie ist ihnen in Fleisch und Blut übergegangen.
Das Leben südlich des Zaunes, nur ein paar Meter entfernt, ist ganz anders. Zwar leben die Ortsansässigen von Nogales, Sonora, in einem relativ wohlhabenden Teil Mexikos, doch ihr durchschnittliches Haushaltseinkommen macht nur ungefähr ein Drittel dessen aus, was den Bewohnern von Nogales, Arizona, zur Verfügung steht. Die meisten Erwachsenen in Nogales, Sonora, besitzen keinen Highschool-Abschluss, und viele Teenager gehen überhaupt nicht in die Schule. Mütter müssen sich Sorgen um die hohe Kindersterblichkeit machen, und das dürftige Gesundheitswesen lässt es wenig erstaunlich erscheinen, dass die Bewohner von Nogales, Sonora, nicht so lange leben wie ihre nördlichen Nachbarn. Außerdem ist ihnen der Zugang zu vielen öffentlichen Einrichtungen verwehrt, und die Straßen südlich des Zaunes befinden sich in einem kläglichen Zustand. Recht und Ordnung lassen ebenfalls zu wünschen übrig. Die Kriminalität ist hoch, und die Eröffnung eines Geschäfts riskant. Man muss nicht nur mit Überfällen rechnen, sondern es ist auch schwierig, sich sämtliche Genehmigungen zu besorgen und all die beteiligten Amtsinhaber zu schmieren. Die Bewohner von Nogales, Sonora, erleben täglich die Bestechlichkeit und Untauglichkeit ihrer Politiker. Anders als bei ihren nördlichen Nachbarn ist Demokratie für sie eine noch junge Erfahrung. Bis zu den politischen Reformen des Jahres 2000 befand sich Nogales, Sonora – genau wie das übrige Mexiko –, unter dem Daumen der korrupten Institutionellen Revolutionspartei (Partido Revolucionario Institucional, PRI).
Wie können die beiden Hälften derselben Stadt so verschieden sein? Es gibt keine geographischen oder klimatischen Unterschiede, und auch das in der Gegend vorherrschende Infektionsrisiko ist gleich, da Grenzen für Bakterien keine Hürde bilden. Natürlich sind die Gesundheitsverhältnisse sehr unterschiedlich, doch dies hat nichts mit dem Krankheitsumfeld zu tun, sondern damit, dass die Menschen südlich der Grenze unter schlechteren sanitären Bedingungen leben und über keine hinreichende Gesundheitsversorgung verfügen.
Aber vielleicht sind die Bewohner völlig unterschiedlicher Herkunft, und in Nogales, Arizona, wohnen die Enkel von europäischen Einwanderern, während im Süden die Nachfahren der Azteken leben? Durchaus nicht. Die Herkunft der Bürger auf beiden Seiten der Grenze ist recht ähnlich. Nachdem Mexiko 1821 die Unabhängigkeit von Spanien errungen hatte, war die Gegend um »Los dos Nogales« Teil des mexikanischen Staates Vieja California und blieb es auch nach dem mexikanisch-amerikanischen Krieg von 1846–1848. Erst durch den Gadsden-Kauf von 1853 wurde die US-Grenze in dieses Gebiet ausgedehnt. Leutnant N. Michler wies bei der Vermessung auf das »hübsche kleine Tal von Los Nogales« hin. Hier entstanden die zwei Städte zu beiden Seiten der Grenze. Die Einwohner von Nogales, Arizona, und Nogales, Sonora, haben die gleichen Vorfahren, verzehren die gleichen Speisen, hören die gleiche Musik und haben vermutlich auch die gleiche Kultur.
Natürlich gibt es, wie der Leser bestimmt längst erraten hat, eine einfache und offensichtliche Erklärung für die Unterschiede zwischen den beiden Hälften von Nogales: nämlich genau die Grenze, welche die beiden Hälften voneinander trennt.
Nogales, Arizona, liegt in den Vereinigten Staaten. Seine Einwohner haben Zugang zu den Wirtschaftsinstitutionen der USA. Sie können ihre Beschäftigung frei wählen, eine Schulausbildung und Qualifikationen erwerben und ihre Arbeitgeber zu Investitionen in die beste Technologie ermutigen, wodurch sie letztlich höhere Löhne beziehen. Außerdem verfügen sie über politische Institutionen, die es ihnen gestatten, am demokratischen Prozess teilzunehmen, ihre politischen Vertreter zu wählen und sie bei Fehlverhalten zu ersetzen. Folglich stellen die Politiker die von den Bürgern geforderte Grundversorgung bereit (vom Gesundheitswesen über Straßen bis hin zu Recht und Ordnung).
Die Einwohner von Nogales, Sonora, hingegen sind in einer weniger glücklichen Lage. Sie leben in einer anderen Welt, die von anderen Institutionen gestaltet wird. Dadurch werden sehr unterschiedliche Anreize für die Einwohner der beiden Nogales und für die Unternehmer und Betriebe geschaffen, die dort investieren. Diese Anreize, die von den unterschiedlichen Institutionen der beiden Nogales und der Länder, in denen sie liegen, gesetzt werden, sind der Hauptgrund für die wirtschaftlichen Gegensätze auf beiden Seiten der Grenze.
Warum begünstigen die Institutionen der Vereinigten Staaten den wirtschaftlichen Erfolg so viel stärker als die Institutionen Mexikos und überhaupt ganz Lateinamerikas? Die Antwort auf diese Frage ist in der Art und Weise zu finden, wie sich die unterschiedlichen Gesellschaften während der frühen Kolonialzeit entwickelten. Damals kam es zu einer institutionellen Divergenz, deren Folgen bis heute andauern. Um diese Divergenz zu begreifen, müssen wir mit der Gründung der Kolonien in Nord- und Lateinamerika beginnen.
Die Gründung von Buenos Aires
Am Anfang des Jahres 1516 segelte der spanische Entdecker Juan Díaz de Solís in eine breite Flussmündung an der Ostküste Südamerikas. De Solís watete an Land, nahm das Gebiet für Spanien in Beschlag und nannte den Fluss, da die Einheimischen Silber besaßen, Río de la Plata, »Silberfluss«. Die eingeborenen Völker auf beiden Seiten der Mündung – die Charrúa im heutigen Uruguay und die Querandí auf jenen Ebenen, die im modernen Argentinien als Pampas bezeichnet werden – begegneten den Fremden mit Feindschaft. Sie waren Jäger und Sammler, die in kleinen Gruppen ohne starke, zentralisierte Behörden lebten. Eine solche Gruppe von Charrúa war es auch, die de Solís zu Tode prügelte, als er die neuen Gegenden erforschte, die er für Spanien in Besitz nehmen wollte.
1534 entsandten die immer noch optimistischen Spanier eine erste Siedlergruppe unter Pedro de Mendoza. Im selben Jahr gründeten sie einen Ort an der späteren Stätte von Buenos Aires. Es war eigentlich eine ideale Umgebung für Europäer, denn Buenos Aires, buchstäblich ein Ort der »guten Lüfte«, hatte ein freundliches, gemäßigtes Klima. Aber der erste dortige Aufenthalt der Spanier erwies sich als kurzlebig. Sie hatten es nicht auf gute Lüfte abgesehen, sondern auf Rohstoffe, die sie durch Zwangsarbeit abbauen wollten. Die Charrúa und Querandí erfüllten ihnen diesen Wunsch jedoch nicht. Sie waren nicht bereit, den Spaniern Lebensmittel zu liefern, und sie weigerten sich, für sie zu arbeiten, wenn sie gefangen wurden. Vielmehr griffen sie die neue Siedlung mit Pfeil und Bogen an.
Die Spanier hungerten, da sie nicht damit gerechnet hatten, sich selbst mit Nahrungsmitteln versorgen zu müssen. Buenos Aires entsprach nicht ihren Träumen. Die Einheimischen ließen sich nicht zur Arbeit zwingen, und es gab keine Silber- und Goldvorkommen, denn das Silber, das de Solís gefunden hatte, stammte aus dem weit westlich gelegenen Staat der Inka in den Anden.
Während die Spanier zu überleben versuchten, schickten sie gleichzeitig Expeditionen aus, um einen neuen Standort zu finden, der ihnen größere Reichtümer und eine leichter zu unterjochende Bevölkerung bot. 1537 drang eine der Expeditionen unter Führung von Juan de Ayolas auf der Suche nach einer Route zu den Inka auf dem Fluss Paraná vor. Unterwegs nahm sie Kontakt zu den Guaraní auf, einem sesshaften Volk mit einer auf dem Anbau von Mais und Maniok basierenden Agrarwirtschaft. De Ayolas begriff sofort, dass die Guaraní viel leichter zu handhaben sein würden als die Charrúa und die Querandí. Nach einem kurzen Konflikt brachen die Spanier den Widerstand der Guaraní und gründeten den Ort, der noch heute die Hauptstadt von Paraguay ist. Die Konquistadoren heirateten die Guaraní-Prinzessinnen und übernahmen rasch die Rolle einer neuen Aristokratie. Sie passten die bestehenden Zwangsarbeit- und Tributsysteme der Guaraní ihren eigenen Bedürfnissen an und setzten sich selbst an die Spitze der Gesellschaft. Dies war die Art Kolonie, die ihnen vorgeschwebt hatte, und innerhalb von vier Jahren war Buenos Aires verlassen, da sämtliche Spanier an den neuen Ort übersiedelten. Buenos Aires, das »Paris Südamerikas«, eine Stadt mit breiten Alleen im europäischen Stil, die sich auf den großen Agrarreichtum der Pampas stützte, wurde erst 1580 wieder besiedelt.
Die Preisgabe von Buenos Aires und die Unterwerfung der Guaraní enthüllen die Logik, mit der die Europäer Nord-, Mittel- und Südamerika kolonisierten. Frühe spanische und, wie wir noch ausführen werden, englische Kolonisten hatten kein Interesse daran, den Boden selbst zu bestellen. Sie wollten, dass andere ihnen diese Arbeit abnahmen, und sie wollten Reichtümer an sich bringen, vor allem Gold und Silber.
Von Cajamarca …
Die Expeditionen von de Solís, de Mendoza und de Ayolas folgten bekannteren, die durchgeführt wurden, nachdem Christoph Kolumbus am 12. Oktober 1492 eine der Bahamainseln gesichtet hatte. Die ernsthafte spanische Expansion und Kolonisierung Amerikas begann 1519 mit der Eroberung Mexikos durch Hernán Cortés, mit dem Vorstoß von Francisco Pizarro nach Peru anderthalb Jahrzehnte später sowie mit der Expedition von Pedro de Mendoza zum Río de la Plata nur zwei Jahre danach. Im Lauf des folgenden Jahrhunderts eroberte und kolonisierte Spanien die größten Teile des zentralen, westlichen und südlichen Südamerika, während Portugal im Osten Brasilien für sich beanspruchte.
Die spanische Kolonisierungsstrategie war äußerst effektiv. Zuerst von Cortés in Mexiko perfektioniert, stützte sie sich auf die Erkenntnis, dass sich Widerstand am besten überwinden ließ, wenn man das Oberhaupt der Einheimischen gefangen nahm. Dies ermöglichte den Spaniern, den Reichtum des Führers zu rauben und die eingeborenen Völker zur Abgabe von Tribut und Nahrungsmitteln zu zwingen. Der nächste Schritt bestand darin, sich zur neuen Elite der einheimischen Gesellschaft zu machen und die Kontrolle über die bestehenden Formen der Besteuerung, der Tributzahlung und, vor allem, der Zwangsarbeit an sich zu reißen.
Als Cortés und seine Männer am 8. November 1519 in der großen Aztekenhauptstadt Tenochtitlan eintrafen, wurden sie von dem Aztekenherrscher Moctezuma empfangen, der entgegen zahlreichen Empfehlungen seiner Ratgeber beschlossen hatte, den Spaniern friedlich zu begegnen. Was danach geschah, wird ausführlich in dem Bericht beschrieben, den der Franziskanerpriester Bernardino de Sahagún 1545 in seinem berühmten Florentiner Codex vorlegte:
Und nachdem man am Palast angelangt … war, ergriffen sie ihn … Und danach wurden alle Geschütze abgefeuert … Furcht lagert über ihnen, wie wenn alles Volk einen Todesschrecken erfahren hätte. Ebenso, als schon die Nacht angebrochen war, war alles noch voller Furcht …
Und nachdem der Morgen angebrochen war, wird ausgeschrien, was die Spanier alles nötig haben: weiße Maisfladen, gebratene Truthühner, Eier, frisches Wasser, Holz, Brennholz, Kohlen … Moctezuma befahl dies.
Und nachdem sich die Spanier in der Stadt festgesetzt hatten, fragten sie Moctezuma aus nach allem, was zum Staatsschatz gehört … sie lagen ihm in den Ohren, erkundigten sich eifrig nach dem Golde. Und darauf führt Moctezuma die Spanier, sie umdrängen ihn, bilden einen Haufen um ihn, der in ihrer Mitte steht … ergreifen ihn, halten ihn an der Hand.
Und nachdem sie an dem Schatzhause, das Teocalco genannt wird, angelangt waren, wurden alle Schmucksachen hervorgeholt, der Federschmuck der Tabasco-Leute, die Rangabzeichen, die Federschilde, die goldenen Brustscheiben … die goldenen Nasenhalbmonde, die goldenen Wadenringe, der goldene Handgelenkriemen, die goldene Stirnbinde. Danach wurde das Gold abgelöst, das an den Schilden befestigt war, und an allen den Abzeichen; und nachdem alles Gold abgelöst war, zündeten sie alle die verschiedenen Kostbarkeiten an, steckten sie in Brand …
Und das Gold schmolzen die Spanier in Barren … Und sie gingen überallhin, stöberten alles durch … Sie nahmen alles, was sie fanden, was ihnen gefiel.
Danach gingen sie nach dem eigentlichen Schatzhause Moctezumas, wo das persönliche Eigentum Moctezumas aufbewahrt wurde, nach dem Orte namens Totocalco … Danach wird hervorgeholt all sein Privatbesitz, sein Privateigentum … lauter Kostbarkeiten: die Halskette mit Gehängen, der mit einem Büschel Quetzalfedern geschmückte Oberarmring, der goldene, mit zwei Edelsteinen besetzte Handgelenkriemen und das Armband, der goldene, am Knöchel befestigte Schellenring und die Krone aus Türkismosaik mit dem dreieckig aufragenden Stirnblatt … alles wiesen sie sich zu.
Die militärische Unterwerfung der Azteken wurde 1521 vollendet. Dann begann Cortés als Gouverneur der Provinz Neu-Spanien, den wertvollsten Rohstoff, nämlich die einheimische Bevölkerung, mit Hilfe der encomienda aufzuteilen. Diese Institution war im Spanien des 15. Jahrhunderts im Rahmen der Wiedereroberung des Südens von den Mauren – also von den Arabern, die sich dort während des 8. Jahrhunderts und danach niedergelassen hatten – gegründet worden. In der Neuen Welt nahm sie eine viel bösartigere Form an, nämlich die eines erzwungenen Geschenks der einheimischen Völker an einen als encomendero bezeichneten Spanier. Die Eingeborenen mussten ihm Tribut und Arbeitsdienst leisten, wofür er damit betraut wurde, sie zum Christentum zu bekehren.
Ein lebhafter früher Bericht über die Funktionsweise der encomienda ist uns von Bartolomé de las Casas überliefert worden, einem Dominikanerpriester und Bischof, der die erste und eine der vernichtendsten Kritiken des spanischen Kolonialsystems verfasste. De las Casas erreichte die spanische Insel Hispaniola 1502 mit einer Flotte unter Führung des neuen Gouverneurs Nicolás de Ovando. Die grausame und ausbeuterische Behandlung der Eingeborenen, die er jeden Tag miterlebte, desillusionierte und beunruhigte ihn immer mehr. 1513 nahm er als Armeegeistlicher an der spanischen Eroberung von Kuba teil. Für seine Dienste wurde er sogar mit einer encomienda belohnt. Er lehnte diese Vergünstigung jedoch ab und begann eine lange Kampagne mit dem Ziel, die spanischen Kolonialinstitutionen zu reformieren. Seine Bemühungen gipfelten in dem Kurzgefassten Bericht von der Verwüstung der Westindischen Länder (1542), einer schneidenden Attacke gegen die Barbarei der spanischen Herrschaft. Über die encomienda in Nicaragua schrieb er Folgendes:
Da ihre Orte, wie schon gesagt, ausnahmslos alle ein höchst anmutiger Fruchtgarten waren, quartierten sich die Christen dort ein, jeder in dem Ort, den man ihm zugeteilt hatte (oder der, wie sie es nennen, ihm »anvertraut« wurde), und dort legte dieser Christ seine Felder an, wobei er sich von den armseligen Speisen der Indios ernährte. Und sie entrissen ihnen deshalb die persönlichen Ländereien und Erbgüter, von denen sie ihren Unterhalt gewannen. So hielten denn die Spanier alle Indios, die Herren wie die Frauen und Kinder, bei sich zu Hause fest. Und allen gebieten sie, ihnen Tag und Nacht zu dienen, ohne auszuruhen.
Im Zusammenhang mit der Eroberung Neugranadas, des heutigen Kolumbien, beschreibt de las Casas die gesamte damalige Strategie:
… während die Spanier untereinander die Ortschaften, deren Herren und Bewohner verteilt hatten (denn das ist alles, was sie als Mittel in die Hand bekommen wollen, um ihr letztes Ziel zu erreichen, das in Gold besteht) und nachdem sie alle der üblichen Gewaltherrschaft und Knechtschaft unterworfen hatten, nahm der tyrannische Oberbefehlshaber, der jenes Land regierte, den König und Herrscher jenes ganzen Reiches gefangen und kerkerte ihn ohne jede weitere Begründung und irgendeinen Rechtsgrund sechs oder sieben Monate lang ein, nur weil er Gold und Smaragde von ihm haben wollte.
Der genannte König, der Bogotá hieß, erklärte, weil sie ihn in solche Angst versetzt hatten, er werde ihnen ein goldenes Haus schenken, wie sie es von ihm verlangten, und er hoffte, sich hierdurch aus den Händen seiner Peiniger zu befreien, und er sandte Indios aus, die ihm Gold holen sollten, und diese brachten ihm mehrmals eine große Menge Gold und Edelsteine; da er ihnen jedoch kein goldenes Haus geben konnte, sagten die Spanier, der Hauptmann müsse ihn töten, jener habe sein Versprechen nicht gehalten. Der Tyrann befahl, sie sollten den Gefangenen vor ihn führen und ihn verklagen. So stellten sie denn einen Klageantrag und beschuldigten den genannten König des Landes. Und der Tyrann fällte das Urteil und verdammte ihn zur Folter, wenn er ihnen nicht das goldene Haus beschaffte.
Sie folterten ihn, hängten ihn an den Wippgalgen. Sie schütteten ihm brennenden Talg auf den Unterleib. An jedem befestigten sie eine Kette, deren anderes Ende an einem Pfahl befestigt war, und der Hals war an einem weiteren Pfahl angekettet, und zwei Männer hielten ihm die Hände fest, und so zündeten sie nun ein Feuer unter seinen Füßen an. Und von Zeit zu Zeit ließ sich der Tyrann sehen und sagte, mit diesem Foltern müsse er ihn nach und nach töten, wenn jener ihm nicht das Gold gebe. Und so führte er es auch aus und peinigte den genannten Herrscher zu Tode.
Die in Mexiko perfektionierte Eroberungsstrategie und ihre Institutionen wurden in anderen spanischen Kolonien begierig übernommen. Nirgendwo wurden sie wirkungsvoller eingesetzt als bei Pizarros Eroberung von Peru. Dazu de las Casas am Anfang seines Berichts:
Im Jahre 1531 zog ein anderer großer Tyrann mit einigen Männern in die Königreiche von Peru, und dorthin kam er mit dem gleichen Rechtsanspruch, der gleichen Absicht und den gleichen Grundsätzen wie alle seine Vorgänger.
Pizarro marschierte von der Küste unweit des peruanischen Ortes Tumbes nach Süden. Am 15. November 1532 erreichte er die Gebirgsstadt Cajamarca, wo der Inkaherrscher Atahualpa mit seinem Heer lagerte. Am folgenden Tag näherte sich Atahualpa, der gerade seinen Bruder Huáscar im Kampf um die Nachfolge ihres verstorbenen Vaters Huyana Cápac besiegt hatte, mit seinem Gefolge dem spanischen Lager. Atahualpa war wütend, da ihm gerade mitgeteilt worden war, welche Gräueltaten, zum Beispiel die Schändung eines Tempels für den Sonnengott Inti, die Spanier bereits begangen hatten. Was dann geschah, ist gut bekannt: Die Spanier stellten Atahualpa eine Falle, töteten seine Wächter und Gefolgsleute, nicht weniger als rund zweitausend, und nahmen den König gefangen. Um freigelassen zu werden, musste Atahualpa versprechen, einen Raum mit Gold und zwei weitere von denselben Ausmaßen mit Silber zu füllen. Dies tat er, doch die Spanier brachen ihr eigenes Versprechen und erwürgten ihn im Juli 1533.
Im November eroberten sie die Inkahauptstadt Cusco, wo der Aristokratie Ähnliches widerfuhr wie Atahualpa: Die Männer wurden inhaftiert, damit sie Gold und Silber herbeischaffen ließen. Als sie die Forderungen nicht erfüllen konnten, wurden sie bei lebendigem Leibe verbrannt. Die Spanier entfernten das Gold an den großen Kunstschätzen von Cusco, etwa dem Tempel des Sonnengottes, und schmolzen es zu Barren. Danach konzentrierten sie sich auf die Bevölkerung des Inkareiches. Wie in Mexiko wurden die Bürger encomiendas zugeteilt, wobei den Konquistadoren, die Pizarro begleitet hatten, jeweils eine zufiel.
Die encomienda war die Hauptinstitution, mit der man die Arbeit in der frühen Kolonialzeit kontrollierte und organisierte, doch bald entwickelte sich ein dynamisches Konkurrenzsystem. 1545 suchte ein Ortsansässiger namens Diego Gualpa hoch oben in den Anden (im heutigen Bolivien) einen Eingeborenenschrein. Er wurde von einer Windbö zu Boden geworfen und sah eine Silberader vor sich. Sie war Teil eines mächtigen Silberbergs, den die Spanier El Cerro Rico (»Reicher Hügel«) tauften. Um ihn herum entstand die Stadt Potosí, die auf ihrem Höhepunkt im Jahr 1650 rund 160000 Bewohner hatte und damit größer war als das damalige Lissabon oder Venedig.
Um das Silber abzubauen, benötigten die Spanier Bergleute – eine Menge Bergleute. Sie entsandten einen neuen Vizekönig, ihren Hauptkolonialbeamten Francisco de Toledo, der die vorrangige Aufgabe hatte, das Arbeitsproblem zu lösen. De Toledo, der 1569 in Peru eintraf, verbrachte zunächst fünf Jahre damit, herumzureisen und sein neues Gebiet zu erforschen. Außerdem ließ er die gesamte Erwachsenenbevölkerung erfassen. Um die erforderlichen Arbeitskräfte zu finden, ließ de Toledo fast alle Einheimischen in reducciones (»Zurückführungen«) umsiedeln, was die Ausbeutung der Arbeiter durch die spanische Krone erleichtern sollte. Dann führte er ein Arbeitssystem der Inka wieder ein, das als mita bekannt war (dies bedeutet in der Inkasprache Quechua »Arbeitstribut«). Unter dem mita-System hatten die Inka Zwangsarbeiter zum Betreiben von Plantagen eingesetzt, die Lebensmittel für die Tempel, die Aristokratie und das Heer lieferten. Im Gegenzug bot die Inka-Elite Sicherheit und Schutz vor Hunger.
Unter de Toledo sollte die mita, insbesondere die Potosí-mita, zur umfassendsten und gnadenlosesten Arbeitsausbeutung der spanischen Kolonialzeit werden. De Toledo definierte einen gewaltigen Einzugsbereich, der sich von der Mitte des heutigen Peru über den größten Teil Boliviens hinweg erstreckte und rund 520000 Quadratkilometer groß war. In diesem Gebiet wurde ein Siebtel der männlichen Einwohner, die gerade in die reducciones umgesiedelt worden waren, zur Arbeit in den Bergwerken von Potosí gezwungen. Die Potosí-mita setzte sich während der gesamten Kolonialzeit fort und wurde erst 1825 abgeschafft. Karte 1 zeigt den Einzugsbereich für die mita im Inkareich zur Zeit der spanischen Eroberung, die sich weitgehend mit dem Landesinnern des Reiches deckte und auch die Hauptstadt Cusco einschloss.
Karte 1: Das Inkareich, das Inkastraßennetz und das Einzugsgebiet der Bergbau-mita
Erstaunlicherweise sind die Auswirkungen der mita noch im heutigen Peru an den Unterschieden zwischen den dicht nebeneinanderliegenden Provinzen Calca und Acomayo zu beobachten. Sie scheinen sich stark zu ähneln. Beide befinden sich hoch in den Bergen und werden von den quechuasprachigen Nachfahren der Inka bewohnt. Doch Acomayo ist viel ärmer, und seine Bewohner verbrauchen etwa ein Drittel weniger als die von Calca. Das ist den dort lebenden Menschen nicht neu. In Acomayo werden die unerschrocken bis hierher vordringenden Ausländer gefragt: »Wissen Sie nicht, dass die Leute hier ärmer sind als dort drüben in Calca? Warum kommen Sie hierher?«
Es ist viel schwerer, nach Acomayo, dem alten Zentrum des Inkareiches, zu reisen als in die Provinz Calca. Die Straße nach Calca ist gepflastert, während die nach Acomayo äußerst baufällig wirkt. Um über Acomayo hinauszugelangen, benötigen Reisende ein Pferd oder ein Maultier. In Calca und Acomayo baut man die gleichen Pflanzen an, doch in Calca werden sie auf dem Markt verkauft, während sie in Acomayo dem Eigenbedarf dienen. Diese Ungleichheiten, die für Dritte ebenso wie für die Bevölkerung augenfällig sind, lassen sich durch die institutionellen Unterschiede zwischen den beiden Bezirken erklären, die bis zu de Toledo und seinem Plan für die effektive Ausbeutung der indigenen Arbeit zurückreichen. Der Hauptgegensatz zwischen Acomayo und Calca besteht darin, dass sich Acomayo im Einzugsbereich der Potosí-mita befand, Calca jedoch nicht.
Zusätzlich zur Konzentration der Arbeitskräfte und der mita ergänzte de Toledo das encomienda-System durch eine fixe Kopfsteuer, die jeder erwachsene Mann alljährlich in Silber zu zahlen hatte. Dies war ein weiteres Verfahren, das Menschen auf den Arbeitsmarkt zwingen und die Löhne für spanische Grundeigentümer verringern sollte. Noch eine andere Institution, genannt repartimiento de mercancias, griff in de Toledos Amtszeit um sich. Abgeleitet von dem spanischen Verb repartir (»verteilen«), zog dieses repartimiento, also die »Verteilung der Güter«, den Zwangsverkauf von Waren durch Ortsansässige nach sich, wobei die Spanier die Preise festlegten. Und schließlich führte de Toledo noch den trajín (»Transport«) ein, durch den die Einheimischen genötigt wurden, anstelle von Packtieren schwere Lasten, zum Beispiel Wein, Cocablätter oder Textilien, für die Geschäftsunternehmungen der spanischen Elite zu befördern.
Überall in den amerikanischen Kolonien der Spanier wurden ähnliche Institutionen und Gesellschaftsstrukturen geschaffen. Nach einer Anfangsphase der Plünderungen und der Gier nach Gold und Silber schufen die Spanier ein Netzwerk von Einrichtungen zur Ausbeutung der einheimischen Bevölkerung. Die gesamte Bandbreite von encomienda, mita, repartimiento und trajín sollte den Lebensstandard der Eingeborenen auf ein Minimalniveau hinabdrücken, damit den Spaniern alle über das nackte Überleben hinausgehenden Einnahmen zufielen. Dies erreichten sie, indem sie das Land der indigenen Völker enteigneten, sie zur Arbeit zwangen, ihnen niedrige Löhne zahlten und hohe Steuern auferlegten sowie ihnen überteuerte Preise für Waren abverlangten, die nicht einmal freiwillig gekauft wurden. Diese Institutionen brachten zwar der spanischen Krone einen erheblichen Reichtum ein und ließen die Konquistadoren und deren Nachkommen ebenfalls sehr vermögend werden, aber sie bewirkten andererseits, dass Lateinamerika zum »ungleichsten« Kontinent der Welt wurde und einen großen Teil seines wirtschaftlichen Potentials verlor.
… nach Jamestown
Während die Spanier ihre Eroberung des amerikanischen Doppelkontinents in den 1490er Jahren begannen, war England eine zweitrangige europäische Macht, die sich von den verheerenden Folgen eines Bürgerkriegs, des Rosenkriegs, erholte. Es war nicht in der Lage, sich an der Jagd nach Beute und Gold und an der Ausbeutung der einheimischen Völker in Süd- und Nordamerika zu beteiligen. Fast einhundert Jahre später, 1588, löste der glückliche Sieg über die spanische Armada, mit der König Philipp II. versucht hatte, England zu erobern, politische Schockwellen in Europa aus. Bei allem Glück war die Versenkung der Armada auch ein Anzeichen für die wachsende englische Durchsetzungsfähigkeit auf den Meeren, die dem Staat ermöglichen sollte, selbst zur Kolonialmacht zu werden.
Mithin ist es kein Zufall, dass die Engländer mit ihrer Kolonisierung Nordamerikas zu ebendiesem Zeitpunkt begannen. Aber sie entschieden sich nicht deshalb für Nordamerika, weil es attraktiv gewesen wäre, sondern weil sie für eine Okkupation Südamerikas zu spät kamen und nichts anderes mehr zur Verfügung stand. Die »begehrenswerten« Teile Amerikas, in denen es zahlreiche zur Ausbeutung geeignete Eingeborene gab und in denen sich Gold- und Silberminen befanden, waren bereits besetzt worden. Die Engländer mussten sich also mit den Resten zufriedengeben. Als der englische Schriftsteller und Landwirt Arthur Young im 18. Jahrhundert erörterte, wo einträgliche »Grundprodukte« – womit er exportierbare Agrarerzeugnisse meinte – zu finden seien, merkte er an:
Insgesamt hat es den Anschein, dass die Grundproduktionen unserer Kolonien wertmäßig proportional zu ihrer Entfernung zur Sonne sinken. Auf den Westindischen Inseln, die am heißesten von allen sind, machen sie den Betrag von 8 l. 12 s. 1 d. pro Kopf aus. In den südlichen kontinentalen Gebieten belaufen sie sich auf 5 l. 10 s. In den zentralen auf 9 s. 6½ d., in den nördlichsten Siedlungen auf 2 s. 6 d. Aus diesen Größenordnungen lässt sich gewiss eine höchst wichtige Lehre ziehen: Die Kolonisierung in nördlichen Breiten ist zu vermeiden.
Der erste Versuch der Engländer, eine Kolonie zu gründen – nämlich zwischen 1585 und 1587 in Roanake, North Carolina –, war ein völliger Fehlschlag. 1607 versuchten sie es erneut. Ende 1606 stachen drei Schiffe, Susan Constant, Godspeed und Discovery, unter dem Kommando von Kapitän Christopher Newport nach Virginia in See. Die Kolonisten, unter dem Patronat der Virginia Company, segelten in die Chesapeake Bay und einen Fluss hinauf, den sie James – nach dem herrschenden englischen Monarchen Jakob I. – nannten. Am 14. Mai 1607 gründeten sie die Siedlung Jamestown.
Auch wenn die Siedler an Bord der Schiffe, die der Virginia Company gehörten, Engländer waren, hielten sie sich an ein Kolonisationsmuster, das durch das Vorbild von Cortés, Pizarro und de Toledo geprägt war. Als Erstes planten sie, den örtlichen Häuptling gefangen zu nehmen, um der Bevölkerung Proviant abzupressen und sie zu zwingen, ihnen Lebensmittel und Wohlstand zu verschaffen.
Bei ihrer Landung in Jamestown wussten die englischen Kolonisten nicht, dass sie sich innerhalb des Territoriums des Powhatan-Bündnisses aus rund dreißig Gemeinschaften befanden, die einem König namens Wahunsunacock Loyalität schuldeten. Seine Hauptstadt war der lediglich dreißig Kilometer von Jamestown entfernte Ort Werowocomoco. Die Kolonisten planten, sich zunächst einen Überblick über die Situation zu verschaffen. Wenn die Einheimischen nicht veranlasst werden konnten, ihnen Lebensmittel und Arbeitskräfte zu liefern, würden sie vielleicht zumindest Handel mit ihnen treiben können. Der Gedanke, selbst zu arbeiten und Nutzpflanzen anzubauen, scheint den Siedlern nicht in den Sinn gekommen zu sein. So etwas war unter der Würde der Eroberer der Neuen Welt.
Wahunsunacock bemerkte die Anwesenheit der Kolonisten bald und hegte ihren Absichten gegenüber Misstrauen. Er stand an der Spitze eines für Nordamerika recht großen Reiches. Aber er hatte viele Feinde, und ihm fehlte die zentralisierte politische Kontrolle der Inka. Wahunsunacock beschloss, die Aktionen der Engländer abzuwarten, und schickte zunächst Boten aus, die kundtaten, dass er freundschaftliche Beziehungen zu den Siedlern aufnehmen wolle.





























