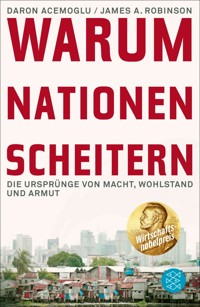19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Von den Wirtschaftsnobelpreisträgern 2024 Wie viel Staat muss sein? Nach dem internationalen Bestseller »Warum Nationen scheitern?« widmen sich Starökonom Daron Acemoglu und Harvard-Politologe James A. Robinson in ihrem neuen Buch dieser fundamentalen Frage. Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Milizen in Libyen, Einschränkung der Presse- und Demonstrationsfreiheit in der Türkei, Umerziehungslager in Nordkorea. Gegenwärtig erleben wir viele Staaten als problematisch: sie sind entweder gescheitert, überreguliert oder despotisch. Aber wie viel Staat ist denn eigentlich notwendig? Die Autoren geben hierauf eine überraschende und provokante Antwort. Anhand zahlreicher historischer und aktueller Beispiele – vom antiken Griechenland über Deutschland im Nationalsozialismus bis zum heutigen China – zeigen sie: Wohlstand, Sicherheit und Freiheit sind in hohem Maße von dem richtigen Rahmen abhängig, in dem der ewige Kampf um Macht zwischen Staat und Gesellschaft ausgetragen wird. Eine überzeugende Analyse, die demonstriert: Ein starker Staat und eine starke Gesellschaft sind kein Widerspruch, sondern bedingen sich gegenseitig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1100
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Prof. James A. Robinson | Prof. Daron Acemoglu
Gleichgewicht der Macht
Der ewige Kampf zwischen Staat und Gesellschaft
Über dieses Buch
Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Milizen in Libyen, Einschränkung der Presse- und Demonstrationsfreiheit in der Türkei, Umerziehungslager in Nordkorea. Gegenwärtig erleben wir viele Staaten als problematisch: sie sind entweder gescheitert, überreguliert oder despotisch. Aber wie viel Staat ist denn eigentlich notwendig? Der Starökonom Daron Acemoglu und Harvard-Politologe James A. Robinson geben hierauf eine überraschende und provokante Antwort. Anhand zahlreicher historischer und aktueller Beispiele – vom antiken Griechenland über das nationalsozialistische Deutschland bis zum aktuellen China – zeigen sie: Wohlstand, Sicherheit und Entwicklung sind in hohem Maße von dem richtigen Rahmen abhängig, in dem der permanente Kampf um Macht zwischen Staat und Gesellschaft ausgetragen wird. Ein überzeugende Analyse, die demonstriert: Ein starker Staat und eine starke Gesellschaft sind kein Widerspruch, sondern bedingen sich gegenseitig.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Daron Acemoglu ist Professor für Wirtschaftswissenschaften am renommierten Massachussetts Institute of Technology (MIT). Er gehört zu den zehn meist zitierten Wirtschaftswissenschaftlern und ist Träger der John-Bates-Clark-Medaille, die als Vorstufe zum Nobelpreis gilt.
James A. Robinson ist Politik- und Wirtschaftswissenschaftler und Professor an der Harvard University. Er ist der weltweit führende Experte für Entwicklungshilfe, Lateinamerika und Afrika. Er arbeitete in Botswana, Mauritius, Sierra Leone und Südafrika. Die beiden Autoren haben mit ihrem mittlerweile zum Klassiker gewordenen Titel »Warum Nationen scheitern« weltweit für Aufsehen gesorgt.
Impressum
Deutsche Erstausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »The Narrow Corridor. State, Societies, and the Fate of Liberty« im Verlag Penguin Press/Penguin Random House, New York.
©2019 by Daron Acemoglu and James A. Robinson.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2019 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490590-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Vorwort
Freiheit
Alles Übel dieser Welt
Das Gilgamesch-Problem
Der schmale Korridor zur Freiheit
1. Wie endet die Geschichte?
Eine künftige Anarchie?
Der Staat mit dem Artikel 15
Eine Reise durch die Dominanz
Der Krieg aller gegen alle und der Leviathan
Furcht und Schrecken
Umerziehung durch Arbeit
Der janusgesichtige Leviathan
Der Normenkäfig
Jenseits von Hobbes
Den Texanern Fesseln anlegen
Der Leviathan in Fesseln
Diversität – nicht das Ende der Geschichte
Kurzer Überblick über den Inhalt des Buchs
2. Die Rote Königin
Die sechs Heldentaten des Theseus
Solons Fesseln
Der Rote-Königin-Effekt
Wenn nötig, in die Verbannung
Die fehlenden Rechte
Häuptlinge? Welche Häuptlinge?
Eine Schieflage
Unlesbar bleiben
Der enge Korridor
Probieren geht über Studieren
Den Leviathan fesseln: Vertrauen und Kontrolle
3. Der Wille zur Macht
Der Aufstieg des Propheten
Was ist dein Trumpf?
Die Hörner des Büffels
Der Übeltäter, der kein Gesetz kennt
Die rotmäulige Kanone
Tabubrüche
Zeit der Wirren
Warum man den Willen zur Macht nicht in Fesseln legen kann
4. Die Wirtschaft außerhalb des Korridors
Der Geist in der Kornkammer
Für Fleiß kein Raum
Die Wirtschaft im Käfig der Normen
Ibn Khaldun und der Zyklus des Despotismus
Ibn Khaldun entdeckt die Laffer-Kurve
Das janusköpfige despotische Wachstum
Das Gesetz des gesprungenen Paddels
Ein Hai geht an Land
Der Vogel, der alle anderen frisst
Die Ökonomie der Rosenrevolution
Die Wirtschaft im Normenkäfig und die despotische Wirtschaft
5. Die Allegorie der guten Regierung
Die Fresken der Piazza del Campo
Die Auswirkungen der guten Regierung
Wie der heilige Franziskus zu seinem Namen kam
Die erste Katze auf den Kanarischen Inseln
Die Ökonomie im Korridor
Die Auswirkungen der schlechten Regierung
Warum Tortillas erfunden wurden
6. Die europäische Schere
Europa betritt den Korridor
Die Versammlungspolitik der langhaarigen Könige
Die zweite Klinge
Die beiden Klingen kommen zusammen
Das unvereinigte Königreich
1066 und die Folgen
Die Rote Königin in Aktion: Die Magna Carta
Der unzufriedene Bienenstock
Parlamente in Hülle und Fülle
Vom Thing zum Althing: Europa außerhalb des Korridors
Der Dollar des Mittelalters: Der Byzantinische Leviathan
Vorwärts im Korridor
Der nächste Käfig, den es zu zerbrechen gilt
Die Ursprünge der industriellen Revolution
Warum in Europa?
7. Das Mandat des Himmels
Das Boot zum Kentern bringen
Alles unter dem Himmel
Aufstieg und Fall und Wiederaufstieg des Brunnenfeldsystems
Den Zopf abschneiden
Despotismus billig zu haben
Eine abhängige Gesellschaft
Das chinesische Glück ist wechselhaft
Das Mandat von Marx
Wachstum unter moralischer Führung
Freiheit nach chinesischer Manier
8. Die zerbrochene Rote Königin
Eine Geschichte über den Hass
Indien im Normenkäfig
Die gebrochenen Menschen
Jene, die dominieren
Die gefesselte Ökonomie der Kasten
Republiken aus alter Zeit
Das Land der Tamilen
Von der Gana-Sangha zur Lok Sabha
Keine Ehre unter den Varnas
Die zerbrochene Rote Königin
9. Der Teufel steckt im Detail
Europäische Vielfalt
Krieg machte den Staat, und der Staat machte Krieg
Die Sorte Staat, die der Krieg macht
Die Freiheit auf den Höhen
Unterschiede, auf die es ankommt
In der Leninwerft
Die Ent-Zähmung des russischen Bären
Vom Despotismus zur Auflösung
Weil wir müssen
Gründe für Divergenz
Repressionen auf der Finca
Warum die Geschichte eine Rolle spielt
10. Was ist los mit Ferguson?
Mord um die Mittagszeit
Der Kollateralschaden des amerikanischen Exzeptionalismus
Was für eine Bill of Rights?
Amerikanische Sklaverei, amerikanische Freiheit
Auf Umwegen unterwegs zur amerikanischen Staatsbildung
We Shall Overcome
Das Leben im amerikanischen Korridor
Wer holt sich auf der Route 66 den Kick?
Warum können wir nicht die ganze Zeit alle Signale auffangen?
Der paradoxe Amerikanische Leviathan
11. Der Papier-Leviathan
Patienten des Staates
Gnocchi im stahlharten Gehäuse
Beim Ententest durchgefallen
Kein Platz für Straßen
Der Orang-Utan im Frack
Im Meer pflügen
Mississippi in Afrika
Die postkoloniale Welt
Die Folgen des Papier-Leviathans
12. Al-Wahhabs Kinder
Der Traum des Taktikers
Die Ulama zähmen
Den Normenkäfig intensivieren
Die Unberührbaren Saudi-Arabiens
Nebukadnezar reitet wieder
Die Saat des 11. September 2001
13. Die Rote Königin außer Kontrolle
Eine Revolution des Nihilismus
Eine Regenbogenkoalition der Unzufriedenen
Die Rote Königin des Nullsummenspiels
Despotismus von unten
Wie die Rote Königin außer Kontrolle gerät
Wie viel Land benötigt ein Inquilino?
Wem die Stunde schlägt
Die Verlockung der Autokraten
Wer mag schon Gewaltenteilung?
Zurück im Korridor?
Gefahr im Verzug
14. Wege in den Korridor
Die Bürde des schwarzen Mannes
Die Regenbogenkoalition
Türen in den Korridor
Ein stahlhartes Gehäuse bauen
Schwarzer Türke, weißer Türke
Der Viagrafrühling
Dem Orang-Utan den Frack ausziehen
Die Form des Korridors
Eine andere Welt?
Der Korridor der Globalisierung
Wir sind jetzt alle Hobbesianer
15. Leben mit dem Leviathan
Hayeks Irrtum
Der schwedische Kuhhandel
Der Leviathan gegen den Markt
Ungeteilter Wohlstand
Die Wall Street außer Rand und Band
Überdimensionierte Konzerne
Wie man das Nullsummenspiel der Roten Königin vermeidet
Der Krieg des Leviathans gegen den Terror
Bürgerrechte in Aktion: Das Niemöller-Prinzip
Danksagung
Bibliographischer Essay
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Quellen für die Karten
Bildnachweis
BILDTEIL
Für Arda und Aras; auch wenn dies hier weniger ist, als ich euch verdanke. DA
Für Adrián und Tulio. Für mich die Vergangenheit; für euch die Zukunft. JR
Vorwort
Freiheit
Dieses Buch handelt von der Freiheit und davon, wie und warum menschliche Gesellschaften sie errungen haben oder an dieser Aufgabe gescheitert sind. Es handelt gleichermaßen von den Folgen, die sich daraus ergeben. Unsere Definition von Freiheit schließt sich jener von John Locke an, der erklärt, »ein Zustand vollkommener Freiheit« sei dann erreicht, wenn Menschen
ihre Handlungen regeln und über ihren Besitz und ihre Person so verfügen, wie es ihnen am besten scheint, ohne dabei jemanden um Erlaubnis zu bitten oder vom Willen eines anderen abhängig zu sein.
So verstanden, ist Freiheit eine grundlegende Bestrebung jedes menschlichen Wesens. Locke betont jedoch, dass dabei …
… niemand einem anderen … an seinem Leben und Besitz, seiner Gesundheit und Freiheit Schaden zufügen soll.
Unbestritten dürfte sein, dass in früheren Zeiten ebenso wie heute die Freiheit ein rares Gut war. Jahr für Jahr fliehen Millionen von Menschen aus ihrer Heimat im Nahen Osten, in Afrika, Asien und Mittelamerika und setzen dabei Leib und Leben aufs Spiel, nicht eines besseren Verdienstes oder bequemerer Lebensverhältnisse wegen, sondern weil sie sich und ihre Familien vor Angst und Gewalt schützen wollen.
Philosophen haben Freiheit oftmals ganz unterschiedlich definiert. Doch auf der elementarsten Ebene beginnt Freiheit, wie Locke gezeigt hat, dann, wenn die Menschen frei von Gewalt, Einschüchterung und anderen erniedrigenden Bedingungen sind. Die Menschen müssen ihr Leben frei gestalten können, ohne Angst, dafür bestraft oder mit drakonischen sozialen Sanktionen belegt zu werden.
Alles Übel dieser Welt
Im Januar 2011 kam es auf dem Markt in Harika, einem Viertel der syrischen Hauptstadt Damaskus, zu spontanen Protesten gegen das despotische Regime von Baschar al-Assad. Nicht lange danach schrieben Kinder in der südlich von Damaskus gelegenen Stadt Dara’a »Das Volk will den Sturz der Regierung« an eine Hauswand. Die Kinder wurden festgenommen und gefoltert. Eine Menschenmenge forderte ihre Freilassung, worauf die Polizei zwei der Protestierer erschoss. Daraufhin kam es zu Massendemonstrationen, die sich rasch über das ganze Land ausbreiteten. Viele ihrer Teilnehmer wollten, wie sich herausstellte, tatsächlich den Sturz der Regierung. Kurze Zeit später brach der Bürgerkrieg aus, was dazu führte, dass sich die staatlichen Institutionen, das Militär und die Sicherheitskräfte aus einem Großteil des Landes zurückzogen. Statt Freiheit herrschte nun unkontrollierte Gewalt.
Adam, ein Medienmanager aus Latakia, brachte auf den Punkt, was dies für Folgen hatte:
Wir dachten, wir hätten ein Geschenk bekommen, aber was wir bekamen, war alles Übel dieser Welt.
Der aus Aleppo stammende Dramatiker Husayn fasste es so zusammen: »Wir hätten nie erwartet, dass diese finsteren Gruppen nach Syrien kommen würden – jene, die jetzt das Sagen haben.«
Führend unter diesen »finsteren Gruppen« war der sogenannte Islamische Staat oder ISIS, wie man ihn damals nannte, dessen Ziel es war, ein neues »islamisches Kalifat« zu errichten. 2014 brachte ISIS die syrische Großstadt Raqqa unter seine Kontrolle. Auf der anderen Seite der Grenze, im Irak, eroberte ISIS die Städte Falludscha, Ramadi und die historische Stadt Mossul mit ihren 1,5 Millionen Einwohnern. ISIS und andere bewaffnete Gruppierungen füllten das Machtvakuum, das durch den Zusammenbruch der Regierungen in Syrien und im Irak entstanden war, mit unvorstellbarer Grausamkeit. Schwere körperliche Misshandlungen, Enthauptungen und Verstümmelungen waren an der Tagesordnung. Abu Firas, der für die Freie Syrische Armee kämpfte, schilderte die »neue Normalität« in Syrien:
Schon so lange habe ich nicht mehr gehört, dass jemand eines natürlichen Todes gestorben ist. Anfangs wurden ein oder zwei Menschen getötet. Dann zwanzig. Dann fünfzig. Dann wurde es Normalität. Wenn wir fünfzig Leute verloren haben, dachten wir: »Gott sei Dank, es sind nur fünfzig!« Ich kann ohne das Geräusch von Bomben und Geschossen nicht schlafen. Es ist, als würde etwas fehlen.
Amin, ein Physiotherapeut aus Aleppo, erzählte:
Einer meiner Kumpel rief seine Freundin an und sagte: »Schatz, ich habe keine Freiminuten mehr. Ich melde mich gleich noch mal mit Amins Telefon.« Nach einer Weile rief sie mich an und fragte nach ihm, und ich sagte ihr, dass er getötet worden sei. Sie brach in Tränen aus, und meine Freunde fragten: »Warum hast du ihr das erzählt?« Ich sagte: »Weil es passiert ist. Es ist normal. Er ist tot.« … Wenn ich in das Kontaktverzeichnis meines Handys schaute, waren nur ein oder zwei Namen noch am Leben. Bei uns hieß es: »Wenn einer stirbt, dann lösche seine Nummer nicht. Sondern ändere seinen Namen zu Märtyrer.« … Wenn ich also meine Kontaktliste öffnete, stand da überall Märtyrer, Märtyrer, Märtyrer.
Der Zusammenbruch des syrischen Staates verursachte eine Katastrophe enormen Ausmaßes. Von den rund 18 Millionen Syrerinnen und Syrern, die vor dem Krieg im Land lebten, kamen schätzungsweise 500000 ums Leben. Mehr als sechs Millionen wurden innerhalb des Landes vertrieben, und fünf Millionen sind aus dem Land geflohen und fristen ihr Dasein als Flüchtlinge.
Das Gilgamesch-Problem
Es überrascht nicht, dass der Kollaps des syrischen Staates eine derartige Katastrophe nach sich zog. Philosophen und Sozialwissenschaftler haben bereits seit langem nachgewiesen, dass ein Staat vorhanden sein muss, wenn man Konflikte lösen, den Gesetzen Geltung verschaffen und die Gewalt im Zaum halten will. John Locke schreibt:
Wo es kein Gesetz gibt, da gibt es auch keine Freiheit.
Doch die syrische Bevölkerung wollte mit ihren Protesten von Assads autokratischem System gewisse Freiheiten einfordern. Reumütig bekannte Adam:
Es ist schon ein bisschen paradox. Wir wollten mit unseren Demonstrationen erreichen, dass die Korruption aufhört, Schluss ist mit den kriminellen, üblen Vorgängen und den Misshandlungen von Menschen.
Aber erreicht haben wir nur, dass jetzt noch viel mehr Menschen misshandelt werden.
Dieses Paradox, von dem Adam spricht, ist in menschlichen Gesellschaften schon von jeher präsent. Von ihm handelt eines der ältesten schriftlichen Zeugnisse, über die wir verfügen, die 4200 Jahre alten sumerischen Tontafeln mit dem Gilgamesch-Epos. Gilgamesch war der König von Uruk, der vielleicht ersten Großstadt der Welt, gelegen am Ufer des Euphrat im Süden des heutigen Iraks. Das Epos erzählt von der bemerkenswerten Stadt, die Gilgamesch erschuf, in der der Handel florierte und die ihren Einwohnern öffentliche Dienstleistungen bot:
Sieh wie ihre Wallanlagen wie Kupfer in der Sonne
glänzen! Nimm die steinerne Treppe … wandle auf der
Mauer von Uruk umher, folge ihrem Lauf um die Stadt,
beschaue ihre mächtigen Fundamente, prüfe ihr
Ziegelwerk, wie meisterhaft es erschaffen ist, schaue
hinaus auf das Land, das die Stadt umschließt, die
prächtigen Paläste und Tempel, die Läden und
Marktplätze, die Häuser und öffentlichen Plätze.
Doch die Sache hatte einen Haken.
Wer kann es mit Gilgamesch aufnehmen? … Die Stadt gehört ihm, er stolziert darin umher, hochmütig, den Kopf hoch erhoben, und trampelt seine Bürger nieder wie ein wilder Stier. Er ist der König, er tut, was ihm beliebt, nimmt dem Vater seinen Sohn und zermalmt ihn, nimmt der Mutter die Tochter und missbraucht sie … keiner wagt es, sich ihm zu widersetzen.
Gilgamesch kannte keine Grenzen für sein Tun. Darin ähnelte er dem syrischen Despoten Assad. In seiner Verzweiflung flehte das Volk Anu an, den Gott des Himmels und die oberste Gottheit des sumerischen Pantheons:
Himmlischer Vater, Gilgamesch … hat alle Grenzen
überschritten. Das Volk leidet unter seiner Tyrannei …
Willst du, dass dein König so herrscht? Darf ein Hirte
seine eigene Herde niedermetzeln?
Anu erhörte das Flehen und bat Aruru, die Schöpfungsmutter,
einen Doppelgänger für Gilgamesch zu erschaffen, sein
zweites Ich, einen Mann, der ihm an Stärke und Mut
gleichkommt, einen Mann, der seinem stürmischen Herzen
in nichts nachsteht. Erschaffe einen neuen Helden,
lasse die beiden einander vollkommen ebenbürtig sein,
auf dass Uruk Frieden findet.
Anu fand also eine Lösung für das, was wir als das »Gilgamesch-Problem« bezeichnen – zur Förderung des Guten die Befugnisse und die Macht des Staates zu kontrollieren. Anus Lösung bestand darin, einen »Doppelgänger« zu erschaffen, ähnlich dem, was man heute als »Gewaltenteilung« kennt. Gilgameschs Doppelgänger Enkidu sollte ihn im Zaum halten. James Madison, einer der Gründerväter des US-amerikanischen Regierungssystems, hätte das gefallen. 4000 Jahre nach Gilgamesch forderte er, eine Verfassung müsse so beschaffen sein, dass »Ehrgeiz dem Ehrgeiz entgegenwirkt«.
Gilgameschs erste Begegnung mit seinem Doppelgänger fand statt, als er gerade im Begriff war, sich durch Raub eine neue Braut zu beschaffen. Dabei stellte sich Enkidu ihm in den Weg, und sie kämpften miteinander. Obwohl Gilgamesch schließlich die Oberhand gewann, war danach seine unangefochtene, despotische Macht dahin. Die Saat der Freiheit in Uruk?
Leider nein. Eine von oben verordnete Gewaltenteilung funktioniert in der Regel nicht, und dies war auch in Uruk der Fall. Schon bald taten sich Gilgamesch und Enkidu zusammen:
Sie umarmten und küssten sich.
Sie hielten einander die Hände wie Brüder.
Sie gingen Seite an Seite.
Sie wurden wahre Freunde.
Alsbald nahmen sie sich vor, das Ungeheuer Humbaba zu töten, den Hüter des großen Zedernwaldes. Als die Götter den Himmelsstier losschickten, um die beiden für diesen Frevel zu bestrafen, töteten sie mit vereinten Kräften auch ihn. Die Aussicht auf Freiheit verflüchtigte sich mit dem Verschwinden der Gewaltenteilung.
Woraus soll die Freiheit erwachsen, wenn nicht aus einem Staat, der durch Doppelgänger oder die Gewaltenteilung eingehegt wird? Aus einem Regime wie dem von Assad gewiss nicht. Bestimmt auch nicht aus der Anarchie, die dem Zusammenbruch des syrischen Staats folgte.
Unsere Antwort ist einfach: Freiheit benötigt den Staat und die Gesetze. Sie wird aber nicht vom Staat oder den Eliten, die ihn kontrollieren, erteilt. Vielmehr wird sie von den gewöhnlichen Bürgern, von der »Gesellschaft«, errungen. Die Gesellschaft muss den Staat kontrollieren, so dass er ihre Freiheit schützt und fördert, anstatt sie zu unterdrücken, wie es Assad in Syrien vor 2011 getan hat. Freiheit benötigt eine mobilisierte Gesellschaft, die an der Politik partizipieren kann, die nötigenfalls protestiert und in der Lage ist, die Regierung aus dem Amt zu wählen. Die Freiheit geht aus einem fragilen Gleichgewicht zwischen Staat und Gesellschaft hervor.
Der schmale Korridor zur Freiheit
In diesem Buch möchten wir darlegen, dass Freiheit nur entstehen und gedeihen kann, wenn sowohl der Staat als auch die Gesellschaft stark sind. Ein starker Staat wird benötigt, um die Gewalt zu kontrollieren, den Gesetzen Geltung zu verschaffen und öffentliche Dienstleistungen bereitzustellen, die unabdingbar sind, wenn den Menschen ermöglicht werden soll, ihr Leben nach eigenem Gutdünken zu führen. Eine starke, mobilisierte Gesellschaft wird benötigt, um den starken Staat zu kontrollieren und ihm Fesseln anzulegen. Doppelgänger-Lösungen und Gewaltenteilung beheben das Gilgamesch-Problem nicht, weil ohne die Wachsamkeit der Gesellschaft die Verfassungen und Garantien nicht viel mehr wert sind als das Papier, auf dem sie geschrieben stehen.
Zwischen der von despotischen Staaten erzeugten Angst und Repression einerseits und der Gewalt und Gesetzlosigkeit bei Abwesenheit eines Staates andererseits liegt ein schmaler Korridor der Freiheit. In diesem Korridor halten sich Staat und Gesellschaft die Waage. Dieses Gleichgewicht wird nicht durch ein revolutionäres Moment hergestellt. Es ist ein ständiges, tägliches Ringen zwischen beiden Kräften, das sich positiv auswirkt. Im Korridor der Freiheit treten Staat und Gesellschaft nicht einfach nur in Konkurrenz zueinander, sondern sie kooperieren auch. Dies versetzt den Staat besser in die Lage, die Leistungen zu erbringen, nach denen die Gesellschaft verlangt, und fördert eine stärkere gesellschaftliche Mobilisierung zur Kontrolle dieser Fähigkeit.
Warum dies ein Korridor und keine Tür ist, hat seinen Grund darin, dass die Erringung der Freiheit in einem Prozess vonstattengeht. Man muss in dem Korridor einen langen Weg zurücklegen, bevor die Gewalt unter Kontrolle gebracht ist, Gesetze verfasst und durchgesetzt sind und der Staat beginnt, seinen Bürgern Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Es ist ein Prozess, weil der Staat und die Eliten erst lernen müssen, mit den Fesseln zu leben, die ihnen die Gesellschaft anlegt, ebenso wie die verschiedenen Segmente der Gesellschaft lernen müssen, trotz ihrer Differenzen zusammenzuarbeiten.
Dieser Korridor ist deshalb schmal, weil all diese Aufgaben nicht leicht zu bewältigen sind. Wie lässt sich ein Staat mit einer riesigen Bürokratie, einem mächtigen Militär und dem Vermögen, über Recht und Gesetz zu entscheiden, in Schranken halten? Wie kann man sicherstellen, dass sich ein Staat, der dazu aufgerufen ist, in einer komplexen Welt mehr Verantwortung zu übernehmen, gebändigt und kontrollierbar bleibt? Wie dafür sorgen, dass eine Gesellschaft ihre Kooperationsbereitschaft aufrechterhält und sich nicht gegen sich selbst wendet, zerrissen von Differenzen und Spaltungen? Wie verhindern, dass all dies nicht zu einem Nullsummenspiel wird? Dies ist ganz und gar nicht einfach, und deshalb ist der Korridor schmal. Gesellschaften treten in ihn ein und verlassen ihn wieder, jeweils mit weitreichenden Folgen.
Nichts davon lässt sich künstlich in die Wege leiten. Ohnehin neigen Staatsführer in der Regel nicht dazu, Freiheit aus eigenem Antrieb bewusst herbeizuführen. Sind der Staat und seine Eliten zu mächtig und verhält sich gleichzeitig die Gesellschaft unterwürfig, warum sollten dann die Herrschenden den Menschen Rechte und Freiheit einräumen? Und selbst wenn sie es täten, könnte man darauf vertrauen, dass sie zu ihrem Wort stehen?
An der Geschichte der Frauenbewegung verdeutlicht sich, wie sich die Ursprünge der Freiheit seit der Zeit des Gilgamesch bis heute entwickelt haben. Welche gesellschaftlichen Veränderungen seit jenen Tagen, in denen – wie es im Epos heißt – »die Jungfräulichkeit jedes Mädchens … ihm gehörte«, haben dazu geführt, dass Frauen heute Rechte haben (zumindest in einigen Gesellschaften)? Könnte es sein, dass diese Rechte von Männern gewährt wurden? Die Vereinigten Arabischen Emirate beispielsweise verfügen über einen Rat zur Gleichstellung der Geschlechter, der 2015 von Scheich Muhammad Bin Raschid Al Maktum eingesetzt wurde, dem Vizepräsidenten und Premierminister des Landes und Herrscher von Dubai. Der Rat vergibt jedes Jahr Preise an »die Verwaltungsbehörde mit der besten Bilanz hinsichtlich der Gleichstellung der Geschlechter« sowie an die Bundesbehörde mit der entsprechend besten Bilanz und an »die beste Gleichstellungsinitiative«. Die Preise des Jahres 2018, die Scheich Maktum persönlich überreichte, haben eines gemeinsam – sie alle wurden einem Mann verliehen. Die Lösung, die die Vereinigten Arabischen Emirate verfolgen, hat den Makel, dass sie von Scheich Maktum künstlich eingeführt und der Gesellschaft auferlegt wurde, ohne Beteiligung der Gesellschaft.
Man vergleiche dies zum Beispiel mit der erfolgreicheren Geschichte der Frauenbewegung in Großbritannien, wo den Frauen die Rechte nicht einfach zu Füßen gelegt wurden, sondern wo sie sie hart erkämpfen mussten. Frauen schlossen sich zu einer sozialen Bewegung zusammen, den sogenannten Suffragetten, die aus der British Women’s Social and Political Union hervorging, einer ausschließlich von Frauen gebildeten, 1903 gegründeten Organisation. Die britischen Frauen warteten nicht darauf, dass Männer ihnen Preise für die »beste Gleichstellungsinitiative« verliehen. Sie mobilisierten sich, engagierten sich in Protestaktionen und übten zivilen Ungehorsam. Sie zündeten einen Sprengsatz am Sommerhaus des damaligen Schatzkanzlers und späteren Premiers David Lloyd George und ketteten sich vor dem Parlament an das Geländer. Sie verweigerten die Entrichtung von Steuern, und wenn man sie ins Gefängnis warf, traten sie in Hungerstreik und mussten zwangsernährt werden.
Emily Davison war prominente Vorkämpferin der Suffragettenbewegung. Am 4. Juni 1913 stürmte sie beim berühmten Epson Derby mitten auf die Galopprennbahn und stellte sich Anmer, dem Pferd König Georges V., in den Weg. Manchen Berichten zufolge soll Davison dabei die lila-weiß-grüne Fahne der Suffragetten geschwungen haben. Davison wurde von Anmer erfasst, das Pferd stürzte und begrub sie unter sich. Vier Tage später starb sie an ihren Verletzungen. Fünf Jahre danach konnten Frauen erstmals an Parlamentswahlen teilnehmen. Die Frauen in Großbritannien bekamen nicht aufgrund der Großherzigkeit männlicher Führer Rechte, sondern weil sie sich organisiert und sich selbst ermächtigt hatten.
Die Geschichte der Frauenemanzipation ist kein Ausnahmefall. Freiheit hängt fast immer von der Mobilisierung der Gesellschaft und ihrer Fähigkeit ab, gegenüber dem Staat und seinen Eliten ein Machtgleichgewicht herzustellen.
1.Wie endet die Geschichte?
Eine künftige Anarchie?
Im Jahr 1989 sagte Francis Fukuyama das »Ende der Geschichte« voraus, da sich alle Länder den politischen und wirtschaftlichen Institutionen der Vereinigten Staaten angleichen würden, was er als »dreisten Sieg des wirtschaftlichen und politischen Liberalismus« bezeichnete. Nur fünf Jahre später entwarf Robert Kaplan in seinem Beitrag The Coming Anarchy ein radikal anderes Zukunftsbild. Am Beispiel von Westafrika verdeutlichte er seine düstere Vision:
Westafrika wird zum Symbol der [Anarchie] … Krankheiten, Übervölkerung, sinnlose Verbrechen, Mangel an Ressourcen, Flüchtlingsströme, die zunehmende Erosion der Nationalstaaten und internationalen Grenzen sowie das Erstarken privater Armeen, Sicherheitsfirmen und internationaler Drogenkartelle sind heute in Westafrika höchst eindrucksvoll zu beobachten. Westafrika bietet eine prägnante Einführung in die Problemstellungen, über die zu diskutieren oft äußerst unangenehm ist, mit denen unsere Zivilisation aber schon bald konfrontiert sein wird. Die politische Welt dahingehend neu zu vermessen wird somit noch einige Jahrzehnte dauern … Ich denke, ich muss mit Westafrika beginnen.
In seinem 2018 erschienenen Artikel Why Technology Favors Tyranny traf Yuval Noah Harari ebenfalls eine Zukunftsprognose. Ihr zufolge seien die Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz Vorboten »digitaler Diktaturen«, die es Regierungen ermöglichen würden, unser Handeln, Kommunizieren und Denken zu überwachen, zu kontrollieren und sogar zu steuern.
Also mag die Geschichte vielleicht an ihr Ende kommen, aber auf ganz andere Weise, als Fukuyama sich das vorgestellt hat. Doch wie? Wird Fukuyamas Vision der Demokratie triumphieren oder doch die Anarchie oder die digitale Diktatur? Die zunehmende staatliche Kontrolle des Internets, der Medien und des Lebens der gewöhnlichen Bürger in China könnte darauf hindeuten, dass wir auf dem Weg in eine digitale Diktatur sind, während die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten und in Afrika uns vor Augen führen, dass die Vorstellung künftiger Anarchie gar nicht so weit hergeholt sein könnte.
Doch wir wollen uns diesem Thema auf systematische Weise nähern. Beginnen wir deshalb, wie Kaplan vorschlägt, mit Afrika.
Der Staat mit dem Artikel 15
Hält man sich an der westafrikanischen Küste am Golf von Guinea ostwärts und durchquert Äquatorial-Guinea, Gabun und Pointe-Noire in Kongo-Brazzaville, gelangt man an die Mündung des Kongo-Flusses, den Eingang zur Demokratischen Republik Kongo, einem Land, das oft als Inbegriff der Anarchie beschrieben wird. Dort kursiert ein Witz: Seit seiner Unabhängigkeit von Belgien im Jahr 1960 gab es in dem Land sechs Verfassungen, alle mit einem gleichlautenden Artikel 15. Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, der im 19. Jahrhundert in Frankreich diverse Staatsämter innehatte, sagte einmal, eine Verfassung solle »kurz und unbestimmt« sein. Artikel 15 der kongolesischen Verfassung erfüllt diese Kriterien, er ist kurz und unbestimmt und lautet schlicht: Débrouillez-vous – Sorgt für euch selbst.
Unter einer Verfassung stellt man sich zumeist ein Dokument vor, in dem die Verantwortlichkeiten, Pflichten und Rechte der Bürger und des Staates festgeschrieben sind. Der Staat soll die Konflikte zwischen den Bürgern lösen, sie beschützen und die wesentlichen öffentlichen Dienstleistungen zur Verfügung stellen wie etwa Bildung, Gesundheitsfürsorge und Infrastruktur, um den Menschen zu ermöglichen, ihr Leben angemessen zu gestalten. Aber eine Verfassung sollte nicht sagen, sorgt für euch selbst.
Artikel 15 ist nur ein Witz. In der kongolesischen Verfassung gibt es keinen solchen Artikel. Aber dieser Witz trifft den Nagel auf den Kopf. Die Kongolesen haben mindestens seit der Unabhängigkeit 1960 für sich selbst gesorgt (und davor war ihre Lage noch schlechter). Ihr Staat hat wiederholt darin versagt, auch nur etwas von dem zu leisten, was von ihm erwartet wird, und er ist in weiten Teilen des Landes nicht präsent. Fast überall im Kongo sind die Gerichte, Straßen, Kliniken und Schulen im Verfall begriffen. Mord, Raub, Erpressung und Einschüchterung sind gang und gäbe. Während des Zweiten Kongokriegs, der von 1998 bis 2003 tobte, verwandelte sich das Leben der meisten, ohnehin schon arg gebeutelten Kongolesen in eine wahre Hölle. Schätzungsweise fünf Millionen Menschen kamen dabei ums Leben. Sie wurden umgebracht, starben an Krankheiten oder verhungerten.
Nicht einmal in Friedenszeiten hat es der kongolesische Staat vermocht, die Zusagen seiner Verfassung einzuhalten. Artikel 16 lautet:
Alle Bürger haben das Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit und auf freie Entwicklung ihrer Persönlichkeit, sofern sie die Gesetze, die öffentliche Ordnung, die Rechte anderer und die öffentliche Moral respektieren.
Ein Großteil der Kivu-Region im Osten des Landes wird jedoch nach wie vor von Rebellengruppen und Warlords kontrolliert, die die dort lebenden Menschen ausplündern, drangsalieren und ermorden und die Bodenschätze des Landes rauben.
Wie steht es mit dem echten Artikel 15 der kongolesischen Verfassung? »Die staatlichen Behörden sind verantwortlich für die Verhinderung sexueller Gewalt …«. Doch 2010 nannte ein Vertreter der Vereinten Nationen das Land »die Welthauptstadt der Vergewaltigung«.
Die Kongolesen sind auf sich allein gestellt. Débrouillez-vous.
Eine Reise durch die Dominanz
Dies trifft nicht nur auf die Kongolesen zu. Reist man Richtung Golf von Guinea zurück, trifft man auf einen Ort, der Kaplans düstere Zukunftsvision vollkommen zu bestätigen scheint – Lagos, das Wirtschaftszentrum Nigerias. Kaplan beschreibt Lagos als eine Stadt, »deren Kriminalität, Umweltverschmutzung und Übervölkerung sie zum Klischee par excellence der urbanen Dysfunktion der Dritten Welt machen«.
Im Jahr 1994 herrschte in Nigeria eine Militärdiktatur, mit General Sani Abacha als Präsident. Abacha sah es nicht als seine Aufgabe an, Konflikte unparteiisch zu lösen oder die Nigerianer zu beschützen. Er konzentrierte sich darauf, seine Gegner umzubringen und die Bodenschätze des Landes auszubeuten. Er soll seinem Land mindestens drei Milliarden Dollar geraubt haben, vermutlich noch viel mehr.
Im Jahr zuvor, 1993, kehrte der Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Wole Soyinka nach Lagos zurück. Er wollte von Cotonou aus, dem Regierungssitz des benachbarten Benin, die Grenze zu Nigeria überqueren (siehe Karte 1). Das schilderte er wie folgt: »Als wir uns der Grenze zwischen Benin und Nigeria näherten, wurde die ganze Geschichte auf einen Schlag deutlich. Die Schlange der am Straßenrand geparkten Wagen, die die Grenze nicht passieren konnten oder wollten, war auf beiden Seiten kilometerlang.« Er sah Leute, die gewagt hatten, die Grenze zu passieren. »Mit verbeulten Fahrzeugen und/oder ausgeplünderten Taschen waren sie zurückgekommen, man hatte sie mit Waffengewalt gezwungen, Wegezoll zu zahlen, als sie bis zur ersten, von Demonstranten errichteten Straßenblockade vorgeprescht waren.«
Karte 1: Westafrika: Das historische Königreich der Aschanti, das Land der Yoruba, das Land der Tiv und Wole Soyinkas Reiseweg von Cotonou nach Lagos
Soyinka ließ sich jedoch nicht abschrecken, passierte zu Fuß die Grenze und suchte nach jemand, der ihn in die Hauptstadt bringen konnte. Aber er hörte immer nur: »Oga Wole, eko e da o« (Meister Wole, Lagos ist nicht gut). Ein Taxifahrer deutete mit seiner bandagierten Hand auf seinen bandagierten Kopf und erzählte, was ihm zugestoßen war. Eine blutrünstige Gang hatte ihn verfolgt und erwischt, obwohl er mit Vollgas im Rückwärtsgang versucht hatte zu entkommen.
Oga … diese Kerle haben meine Windschutzscheibe eingeschlagen, obwohl ich schon rückwärts gefahren bin. Gott hat mich gerettet. Eko ti daru, Lagos ist ein Chaos.
Schließlich fand Soyinka ein Taxi, das ihn nach Lagos brachte, doch der zögerliche Fahrer meinte: »Mann, die Straße ist schlecht. Sehr schlecht.« Und so begann, wie Soyinka schrieb, »die albtraumhafteste Reise meines Daseins«:
Die Straßensperren bestanden aus leeren Benzinfässern, abgefahrenen Reifen, Felgen, Verkaufsbuden, Holzklötzen, Baumstämmen, kleinen Felsbrocken … Die angeworbenen Straßenrowdys hatten die Sache … in die eigenen Hände genommen … An manchen der Straßensperren wurde ein Wegezoll erhoben, man zahlte und konnte weiterfahren – aber das bot eine Sicherheit, die nur bis zur nächsten Barriere reichte. Manchmal bestand der Zoll aus einem Kanister voll Benzin, das aus dem Wagentank abgezapft wurde, dann durfte man die Fahrt fortsetzen – bis zur nächsten Schranke. … Einige der Fahrzeuge hatten eindeutig einen Gassenlauf durch Wurfgeschosse, Knüppel, ja bloße Fäuste hinter sich, andere schienen direkt vom Filmset von Jurassic Park hierher verfrachtet – man hätte schwören können, dass abnormale Zahnabdrücke in der Karosserie zu sehen waren.
Als sich Soyinka Lagos näherte, wurde die Situation noch schlimmer:
Normalerweise dauert die Fahrt von dort ins Herz von Lagos ungefähr zwei Stunden. Jetzt waren bereits mehr als fünf Stunden vergangen, und wir hatten noch keine fünfzig Kilometer hinter uns gebracht. Meine Besorgnis wuchs … Es lag eine mit Händen greifbare Spannung in der Luft, als wir näher und näher an Lagos herankamen. Die Blockaden standen dichter, die Zahl demolierter Fahrzeuge nahm zu, und, am schlimmsten, es lagen Leichen am Straßenrand.
Leichen sind kein ungewöhnlicher Anblick in Lagos. Als ein hochrangiger Polizeibeamter vermisst gemeldet wurde, suchte die Polizei im Gewässer unter einer Brücke nach seinem Leichnam. Die Suche endete nach sechs Stunden und dem Fund von 23 Toten, von denen keiner die gesuchte Person war.
Während das nigerianische Militär das Land ausplünderte, war es für die Bewohner von Lagos nicht leicht, sich durchzuschlagen. Die Stadt war ein Hort des Verbrechens, und der internationale Flughafen befand sich in derart marodem Zustand, dass er von ausländischen Fluggesellschaften gemieden wurde. Gangs, die sich »Area Boys« nannten, machten Jagd auf Geschäftsleute, raubten sie aus und töteten sie sogar zuweilen. Die Area Boys waren nicht die einzige Gefahr für die Menschen. Auf den Straßen fand man nicht nur Leichen, dort türmte sich der Müll, und Ratten liefen umher. Ein Reporter der BBC berichtete 1999, dass »die Stadt … unter einem Berg von Abfällen verschwindet«. Es gab weder eine öffentliche Stromversorgung noch fließendes Wasser. Wollte man in der Wohnung Licht haben, benötigte man einen Generator. Oder Kerzen.
Das albtraumhafte Leben der Bewohner von Lagos beschränkte sich nicht darauf, dass ihre Straßen von Ratten und Müll verseucht waren und auf den Gehsteigen Leichen lagen. Sie lebten in ständiger Angst. Im Zentrum von Lagos zu wohnen, mit den Area Boys vor Ort, war kein Spaß. Selbst wenn man heute von ihnen verschont blieb, konnten sie es schon morgen auf einen abgesehen haben – vor allem, wenn man die Kühnheit besaß, sich darüber zu beschweren, was sie der Stadt antaten, oder wenn man ihnen nicht die von ihnen eingeforderte Unterwürfigkeit bewies. Ständige Angst, Unsicherheit und Ungewissheit kann ebenso zermürbend sein wie die tatsächliche Gewalt, weil sie einen – um einen Begriff des Philosophen und Politikwissenschaftlers Philip Pettit zu benutzen – unter die »Dominanz« einer anderen Menschengruppe stellt.
In seinem Buch Republicanism: A Theory of Freedom and Government schreibt Pettit, die Grundlage eines erfüllten, ehrbaren Lebens sei Nicht-Dominanz – die Freiheit von Dominanz, Angst und extremer Unsicherheit. Pettit zufolge ist es inakzeptabel,
unter der Gewalt von jemand anderem leben zu müssen, in einer Art und Weise, die einen schutzlos macht vor einem Übel, das der andere einem willkürlich aufzuerlegen in der Lage ist.
Eine solche Dominanz herrscht beispielsweise dann, wenn
eine Ehefrau in die Lage gerät, dass ihr Mann sie nach Belieben schlagen kann, ohne dass sie die Möglichkeit hat, dies zu verhindern; wenn ein Arbeitnehmer es nicht wagen kann, sich über seinen Arbeitgeber zu beschweren, und wehrlos einer Vielzahl von Schikanen ausgesetzt ist … zu denen der Arbeitgeber womöglich greift; wenn der Schuldner von der Gnade des Gläubigers oder des Bankbeamten abhängig ist, dass dieser ihn nicht in Armut und Ruin stürzt.
Pettit betont, bereits die Drohung mit Gewalt oder Misshandlung könne ebenso schlimm sein wie die tatsächlich ausgeübte Gewalt oder die Misshandlung selbst. Natürlich kann man der Gewalt dadurch entgehen, dass man sich den Wünschen oder Befehlen der anderen Person fügt. Doch der Preis dafür ist, etwas zu tun, was man nicht möchte, und dieser Bedrohung ständig ausgesetzt zu sein. (Ökonomen würden dazu sagen, Gewalt liege »außerhalb des Gleichgewichtspfads«, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht das eigene Verhalten beeinflusst oder Folgen hat, die fast so schmerzlich sind wie die tatsächlich ausgeübte Gewalt.) Pettit schreibt, solche Menschen
leben überschattet durch die Anwesenheit eines anderen, selbst wenn sich keine Hand drohend gegen sie erhebt. Sie leben in der Ungewissheit, wie der andere reagieren wird, und müssen die Launen des anderen wachsam im Auge behalten … Sie finden sich … nicht in der Lage, dem anderen ins Auge zu blicken, und sehen sich vielleicht sogar dazu gezwungen, zu schmeicheln, um sich bei ihm beliebt zu machen.
Jede Beziehung von ungleicher Machtverteilung, ob sie durch Drohung oder durch andere soziale Mittel wie Sitten und Gebräuche erzwungen wird, stellt eine Form von Dominanz dar, weil sie darauf hinausläuft,
der Willkür ausgeliefert zu sein; dem potentiell unberechenbaren Willen oder dem potentiell eigentümlichen Urteil des anderen ausgeliefert zu sein.
Wir definieren »Freiheit« als die Abwesenheit von Dominanz, denn wer dominiert wird, kann keine freie Wahl treffen. Freiheit oder – in Pettits Worten – Nicht-Dominanz bedeutet
Emanzipation von jeder derartigen Unterordnung, Befreiung aus jeder derartigen Abhängigkeit. Sie setzt voraus, auf Augenhöhe mit seinen Mitbürgern stehen zu können, in dem gemeinsamen Bewusstsein, dass keiner der Beteiligten über die Macht verfügt, willkürlich auf jemand anderen übergreifen zu können.
Entscheidend ist, dass Freiheit nicht einfach nur die abstrakte Möglichkeit voraussetzt, sein Handeln selbst bestimmen zu können, sondern auch die Fähigkeit gegeben ist, diese Freiheit konkret ausüben zu können. Diese Fähigkeit fehlt, wenn eine Person, Gruppe oder Organisation über die Macht verfügt, jemand anderen zu etwas zu zwingen, zu bedrohen oder das Gewicht sozialer Beziehungen zu nutzen, um jemand anderen zu unterjochen. Sie kann nicht bestehen, wenn Konflikte durch Gewalt oder die Drohung mit ihr gelöst werden. Und ebenso fehlt sie, wenn Konflikte durch ungleiche Machtverhältnisse aufgrund fest verwurzelter Bräuche gelöst werden. Freiheit benötigt das Ende von Dominanz, worauf sie sich auch gründen mag.
In Lagos herrschte nirgendwo Freiheit. Konflikte wurden zugunsten der stärkeren, besser bewaffneten Partei gelöst. Es gab Gewalt, Raub und Mord. Auf Schritt und Tritt zerfiel die Infrastruktur. Dominanz herrschte allerorten. Das war nicht die künftige Anarchie. Sie war bereits präsent.
Der Krieg aller gegen alle und der Leviathan
Den meisten von uns, die in Sicherheit und Behaglichkeit leben, mag das Lagos der 1990er Jahre als eine singuläre Anomalie erscheinen. Das ist es aber nicht. Die menschliche Existenz ist zu einem großen Teil von Unsicherheit und Dominanz geprägt. Im Laufe der Geschichte, selbst nach der Entstehung von Landwirtschaft und Sesshaftigkeit vor etwa zehntausend Jahren, lebten die Menschen zumeist in »nichtstaatlichen Gesellschaften«. Manche dieser Gesellschaften ähneln den wenigen verbliebenen Gruppen von Jägern und Sammlern in den abgelegenen Regionen des Amazonas und Afrikas (die zuweilen als »Kleingesellschaften« bezeichnet werden). Andere wie beispielsweise die Paschtunen, eine Ethnie von rund 50 Millionen Menschen im Süden und Osten Afghanistans und im nordwestlichen Pakistan, waren weit größer und betrieben Landwirtschaft und Viehzucht. Archäologische und anthropologische Forschungen belegen, dass viele dieser Gesellschaften in einer noch traumatischeren Existenz gefangen waren als jene, die die Einwohner von Lagos in den 1990er Jahren täglich erlitten haben.
Höchst aufschlussreich sind die historischen Belege über Mord und Totschlag, die Archäologen anhand entstellter oder beschädigter Skelettreste erschlossen und Anthropologen durch eigene Beobachtung von noch existierenden nichtstaatlichen Gesellschaften gewonnen haben. Im Jahr 1978 dokumentierte die Anthropologin Carol Ember systematisch, dass es in Jäger-und-Sammler-Gesellschaften ein sehr hohes Maß an kriegerischen Auseinandersetzungen gab – ein Schock für das von ihrer Profession vermittelte Bild des »friedlichen Wilden«. In zwei Dritteln der Gesellschaften, die Ember untersuchte, wurde häufig Krieg geführt, mindestens einmal alle zwei Jahre. Nur zehn Prozent dieser Gesellschaften führten nicht Krieg. Steven Pinker, der sich auf die Forschungen von Lawrence Keeley stützte, wertete die Belege über 27 nichtstaatliche Gesellschaften aus, die im Laufe der vergangenen 200 Jahre von Anthropologen untersucht worden waren. Seiner Schätzung nach kamen von je 100000 Personen mehr als 500 gewaltsam zu Tode – über hundertmal mehr, als die aktuelle Mordrate in den Vereinigten Staaten beträgt, die bei 5 pro 100000 liegt, und über tausendmal mehr als in Norwegen, wo sie bei 0,5 pro 100000 liegt. Die archäologischen Zeugnisse aus vormodernen Gesellschaften stimmen mit diesem Gewaltniveau überein.
Wir sollten uns bewusstmachen, was diese Zahlen bedeuten. Bei einer Todesrate von 500 pro 100000 Personen oder 0,5 Prozent hat ein typisches Mitglied einer solchen Gesellschaft eine Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent, innerhalb eines Zeitraums von 50 Jahren getötet zu werden – das heißt, ein Viertel der Menschen, die man kennt, wird gewaltsam zu Tode kommen. Welches Maß an Unberechenbarkeit und Angst ein derartiges Gewaltniveau bewirkt, ist kaum vorstellbar.
Obgleich ein Großteil des Blutvergießens auf kriegerische Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Stämmen oder Gruppen zurückging, waren es nicht allein Kriege und Konflikte innerhalb der Gruppen selbst, die unablässig zu Gewalt führten. Die Gebusi in Neuguinea beispielsweise haben sogar eine noch höhere Mordrate – sie lag in den 1940er und 1950er Jahren, als dieses Volk noch nicht entdeckt war, bei fast 700 pro 100000 Personen. Meist fand dieses Töten in friedlichen, normalen Zeiten statt, falls man eine Zeit, in der jedes Jahr fast einer von 100 Menschen ermordet wird, als friedlich bezeichnen kann. Der Grund hierfür steht mit dem Glauben in Zusammenhang, dass jeder Todesfall durch Hexerei herbeigeführt wird, was dazu führt, dass auch Jagd auf jene gemacht wird, die für nichtgewaltsame Todesfälle verantwortlich zu sein scheinen.
Es ist nicht nur Mord, was das Leben nichtstaatlicher Gesellschaften prekär macht. In nichtstaatlichen Gesellschaften war die Lebenserwartung der Menschen zum Zeitpunkt ihrer Geburt sehr niedrig und lag zwischen 21 und 37 Jahren. Ähnlich kurze Lebensspannen galten bei unseren Vorfahren bis vor 200 Jahren nicht als ungewöhnlich. Somit lebten viele unserer Vorfahren, ähnlich den Einwohnern von Lagos, in Verhältnissen, wie sie der berühmte Philosoph und Staatstheoretiker Thomas Hobbes in seinem Buch Leviathan beschrieb, nämlich in
beständige[r] Furcht und Gefahr eines gewaltsamen Todes – das menschliche Leben ist einsam, armselig, ekelhaft, bestialisch und kurz.
Dies war, was Hobbes, der sein Werk ebenfalls in einer albtraumhaften Zeit, dem englischen Bürgerkrieg in den 1640er Jahren, verfasste, als Krieg »eines jeden gegen jeden« bezeichnete oder was Kaplan »Anarchie« nennen würde.
Aus Hobbes’ brillanter Schilderung des Kriegs aller gegen alle geht anschaulich hervor, warum ein Leben unter solchen Bedingungen noch schlimmer ist als trostlos. Hobbes’ Ausgangspunkt sind einige Grundannahmen über die menschliche Natur, die ihn zu der Überzeugung führen, dass in jedem zwischenmenschlichen Handeln Konflikte angesiedelt sind, »wenn daher zwei Menschen nach demselben Gegenstand streben, den sie jedoch nicht zusammen genießen können, so werden sie Feinde und sind … bestrebt, sich gegenseitig zu vernichten oder zu unterwerfen.« Eine Welt ohne die Möglichkeit, diese Konflikte zu lösen, wäre keine glückliche:
Daher kommt es auch, dass, wenn jemand ein geeignetes Stück Land bepflanzt, einsät, bebaut oder besitzt und ein Angreifer nur die Macht eines einzelnen zu fürchten hat, mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass andere mit vereinten Kräften anrücken, um ihn von seinem Besitz zu vertreiben und ihn nicht nur der Früchte seiner Arbeit, sondern auch seines Lebens und seiner Freiheit zu berauben.
Bemerkenswert ist, dass Hobbes damit Pettits These über die Dominanz vorwegnimmt und betont, allein schon die Drohung mit Gewalt könne schädlich sein, selbst wenn man der tatsächlichen Gewalt entgeht, indem man nach Einbruch der Dunkelheit zu Hause bleibt, nämlich weil man dadurch in seinen Bewegungen und Begegnungen eingeschränkt wird. Der Krieg aller gegen alle, so Hobbes, besteht »nicht in tatsächlichen Kampfhandlungen, sondern in der bekannten Bereitschaft dazu während der ganzen Zeit, in der man sich des Gegenteils nicht sicher sein kann«. Somit hat schon die Aussicht auf einen Krieg »eines jeden gegen jeden« beträchtliche Folgen für das Leben des Menschen. Er möge beispielsweise »bedenken, dass er sich bei Antritt einer Reise bewaffnet und darauf bedacht ist, in guter Begleitung zu reisen, dass er beim Schlafengehen seine Türen und sogar in seinem Hause seine Truhen verschließt.« Dies alles war Wole Soyinka nur allzu gut vertraut. In Lagos ging er niemals aus dem Haus, ohne seine Glock-Pistole mitzunehmen, um sich notfalls verteidigen zu können.
Hobbes erkannte auch, dass Menschen nach gewissen grundlegenden Annehmlichkeiten und wirtschaftlichen Chancen streben: »Die Leidenschaften, die die Menschen friedfertig machen, sind Todesfurcht, das Verlangen nach Dingen, die zu einem angenehmen Leben notwendig sind, und die Hoffnung, sie durch Fleiß erlangen zu können.« Aber diese Dinge stellen sich unter den Verhältnissen eines Kriegs aller gegen alle nicht von selbst ein. Im Gegenteil, wirtschaftliche Anreize werden verhindert:
In einer solchen Lage ist für Fleiß kein Raum, da man sich seiner Früchte nicht sicher sein kann; und folglich gibt es keinen Ackerbau, keine Schifffahrt, keine Waren, die auf dem Seeweg eingeführt werden können, keine bequemen Gebäude, keine Geräte, um Dinge, deren Fortbewegung viel Kraft erfordert, hin- und her zu bewegen, keine Kenntnis von der Erdoberfläche …
Natürlich suchen die Menschen nach einem Ausweg aus der Anarchie, nach einer Möglichkeit, »Selbstbeschränkung« zu üben und »dem elenden Kriegszustand zu entkommen, der … aus den natürlichen Leidenschaften der Menschen notwendig folgt«. Hobbes hatte bereits vorweggenommen, wie dies möglich wäre, als er den Begriff des Kriegs aller gegen alle einführte, da er beobachtet hatte, dass ein solcher Krieg ausbricht, wenn »Menschen … ohne eine allgemeine, sie alle im Zaum haltende Macht leben«. Er bezeichnete diese allgemeine Macht als den »große[n] Leviathan … genannt Gemeinwesen oder Staat« – drei Namen für ein und dasselbe. Der Krieg aller gegen alle lässt sich demnach verhindern, wenn eine Art zentralisierte Autorität geschaffen wird, eine, die bei den Kongolesen, Nigerianern und den Bewohnern anarchistischer, nichtstaatlicher Gesellschaften nicht zur Verfügung steht. Hobbes wählte das Bild des Leviathans, des im Buch Hiob beschriebenen Meeresungeheuers, um damit zu unterstreichen, dass ein solcher Staat mächtig sein muss. Das Titelblatt seines Buches schmückt eine Radierung des Leviathans, zusammen mit dem Zitat aus dem biblischen Text: »Keine Macht ist auf Erden, die ihm gleichkommt.«
Hobbes wusste, dass der allmächtige Leviathan gefürchtet werden würde. Aber besser einen mächtigen Leviathan fürchten als sämtliche Mitmenschen. Der Leviathan würde den Krieg aller gegen alle beenden, dafür sorgen, dass die Menschen aufhören würden, »sich gegenseitig zu vernichten oder zu unterwerfen«, den Müll und die Area Boys beseitigen und die Stromversorgung wieder in Gang setzen.
Klingt großartig, aber wie genau kommt man zu einem Leviathan? Hobbes schlug hierfür zwei Möglichkeiten vor. Die erste sei ein Staat »durch Einsetzung … wenn bei einer Menge von Menschen jeder mit jedem übereinstimmt«, einen solchen Staat zu erschaffen und ihm Macht und Autorität zu übertragen, oder wie Hobbes schrieb, »den eigenen Willen und das eigene Urteil seinem Willen und Urteil [zu unterwerfen]«. Somit würde eine Art Gesellschaftsvertrag zur Entstehung eines Leviathans führen. Was in Lagos schwer zu organisieren gewesen wäre. Als zweite Möglichkeit sah Hobbes einen »Staat durch Aneignung«, der »mittels Gewalt« entsteht, da Hobbes überzeugt war, dass aus dem Zustand des Kriegs aller gegen alle jemand hervorgehen würde, der »seine Feinde seinem Willen … unterwirft«. Entscheidend aber sei, dass »die Rechte und Folgen der Souveränität … in beiden Fällen die gleichen [sind]«. Auf welche Weise auch immer eine Gesellschaft einen Leviathan bekommen würde, das Ergebnis wäre Hobbes’ Ansicht nach immer dasselbe – das Ende des Kriegs aller gegen alle.
Diese Schlussfolgerung klingt vielleicht überraschend, aber Hobbes’ Logik verdeutlicht sich in seiner Diskussion der drei Möglichkeiten, einen Staat zu regieren: als Monarchie, Aristokratie und Demokratie. Obwohl diese Varianten als Entscheidungsinstitutionen sehr unterschiedlich erscheinen, erklärt Hobbes: »Der Unterschied zwischen diesen drei verschiedenen Staatsformen liegt nicht in der Verschiedenheit der Gewalt, sondern in der unterschiedlichen Angemessenheit.« Unterm Strich sei eine Monarchie wahrscheinlich vorteilhafter und habe praktische Vorzüge, aber ausschlaggebend sei, dass ein Leviathan, wie immer er regiere, das bewerkstellige, was ihm eigen ist: Er würde den Krieg aller gegen alle beenden, die »beständige Furcht und Gefahr eines gewaltsamen Todes« bändigen und garantieren, dass das Leben der Menschen nicht mehr »einsam, armselig, ekelhaft, bestialisch und kurz« ist. Im Wesentlichen, so Hobbes, habe jeder Staat das Ziel der »Bewahrung von Frieden und Gerechtigkeit«, denn dies sei der »Zweck, zu dem alle Staaten eingerichtet wurden«.
Der Einfluss, den Hobbes mit seinem Meisterwerk auf die modernen Sozialwissenschaften hatte, ist kaum zu überschätzen. Bei den Theorien über Staaten und Verfassungen folgen wir Hobbes und beginnen bei der Überlegung, welche Probleme sie lösen, wie sie Verhalten einschränken und wie sie die Macht innerhalb der Gesellschaft verteilen. Wir suchen die Kennzeichen, wie eine Gesellschaft funktioniert, nicht in gottgegebenen Regeln, sondern in grundlegenden menschlichen Beweggründen, und überlegen, wie wir sie formen können. Aber noch weitreichender ist Hobbes’ Einfluss darauf, wie wir heute Staaten wahrnehmen. Wir respektieren sie und ihre Repräsentanten, unabhängig davon, ob es Monarchien, Aristokratien oder Demokratien sind. Selbst nach einem Militärputsch oder einem Bürgerkrieg nehmen die Vertreter der neuen Regierung ihren Sitz in den Vereinten Nationen ein, und die internationale Gemeinschaft erwartet von ihnen, dass sie den Gesetzen Geltung verschaffen, Konflikte lösen und ihre Bürger schützen. Ihnen wird offizieller Respekt erwiesen. Genau wie Hobbes es voraussah, verkörpern Herrscher, egal woher sie stammen und wie sie an die Macht gelangt sind, den Leviathan und verfügen über Legitimität.
Hobbes hatte recht, dass die Verhinderung des Kriegs aller gegen alle für die Menschen Vorrang hat. Ebenso recht hatte er mit der Annahme, dass das Töten und Morden zurückgeht, wenn sich ein Staat herausbildet, das Gewaltmonopol beansprucht und den Gesetzen Geltung verschafft. Der Leviathan unterbindet den Krieg »eines jeden gegen jeden«. In den Ländern West- und Nordeuropas liegt die Mordrate heutzutage bei lediglich 1 pro 100000 Personen oder noch niedriger, in diesen Ländern sind die öffentlichen Dienstleistungen effizient und ausreichend vorhanden, und die dort lebenden Menschen sind der Freiheit so nahe wie noch nie in der Menschheitsgeschichte.
Aber es gibt daneben vieles, worin Hobbes nicht recht hatte. Zum einen hat sich herausgestellt, dass nichtstaatliche Gesellschaften durchaus in der Lage sind, Gewalt einzudämmen und Konflikte unter Kontrolle zu halten, auch wenn dies, wie wir sehen werden, nicht viel Freiheit mit sich bringt. Zum anderen war Hobbes zu optimistisch, was die Freiheit betrifft, die ein Staat ermöglichen würde. Genau genommen lag Hobbes bei einem entscheidenden Punkt falsch (ebenso wie die internationale Gemeinschaft, wie wir hinzufügen möchten): Macht schafft kein Recht und gewiss auch keine Freiheit. Das Leben unter dem Joch eines Staates kann armselig, bestialisch und auch kurz sein.
Beginnen wir bei diesem letzten Punkt.
Furcht und Schrecken
Es war nicht einfach so, dass der nigerianische Staat die Anarchie in Lagos nicht verhindern wollte oder dass der Staat der Demokratischen Republik Kongo es für das Beste hielt, den Gesetzen keine Geltung zu verschaffen und zuzulassen, dass Rebellen Menschen töteten. Vielmehr mangelte es diesen beiden Staaten an Handlungsfähigkeit. Die Handlungsfähigkeit eines Staates besteht darin, seine Ziele durchsetzen zu können. Zu diesen Zielen gehört zumeist, den Gesetzen Geltung zu verschaffen, Konflikte zu lösen, wirtschaftliche Aktivitäten zu regulieren und zu besteuern und eine Infrastruktur sowie öffentliche Dienstleistungen bereitzustellen. Auch das Führen von Krieg kann dazugehören. Die Handlungsfähigkeit eines Staats hängt teilweise davon ab, wie seine Institutionen organisiert sind, aber noch entscheidender ist, dass sie von seiner Bürokratie abhängig ist. Es müssen Bürokraten und Staatsbedienstete vorhanden sein, damit die staatlichen Pläne auch umgesetzt werden können, und diese Bürokraten müssen über die Mittel und die Motivation verfügen, die Aufgabe auszuführen. Der Erste, der diese Erkenntnis formulierte, war der deutsche Soziologe Max Weber. Er ließ sich dazu von der preußischen Bürokratie inspirieren, die im 19. und 20. Jahrhundert das Rückgrat des deutschen Kaiserreichs gebildet hatte.
Im Jahr 1938 stand die deutsche Bürokratie vor einem Problem. Die regierende Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) hatte beschlossen, sämtliche Juden aus Österreich, das kurz zuvor an das sogenannte Dritte Reich angeschlossen worden war, zu vertreiben. Doch daraus entwickelte sich bald ein bürokratischer Engpass. Denn die Dinge mussten »ordentlich« erledigt werden, deshalb hatte jeder Jude vor seiner erzwungenen Ausreise eine Reihe von Papieren und Dokumenten beizubringen. Dies aber nahm in den betreffenden Behörden unmäßig viel Zeit in Anspruch. Mit der Lösung dieses Problems wurde der Leiter des Referats IV D 4 im Reichssicherheitshauptamt, der SS-Mann Adolf Eichmann, beauftragt. Er ersann das System einer »einzigen Anlaufstelle«, wie es die Weltbank heute nennen würde, eine Art Fließbandvorgang, bei dem alle beteiligten Stellen zusammengefasst wurden – das Finanzministerium, die Steuerbehörde, die Polizei und die Führung der jüdischen Organisationen. Eichmann schickte zudem jüdische Funktionäre ins Ausland, wo sie bei jüdischen Organisationen Gelder beschaffen sollten, so dass die einheimischen Juden die für die Zwangsemigration benötigten Visa bezahlen konnten. In ihrem Buch Eichmann in Jerusalem schreibt Hannah Arendt:
Auf der einen Seite kommt der Jude herein, der noch etwas besitzt, einen Laden oder eine Fabrik oder ein Bankkonto. Nun geht er durch das ganze Gebäude, von Schalter zu Schalter, von Büro zu Büro, und wenn er auf der anderen Seite herauskommt, ist er aller Rechte beraubt, besitzt keinen Pfennig mehr, dafür aber einen Pass, auf dem steht: »Sie haben binnen 14 Tagen das Land zu verlassen, sonst kommen Sie ins Konzentrationslager.
Die Folge dieses Fließbandsystems war, dass binnen acht Monaten 45000 Juden aus Österreich vertrieben werden konnten. Eichmann wurde daraufhin zum Obersturmbannführer befördert und koordinierte die Transporte in die Vernichtungslager, wozu auch die Lösung vieler ähnlicher bürokratischer Engpässe gehörte, die den Massenmord erschwerten.
Hier war ein mächtiger, fähiger Staat am Werk, ein bürokratischer Leviathan. Aber er nutzte seine Handlungsfähigkeit nicht dazu, Konflikte zu lösen oder den Krieg aller gegen alle zu beenden, sondern um Juden zu schikanieren, auszurauben und schließlich zu ermorden. Das Dritte Reich, das sich auf die Tradition der preußischen Bürokratie und Berufsarmee stützte, kann man nach Hobbes’ Definition gewiss als einen Leviathan bezeichnen. So wie es Hobbes vorschwebte, unterwarfen die Deutschen oder zumindest ein großer Teil von ihnen, »den eigenen Willen und das eigene Urteil seinem Willen und Urteil«. Der deutsche Philosoph Martin Heidegger erklärte sogar seinen Studenten: »Der Führer selbst und allein ist die heutige und künftige deutsche Wirklichkeit und ihr Gesetz.« Der deutsche Staat rang der Bevölkerung Ehrfurcht ab, und das nicht nur unter Hitlers Anhängern. Es gab nicht viele Deutsche, die sich gegen den Nazi-Staat auflehnten oder seine Gesetze missachteten.
Die Ehrfurcht verwandelte sich in Angst angesichts der SA, der SS und der Gestapo, die omnipräsent zu sein schienen. Die Deutschen lagen nachts schweißgebadet in ihren Betten und warteten auf das Pochen an ihren Wohnungstüren und den Klang der Stiefel in ihren Wohnzimmern, wenn man sie abholte, um sie in einen Keller zum Verhör zu bringen oder sie an die Ostfront zu schicken, wo sie der fast sichere Tod erwartete. Der deutsche Leviathan wurde viel mehr gefürchtet, als dies bei der Anarchie in Nigeria oder im Kongo der Fall war. Und das aus gutem Grund. Der Nazi-Staat inhaftierte, folterte und tötete eine enorme Zahl von Deutschen – Sozialdemokraten, Kommunisten, politische Gegner, Homosexuelle und Zeugen Jehovas. Er ermordete sechs Millionen Juden, darunter viele deutsche Staatsangehörige, sowie 200000 Roma. Nach manchen Schätzungen liegt die Zahl der Slawen, die er in Polen und Russland umbrachte, bei über 10 Millionen.
Was die Deutschen und die Bürger der besetzten Gebiete unter dem Hitler-Regime erlitten, war nicht Hobbes’ Krieg aller gegen alle. Es war ein Krieg des Staates gegen seine Bürger. Es war Dominanz und Mord. Nicht gerade das, was Hobbes sich von seinem Leviathan erhofft hatte.
Umerziehung durch Arbeit
Die Angst vor einem allmächtigen Staat beschränkt sich nicht auf entsetzliche Ausnahmen wie das Dritte Reich, sie ist weit verbreitet. In den 1950er Jahren bewunderten viele europäische Linke die chinesische Volksrepublik. In französischen Cafés war maoistisches Denken ein absolutes Muss, und das Kleine Rote Buch des Vorsitzenden Mao wurde in Szene-Buchhandlungen zum Verkaufsschlager. Denn schließlich hatte es die Kommunistische Partei Chinas geschafft, das Joch des japanischen Kolonialismus und des westlichen Imperialismus abzuschütteln, und arbeitete nun eifrig daran, aus den Trümmern der Hinterlassenschaften einen fähigen Staat und eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen.
Am 11. November 1959 wurde Zhang Fuhong, Sekretär der Kommunistischen Partei des Bezirks Guangshan, körperlich attackiert. Ein Mann namens Ma Longshan machte den Anfang und versetzte ihm einen Tritt. Andere fielen mit Füßen und Fäusten über ihn her. Er wurde blutig geschlagen, man riss ihm büschelweise Haar aus, seine Uniform wurde zerfetzt, und er konnte sich kaum noch auf den Beinen halten. Am 15. November, nach wiederholten weiteren Misshandlungen, konnte er nur noch bäuchlings auf dem Boden liegen, während die Leute auf ihn eintraten und ihm die restlichen Haare ausrissen. Dann schleifte man ihn in seine Wohnung zurück. Inzwischen hatte er die Kontrolle über seine Körperfunktionen verloren und konnte nicht mehr essen und trinken. Am nächsten Tag wurde er erneut misshandelt, und als er um Wasser bat, wurde es ihm verweigert. Am 19. November starb er.
Yang Jisheng schildert diese grauenhaften Vorgänge in seinem Buch Grabstein. Im gleichen Jahr, nur einige Monate zuvor, war er aus seinem Internat dringlich nach Hause gerufen worden, weil sein Vater kurz vor dem Hungertod stand. In Wanli angekommen, bot sich ihm ein grauenvolles Bild:
Die Ulmen vor der Tür … hatten keine Rinde mehr, selbst die Wurzeln unten waren weg, übrig war eine zerzauste Grube. Der Teich lag trocken, wegen der Muscheln, erzählten die Nachbarn. Muscheln haben einen unangenehmen Geruch, die hat man früher nicht gegessen. Man hörte keine Hunde bellen, keine Hühner liefen herum … Wanli war ausgestorben. Ich betrat unser Haus, nichts als die vier Wände, nicht ein Korn Getreide, nicht das Geringste zu essen, in den Krügen war nicht einmal Wasser … Vater lag auf dem Bett, die Augen matt und tief eingesunken, er hatte überhaupt kein Fleisch mehr im Gesicht, nur schlaffe, faltige Haut … Ich kochte aus dem mitgebrachten Reis einen Brei … aber mein Vater konnte schon nicht mehr schlucken. Drei Tage später haben wir uns für immer verabschiedet.
Der Vater von Yang Jisheng starb während der großen Hungersnot, die Ende der 1950er Jahre in China herrschte und der an die 45 Millionen Menschen zum Opfer gefallen sein sollen. Yang berichtet:
Der Hunger gegen Ende war entsetzlicher als der Tod selbst. Die Maiskolben waren gefressen, das wilde Gemüse war gefressen, die Baumrinde war gefressen, Vogelmist, Mäuse und Ratten, Baumwolle, alles hat man sich in den Bauch gestopft. Wo man Guanyin-Erde, eine Art fetten Lehms, ausgegraben hat, hat man sie sich schon beim Graben in dicken Klumpen in den Mund geschoben. Die Leichen der Toten, Verhungernde von außerhalb, selbst eigene Verwandte hat man zu Lebensmitteln gemacht.
Kannibalismus war weit verbreitet.
Die Chinesen erlebten in dieser Zeit einen Albtraum. Aber wie im Dritten Reich kam er nicht dadurch über die Menschen, dass es keinen Leviathan gab. Er wurde vielmehr vom Staat geplant und durchgeführt. Zhang Fuhong wurde von seinen Genossen der Kommunistischen Partei zu Tode geprügelt, Ma Longshan war ihr Bezirkssekretär. Zhangs Verbrechen bestand aus »rechtem Abweichlertum« und darin, dass er ein »entartetes Element« sei. Das heißt, er hatte Maßnahmen gegen die zunehmende Hungersnot initiiert. Das bloße Erwähnen der Hungersnot konnte dazu führen, dass man als »Leugner der Großen Ernte« abgestempelt und einer »Kampfkritik« unterzogen, das heißt zu Tode geprügelt wurde.
In der Volkskommune von Huadian, gelegen in einem anderen Landesteil, starben zwischen September 1959 und Juni 1960 12134 Menschen, ein Drittel der Bevölkerung. Die meisten verhungerten, aber nicht alle. 3528 Menschen wurden von Kadern der Kommunistischen Partei zusammengeschlagen, wodurch 636 ums Leben kamen, 141 trugen eine dauerhafte Behinderung davon, und 14 begingen Selbstmord.
Der Grund, warum in Huadian so viele Menschen umkamen, ist einfach. Im Herbst 1959 betrug die Getreideernte 5,955 Millionen Kilo, was ungewöhnlich niedrig war. Doch die Kommunistische Partei hatte beschlossen, dass die Bauern 6 Millionen Kilo abliefern mussten. Deshalb ging das gesamte Getreide von Huadian an die Großstädte und an die Partei. Und die Bauern ernährten sich von Baumrinde, Schnecken und Muscheln.
Diese Ereignisse standen in Zusammenhang mit dem »Großen Sprung nach vorn«, dem »Modernisierungs«-Programm, das der Vorsitzende Mao Zedong 1958 mit dem Ziel ausgerufen hatte, das Handlungsvermögen des chinesischen Staates zu nutzen, um das Land grundlegend umzuwandeln, von einer ländlich-agrarisch geprägten zu einer Industriegesellschaft. Zur Durchführung des Programms wurden den Bauern hohe Steuern auferlegt, mit denen man die Industrie subventionieren und in Maschinen investieren wollte. Das Ergebnis war nicht nur eine humanitäre Katastrophe, sondern auch eine wirtschaftliche Tragödie größten Ausmaßes – alles geplant und ausgeführt vom Leviathan. Yangs aufrüttelndes Buch verdeutlicht eindringlich, wie der Leviathan, der die Macht hatte, dem Einzelnen alles zu nehmen, die Maßnahmen vollzog, beispielsweise die Konfiszierung der gesamten Getreideproduktion der Kommune von Huadian, und wie dabei »Kampfkritik« und Gewalt eingesetzt wurden. Ein Mittel hierzu war, das Kochen und Essen in einer vom Staat betriebenen »Gemeinschaftsküche« zu zentralisieren, und »wer nicht gehorchte, bekam nichts zu essen«. Somit ging den Familien »die Fähigkeit verloren, aus eigener Kraft für sich zu sorgen«. Jeder, der sich gegen das System stellte, wurde »in Stücke gerissen«, und folglich blieb niemandem eine andere Wahl, als zu einem »Herrscher« oder einem »Sklaven« zu werden. Um zu überleben, mussten die Menschen auf dem herumtrampeln, was sie am höchsten wertschätzten, und das schönreden, was sie immer am meisten verachtet hatten, und ihre Loyalität gegenüber dem System demonstrieren, indem sie sich in »meisterhafter Anpassung und Verstellung« übten – schlicht und einfach ein System der Dominanz.
Hobbes erklärte, das Leben sei »einsam, armselig, ekelhaft, bestialisch und kurz«, wenn die Menschen »ohne eine allgemeine, sie alle im Zaum haltende Macht leben«. Yangs Schilderungen nach versetzte Mao zwar alle in »Ehrfurcht und Schrecken«, doch dadurch wurde für die meisten Menschen das Leben nicht weniger ekelhaft, bestialisch und kurz.