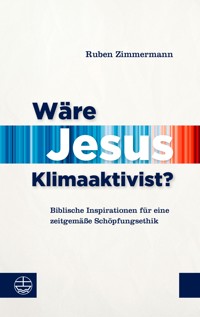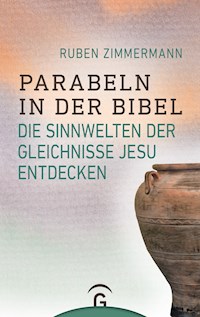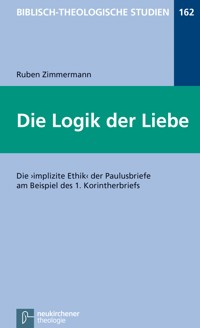![Warum weniger gut sein kann. Eine Ethik des Verzichts. [Was bedeutet das alles?] - Ruben Zimmermann - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/640fef1328fe7d059b09e5a3d1656efe/w200_u90.jpg)
Warum weniger gut sein kann. Eine Ethik des Verzichts. [Was bedeutet das alles?] E-Book
Ruben Zimmermann
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Weniger ist mehr – woran wir uns gewöhnen sollten, dürfen und können! Wie könnte angesichts der Forderungen der Marktwirtschaft und des Kapitalismus eine Verzichtsethik aussehen, die nicht die Schrecken, sondern die Chancen des Verzichtens betont? Ruben Zimmermann plädiert dafür, Verzicht nicht als politischen Kampfbegriff oder apokalyptisches Drohwort zu verwenden, sondern die Möglichkeit zu verzichten als individuell und sozial wertvolle Handlungsweise zu verstehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ruben Zimmermann
Warum weniger gut sein kann
Eine Ethik des Verzichts
Reclam
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist ausgeschlossen.
RECLAMSUNIVERSAL-BIBLIOTHEKNr. 962404
2025 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Cornelia Feyll, Friedrich Forssman
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2025
RECLAM, UNIVERSAL-BIBLIOTHEK und RECLAMSUNIVERSAL-BIBLIOTHEK sind eingetragene Marken der Philipp Reclam jun.GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962404-4
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-014661-3
reclam.de | [email protected]
Inhalt
Was ist attraktiv am Reizwort des Verzichts?
1. Was bedeutet überhaupt »Verzicht«?
2. Spurensuche des Verzichtens
3. Wie funktioniert die Verzichtsethik? – Definition und Leitfragen
4. Verzichtsethik im Gespräch
5. Konsumethik: Von Minimalist:innen, Ware2Share und ›Flexitarier:innen‹
6. Klimaethik: Wie Verzicht und Verbot einander ergänzen
7. Medizinethik: Behandlungs- und Nahrungsverzicht am Lebensende
8. Die Praxis des Verzichtens
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Zum Autor
Danksagung
Was ist attraktiv am Reizwort des Verzichts?
Verzicht – das klingt erst einmal wenig attraktiv. Man denkt an Verbote, Defizite und Entbehrungen. Man denkt an Verlust statt an Lust, an ein Aufgebenmüssen von vielem, was das Leben angenehm und schön macht. Vor dem inneren Auge ziehen Moralprediger:innen oder Politiker:innen auf, die einem sagen, was man alles nicht tun darf.
Zwar mehren sich aus unterschiedlichen Perspektiven wie Psychotherapie, Ökologie, Kulturanthropologie bis hin zur Politikwissenschaft und Philosophie die Versuche, den Verzicht aus der Ecke des verhassten Kampfbegriffs herauszuführen und seinen Wert neu zu erschließen. Durch Überschriften wie »Weniger ist mehr«, »Lust auf Verzicht« oder »The Joy of Missing Out« (JOMO1) wird aber unter Umständen der Widerwille oder Eifer des Widerspruchs nur noch mehr angeheizt.
Und in der Tat gilt es, mit solchen Slogans vorsichtig zu sein. Es könnte allzu schnell eine wesentliche Facette des Verzichts übergangen werden. Der Verzicht hat nämlich auch eine mühsame Seite. Weniger bleibt weniger! Es tut weh, auf lieb gewordene Annehmlichkeiten zu verzichten oder seinen Urlaubsradius einzuschränken. Rechte und Privilegien nicht in Anspruch zu nehmen, kann schmerzlich sein. Der Verzicht auf Vergeltung kostet Überwindung.
Aber trotz alledem kann es gut sein, zu verzichten. Es kann das Richtige, vielleicht sogar das Gebotene sein, sich einzuschränken, Chancen und Möglichkeiten nicht zu ergreifen. Die Begriffe ›gut‹, ›richtig‹ oder ›geboten‹ zeigen zugleich, dass der vorliegende Essay in erster Linie kein Lebenshilfebuch mit hilfreichen Ratschlägen sein will. Es geht vielmehr um die Skizze zu einer Ethik des Verzichts. Ethik und Moral fragen nicht nur nach den Befindlichkeiten des oder der Einzelnen oder dem Augenblicksglück. Ethik ist ein soziales Unternehmen. Wir brauchen Regeln und Klärungen bei Auseinandersetzungen und Konflikten unter Menschen oder von Menschen mit nichtmenschlichen Lebewesen und Ökosystemen. Ethik ist besonders dann notwendig, wenn dieses Zusammenleben aus der Balance geraten ist, wenn der richtige Weg, die gute Entscheidung nicht klar vor Augen stehen.
Die Ethik darf sich dabei nicht aus der Aufgabe davonstehlen, zu benennen und auch zu bewerten, was richtig und falsch, gut oder besser ist. Oder präziser formuliert: Ethik als die Reflexion auf Ethos bzw. Moral hat die Aufgabe, Begründungszusammenhänge zu erschließen und zu diskutieren, warum es für eine:n Einzelne:n im Zusammenleben mit anderen in einer bestimmten Situation besser oder schlechter sein könnte, das eine zu tun oder das andere zu lassen.
Eine Ethik des Verzichts sieht sich nun vor besondere Herausforderungen gestellt: Zum einen handelt es sich um eine Ethik des Unterlassens, des Nicht-Tuns, könnte man sagen. Kann man denn auch über etwas nachdenken, das gar nicht getan wird? Gibt es eine Moralphilosophie der Passivität oder zumindest eine Philosophie der Einschränkung? Zum anderen handelt es sich um eine Ethik, die sich vor allem an die Privilegierten und Habenden richtet. Nur wer Rechte, Chancen, Güter und Ämter bereits besitzt, kann auch auf diese verzichten. Anders als viele Gerechtigkeitsethiken ist die Verzichtsethik eine Ethik für die, denen es gut geht. Zu gut vielleicht, wenn man den Horizont etwas über den eigenen Tellerrand hinaus weitet, und zwar nicht nur geographisch, sondern auch zeitlich, etwa im Blick auf die kommenden Generationen.
Schließlich unterscheidet sich die Ethik des Verzichts auch von einer Pflichten- und Verbotsethik – und genau dieser Charakter könnte sie besonders interessant machen. Verzicht ist seinem Wesen nach von Freiheit, Freiwilligkeit und Flexibilität gekennzeichnet. Niemand sollte anderen Verzicht aufzwingen. Kein Gesetz kann ihn einfordern. Verzichten ist ein freiwilliger Akt, der auch von Zeit zu Zeit jenseits des Prinzipiellen vollzogen werden kann. Und das, worauf verzichtet wird, muss nicht grundsätzlich schlechtgeredet werden. Damit stellt der Verzichtsbegriff eine Herausforderung für die Handlungsbegründung, also: für die Ethik, dar.
Der folgende Essay möchte diese Denk- und Funktionsweise einer Verzichtsethik durchleuchten. Im Kernteil des Buches wird also eine Handlungs-, oder sagen wir treffender: eine Unterlassungstheorie diskutiert. Da die Verzichtsethik eine praktische, anwendungsorientierte Ethik ist, geht dies nicht, ohne auf Beispiele aus der Praxis des konkreten Lebens und der Geschichte zu verweisen, um an diesen den Blick auf das Phänomen zu schärfen. Wir Menschen sind Verzichtswesen, die in vielen Abläufen unseres alltäglichen Lebens bereits verzichten, ohne groß darüber nachzudenken. Diese ›kleinen‹ Verzichte können ermutigen, auf diesem Pfad weiterzugehen und zu größeren Verzichtsakten angespornt zu werden. Es gibt also manches zu erkunden.
1. Was bedeutet überhaupt »Verzicht«?
Was hat Verzicht mit Verzeihen zu tun?
Der deutsche Begriff »Verzicht« steht verblüffenderweise dem Verb »verzeihen« nahe. Er ist seit dem späten Mittelalter im Mittelhochdeutschen als »vurziht«, »vürziht« oder schon »verzicht« belegt, aber bis Anfang des 18. Jahrhunderts fast ausschließlich im Bereich der Rechtssprache anzutreffen.2 Er bedeutet dabei insbesondere das Aufgeben von Rechtsansprüchen zum Beispiel im Erbfall oder bei Eigentumsübertragung. Dabei kann es sich um das Aufgeben von allen Rechtsansprüchen oder auch nur von speziellen oder beschränkten Ansprüchen zugunsten eines Rechtspartners handeln, sei es als mündliche Festlegung, sei es durch Ausstellung eines Verzichtsbriefs. Es kann aber ebenso auch das Zurücktreten von Herrschaftsrechten umfassen oder das bewusste Nichteinlegen von Rechtsmitteln.
Letzteres ist dann gleichbedeutend mit einem Verzicht auf Vergeltung, Wiedergutmachung oder Ausgleichszahlungen. Eine Rechtsperson verzichtet auf einen zustehenden Rechtsanspruch trotz Verletzung ihrer Rechte durch eine Gegenpartei. Sie verzichtet und verzeiht also gleichzeitig. In ihrem Verzicht bringt sie Verzeihung zur Geltung.
Die offene Bedeutung des Begriffs
Ab dem 18. und vermehrt dann im 19. Jahrhundert zeigt die Wortstatistik einen deutlichen Anstieg der Häufigkeit der Verwendung, und damit verbunden weitet sich das Bedeutungsspektrum von »Verzicht« erheblich aus:3 Das Deutsche Wörterbuch erklärt »verzichten« als »ohne etwas auskommen (wollen)« oder »absehen von etwas«. Umfassender wird »Verzicht« beschrieben »als feststellung, dasz etwas im bereich der möglichkeit liegt, nicht getan bzw. angewandt wird, ohne dasz darin eine ausgesprochen ablehnende haltung zum ausdruck kommt« (ebd., XII/I, 2583). Auch wer eine Absicht oder einen Wunsch aufgibt, verzichtet. Verzicht wird dabei insgesamt als positiv gewerteter Willensentscheid des Einzelnen gesehen.
Die Breite der bereits im 19. Jahrhundert erreichten Bedeutung hat sich bis in die Gegenwart erhalten. Entsprechend dem Wörterbuch der Deutschen Gegenwartssprache (DWDG) ist Verzicht die »Aufgabe eines Wunsches, Anspruchs, Rechtes, Entsagung«.4 Häufig mit dem Begriff kombinierte Adjektive sind »schwer«, »schmerzlich«, »freiwillig«. Das Nomen begegnet in folgenden Verbalkonstruktionen: »seinen V. erklären«; »sich zum V. bereit erklären«; papierdeutsch: »V. leisten, üben (auf etw. verzichten)«, aber auch »(von jmdm.) einen V. fordern«. Es weist engere oder weitere semantische Schnittmengen mit Begriffen wie »Entsagung«, »Askese«, »Bescheidung«, »Vermeidung«, »Unterlassung« oder »Selbstbeherrschung« auf.5
Grundlegend geändert hat sich allerdings die Bewertung des Verzichts. Wurde früher der Verzicht als ein respektierter, anerkannter oder sogar bewunderter Akt der freiwilligen Einschränkung gewürdigt, so hat sich im gegenwärtigen Sprachgebrauch Verzicht zu einem Reizwort oder sogar zu einer Drohvokabel gewandelt.
Wie konnte das sein? Mag es vielleicht daran liegen, dass nun das Einfordern des Verzichts von anderen zur Entscheidung des Einzelnen hinzugetreten ist? Hat der von außen erzwungene Verzicht vielleicht den freiwilligen Verzicht überformt oder gar abgelöst? Und entsprechend stellt sich die Frage: Handelt es sich beim Verbot von außen überhaupt noch um einen Verzicht?
Um solche kulturellen Veränderungen besser einordnen zu können, begeben wir uns zunächst auf eine kleine Zeitreise in die Geschichte des Verzichtens.
2. Spurensuche des Verzichtens
Der Begriff »Verzicht« ist erst im Mittelalter und vermehrt ab dem 18. Jahrhundert im Umlauf. Das Phänomen des Verzichtens hingegen ist so alt wie die Menschheitsgeschichte. Vier quellenorientierte Beispiele sollen einige Schlaglichter darauf werfen, wie in Philosophie und Religion der abendländischen Geistesgeschichte über das Verzichten nachgedacht und wie es begründet wurde.
Mittelmaß ist auch gut – oder: Die Tugend der Mäßigung nach Aristoteles
Natürlich will niemand mittelmäßig sein. Es geht heute vor allem darum, Superlative und Höchstleistungen zu bringen, wenn nicht in kognitiven Fähigkeiten, dann doch im Sport, durch herausragende künstlerische Leistungen oder durch ein Millionenpublikum auf Instagram und TikTok.
Es mag deshalb verwundern, dass eine der ältesten Lehren des Lebensglücks, die Nikomachische Ethik des Aristoteles, ausgerechnet das Mittelmaß (μεσότης, mesótēs) preist. Es wird von dem Philosophen als die Mitte zwischen dem Mangel und dem Übermaß bestimmt. Aristoteles nennt den Sport und die Ernährung als leicht nachvollziehbare Beispiele, und wir können heute sagen, sogar über die Zeiten hinweg: »Denn ein Zuviel an Körpertraining zerstört die Kraft genauso wie ein Zuwenig; genauso zerstört ein Zuviel oder Zuwenig an Essen und Trinken die Gesundheit; das richtige Maß aber schafft Gesundheit, fördert und erhält sie.«6
Entsprechend wird der Mut als Mitte zwischen Mutlosigkeit bzw. Feigheit und Übermut bzw. Kühnheit betrachtet. Großzügigkeit ist die gute Mitte zwischen Geiz und Verschwendungssucht, Gerechtigkeit zwischen Unrecht zu leiden und Unrecht zu tun. Aristoteles schreibt weiter: »Wer nämlich aus Furcht vor allem davonläuft und nirgends standhält, wird ein Feigling, wer aber schlechterdings nichts fürchtet, sondern auf alles losgeht, wird ein Held; desgleichen wird, wer jede Lust genießt und sich keiner enthält, zügellos, wer aber jede Lust meidet wie die Leute ohne Kultur, wird in gewisser Weise stumpfsinnig.«
Die Tugend, die aus dem Quartett der sogenannten ›Kardinaltugenden‹ den Weg zu dieser Mitte weist, ist die »Besonnenheit« (griech. σωφροσύνη, sōphrosýnē). Der erste Begriffsteil setzt sich aus den Bestandteilen σώφρων sōphrōn (klug, weise) und der Nominalendung -σύνη -sýnē zusammen; der erste Begriff kann wiederum in die Bestandteile σῶς sōs (heil, wohlbehalten, gesund, lebendig) und φρήν phrēn (Gemüt, Sinn, Verstand, wörtlich Zwerchfell) aufgeteilt werden.
Diese kleine Wortkunde macht sichtbar, dass der Begriff sowohl das Wohlergehen als auch die Lebensklugheit einschließt; eine Übersetzung mit »gesundem Menschenverstand« fängt diese Doppelsemantik also recht gut ein. In der nachfolgenden Begriffsgeschichte und dann auch in der lateinischen Übersetzung des Begriffs mit »temperantia« fließen die Mesotes-Lehre und die Tugend zusammen, so dass auch die sōphrosýnē selbst durchaus zurecht als »Mäßigung«, »Wohlmaß«, »Beherrschung« oder eben »Besonnenheit« übersetzt wurde.
Für Aristoteles verhilft die Tugend der Besonnenheit dem Menschen zur Erkenntnis der ›goldenen Mitte‹ zwischen zwei Extremen. Es geht dabei aber nicht um einen faulen Kompromiss, schon gar nicht um einen mathematisch bestimmbaren Mittelwert. Vielmehr versteht Aristoteles unter dieser Mitte eine angemessene Balance, die zwischen zwei Gefahren im wahrsten Sinne des Wortes ›ver-mittelt‹. Für Aristoteles sind das zunächst Lustlosigkeit und Zügellosigkeit, doch wir können dies leicht erweitern in Richtung Gleichgültigkeit/Stumpfheit oder Unmäßigkeit und Übermaß.
Der Hang zum Übermaß oder Übermut wird in der griechischen Philosophie als Pleonexie (πλεονεξία, pleonexía) oder Hybris (ὕβρις, hýbris) verworfen. Er hindere das Glück und ziehe den Menschen in eine immer weiter fortschreitende Spirale des ›Immer-mehr-Haben-‹ (πλέον ἔχειν, pléon échein) und ›Immer-mehr-Sein-Wollens‹ hinein. So entstehen Genusssucht, Ehrsucht und Herrschsucht.
Schon die Sieben Weisen hatten dagegen die alten delphischen Mahnungen »nichts allzu sehr« (μηδὲν ἄγαν, mēdén ágan) und das »mittlere Maß ist das Beste« (μέτρον ἄριστον, métron áriston) gesetzt.7 Wer mit Besonnenheit bzw. gesundem Menschenverstand das rechte Maß findet, der ist auf gutem Weg zu dauerhaftem Glück bzw. zur Glückseligkeit, zur eudaimonía (εὐδαιμονία).
Anregend an der Aristotelischen ›Verzichts‹-Lehre ist, dass die Leidenschaften nicht – wie in der späteren Stoa – grundsätzlich verworfen werden. Sinnlichkeit, Lust oder Emotionen müssen nicht vollständig unterdrückt oder ausgemerzt werden. Sie stellen wesentliche Antriebskräfte des Menschen dar. Sie sollten nur nicht die Oberhand gewinnen und den Menschen beherrschen oder gar versklaven. Verzichtet wird also nicht grundsätzlich, sondern im Blick auf übermäßige Ausschläge nach oben und unten empfohlen. Die Mäßigung hilft, die förderliche Balance zwischen einem Zuviel und einem Zuwenig zu finden. Sie schränkt Hybris, Zügellosigkeit oder Übermaß ein, aber bewahrt zugleich davor, in Lethargie, Gleichgültigkeit oder Passivität zu verfallen. Gerade so verhilft sie zu einem glücklichen Leben.
Und ebenso relevant: Tugenden werden in der altgriechischen Ethik nicht angeboren oder zufällig erlangt. Sie müssen geschult und trainiert werden. Wenn Verzicht in dieser Richtung als Tugend beschrieben wird, dann ist die deutsche Wendung »Verzicht üben« tiefsinniger, als es uns vielleicht auf Anhieb bewusst war. Verzicht kann und muss auch eingeübt, erprobt und erlernt werden.
Wie viel Luxus braucht der Mensch? – oder: Von der Dekadenz der Fische und der Weisheit der Hunde in der Stoa (Epiktet und Seneca)
Auch die stoischen Philosophen streben nach der εὐδαιμονία (eudaimonía), dem dauerhaften Lebensglück. Im Blick auf unser Thema kann man aber eine Verschärfung erkennen: Während Aristoteles die Kraft der Leidenschaften und Triebe durch das rechte Maß zu bändigen versuchte, sehen die Stoiker in jeder Form von Leidenschaft oder Affekt (πάθος páthos) eine Gefährdung und mahnen zu grundsätzlicher Selbstbeherrschung und Affektkontrolle. Akzeptiert Aristoteles ein gewisses Maß an Gütern, so halten sie die meisten Stoiker für überflüssig, ja dem glücklichen Leben hinderlich. Stattdessen lobt man die »Selbstgenügsamkeit« (αὐτάρκεια autárkeia).
Der griechisch schreibende stoische Philosoph Epiktet hat in seinen Ausführungen im Handbüchlein der Moral (Enchiridion) gleich zu Beginn den Verzicht sogar für die vom Menschen überhaupt beherrschbaren Dinge (es gibt vieles, was der Stoiker als unbeeinflussbar hinnimmt) als wesentlich benannt: »Wenn du nun nach so hohen Zielen strebst, denke daran, dass du nicht mit nur mäßigem Bemühen nach ihnen greifen darfst, nein, du musst auf manches ganz verzichten, manches vorläufig aufschieben.«8 Verzicht (ἔκκλισις ékklisis) wird geradezu als Kontrastprogramm zum Begehren (ὄρεξις órexis) herausgestellt: »Verzichten ist besser als Zugreifen.«9 Dabei kann der Gegenstandsbereich des Verzichts vielfältig sein, sei es Essen (z. B. Süßigkeiten), seien es materielle Güter wie Kleider oder Besitz, aber auch Schlafverzicht (für den Sportler), ferner Verhaltensweisen wie Schreien, jemanden zu verlachen oder Witze zu reißen. In den Diatriben (V) erinnert Epiktet voll Bewunderung an den Spartaner Lykurg, der freimütig auf Rache verzichtete, obwohl ihm vom Volk Vergeltung an dem jungen Mann zugestanden worden war, der ihm ein Auge ausgeschlagen hatte. Lykurg verzichtet auf Vergeltung und erzieht – wie es banal heißt – den Aggressor stattdessen zu einem guten Menschen.
In den Diatriben (