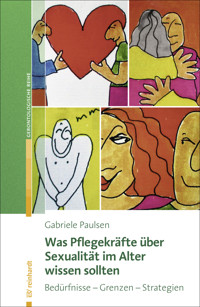
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ernst Reinhardt Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Reinhardts Gerontologische Reihe
- Sprache: Deutsch
Sexualität im Alter ist ein Tabuthema - auch in der Pflege. Die Autorinnen ermutigen dazu, sich dem schambehafteten Thema zu stellen. Pflegekräfte finden hier Anregungen, mit sensiblen Fragen professionell umzugehen: Wie kann das Recht der älteren Menschen auf sexuelle Selbstbestimmung auch stationär eingelöst werden? Wie geht man als Pflegekraft mit pflegebedürftigen älteren Menschen um, die körperliche Nähe fordern? Was löst die Sehnsucht der älteren Menschen nach Zärtlichkeit aus? Durch offene und klare Benennung von vielleicht auch ungewöhnlichen Situationen in der Pflege verändern sie den Blickwinkel, ohne dabei gesetzliche Grenzen aus den Augen zu verlieren. So hilft dieses Buch, das Thema "Sexualität im Alter" auch institutionell anzugehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Reinhardts Gerontologische ReiheBand 55
Gabriele Paulsen, Hamburg, Fachkrankenpflegerin, berät und coacht im Gesundheitswesen. Als Inhaberin der Agentur Nessita empfiehlt sie SeniorInnen und immobilen Menschen erotische Dienstleistungen.
Nina de Vries, Berlin, arbeitet seit vielen Jahren als Sexualassistentin v. a. für Menschen mit Behinderungen oder kognitiven Beeinträchtigungen. Sie hält Vorträge zum Thema und bildet selbst SexualassistentInnen aus.
Hinweis: Soweit in diesem Werk eine Dosierung, Applikation oder Behandlungsweise erwähnt wird, darf der Leser zwar darauf vertrauen, dass die Autoren große Sorgfalt darauf verwandt haben, dass diese Angabe dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes entspricht. Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen oder sonstige Behandlungsempfehlungen kann vom Verlag jedoch keine Gewähr übernommen werden. – Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnungen nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-497-02744-6 (Print)
ISBN 978-3-497-61033-4 (PDF-E-Book)
ISBN 978-3-497-61065-5 (EPUB)
ISSN 0939-558X
© 2018 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Printed in EU
Covermotiv und Illustrationen im Innenteil: © Nina de Vries, Potsdam
Satz: Bernd Burkart; www.form-und-produktion.de
Ernst Reinhardt Verlag, Kemnatenstr. 46, D-80639 München
Net: www.reinhardt-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Inhalt
Vorwort
Einleitung
1 Das Recht auf selbstbestimmte Sexualität – Welches Angebot können Pflegekräfte ihren Bewohnern und Klienten machen?
1.1 Passive Sexualassistenz
1.2 Aktive Sexualassistenz
2 Körperliche und seelische Unversehrtheit, Freiheit und Sicherheit – Rechte und Pflichten
2.1 Menschenrechte
2.2 Situation der Pflegekräfte
2.3 Situation der Klienten
3 Privatheit im Heim gewährleisten – Im Gespräch mit praktizierenden Sexualassistenten
4 Pflege, Betreuung und Behandlung – Nur nicht intim werden!
4.1 Pflege der Pflegenden
4.2 Bedürfnisse der zu Pflegenden erfassen
4.3 Ausbildung
5 Beratung und Aufklärung – Wer spricht wie und mit wem über das Bedürfnis nach Berührung?
6 Wertschätzende Kommunikation und Teilhabe – Was trennt, was verbindet?
7 Religion und Weltanschauung – Andere Länder, andere Sitten: die gleiche Sehnsucht
8 Palliative Begleitung – Wenn der letzte Wunsch uns ungewöhnlich erscheint
Nachwort
Anhang
Verwendete Literatur
Weiterführende Literatur
Beratungsstellen
Filmtipps
Fragebogen für Mitarbeiter
Assessmentinstrument „SexAT“ – deutsche Version
Sachregister
Die Fragebögen aus Kapitel 4 finden Sie als Kopiervorlagen im Anhang und als Download unter www.reinhardt-verlag.de/de/downloads/.
Vorwort
Der alte Mensch bleibt ein sexuelles Wesen, ob weiblich oder männlich, ob dement oder bei Sinnen, ob körperlich beeinträchtigt oder unversehrt, ob selbstständig oder pflegebedürftig.
Natürlich ist das so.
Und selbstverständlich hat jeder Mensch ein Recht auf seine Sexualität.
Wie aber steht es mit diesem Recht, wenn der Mensch nicht mehr in der Lage ist, seine Wünsche nach Erotik, Lust, Sinnlichkeit, Zärtlichkeit und Beischlaf ohne Hilfe zu befriedigen?
Mitarbeiter in der Altenpflege kennen diese Menschen. Sie werden mit deren Verlangen, Begierde und Lust verbal und manchmal auch handgreiflich konfrontiert. Das führt zu Irritationen und Verunsicherung, denn die Orte, an denen alte Menschen gepflegt werden, fühlen sich für diesen wichtigen Lebensbereich weder zuständig noch verantwortlich. Zwar wird einem alten Mann die Eichel und einer alten Frau die Scheide gereinigt, aber die Gefühle, die Sehnsüchte, die Träume, die Begierden kommen nicht zur Sprache.
Wenn ein Mann nach einer Prostataoperation wissen will, ob er noch Geschlechtsverkehr haben kann, wenn eine Frau die Trockenheit ihrer Scheide beim Masturbieren beklagt, dann sind Pflegende im besten Falle ratlos, im schlimmsten Falle erleben sie die Sorge der alten Menschen als Anmaßung ihnen gegenüber.
So wird das Thema unter der Decke gehalten. Pflegende trauen sich nicht das „heiße Eisen“ anzupacken, sind nicht sicher, ob sie mit den alten Menschen offen darüber reden dürfen oder befürchten, weitergehende Gelüste auszulösen, die sie nicht mehr beherrschen können. Manche sind auch überzeugt, dass das Thema Sexualität nicht mit der Würde ihrer Profession zu vereinbaren ist.
Nur so ist zu erklären, dass selbst die harmloseste Form der Sexualität, die Erotik, bei der Pflege alter Menschen zu kurz kommt. Flirten, das Spiel mit den Augen, der Augenblick, der verzaubert, das Versprühen von Feenstaub, die liebevolle Berührung, der zarte Kuss auf die Hand, die Stirn, die Wange, all das gilt als überflüssig und unangemessen. In einem derartigen Klima haben Mitarbeiter, die in der Lage sind, den Menschen zärtlich, liebevoll, verwöhnend und schmeichelnd zu begegnen, einen schweren Stand.
Eine Pflegerin erzählt, dass sie sich zu einer unruhigen Dame in das Bett gelegt habe und zwar in der Löffelchenstellung. Die Dame sei ein wenig zur Ruhe gekommen und sie, die Pflegerin, habe das gute Gefühl gehabt, die Dame mit ihrer körperlichen Wärme zu verwöhnen. Kolleginnen reagieren empört. Das sei ja wohl das Letzte, sich in ein Patientenbett zu legen, das sei absolut unprofessionell.
Wer Menschen mit Demenz begleitet, der weiß in aller Regel, dass er sie durch Zeigen und Vormachen zu selbstständigem Handeln anleiten kann, und er weiß vor allem, dass er bei den Menschen bleiben muss, um ihnen Sicherheit zu geben. Beim Anreichen von Speisen oder Getränken hat sich das bewährt. Beim Duschen scheint eine solche Vorgehensweise unvorstellbar, ja abwegig. Doch bin ich überzeugt, dass sich mancher Herr und manche Dame mit Demenz mit weniger Aufwand duschen ließen, wenn eine Pflegekraft sich mit unter die Dusche stellen würde. Es überrascht nicht, dass ein entsprechender Vorschlag bei den meisten Pflegenden sofort sexuelle Fantasien auslöst, die unter Protest abgewehrt werden müssen.
Solange Liebe, Erotik, Sinnlichkeit und Sexualität in der Altenpflege fast ausschließlich unter dem Aspekt von Missbrauch und Übergriff durch die sexuell aktiven alten Damen und Herren behandelt werden, bleiben die positiven Auswirkungen der körperlichen Nähe unbeachtet.
Selbstverständlich muss niemand in der Pflege über seine Grenzen hinweggehen. Wer sich nicht in der Lage fühlt, einen alten Menschen im Genitalbereich zärtlich und sinnlich zu waschen, kann und darf dazu nicht verpflichtet werden. Es darf umgekehrt aber auch niemandem verboten werden. Sinnvolle Grenzen, zum Beispiel aus arbeitsrechtlichen Gründen, müssen besprochen werden, aber doch so, dass die Pflegenden mit sehr niedrigen Grenzen nicht den Maßstab für eine Pflege setzen, die Sinnlichkeit verhindert.
Zu Recht fordert die Autorin: „Schaffen wir daher Gelingensbedingungen für Lust statt Verlust.“ (Einleitung). Die Schaffung eines sexualfreundlichen Klimas sollte der erste Schritt sein. Sie nennt das passive Sexualassistenz. Mitarbeiter sollten offen für die sexuellen Wünsche der alten Menschen sein; sie müssen sie nicht erfüllen, aber sie müssen nach Wegen suchen, wie ein Gelingen möglich werden kann. Für die aktive Sexualassistenz, Kuscheln, Erotik, Sex, Massage oder auch das Duschen können dann Frauen und Männer angefragt werden, die gegen Entgelt bereit sind, eine sexuelle Dienstleistung zu erbringen. Sexualassistenten bieten „den Austausch von Zärtlichkeit und Nacktheit, den Genuss der Zeit zu zweit“ (Kap. 1) an. Das klingt gut und so ist zu hoffen, dass aktive Sexualassistenz eine selbstverständliche Dienstleistung wird, die ein alter Mensch, der darauf angewiesen ist, anfordern kann.
Ich denke nicht, dass es einen Anspruch auf die Vergütung dieses Vergnügens gibt. Aber vielleicht sind Fördervereine, die sich für das Wohl alter Menschen mit Beeinträchtigungen einsetzen, bereit, im Bedarfsfalle die Kosten zu übernehmen. Wer sich rechtzeitig Gedanken über seine Zeit der nachlassenden Autonomie macht und sich ein Leben ohne Zärtlichkeit und Sinnlichkeit nicht vorstellen kann, der könnte, ein weiterer Vorschlag von mir, vorsorglich einen Betrag für die zukünftige erwünschte Dienstleistung zurücklegen. Auch ist es sinnvoll, durch eine Lebensverfügung (wie sie z. B. in meinem Buch Meine Lebensverfügung für ein gepflegtes Alter, Ernst Reinhardt Verlag, 2017, vorgestellt wird) o.ä. schriftlich festzuhalten, welche eigenen Wünsche und Bedürfnisse im Pflegefall berücksichtigt werden sollen.
Tönisvorst im Mai 2018
Erich Schützendorf
Einleitung
Sexualität in der zweiten Lebenshälfte gilt in der Gesellschaft nach wie vor als vernachlässigtes Thema. Und das, obwohl diese Zeit mittlerweile als sehr bewegt und nicht ruhig – sozusagen als vorzeitige Einstimmung auf den Ruhestand – beschrieben wird.
Auch die wissenschaftliche Datenlage zum Thema Erotik und Sexualität im Alter ist im Jahre 2017 noch unzureichend. Doch die Thematik stößt zunehmend auf öffentliches Interesse – und hält nun auch in stationären Pflegeeinrichtungen Einzug. Denn in Kürze bezieht die Oswalt-Kolle-Generation unsere Pflegeheime.
Der deutsche Journalist, Autor und Filmproduzent wurde in den 1970er Jahren bekannt durch seine Filme zur sexuellen Aufklärung. Obwohl seine Texte und Filme gegen die damals vorherrschenden Moral- und Sittenvorstellungen verstießen, genossen sie einen großen kommerziellen Erfolg. Kolle arbeitete bis zu seinem Tod 2010 in Amsterdam an seinem letzten Buch „Sex: 10 Todsünden“ (Kolle/Wagner 2011). Er wurde ebenfalls 2010 vom Internationalen Bund der Konfessionslosen und Atheisten e. V. (IBKA) für seine Verdienste um die sexuelle Selbstbestimmung geehrt.
Durch den Generationswechsel folgt somit eine Bewohnerklientel mit einer ganz anderen sexuellen Sozialisation, gepaart mit dem Mut und dem Wunsch, die eigenen, ganz natürlichen Bedürfnisse zu benennen und auch auszuleben. Denn wir alle wissen: Der Wunsch nach Zärtlichkeit und Intimität verlässt uns auch im zunehmenden Alter nicht. Zeiten ändern sich, doch Gefühle bleiben.
Das neue Pflegestärkungsgesetz legt den Fokus auf ein weitestgehend selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause. Dafür nimmt der Bund künftig viel Geld in die Hand, um die Versorgung sicherzustellen und Defizite durch personelle Unterstützung der pflegenden Angehörigen auszugleichen. Um den Anforderungen des neuen Pflegemarktes gewachsen zu sein, werden sich vollstationäre Institutionen ebenfalls diesem Anspruch auf Selbstbestimmung stellen müssen. Das fordert ein Umdenken in der Versorgung. In diesem Buch sollen Geschichten erzählt, Beispiele erörtert, Impulse gesetzt und zum Nachdenken anregt werden. Die Erfahrungen aus der Praxis können unterstützen, begleiten, Raum geben, wertschätzen, herausfordern und bestenfalls neue Wege bereiten. Selbstbestimmung ist nicht ausschließlich universell möglich und nötig, sondern kann als graduelles Konzept in der Pflege gelebt werden. Auch wenn es in Teilen, zumindest gefühlt, nicht mit unserer Pflege- und Sorgekultur konform geht, denn Pflegende neigen nach wie vor zum „Überpflegen“. Aus Sorge und Fürsorge ist schnell entschieden, was dem zu Pflegenden gutzutun scheint bzw. was richtig oder angemessen wäre. Eine Form von Übergriffigkeit, die nur durch Reflexion des eigenen Handelns als solche erkannt werden kann. Wenn es dadurch gelingt, Situationen weitestgehend wertfrei zu analysieren, wird es möglich, die (Für-)Sorge der Selbstbestimmung gegenüberzustellen und eine bewusste Entscheidung zu treffen.
Es folgen acht Kapitel, deren Überschriften wir zur besseren Orientierung an die Pflege-Charta (BMFSFJ 2014) angelehnt haben, um das Thema Sexualität gezielt miteinzubeziehen. Damit können Mitarbeiter aus der Pflege in ihrer persönlichen Entwicklung nicht nur an Pflegetheorien wachsen, sondern auch Denkanstöße mit hohem Praxisbezug bekommen. Für die Einsicht in die Pflegepraxis gibt es über das Buch verteilt immer wieder Praxisbeispiele mit Lösungsansätzen, die in Zusammenarbeit mit Frau Margret Schleede-Gebert (www.schleedegebert.de, 16.05.2018) entstanden sind. Pflegende Angehörige stehen ebenfalls oft und auch erstmalig vor der großen Herausforderung, einen nahestehenden Angehörigen zu pflegen. Wenn es dann nicht um die Grund- und/oder Behandlungspflege, sondern um wut-, scham- oder auch ekelauslösende Themen geht, ist es möglich, dass Pflegende überreagieren oder sich aus Unsicherheit der Situation entziehen. Meist bleibt es nicht bei einer einmaligen eher unangenehmen Begegnung – sind nämlich keine respektvollen Zeichen der eigenen Grenzen in Wort, Mimik und Gestik spürbar, nimmt die Verunsicherung auf beiden Seiten zu. Als „sexuelle Wesen“ sind wir alle unseren ganz natürlichen Bedürfnissen unterworfen. Sie sind nicht veränderbar – veränderbar sind aber unsere Werte und Normen, um (nicht nur die eigenen) Bedürfnisse erfüllen zu können. Wir können eine andere Strategie zur eigenen Bedürfnisbefriedigung wählen. Es kommt auf die Priorität der Befriedigung an. Diese verschiebt sich je nach Bedürfnislage, das heißt zum Beispiel, wenn ich Hunger habe, hat das Bedürfnis nach Essen die höchste Priorität.
Sexualität im Alter und im Zusammenhang mit Demenz wird bisher ausschließlich pathologisch diskutiert. Dem Menschen mit Demenz wird somit eine gleichwertige Sexualität abgesprochen. Diesbezügliche Forschungen sind meist wenig aussagekräftige Zahlenwerke und zudem kaum ergebnisorientiert. Schaffen wir daher Gelingensbedingungen für Lust statt Verlust – und damit verbundenen Frust. Wen geht es an, wer kann betroffen sein? Die Grafik des statistischen Bundesamtes zeigt den Bedarf in Zahlen.
Abbildung: Eckdaten der Pflegestatistik (Statistisches Bundesamt 2015, 5)
Scham schützt unsere Intimität und ist ein entscheidender Mechanismus, um Gruppen zu bilden und zu erhalten: Eine peinliche Emotion treibt dazu an, die geltenden Normen einzuhalten. Selbst wenn nur 1 % der knapp 800.000 Bewohner von Pflegeheimen in Deutschland, die geltende Norm nicht mehr einhalten können (wie z. B. im Falle demenzieller Veränderungen), werden stationär nicht nur umfangreiche kommunikative und sprachliche Fähigkeiten nötig. Es braucht neue institutionelle Konzepte für dieses ganz natürliche Bedürfnis nach Nähe.
Zur besseren Lesbarkeit haben wir in diesem Buch für alle Personen die männliche Form verwendet. Selbstverständlich ist die weibliche Form immer mitgemeint.
1 Das Recht auf selbstbestimmte Sexualität
Welches Angebot können Pflegekräfte ihrenBewohnern und Klienten machen?
Die Entscheidung, auf Sexualität zu verzichten, kann im Alter eine durchaus sinnhafte, gesunde Dimension haben – insbesondere, wenn Sexualität in jüngeren Jahren nie als lustvoll, sondern als Pflicht, als schmerzhaft erlebt und mit Ekel verbunden wurde. Gerade Frauen wurden im Leben oft auch mit Gewalterfahrungen konfrontiert. Ein allgemein gültiges Optimum an sexuellem Interesse gibt es in keinem Alter, vielmehr variiert diese je nach individueller Lebenslage (Ebberfeld 1992). Sexualität verschwindet im Alter meist, wenn sie schon früher unwichtig und die Einstellung dazu negativ war. Sicherlich verliert sie im Laufe des Lebens an Bedeutung – und doch findet mehr davon statt als zugegeben wird. Es gibt immer wieder Liebesbeziehungen, die innerhalb der Einrichtung entstehen, und auch neue Begegnungen mit Menschen, die nicht stationär aufgenommen sind. Dazu kommt, dass die meisten Menschen sich oft sehr viel jünger fühlen, als sie sind. Im Falle einer stationären Heimaufnahme stellt sich dann die Frage, ob noch die Möglichkeit besteht, erotische Bedürfnisse – ganz unabhängig vom Geschlecht – zum einen zu bekunden und zum anderen auch auszuleben. Homosexualität ist in der Generation, die heute die Heime bewohnt, noch keine Normalität. Wurde sie in Österreich doch noch bis 1971 strafrechtlich verfolgt, während sie in Deutschland 1969 und in der Schweiz 1942 straffrei wurde.
BEISPIEL
Wir sorgen für Anstand: Zwei Bewohnerinnen teilen sich ein Zimmer. Tagsüber gehen sie Hand in Hand über den Flur und küssen sich häufig. Oft liegen sie morgens in einem Bett. Der Nachtdienst hat beobachtet, dass es zu sexuellen Handlungen kommt. Die Mitarbeiter beschließen, die beiden zu trennen. Aussage: „Wir ziehen uns doch hier keine Lesben ran!“
Lösungsansatz: Die professionelle Pflegekraft weiß, dass die meisten Menschen vermutlich bisexuell sind. Gerade für die Generation, die derzeit noch die Heime bewohnt, bestand in der Nachkriegszeit ein Männermangel. Schon während des Krieges sind Frauen zueinander geflüchtet, um sich gutzutun.
Das Interesse an unseren Mitmenschen und neuen Mitbewohnern kann und darf wieder erwachen. So sind Neugierde und Flirts beim gemeinsamen Essen nicht ungewöhnlich. Oft berichten Pflegende aus der Praxis von einer Art Wettbewerb beim Buhlen um neue Bewohner. Männer werden von Frauen umgarnt und umgekehrt, nicht selten kommt es dabei zu Unstimmigkeiten und ungewöhnlichen Verhaltensweisen. So wird gerade während der Mahlzeiten im Speiseraum um den Platz neben dem „Neuen“ gestritten oder im Gespräch versucht, die eigenen Chancen auszuloten.
BEISPIEL
Das geht ja gar nicht: Herr B. lebt in einer betreuten Wohnanlage. Er ist für sein Alter noch sehr attraktiv und die Damen im Haus hofieren ihn. Jeden Nachmittag überredet er eine der Damen, ihn doch nach Hause zu begleiten. Circa 45 Minuten später wird der Notruf betätigt und Herr B. fordert von der Pflegekraft, die vor ihm kniende Frau aus dem Zimmer zu bringen. Die Hose von Herrn B. ist offen. Offensichtlich hat die Frau ihn oral befriedigt.
Lösungsansatz: Diese Situation ist sowohl für die Dame als auch für das Pflegepersonal entwürdigend. Daher steht ein Gespräch mit Herrn B. an, dahingehend, dass er künftig dafür Sorge trägt, sein Liebesspiel so zu gestalten, dass die Intimsphäre aller gewahrt bleibt.
Während eines Krankenhausaufenthaltes können diese Interessen oder Regungen mit der zeitlich begrenzten Verweildauer sicherlich im Hintergrund verbleiben (zumal in der Klinik grundsätzlich Therapie und Genesung im Vordergrund stehen).
Jung verunfallte Menschen (mit z. B. folgender Querschnittslähmung) bedürfen im Rahmen der Rehabilitation sehr wohl der Unterstützung beim Erleben der zukünftig „neuen“ eigenen Sexualität. Hier sind Stimulantien wie aufklärende Gespräche in offener Atmosphäre, Filme, Hilfsmittel („Sexspielzeug“), aber auch Sexualassistenz gemeint. Auch in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen hat diese Art der Unterstützung bereits seit Jahren einen festen Platz.
In Senioreneinrichtungen geht man noch sehr zurückhaltend mit dem Thema um. Obwohl Senioren immer deutlicher ihr Recht auf Sexualität und Beziehung einfordern, fehlt es den Trägern an sexualpädagogischen Konzepten und Möglichkeiten der praktischen Umsetzung. Belastende Vorurteile lassen es an Empathie bzw. professionellen Umgangsformen mangeln – und oft auch an konkreten Umsetzungsideen. So scheuen meist Personal, aber auch Bewohner und Angehörige eine offene Gesprächskultur zum Thema. Die dahinterliegende Angst vor Zurückweisung scheint übermächtig und führt zur Verleumdung der eigenen Gefühle. Die Akzeptanz von Bewohnerwünschen setzt meist eine Eigenverantwortlichkeit voraus, die sich die Bewohner nach dem Einzug selbst gar nicht zugestehen. Grenzüberschreitungen, egal welcher Art, werden von ihnen in Kauf genommen oder nicht als solche empfunden (diese sind selbstverständlich auch umgekehrt möglich).
Lebendig fühlt sich der zu Pflegende meist dann, wenn er die Fähigkeiten zur Selbstversorgung noch nicht verloren hat. Somit streben wir seit vielen Jahren die ressourcenorientierte Pflege an, welche wir künftig noch viel mehr mit den Erwartungen der Klienten abgleichen sollten, um einer Überversorgung entgegenzuwirken. Die Erhaltung selbstbestimmter Alltagskompetenz durch Kenntnis von Möglichkeiten und Präventionsmaßnahmen müssen gezielt durch Information, Beratung, Schulung und Moderation herbeigeführt werden, um das Gefühl von Stimmigkeit (Kohärenz) herzustellen.
!
Mit einem transparenten Konzept (z. B. einem Pflegeleitbild,
Kap. 5
) können hierfür Routinen mit Blick in die Zukunft geschaffen und Pflegeeinrichtungen zu lebendigen Räumen mit kurzen Wegen werden.
Transparenz beginnt bei der Wahrnehmung der Mitarbeiter. Werden Bedürfnisse adäquat erfragt oder erkannt und bekommen die Mitarbeiter Unterstützung durch die Einrichtungsleitung?
Wir wissen um erotische Bedürfnisse unserer Bewohner und erkennen diese an. Erotik altert nicht, sie reift. Kommunikation und professionelle Abgrenzung ist uns zum Schutz der Kollegen aller Bereiche ebenfalls ein Anliegen. Mit beispielsweise einem anlassbezogenen Meldebogen lässt sich die hausinterne Situation wie folgt prüfen:
Wann ist was, wo passiert? Wer war beteiligt?
Welche Art von Unterstützung wurde im Anschluss gesucht?
Wie wurde auf der Handlungsebene situativ reagiert?
Welche nächsten Schritte werden eingeleitet?
Man unterscheidet bei einer Meldung (A) Vorkommnisse zwischen Bewohnern und (B) Vorkommnisse zwischen Bewohner und Mitarbeitern.
Der Meldebogen macht eine Erhebung und Bedarfsermittlung in kurzer Zeit mit nur einem Formular nachweislich möglich. Es entsteht ein Überblick zum Thema im Haus. Um Veränderung einzuleiten und Bewusstsein zu schaffen, kann eine sich wiederholende Bewohnerbefragung zum Bereich Liebe, Intimität und Partnerschaft aufschlussreich und inspirierend sein:
Ist die Atmosphäre in der Einrichtung für Sie eher lustfreundlich oder lustfeindlich? Fühlen Sie sich in Ihren Räumen ungestört und sicher? Haben Sie die Möglichkeit zu zweit in ihrem Schlafzimmer zu übernachten?
Welche Veranstaltungen würden Sie gern besuchen?
– Flirten/Kontaktbörse,
– Lebenslust/Erotik,
– Körpererfahrungen/Massage,
– Liebe und Partnerschaft.
Welche Filme würden Sie gern sehen (Liebe, Erotik, Partnerschaft, Sexualität)?
Wünschen Sie sich mehr Literatur oder Hörbücher zum Thema in der Hausbibliothek?
Haben Sie den Wunsch über Einsamkeit und/oder Beziehungsfragen zu sprechen? Wenn ja, mit wem?
So könnte ein neuer, anderer Blick auf die künftige Pflegesituation entstehen und diese maßgeblich verändern. Selbstbestimmung auf allen Seiten gelingt durch:
Findung innovativer Ideen unter Miteinbezug der Familie
Herbeiführung fokussierter Entscheidungen
Vereinbarung gemeinsamer Ziele und Entscheidungen (Pflegeleitbild)
– Welche Pflege wollen wir anbieten
– Welches Modell findet Anwendung
– Pflegeverständnis
– Kommunikation und Zusammenarbeit
– Organisation, Größe, Erscheinungsbild und Lage der Einrichtung
– In- und externe Qualitätssicherung
– Kooperationspartner (z. B. externe Sexualassistenz)
Vereinbarung gemeinsamer Ziele und Strategien
Klärung von Konflikten
Bewältigung der Vergangenheit
Gestaltung der Zukunft
Liebesdienste für ältere Menschen: Diesen dreiminütigen Beitrag zum Thema drehten wir für das NDR-Magazin DAS! in einer stationären Pflegeeinrichtung in Hamburg. Nach der Ausstrahlung meldeten sich am nächsten Tag gleich fünf Interessenten mit der Bitte um Heimaufnahme bei der Heimleitung. Nun ist nicht davon auszugehen, dass diese potenziellen Kunden ausschließlich an Sexualassistenz interessiert waren. Anzunehmen ist eher, dass der Film Selbstbestimmung und Freiheit auch innerhalb einer Institution implizierte.





























