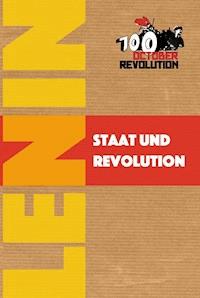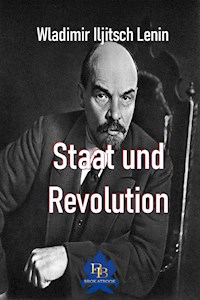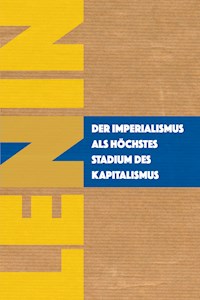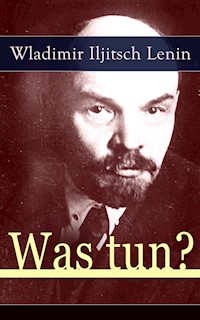Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
1902 veröffentlichte Lenin in München die programmatische Schrift Was tun?, unter dem Decknamen "N. Lenin". Sie machte ihn unter den Revolutionären bekannt, polarisierte aber auch stark. Denn darin entwarf er das Konzept einer geheim agierenden, disziplinierten und zentralisierten Arbeiterpartei, bestehend aus Berufsrevolutionären. Die Partei sollte in ideologischen und strategischen Fragen geeint auftreten und die Masse der Bevölkerung auf dem Weg zur Revolution anführen. (aus wikipedia.de)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Was tun?
Wladimir Iljitsch Lenin
Inhalt:
Entstehung und Geschichte des Kommunismus
Was tun?
Vorwort
I - Dogmatismus und „Freiheit der Kritik“
a) Was heißt „Freiheit der Kritik“?
b) Die neuen Verteidiger der „Freiheit der Kritik“
c) Die Kritik in Rußland
d) Engels über die Bedeutung des theoretischen Kampfes
II - Spontaneität der Massen und Bewußtheit der Sozialdemokratie
a) Der Beginn des spontanen Aufschwungs
b) Die Anbetung der Spontaneität Die Rabotschaja Mysl
c) Die „Gruppe der Selbstbefreiung“ und das Rabotscheje Delo
III - Trade-unionistische und sozialdemokratische Politik
a) Die politische Agitation und ihre Einengung durch die Ökonomisten
b) Die Geschichte darüber, wie Plechanow von Martynow vertieft wurde
c) Die politischen Enthüllungen und die „Erziehung zur revolutionären Aktivität“
d) Was hat der Ökonomismus mit dem Terrorismus gemein?
e) Die Arbeiterklasse als der Vorkämpfer der Demokratie
f) Noch einmal die „Verleumder“, noch einmal die „Mystifikatoren“
IV - Die Handwerklerei der Ökonomisten und die Organisation der Revolutionäre
a) Was ist Handwerklerei?
b) Handwerklerei und Ökonomismus
c) Die Organisation der Arbeiter und die Organisation der Revolutionäre
d) Der Umfang der Organisationsarbeit
e) „Verschwörer“organisation und „Demokratismus“
f) Örtliche und gesamtrussische Arbeit
V - „Plan“ einer gesamtrussischen politischen Zeitung
a)Wer fühlt sich durch den Artikel Womit beginnen? gekränkt?
b) Kann eine Zeitung ein kollektiver Organisator sein?
c) Welchen Organisationstypus brauchen wir?
Schluß
Beilage
Was tun?, Wladimir Lenin
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849625368
www.jazzybee-verlag.de
Entstehung und Geschichte des Kommunismus
Kommunismus, in einer besonderen Bedeutung des Wortes nach dem allgemein üblichen wissenschaftlichen Sprachgebrauch ursprünglich ein bestimmtes Grundprinzip der wirtschaftlichen und sozialen Ordnung einer menschlichen Gemeinschaft, nämlich das der Gütergemeinschaft mit wirtschaftlicher und sozialer Gleichheit der Individuen und völligem Aufgeben der individuellen wirtschaftlichen Selbständigkeit. Dann wurde das Wort der Ausdruck für alle auf diesem Prinzip beruhenden Theorien und Systeme menschlicher Gemeinwirtschaften und deren geschichtliche Erscheinung. In einem engeren Sinne bezeichnet es von diesen Theorien und Systemen nur diejenigen, die jenes Prinzip zum Grundprinzip eines Staatswesens und einer Volkswirtschaft machen (Staatskommunismus). Im folgenden ist von dem K. in diesem engeren Sinne die Rede. Der K. in diesem Sinne hat mit dem Sozialismus manche Verwandtschaft, so daß es schwer ist, ihn von diesem vollständig und scharf zu trennen. Beide Systeme bezwecken eine nach der Meinung ihrer Anhänger bessere Staats- und Gesellschaftsordnung, als die bestehende ist, und sind ursprünglich aus einem humanen Bestreben hervorgegangen: die Not und das Elend im Volksleben zu beseitigen. Sie wollen die Armut, das Proletariat, die Unmoralität verbannen und die Unterschiede in den wirtschaftlichen, moralischen und sozialen Verhältnissen der Menschen ausgleichen oder aufheben, sie wollen allen eine glückliche materielle und moralische Existenz sichern und deshalb das Staats- und Wirtschaftsleben auf neuen Grundlagen errichten. Beide beruhen auf dem Glauben, daß durch eine vollständige Um- und Neugestaltung der gegenwärtigen Rechts- und Gesellschaftsordnung die Ursachen aller beklagten wirtschaftlichen, sozialen, rechtlichen und politischen Übelstände beseitigt werden könnten. Für diese neue Ordnung stellen sie als Grundprinzip hin, daß die wirtschaftliche Freiheit des einzelnen eingeschränkt werden und die Gesamtheit die Sorge und Verantwortlichkeit für die Lage der einzelnen übernehmen müsse. Auf dieser Grundlage erfinden sie für das ökonomische Gebiet neue Organisationen der wirtschaftlichen Tätigkeit, der Produktion und der Verteilung der Güter, welche die Forderungen einer angeblichen Gerechtigkeit verwirklichen sollen. Doch lassen sich zwischen dem Sozialismus und dem K. sowohl rücksichtlich der Zielpunkte wie der praktischen Vorschläge für die Neugestaltung der bestehenden Zustände auch einige erhebliche Unterschiede konstatieren. Freilich gehen auch unter den Kommunisten selbst die Meinungen auseinander, und man spricht deshalb von verschiedenen kommunistischen Systemen. Aber gewisse Grundanschauungen finden sich doch bei allen, und diese sind es, die das Wesen des K. im strengeren Sinne charakterisieren. Es sind hauptsächlich folgende: Der K. sieht die Wurzel aller Übelstände im Privateigentum. Dieses mache erst die Menschen zu Egoisten und lasse den an sich berechtigten und nützlichen Trieb zur Selbsterhaltung und Förderung der eignen Interessen ausarten in die unberechtigte und schädliche Selbstsucht. Die Folge sei bei der bisherigen Rechtsordnung unter der Herrschaft der persönlichen Freiheit die Ausbeutung des einen durch den andern, die wirtschaftliche und damit auch die soziale und politische Ungleichheit. Das Privateigentum müsse demnach vor allem beseitigt werden. Charakteristisch für den K. ist ferner, daß er Menschenglück und gerechte, normale Zustände in der Gesellschaft nur da sieht, wo unbedingte Gleichheit der einzelnen besteht. Es soll daher kein ökonomischer, sozialer, politischer Unterschied irgendwelcher Art bestehen und Gleichheit der Arbeitslast, des Einkommens und des Genusses herbeigeführt werden. Zu diesem Zweck wird eine Organisation der wirtschaftlichen Tätigkeit der einzelnen von Gesellschafts wegen gefordert. Diese soll auf der Gütergemeinschaft beruhen; alle Produktions-wie alle Genussmittel sind Eigentum der Gesamtheit. Es besteht kein Privateigentum und kein Erbrecht. Die Gesamtheit regelt Herstellung, Verteilung, Verbrauch der materiellen Güter nach dem Grundsatz der Gleichheit. Für alle Arbeitsfähigen besteht Arbeitszwang. Die Ernährung und Ausbildung der Jugend ist gleich und erfolgt auf gemeinsame Kosten. In diesem Ideenkreis bewegen sich alle Kommunisten. Im einzelnen und in der Art, wie sie ihre Ideen zu verwirklichen dachten, weichen sie voneinander ab.
Schon im Altertum hat Platon in seiner »Politeia« (»Der Staat«) und den »Nomoi« (»Die Gesetze«) eine Art von kommunistischem Staat als Idealstaat hingestellt. In diesem, der die ideale Verwirklichung der griechischen Staatsidee sein soll, besteht nicht die volle, sondern nur eine teilweise Gütergemeinschaft, noch weniger die volle Gleichheit der Menschen. Seit dem 16. Jahrh. hat fast jedes Jahrhundert hervorragende Vertreter des kommunistischen Gedankens aufzuweisen. Die erste eingehende und geistvolle Darstellung und Verteidigung des K. und das erste Bild eines wirklich kommunistischen Staates lieferte Thomas Morus in einem Jugendwerk: »De optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia libri duo« (1516, deutsch von H. Kothe in Reclams Universal-Bibliothek), dessen Ideen freilich der spätere Staatsmann und Kanzler Heinrichs VIII. von England nicht mehr vertrat. Das Werk erregte wegen der scharfen und freimütigen Kritik des damaligen, auf der privilegierten Ausbeutung beruhenden Klassen- und Ständestaates großes Aufsehen. Aus ihm schöpften später vielfach Kommunisten ihre Ideen und ihre Gründe. Unter diesen sind als Erfinder kommunistischer Staatsordnungen besonders hervorzuheben der kalabresische Dominikanermönch und Philosoph Thomas Campanella, 1568–1659, der das phantastische Bild eines kommunistischen Staates in seinem Werk über den Sonnenstaat (»Civitas Solis«, 1620) entwarf, und dessen Ideen in dem Jesuitenstaat an den Ufern des Paraguay in der ersten Hälfte des 17. Jahrh. zum Teil verwirklicht wurden; ferner der französische Rechtsgelehrte Vairasse, aus dessen kommunistischem Werk »Histoire des Sevarambes« (1677) später namentlich der Sozialist Charles Fourier und der Kommunist Cabet einzelne Ideen entnahmen; endlich der Franzose Morelly (»Naufrages des îles flottantes, ou la Basiliade de Bilpai«, Messina 1753; »Code de la nature«, 1755). »Staatsromane« nennt Robert v. Mohl mit Recht diese Werke in seiner historisch-kritischen Darstellung derselben (»Geschichte und Literatur der Staatswissenschaft«, Bd. 1, S. 167 ff.).
Diese Kommunisten waren reine Theoretiker des K. Sie waren nicht bestrebt, ihre kommunistischen Ideen zu verwirklichen. Darin unterscheiden sie sich von den modernen Kommunisten. Diese letzteren haben keine neuen kommunistischen Grundgedanken erfunden, sondern bewegen sich in den Ideen von Morus, Campanella, Vairasse, Morelly u. a. Wenn trotzdem von verschiedenen Systemen derselben gesprochen wird, so hat das nur insofern einen Grund, als sie jenen Kommunisten gegenüber und unter sich in der Art der Durchführung des kommunistischen Gedankens, in der Organisation des von ihnen erstrebten kommunistischen Heilstaates auseinandergehen. Die einen (Cabet, Weitling) wollen den K. in einem großen zentralisierten Staat verwirklichen, in dem die Zentralbehörde die Tätigkeit aller einzelnen wie die Marionetten auf einem Puppentheater dirigiert; die andern (Babeuf, R. Owen) wollen die Auflösung des Staates in kommunistisch organisierte, selbständige ländliche Gemeinden ohne Städte. Die einen (Cabet, Weitling) träumen von einem hohen Genuss- und Kulturleben aller, wie es heute nur die Wohlhabenden und Reichen genießen können; die andern (Babeuf, R. Owen) erkannten, daß die kommunistische Gesellschaft den einzelnen nur eine sehr bescheidene materielle Existenz und ein niedriges geistiges Leben verschaffen könne. Die einen erstreben die Gleichheit lediglich in den materiellen Verhältnissen, die andern wollen auch die Gleichheit der Bildung und die Aufhebung der Ehe und der Familie. Die einen endlich wollen Einführung des K. auf dem Wege friedlicher Agitation, die andern auf dem Wege der gewaltsamen Revolution.
Die erste kommunistische Agitation hat François Noël Babeuf 1795 und 1796 in Paris ins Leben gerufen. Es war eine wesentlich politische Bewegung, die kommunistische Lehre und Agitation nur das Mittel, die untern Klassen gegen die bestehende Staatsgewalt zu gewinnen. So ist es erklärlich, daß der Plan des neuen kommunistischen Staates, den er durch die Revolution erringen wollte, weder näher entworfen, noch begründet wurde. Das kommunistische Programm Babeufs, wenn man von einem solchen sprechen will, umfasste im wesentlichen nur die oben erwähnten allgemeinen kommunistischen Forderungen; seine Besonderheit besteht in folgenden Punkten: 1) der Staat soll wesentlich ein Ackerbaustaat sein, der Betrieb von Gewerben nur stattfinden, soweit er notwendig ist zur Herstellung einfacher Genussmittel und unentbehrlicher Werkzeuge und Maschinen; 2) die Städte als Krankheitserscheinungen des öffentlichen Lebens sollen verschwinden; 3) die allen gleiche Bedürfnisbefriedigung soll ganz einfach sein; 4) die Gleichheit soll zugleich eine Gleichheit der Bildung und des geistigen Lebens sein und, um dies herbeizuführen, der für alle gleiche Unterricht sich nur auf einen elementaren im Lesen, Schreiben, Rechnen, in der Geschichte, den Gesetzen, der Geographie und der Statistik der Republik beschränken, jedes Streben aber, durch Wort oder Schrift ein höheres Wissen zu verbreiten, mit den härtesten Strafen belegt werden.
Nach dem Tode Babeufs löste sich die Partei der Babeuvisten auf. Neue kommunistische Bewegungen zeigten sich zuerst wieder in Frankreich unter der Julimonarchie. Die erste ging aus von Männern, die sich zur Lehre Babeufs bekannten und sich nach ihm Babeuvisten nannten. Einer der Mitverschwornen Babeufs, Ph. Buonarroti, hatte über Babeuf ein Buch geschrieben (die Hauptquelle für die Geschichte der Babeufschen Verschwörung: »Conspiration de légalité dite de Babeuf, suivie du procès auquel elle donna lieu et des pièces à l'appui«, Brüssel 1828, 2 Bde.), das in den 1830er Jahren eine Anzahl radikaler Republikaner zu Kommunisten im Sinne Babeufs gemacht hatte, und diese bildeten 1837 in Paris eine revolutionäre Partei zur Verwirklichung des K. An der Spitze standen Louis Blanqui, Barbès und Martin Bernard. Ihre Ideen vertraten sie für den Pariser Pöbel in der leidenschaftlichsten und zynischsten Weise in ihren Blättern: »Le Moniteur républicain« und »L'Homme libre«; gleich Babeuf wollten auch sie den K. durch die gewaltsame Revolution herbeiführen. Ihre Verbindung hieß die Société des saisons. Am 12. Mai 1839 versuchten sie durch einen Aufstand sich der Stadt Paris zu bemächtigen. Der Aufstand wurde indes unterdrückt, die gerichtliche Untersuchung ergab, daß die eigentliche Verbindung nur einige hundert Personen umfasste. Man schickte die Führer der Bewegung ins Gefängnis. Aber noch jahrelang wucherte die Lehre Babeufs in den geheimen Klubs der Travailleurs égalitaires, die in Paris und an andern Orten entstanden und den K. Babeufs teils dahin erweiterten, daß sie auch die Aufhebung der Ehe und der einzelnen Familie zur vollen Verwirklichung der persönlichen Gleichheit forderten, teils durch die Forderung von öffentlichen nationalen Werkstätten modifizierten. An die Öffentlichkeit sind diese Klubs bis 1848 weniger getreten, aber im geheimen verbreiteten sie doch die Ideen jenes K. in Proletarierkreisen, und als 1848 nach der Februarrevolution Blanqui und Barbès das Gefängnis verließen, fanden sie eine kommunistische Partei ihrer Richtung vor, mit der sie sofort öffentlich zu agitieren begannen. Die Junischlacht machte ihren Agitationen ein Ende.
Gleichzeitig entwickelte sich in Frankreich ein religiöser K., der, von den Grundgedanken des Christentums ausgehend, die Worte der Bibel anwendete, um mit ihnen die Grundlagen der bestehenden Gesellschaft, Privateigentum und Familie, anzugreifen und im Namen Christi die Gemeinschaft der Güter, die Erhebung der niederen Klassen auf den »Ruinen des Privateigentums«, die Gleichheit des materiellen Lebens unter »dem Panier des Evangeliums« zu fordern, der aber zugleich betonte, daß alle privaten Umgestaltungen, wie notwendig auch immer, nicht durch Gewalt und anarchische Störungen, sondern allein durch die Liebe und Verwirklichung des Gedankens der Brüderlichkeit vor sich gehen dürften. Diesem K., der im ganzen wesentlich negativ und theoretisch war, und der sich völlig unklar blieb über die positive neue Gestalt der kommunistischen Gesellschaft, brach der Priester de Lamennais, vorzüglich durch seine Aufsehen erregenden Schriften: »Paroles d'un croyant« (1834) und »Le livre du peuple« (1837; deutsch, Leipz. 1905), Bahn. Ihn bildeten weiter aus der Abbé Constant (»Bible de la liberté«, 1840), Alph. Esquiros (»L'évangile du peuple«, 1840; »Évangile du peuple défendu«, 1841) und besonders C. Pecqueur, beeinflußt von den Lehren Saint-Simons und Fouriers, durch sein Hauptwerk: »De la république de Dieu. Union religieuse pour la politique immédiate de l'égalité et de la fraternité universelle« (1844). Es kam aber nicht zu einer kommunistischen Partei dieser Richtung.
Eine größere kommunistische Partei in Frankreich zu organisieren, gelang in den 1840er Jahren dem Kommunisten Et. Cabet. Ursprünglich ein radikaler Republikaner, der in der reinen demokratischen Republik sein Staatsideal verwirklicht sah, war Cabet als Flüchtling in England Ende der 1830er Jahre durch das Studium kommunistischer Schriften zum Kommunisten, aber einem friedlichen Kommunisten, geworden. Er veröffentlichte 1840 die »Voyageen Icarie, roman philosophique et social«, ein harmloses Buch, in dem in amüsanter Weise die Zustände einer großen kommunistischen demokratischen Republik, Ikarien, geschildert werden. Das Buch ist eine Reisebeschreibung in der Form eines Romans. Die Phantasie Cabets entwarf ein verführerisches Bild von den glücklichen Zuständen des ikarischen Volkes, die dieses der Durchführung der kommunistischen Ideen verdankt. Dort gibt es keine Armut, keine Verbrechen, keine Unmoralität. Alle führen ein hohes Genuss leben, alle erfreuen sich des glücklichsten Familienlebens, es blühen Wissenschaft und Kunst, das Problem der Menschheit ist dort gelöst. Das verführerische Bild sollte die Franzosen für die kommunistischen Ideen gewinnen. Ähnliche Zustände glaubte Cabet auch in einem kommunistischen Frankreich nach einem Übergangsstadium, das er auf 50 Jahre annahm, herbeiführen zu können. Während desselben sollte noch das Privateigentum bestehen bleiben, aber der kommunistische Staat durch folgende Maßregeln angebahnt werden: 1) Abschaffung des Intestaterbrechts der Seitenverwandten und des testamentarischen Erbrechts sowie der Schenkungen unter Lebenden. Der Staat ist der Erbe dieser Güter. 2) Staatliche Fürsorge für eine bessere materielle Existenz der untern Volksklassen durch gesetzliche Regelung des Arbeitslohns, durch jährliche Verwendung einer halben Milliarde zur Beschäftigung Arbeitsloser mit dem Bau neuer Wohnungen und Werkstätten, durch Überlassung der Staatsgüter zur Bewirtschaftung an Arme und durch Verringerung der Armee. 3) Reform des Steuerwesens durch starke Luxussteuern und progressive Vermögensbesteuerung. 4) Kommunistische Erziehung der Kinder. Die dritte Generation würde, von der Richtigkeit des K. überzeugt, ihn friedlich einführen. Dies der Inhalt jenes Werkes, das übrigens nirgends eine wissenschaftliche Begründung, resp. Rechtfertigung der kommunistischen Forderungen auch nur versucht. Nach Abfassung dieses Werkes kehrte Cabet nach Frankreich zurück, agitierte dort in Schrift und Wort für die friedliche Verwirklichung des K. und fand zahlreiche Anhänger. Aber zu einer politischen Bedeutung gelangte die Bewegung und die Partei der »Ikaristen« nicht. Ihre einzige Tat war die durch Cabet 1848 vorgenommene Gründung einer ikarischen Kolonie in Nauvoo in Amerika. Allein das Experiment missglückte; es brachen bald Streitigkeiten unter den Teilnehmern aus. Die aus Nauvoo ausgestoßenen Anhänger Cabets gründeten eine Gemeinde in Chettenham, die 1864 zugrunde ging. Die in Nauvoo Verbliebenen siedelten später nach Adams County in Iowa und 1881 nach Ikarie Speranza in Kalifornien über.
Robert Owen versuchte eine wissenschaftliche Begründung des K., namentlich in seinen beiden Hauptwerken: »New views of society« (1812) und »Book of the new world« (1820). Der Grundgedanke seiner kommunistischen Ideen ist, daß, da der Charakter der Menschen, der ihre Handlungen bestimme, ein Produkt der angeborenen Anlagen und der äußern Verhältnisse, unter denen die Anlagen ausgebildet werden und die Menschen leben, sei, der einzelne Mensch aber weder den einen noch den andern Faktor bestimmen könne, niemand für seinen Charakter und seine Handlungen verantwortlich sei. Die Erziehung und die äußern Verhältnisse seien in der heutigen Gesellschaft durch eine falsche Organisation des wirtschaftlichen und sozialen Lebens derart, daß der Charakter der meisten Menschen ein schlechter werden müsse; daher die schlechten Zustände. Das Problem, für alle Menschen günstige äußere Verhältnisse herzustellen, so daß alle, auch die mit schlechten Anlagen, gute Charaktere würden und gut handelten, sei nur durch eine kommunistische Gesellschaftsordnung zu lösen, bei der aber der kleine Teil, der heute ein höheres Kulturleben führe, auf dieses verzichten müsse; das für alle gleiche materielle Genuss leben müsse ein ganz einfaches sein, sich auf eine sehr mäßige Befriedigung der natürlichen Bedürfnisse beschränken, und das geistige Genuss leben müsse auf ein niedriges Maß reduziert werden, wie es in den Urzuständen war, ehe Wissenschaft und Kunst existierten. Das Mittel zur Herstellung jener günstigen äußern Bedingungen findet Owen in der Bildung von kleinen wirtschaftlich selbständigen kommunistischen Gemeinden (von 500 bis 2000 Mitgliedern), die, was sie zum Leben gebrauchen, wesentlich selbst produzieren und nur solche Produkte, die sie notwendig gebrauchen, aber auf ihrem Boden nicht selbst erzeugen können, von andern Gemeinden erwerben sollen. Die Gemeinde ist die Eigentümerin des Bodens und aller andern Güter. Der Gemeinderat, bestehend aus den 30–40 Jahre alten Gemeindegliedern, ordnet und leitet die materielle Produktion und Konsumtion und die für alle gleiche Erziehung und Ausbildung. Er weist den einzelnen die Arbeit und die materiellen Bedürfnisbefriedigungsmittel zu. Die einzelnen Arbeiten werden auf die verschiedenen Altersklassen, als welche acht unterschieden werden, verteilt, so daß jeder im Lauf des Lebens nacheinander die verschiedenen Arbeiten zu verrichten hat. Die Erziehung und Ausbildung der Kinder ist gemeinsam, der Unterricht erstreckt sich nur auf die elementaren Fächer, der Hauptpunkt in der Erziehung ist die Ausbildung der Nächstenliebe. Ein radikaler Gegner aller positiven Religionen, verwirft Owen alle kirchlichen Gebräuche und jede Art von Gottesverehrung. Die Ehe soll ein freier Vertrag und jederzeit einseitig auflöslich sein. Owens kommunistische Gesellschaftsordnung bietet ein wenig verlockendes Bild, und es ist daher begreiflich, daß er dafür trotz seiner unermüdlichen, auf ihre friedliche allmähliche Herbeiführung gerichteten Agitation keine Anhänger gewann. Einige Versuche, die er in Amerika und England mit der Durchführung solcher kommunistischer Gemeinden machte, scheiterten vollständig. Als Kommunist und kommunistischer Agitator hat Owen nichts erreicht. Wenn Owens Name noch heute in England mit Ehren genannt wird, so verdankt er das dem epochemachenden Beispiel, das er als humaner Fabrikherr in der sittlichen wie materiellen Hebung seiner Arbeiter gegeben, und der Einwirkung, die er auf die Anfänge des englischen Genossenschaftswesens und der englischen Fabrikgesetzgebung ausgeübt hat.
Auch dem Schneidergesellen Wilh. Weitling (geb. 1808 in Magdeburg, seit 1849 in Amerika, gest. 1871 in New York), dem Verfasser der Schriften: »Die Menschheit, wie sie ist und sein sollte« (1838), »Garantien der Harmonie und Freiheit« (1842) und »Das Evangelium des armen Sünders« (1845, Neudruck Düsseld. 1902), der Anfang der 1840er Jahre in der Schweiz (Zürich, Lausanne, Neuenburg) eine auf kleine Kreise beschränkt gebliebene kommunistische Agitation betrieb, hat man als Autor eines selbständigen kommunistischen Systems bezeichnet. Allerdings hat er ein neues Bild von einem kommunistischen Staat gezeichnet; aber seine Anschauungen sind unreif und reine Phantasieprodukte (für die z. B. charakteristisch ist, daß an der Spitze des großen zentralisierten kommunistischen Staates als die gesamte Produktion, Verteilung und Konsumtion dirigierende Obrigkeit ein Trio von drei Philosophen stehen soll, die durch Preisarbeiten zu dieser Stellung gelangen sollen). Eine neue Art von radikalem, revolutionärem K. ist die des Russen Bakunin und der russischen Nihilisten, die, zusammenhängend mit spezifisch russischen Verhältnissen, auf die völlige Selbständigkeit der kommunistischen Gemeinden gegenüber dem Staat, auf die Abschaffung jeder Religion, Auflösung der Familie und vollständige politische wie soziale Emanzipation des weiblichen Geschlechts ausgeht.
Nicht alle Kommunisten sind nach den Anschauungen eines Bakunin und Babeuf zu beurteilen, und manche landläufige Vorstellungen über K. und Kommunisten treffen nur für einzelne, nicht für alle zu, soz. B. daß die Kommunisten stets irreligiös oder unchristlich, daß sie rohe Materialisten seien, die nur teilen und dem einzelnen ein hohes Genuss leben ohne Arbeit bereiten wollten, daß alle die Ehe und die Familie aufheben wollten etc. Aber alle trifft mit Recht der Vorwurf, daß sie unklare Phantasten sind. Ihnen fehlt die klare Einsicht in die menschliche Natur und in die allein möglichen Grundlagen einer gesunden Volkswirtschaft und friedlichen Kulturgemeinschaft, ihnen mangelt das Verständnis der wirklichen Triebkräfte menschlicher Handlungen und derjenigen organischen Gestaltung der Volkswirtschaft, die das Kulturleben der Völker und den Kulturfortschritt der Menschheit bisher bedingt hat und wohl auch in Zukunft bedingen wird. In vollständiger Verkennung dieser Verhältnisse kommen sie zu dem Grundirrtum: der Forderung der radikalen Verwirklichung der Idee der Gleichheit. Sie verkennen die große Bedeutung, die für die individuelle Zufriedenheit wie für das materielle Wohl und den geistigen Fortschritt der einzelnen und der Gesamtheit die individuelle Bewegungsfreiheit und das Bewusstsein der Verantwortlichkeit für die eigne Lage haben; sie verkennen den segensreichen Einfluss der Institutionen des privaten Eigentums und des Erbrechts auf die Erhöhung der individuellen Ausbildung, auf die Steigerung des Arbeitsfleißes und des Sparsinns, auf die Sicherung des steten Fortschritts im Wirtschaftsleben. Wohl läßt sich eine materielle Gleichheit aller durchführen, aber, wie Owen das richtig erkannt hat, nur auf der niedrigsten Stufe menschlichen Genusslebens. Die Durchführung des K. wäre die Nivellierung aller zu Proletariern, die Beseitigung des Kulturlebens und des Kulturfortschritts für die Völker. Inwieweit der moderne Sozialismus dem K. sich nähert, s. unter Sozialismus.
Vgl. L. Stein, Der Sozialismus und K. des heutigen Frankreich (Leipz. 1842) und Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich (das. 1850, 3 Bde.); Sudre, Histoire du communisme (5. Aufl., Par. 1856; deutsch, 2. Aufl., Berl. 1887); Hildebrand, Die Nationalökonomie der Gegenwart und Zukunft (Frankf. 1848); Marlo (Winkelblech), Untersuchungen über die Organisation der Arbeit (Kassel 1850–1859, 3 Bde.; 2. Aufl., Tübing. 1886, 4 Bde.); Schäffle, Kapitalismus und Sozialismus (Tübing. 1870); R. Meyer, Der Emanzipationskampf des vierten Standes (Berl. 1874–75, 2 Bde.); Woolsey, Communism and socialism in their history and theory (Lond. 1880); Leroy-Beaulieu, Le collectivisme (Par. 1884, 4. Aufl. 1903); Nordhoff, Communistic societies of the United States (Lond. 1875); H. A. James, Communism in America (New York 1879); Sagot, Le communisme an Nouveau Monde (Par. 1900); Kleinwächter, Die Staatsromane (Wien 1891); »Schlaraffia politica, Geschichte der Dichtungen vom besten Staat« (Leipz. 1892); Pöhlmann, Geschichte des antiken K. und Sozialismus (Münch. 1893–1900, 2 Bde.); Herkner, Arbeiterfrage (3. Aufl., Berl. 1902); Adler, Geschichte des Sozialismus und K. (Leipz. 1899, Bd. 1) und dessen Artikel »Sozialismus und K.« im »Handwörterbuch der Staatswissenschaften«; weitere Literatur bei »Sozialismus«.
Was tun?
Brennende Fragen unserer Bewegung
Vorwort
Die vorliegende Broschüre sollte nach dem ursprünglichen Plan des Verfassers einer ausführlichen Entwicklung der Gedanken gewidmet sein, die im Artikel Womit beginnen? (Iskra Nr.4, Mai 1901) enthalten sind. Und wir müssen den Leser vor allem um Entschuldigung bitten, daß das dort gegebene (und in Beantwortung vieler privater Anfragen und Briefe wiederholte) Versprechen so spät eingelöst wird. Eine der Ursachen dieser Verspätung war der im Juni vergangenen Jahres (1901) unternommene Versuch zur Vereinigung aller sozialdemokratischen Auslandsorganisationen. Es war ganz natürlich, das Ergebnis dieses Versuchs abzuwarten, denn wäre er gelungen, so hätte man vielleicht die organisatorischen Ansichten der Iskra von einem etwas andern Gesichtspunkt aus darlegen müssen, und ein solches Gelingen hätte jedenfalls dem Bestehen zweier Strömungen in der russischen Sozialdemokratie sehr rasch ein Ende bereiten können. Wie dem Leser bekannt, endete der Versuch mit einem Mißerfolg und konnte auch, wie wir weiter unten nachweisen wollen, nicht anders enden, nachdem das Rabotscheje Delo in Nr.10 eine neue Schwenkung zum „Ökonomismus“ gemacht hatte. Es erwies sich als unbedingt notwendig, gegen diese verschwommene und wenig bestimmte, dafür aber um so zähere Richtung, die die Fähigkeit besitzt, in verschiedenartigen Formen wiederaufzuerstehen, einen entschiedenen Kampf aufzunehmen. Dementsprechend ist der ursprüngliche Plan der Broschüre abgeändert und ganz beträchtlich erweitert worden.
Ihr Hauptthema sollten die drei Fragen sein, die im Artikel Womit beginnen? aufgeworfen worden sind. Und zwar: die Fragen nach dem Charakter und dem Hauptinhalt unserer politischen Agitation, nach unseren organisatorischen Aufgaben, nach dem Plan für den gleichzeitig und von verschiedenen Seiten in Angriff zu nehmenden Aufbau einer kampffähigen gesamtrussischen Organisation. Bereits seit langem interessieren diese Fragen den Verfasser, der es schon einmal unternommen hatte, sie in der Rabotschaja Gaseta bei einem mißlungenen Versuch zur Wiederherausgabe dieser Zeitung aufzuwerfen (siehe Kapitel V). Aber unsere ursprüngliche Absicht, uns in der Broschüre auf eine Analyse allein dieser drei Fragen zu beschränken und unsere Anschauungen nach Möglichkeit in positiver Form darzulegen, ohne oder fast ohne polemisch zu werden, erwies sich aus zwei Gründen als völlig undurchführbar. Einerseits stellte es sich heraus, daß der „Ökonomismus“ viel zählebiger ist, als wie angenommen hatten (wie gebrauchen das Wort „Ökonomismus“ im weiten Sinne, wie es in Nr.12 der Iskra [Dezember 1901] im Artikel Eine Auseinandersetzung mit Verteidigern des Ökonomismus erläutert worden ist, wo sozusagen ein Konspekt der dem Leser hier vorgelegten Broschüre entworfen wurde ). Es wurde klar, daß die verschiedenen Ansichten über die Losung dieser drei Fragen in weitaus höherem Maße aus dein grundlegenden Gegensatz zwischen den beiden Richtungen in der russischen Sozialdemokratie zu erklären sind als aus Meinungsverschiedenheiten in Einzelfragen. Anderseits hat das Unverständnis, das die „Ökonomisten“ angesichts der tatsächlichen Anwendung unserer Anschauungen in der Iskra an den Tag legen, klar gezeigt, daß wie oft buchstäblich verschiedene Sprachen sprechen, daß wie uns folglich nicht verständigen können, wenn wie nicht ab ovo beginnen, und daß es notwendig ist, den Versuch zu machen, eine möglichst populäre, durch sehr zahlreiche und konkrete Beispiele erläuterte, systematische „Auseinandersetzung“ mit allen „Ökonomisten“ über alle prinzipiellen Punkte unserer Meinungsverschiedenheiten herbeizuführen. Und so habe ich mich entschlossen, den Versuch einer solchen „Auseinandersetzung“ zu unternehmen, wobei ich mit vollkommen bewußt war, daß dies den Umfang der Broschüre stark erweitern und ihr Erscheinen verzögern wird, doch sah ich zugleich keine andere Möglichkeit, mein im Artikel Womit beginnen? gegebenes Versprechen einzulösen. Der Entschuldigung wegen der Verspätung muß ich also noch die Entschuldigung wegen der riesigen Mängel in der literarischen Bearbeitung der Broschüre hinzufügen: ich mußte in größter Hast arbeiten und wurde überdies durch alle möglichen anderen Arbeiten aufgehalten.
Die Analyse der drei obengenannten Fragen stellt nach wie vor das Hauptthema der Broschüre dar, doch mußte ich mit zwei allgemeineren Fragen beginnen: Warum ist eine so „harmlose“ und „natürliche“ Losung wie „Freiheit der Kritik“ für uns ein wahres Kampfsignal? Warum können wie uns nicht einmal über die Grundfrage, die Rolle der Sozialdemokratie hinsichtlich der spontanen Massenbewegung, verständigen? Ferner verwandelte sich die Darlegung der Auffassungen vom Charakter und Inhalt der politischen Agitation in eine Erläuterung des Unterschieds zwischen trade-unionistischer und sozialdemokratischer Politik und die Darlegung der Auffassungen von den organisatorischen Aufgaben in eine Erläuterung des Unterschieds zwischen der die „Ökonomisten“ befriedigenden Handwerklerei und der, unseres Erachtens, notwendigen Organisation der Revolutionäre. Ferner bestehe ich um so mehr auf dem „Plan“ einer gesamtrussischen politischen Zeitung, als die gegen diesen Plan erhobenen Einwände völlig unhaltbar waren und man mit auf die im Artikel Womit beginnen? gestellte Frage, wie wir den Aufbau der für uns notwendigen Organisation gleichzeitig von allen Seiten in Angriff nehmen könnten, Antworten gab, die am Wesen der Sache vorbeigehen. Endlich hoffe ich im Schlußteil der Broschüre nachzuweisen, daß wir alles, was von uns abhing, getan haben, um den entschiedenen Bruch mit den „Ökonomisten“ zu vermeiden, der sich jedoch als unvermeidlich erwiesen hat; daß das Rabotscheje Delo eine besondere, wenn man will „historische“, Bedeutung dadurch erlangt hat, daß es am vollkommensten, am prägnantesten nicht den konsequenten „Ökonomismus“, sondern jene Zerfahrenheit und jene Schwankungen zum Ausdruck gebracht hat, die zum Merkmal einer ganzen Periode in der Geschichte der russischen Sozialdemokratie geworden sind; daß darum auch die auf den ersten Blick allzu eingehende Polemik gegen das Rabotscheje Delo Bedeutung gewinnt, denn wie können nicht vorwärtsschreiten, wenn wie diese Periode nicht endgültig liquidieren.
I - Dogmatismus und „Freiheit der Kritik“
a) Was heißt „Freiheit der Kritik“?
„Freiheit der Kritik“ ist heutzutage entschieden das modernste Schlagwort, das in den Diskussionen zwischen den Sozialisten und den Demokraten aller Länder am häufigsten gebraucht wird. Auf den ersten Blick kann man sich kaum etwas Seltsameres vorstellen als diese feierlichen Berufungen einer der streitenden Parteien auf die Freiheit der Kritik. Sind denn wirklich aus der Mitte der fortschrittlichen Parteien Stimmen gegen das verfassungsmäßige Gesetz der meisten europäischen Länder laut geworden, das die Freiheit der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Forschung garantiert? „Da stimmt etwas nicht!“ – muß sich jeder Unbeteiligte sagen, der an allen Ecken und Enden das Modeschlagwort hört, aber in das Wesen der Meinungsverschiedenheiten zwischen den Streitenden noch nicht eingedrungen ist. „Dieses Schlagwort gehört offenbar zu jenen konventionellen Wörtchen, die sich wie Spitznamen durch den Gebrauch einbürgern und fast zu Gattungsnamen werden.“
In der Tat, es ist für niemand ein Geheimnis, daß in der heutigen internationalen Sozialdemokratie zwei Richtungen entstanden sind, zwischen denen der Kampf bald entbrennt und in hellen Flammen auflodert, bald erlischt und unter der Asche eindrucksvoller „Waffenstillstands-Resolutionen“ weiterglimmt. Worin die „neue“ Richtung besteht, die dem „alten, dogmatischen“ Marxismus „kritisch“ gegenübersteht, das hat mit genügender Klarheit Bernstein gesagt und Millerand gezeigt.
Die Sozialdemokratie soll aus einer Partei der sozialen Revolution zu einer demokratischen Partei der sozialen Reformen werden. Diese politische Forderung hat Bernstein mit einer ganzen Batterie ziemlich gut aufeinander abgestimmter „neuer“ Argumente und Betrachtungen umgeben. Geleugnet wurde die Möglichkeit, den Sozialismus wissenschaftlich zu begründen und vom Standpunkt der materialistischen Geschichtsauffassung seine Notwendigkeit und Unvermeidlichkeit zu beweisen; geleugnet wurde die zunehmende Verelendung, die Proletarisierung und die Zuspitzung der kapitalistischen Widersprüche; der Begriff „Endziel„ selbst wurde für unhaltbar erklärt und die Idee der Diktatur des Proletariats völlig verworfen; geleugnet wurde der prinzipielle Gegensatz von Liberalismus und Sozialismus; geleugnet wurde die Theorie des Klassenkampfes, die auf eine streng demokratische, nach dem Willen der Mehrheit regierte Gesellschaft angeblich unanwendbar sei, usw.
Somit wurde die Forderung nach einer entschiedenen Schwenkung von der revolutionären Sozialdemokratie zum bürgerlichen Sozialreformismus von einer nicht minder entschiedenen Schwenkung zur bürgerlichen Kritik an allen Grundideen des Marxismus begleitet. Da aber diese Kritik am Marxismus schon seit langem sowohl von der politischen Tribüne wie vom Katheder der Universität, sowohl in einer Unmenge von Broschüren wie, in einer Reihe gelehrter Abhandlungen betrieben wurde, da die ganze heranwachsende Jugend der gebildeten Klassen jahrzehntelang systematisch im Geiste dieser Kritik erzogen wurde, ist es nicht verwunderlich, daß die „neue kritische“ Richtung in der Sozialdemokratie mit einem Schlag als etwas völlig Fertiges hervortrat, so wie Minerva dem Haupte Jupiters entstieg. Ihrem Inhalt nach brauchte sich diese Richtung nicht zu entwickeln und herauszubilden: sie wurde direkt aus der bürgerlichen Literatur in die sozialistische übertragen.
Weiter. Wenn die theoretische Kritik Bernsteins und seine politischen Aspirationen noch für irgend jemand unklar geblieben waren, so sorgten die Franzosen für eine anschauliche Demonstration der „neuen Methode“. Frankreich erwies sich auch diesmal, getreu seinem alten Ruf, als „das Land, wo die geschichtlichen Klassenkämpfe mehr als anderswo jedesmal bis zur Entscheidung durchgefochten wurden“ (Engels in der Vorrede zu Marx’ Schrift Der achtzehnte Brumaire). Die französischen Sozialisten theoretisierten nicht, sondern handelten einfach; die in demokratischer Hinsicht höher entwickelten politischen Verhältnisse Frankreichs gestatteten ihnen, sofort zum „praktischen Bernsteinianertum“ mit allen seinen Konsequenzen überzugehen. Millerand hat ein ausgezeichnetes Beispiel dieses praktischen Bernsteinianertums geliefert – nicht umsonst waren sowohl Bernstein als auch Vollmar sofort dabei, Millerand so eifrig zu verteidigen und ihm Lob zu spenden! In der Tat: Wenn die Sozialdemokratie im Grunde genommen einfach eine Reformpartei ist und den Mut haben muß, dies offen zu bekennen, dann hat ein Sozialist nicht nur das Recht, sondern muß sogar stets danach streben, in ein bürgerliches Kabinett einzutreten. Wenn die Demokratie im Grunde genommen die Aufhebung der Klassenherrschaft bedeutet, warum sollte dann ein sozialistischer Minister nicht die ganze bürgerliche Welt mit Reden über Zusammenarbeit der Klassen entzücken? Warum sollte er nicht selbst dann noch in der Regierung bleiben, wenn die Niedermetzelung von Arbeitern durch Gendarmen zum hundertsten und tausendsten Male den wahren Charakter der demokratischen Klassenzusammenarbeit offenbart hat? Warum sollte er nicht persönlich an der Begrüßung des Zaren teilnehmen, den die französischen Sozialisten jetzt nur noch den Helden des Galgens, der Knute und der Verbannung (knouteur, pendeur et déportateur) nennen? Und als Entgelt für diese unsagbare Erniedrigung und Selbstbespeiung des Sozialismus vor der ganzen Welt, für die Korrumpierung des sozialistischen Bewußtseins der Arbeitermassen – das die einzige Grundlage ist, die uns den Sieg verbürgen kann –, als Entgelt dafür groß aufgemachte Projekte armseliger Reformen, armseliger noch als das, was unter bürgerlichen Regierungen schon errungen werden konnte!
Wer nicht absichtlich die Augen verschließt, der muß sehen, daß die neue „kritische“ Richtung im Sozialismus nichts anderes ist als eine neue Spielart des Opportunismus. Beurteilt man die Menschen nicht nach der glänzenden Uniform, die sie sich selber angelegt, nicht nach dem effektvollen Namen, den sie sich selber beigelegt haben, sondern danach, wie sie handeln und was sie in Wirklichkeit propagieren, so wird es klar, daß die „Freiheit der Kritik“ die Freiheit der opportunistischen Richtung in der Sozialdemokratie ist, die Freiheit, die Sozialdemokratie in eine demokratische Reformpartei zu verwandeln, die Freiheit, bürgerliche Ideen und bürgerliche Elemente in den Sozialismus hineinzutragen.
Freiheit ist ein großes Wort, aber unter dem Banner der Freiheit der Industrie wurden die räuberischsten Kriege geführt, unter dem Banner der Freiheit der Arbeit wurden die Werktätigen ausgeplündert. Dieselbe innere Verlogenheit steckt im heutigen Gebrauch des Wortes „Freiheit der Kritik“. Leute, die tatsächlich davon überzeugt sind, daß sie die Wissenschaft vorwärtsgebracht haben, würden nicht Freiheit für die neuen Auffassungen neben den alten fordern, sondern eine Ersetzung der alten durch die neuen. Das jetzt laut gewordene Geschrei „Es lebe die Freiheit der Kritik !“ erinnert allzusehr an die Fabel vom leeren Faß.
Wir schreiten als eng geschlossenes Häuflein, uns fest an den Händen haltend, auf steilem und mühevollem Wege dahin. Wir sind von allen Seiten von Feinden umgeben und müssen fast stets unter ihrem Feuer marschieren. Wir haben uns, nach frei gefaßtem Beschluß, eben zu dem Zweck zusammengetan, um gegen die Feinde zu kämpfen und nicht in den benachbarten Sumpf zu geraten, dessen Bewohner uns von Anfang an dafür schalten, daß wir uns zu einer besonderen Gruppe vereinigt und den Weg des Kampfes und nicht den der Versöhnung gewählt haben. Und nun beginnen einige von uns zu ruf en: Gehen wir in diesen Sumpf! Will man ihnen ins Gewissen reden, so erwidern sie: Was seid ihr doch für rückständige Leute! und ihr schämt euch nicht, uns das freie Recht abzusprechen, euch auf einen besseren Weg zu rufen! – O ja, meine Herren, ihr habt die Freiheit, nicht nun zu rufen, sondern auch zu gehen, wohin ihr wollt, selbst in den Sumpf; wir sind sogar der Meinung, daß euer wahrer Platz gerade im Sumpf ist, und wir sind bereit, euch nach Kräften bei eurer Übersiedlung dorthin zu helfen. Aber laßt unsere Hände los, klammert euch nicht an uns und besudelt nicht das große Wort Freiheit, denn wir haben ja ebenfalls die „Freiheit“, zu gehen, wohin wir wollen, die Freiheit, nicht nur gegen den Sumpf zu kämpfen, sondern auch gegen diejenigen, die sich dem Sumpfe zuwenden!
b) Die neuen Verteidiger der „Freiheit der Kritik“
Eben diese Losung („Freiheit der Kritik“) wird in letzter Zeit vorn Rabotscheje Delo (Nr.10), dem Organ des „Auslandsbundes russischer Sozialdemokraten“ feierlich verkündet, und zwar nicht als theoretisches Postulat, sondern als politische Forderung, als Antwort auf die Frage: „Ist die Vereinigung der im Ausland wirkenden sozialdemokratischen Organisationen möglich?“ – „Für eine dauerhafte Vereinigung ist Freiheit der Kritik notwendig“ (S.36).
Aus dieser Erklärung ergeben sich zwei ganz bestimmte Schlußfolgerungen: 1. Das Rabotscheje Delo verteidigt die opportunistische Richtung in der internationalen Sozialdemokratie überhaupt; 2. das Rabotscheje Delo fordert die Freiheit des Opportunismus in der russischen Sozialdemokratie. Prüfen wir diese Schlußfolgerungen.
Dem Rabotscheje Delo mißfällt „insbesondere“ „die Neigung der Iskra und der Sarja, einen Bruch zwischen dem Berg und der Gironde in der internationalen Sozialdemokratie zu prophezeien“.
„Überhaupt scheinst uns“, schreibt B. Kritschewski, der Redakteur des Rabotscheje Delo, „das Gerede vom Berg und von der Gironde in den Reihen der Sozialdemokratie eine oberflächliche historische Analogie zu sein, die sich bei einem Marxisten sehr merkwürdig ausnimmt: der Berg und die Gironde repräsentierten nicht verschiedene Temperamente oder geistige Strömungen, wie es den ideologischen Geschichtsschreibern scheinen mag, sondern verschiedene Klassen oder Schichten – die mittlere Bourgeoisie auf der einen und das Kleinbürgertum mit dem Proletariat auf der andern Seite. In der modernen sozialistischen Bewegung gibt es aber keinen Konflikt der Klasseninteressen, sie steht restlos in allen„ (hervorgehoben von B. Kr.) „ihren Spielarten, die ausgemachtesten Bernsteinianer mit inbegriffen, auf dem Boden der Klasseninteressen des Proletariats, seines Klassenkampfes für die politische und wirtschaftliche Befreiung.“ (S.32/33.)
Eine kühne Behauptung! Hat B. Kritschewski nichts von der längst festgestellten Tatsache gehört, daß gerade die starke Beteiligung der Schicht der „Akademiker“ an der sozialistischen Bewegung der letzten Jahre dem Bernsteinianertum eine so rasche Verbreitung gesichert hat? Und von allem – worauf gründet unser Verfassen seine Meinung, daß auch „die ausgemachtesten Bernsteinianer“ auf dem Boden des Klassenkampfes für die politische und wirtschaftliche Befreiung des Proletariats stehen? Das bleibt unbekannt. Diese entschiedene Verteidigung der ausgemachtesten Bersteinianer wird durch kein einziges Argument, keine einzige Erwägung gestützt. Der Verfasser glaubt anscheinend, daß seine Behauptung keiner Beweise bedürfe, wenn en das wiederholt, was die ausgemachtesten Bernsteinianer von sich selber sagen. Aber kann man sich etwas „Oberflächlicheres“ denken als dieses Urteil über eine ganze Richtung, das sich darauf gründet, was die Vertreter dieser Richtung von sich selber sagen? Kann man sich etwas Oberflächlicheres denken als die danach folgende „Moral“ von den zwei verschiedenen und sogar diametral entgegengesetzten Typen oder Wegen der Parteientwicklung (Rabotscheje Delo, S.34/35)? Die deutschen Sozialdemokraten, heißt es, erkennen die volle Freiheit der Kritik an, die Franzosen aber nicht, und gerade ihr Beispiel zeige die ganze „Schädlichkeit der Intoleranz“.
Gerade das Beispiel B. Kritschewskis, antworten wir darauf, zeigt, daß sich manchmal Leute Marxisten nennen, die die Geschichte buchstäblich „nach Ilowaiski“ auffassen. Um die Einheitlichkeit der deutschen und die Zersplitterung der französischen sozialistischen Partei zu erklären, brauche man gar nicht die Besonderheiten der Geschichte des einen und des anderen Landes zu erforschen, die Verhältnisse des militärischen Halbabsolutismus und des republikanischen Parlamentarismus einander gegenüberzustellen, die Folgen der Kommune und des Ausnahmegesetzes gegen die Sozialisten zu analysieren, das wirtschaftliche Leben und die wirtschaftliche Entwicklung zu vergleichen, sieh von Augen zu halten, wie „das beispiellose Anwachsen der deutschen Sozialdemokratie“ begleitet war von einer in der Geschichte des Sozialismus einzig dastehenden Energie im Kampf nicht nun gegen die theoretischen Verirrungen (Mülberger, Dühring , die Kathedersozialisten), sondern auch gegen die taktischen (Lassalle) usw. usf. All das sei überflüssig! Die Franzosen zanken sich, weil sie intolerant, die Deutschen sind einig, weil sie artige Knaben sind.