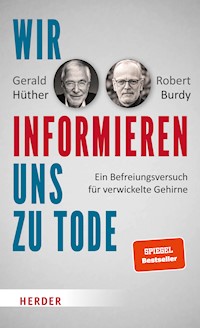Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lagato Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kreativität und Begeisterung statt Leistungsdruck und Stress - wie wir es schaffen, das zu entfalten, was in uns steckt Ob im Umgang mit Kindern, mit Kollegen und Mitarbeitern, mit alten Menschen -- und mit uns selbst: Wir sind es gewohnt, alles als Ressource anzusehen. Kein Wunder, dass 'Burn-Out' die Krankheit unserer Zeit ist, dass wir uns vor Krisen nicht retten können. Denn auch eine Gesellschaft kann kollektiv ihre Begeisterungsfähigkeit verlieren, dann dümpelt man in Routine dahin, man funktioniert, aber man lebt nicht mehr. Der bekannte Gehirnforscher und erfolgreiche Autor Gerald Hüther plädiert für ein radikales Umdenken: Er fordert den Wechsel von einer Gesellschaft der Ressourcennutzung zu einer Gesellschaft der Potentialentfaltung, mit mehr Raum und Zeit für das Wesentliche. In seiner großartigen, ganz konkreten Darstellung zeigt er aus neurobiologischer Sicht, wie es uns gelingen kann, aus dem, was wir sind, zu dem zu werden, was wir sein können.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerald Hüther
Was wir sind und was wir sein könnten
Ein neurobiologischer Mutmacher
Sachbuch
Über dieses Buch
Vor nicht allzu langer Zeit erst hat die Hirnforschung eine Entdeckung gemacht, die unser gegenwärtiges Bild von uns selbst zutiefst erschüttert: Unser Gehirn wird nicht so, wie es unsere genetischen Anlagen vorschreiben. Es lässt sich auch nicht wie ein Muskel trainieren. Es ist viel einfacher. Unser Gehirn wird von ganz allein so, wie und wofür wir es mit Begeisterung benutzen. Dass sich Menschen für alles Mögliche begeistern können, haben sie zu allen Zeiten immer wieder bewiesen, oft genug mit fragwürdigen Folgen. Menschen können aber auch ihre Begeisterungsfähigkeit verlieren, sogar kollektiv. Dann funktioniert ihr Hirn zwar noch, aber es entwickelt sich nicht mehr weiter. Statt Potenzialentfalter, die sie sein könnten, bleiben solche Menschen dann nur Ressourcennutzer und Besitzstandwahrer. Immer neue Krisen, Burn-out, Depressionen und Demenzen werden dann zu Symptomen einer festgefahrenen Kultur.
Gerald Hüther plädiert deshalb für einen Wechsel von einer Gesellschaft der Ressourcenausnutzung und Besitzstandwahrung zu einer Gesellschaft der Potentialentfaltung. Aus der Sicht des Neurobiologen zeigt er eindrucksvoll, wie es uns gelingen kann, aus dem, was wir sind, zu dem zu werden, was wir sein können.
Homepage des Autoren: www.gerald-huether.de
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Dr. rer. nat. Dr. med. habil. Gerald Hüther, geb. 1951, ist Professor für Neurobiologie an der Psychiatrischen Klinik der Universität Göttingen. Zuvor, am Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin, hat er sich mit Hirnentwicklungsstörungen beschäftigt; als Heisenbergstipendiat hat er ein Labor für neurobiologische Grundlagenforschung aufgebaut. Gerald Hüther ist Präsident der Sinn-Stiftung (www.sinn-stiftung.eu) und Autor zahlreicher Bestseller, darunter ›Die Evolution der Liebe‹, ›Männer: Das schwache Geschlecht und sein Gehirn‹, ›Raus aus der Demenzfalle!‹ und zuletzt ›Würde‹.
Inhalt
Was wir sind und was wir sein könnten
Einstieg
1. Wer ist »Wir«?
Blut ist nicht dicker als Tinte
Not schweißt nur zusammen
Angst wirkt noch stärker als Not
Verbundenheit entsteht jenseits von Angst und Not
Hinter’m Horizont geht’s weiter
2. Was sind wir?
Wir sind keine Tiere
Wir haben ein besonderes Gehirn
Wir machen besondere Erfahrungen
Wir haben besondere Bedürfnisse
Wir leben in besonderen Gemeinschaften
3. Wie sind wir so geworden, wie wir sind?
Der Preis des Dazugehörenwollens
Die Mechanismen der Anpassung
Die Anpassungsfalle
4. Was haben wir uns alles eingeredet?
Wir konstruieren unsere eigene Wirklichkeit
Unsere Vorstellungen sind wie Ketten
Unsere Erfahrungen bestimmen unsere Bewertungen
Irren ist menschlich
Wir sind keine Maschinen
Wir sind auch keine Wettkämpfer
Das Ende der Ideologien
5. Was haben wir aus uns gemacht?
Begeisterung ist Dünger fürs Hirn
Wofür wir uns aus uns selbst heraus begeistern
Von wem wir uns begeistern lassen
Fragwürdige Vorbilder
Bedauernswerte Eselstreiber
Clevere Rattenfänger
Wie wir unsere Begeisterungsfähigkeit verlieren
6. Was könnte aus uns werden?
Statt Mauern und Gräben könnten wir auch Brücken bauen
Statt uns vom Leben formen zu lassen, könnten wir auch zu Gestaltern unseres Lebens werden
Statt so weiterzumachen wie bisher, könnten wir auch versuchen, über uns hinauszuwachsen
Statt Ressourcenausnutzer zu bleiben, könnten wir auch Potentialentfalter werden
Potentialentfaltung im individuellen Lebenslauf
Potentialentfaltung in menschlichen Gemeinschaften
Ausstieg
Was wir sind und was wir sein könnten
Einstieg
Manchmal kann ich richtig spüren, wie gern ich lebe, und dann fange ich an zu staunen. Es gibt so vieles, worüber man nur ehrfürchtig innehalten und sich nicht genug wundern kann. Es ist ein Wunder, dass unser blauer Planet als lebendige Insel in der unvorstellbaren Weite des Weltalls überhaupt entstehen konnte. Die ungeheure Vielfalt der Lebensformen, die die Evolution des Lebendigen auf unserer Erde hervorgebracht hat, ist genauso unfassbar. Und über uns selbst und über das, was in so relativ kurzer Zeit aus uns geworden ist, kann man sich auch nur wundern. Kaum einhunderttausend Jahre ist es her, als sich die ersten Vertreter unserer Spezies auf den Weg gemacht haben. Inzwischen sind wir überall auf der Erde unterwegs, wir sind sogar auf dem Mond gewesen. Und dabei entdecken und gestalten wir nicht nur unsere äußere Welt. Wir fangen auch an, uns selbst immer besser zu verstehen. Unser Leben ist ein Erkenntnisprozess. Inzwischen sind wir erstaunlich weit vorangekommen auf diesem Weg der Erkenntnis. Niemand weiß, wohin er uns führen wird. Aber wenn wir aufhörten, ihn weiter zu gehen, wenn wir irgendwann aufhörten, Suchende zu sein, weil wir meinen, alles zu wissen und alles verstanden zu haben, dann hätten wir das größte Wunder verloren, das wir alle mit auf die Welt gebracht haben: unsere Entdeckerfreude.
Zum Glück brauchen wir unsere Entdeckungsreise durch das Leben nicht immer wieder ganz von vorn zu beginnen. Sie beginnt auch nicht irgendwo, sondern genau in der Welt, die uns vorangegangene Generationen als Ergebnis ihrer Versuche hinterlassen haben, eine Welt zu schaffen, in der es keine Probleme mehr gibt und alles besser werden sollte. Nicht alles, was sie uns dabei vererbt haben, ist heutzutage noch hilfreich. Auf manches könnten wir gern verzichten, und viele dieser Hinterlassenschaften bereiten uns heute weitaus größere Probleme, als das unsere Vorfahren damals absehen konnten oder wollten. Aber was wäre das für ein Leben, wenn alles schon so wäre, wie wir es uns wünschen? Dann gäbe es morgen keine Überraschungen und übermorgen keine Enttäuschungen mehr. Dann brauchten wir selbst nichts mehr zu tun und es gäbe für uns nichts mehr, um das wir uns noch kümmern könnten. Dann hätten wir das andere große Wunder verloren, das wir alle mit auf die Welt gebracht haben: unsere Gestaltungslust.
Glücklicherweise sind unsere Probleme immer noch groß genug, und verstanden haben wir noch längst nicht alles. Deshalb sind wir auch noch immer entdeckend und gestaltend unterwegs. Genauso wie alle lernfähigen Tiere. Allerdings mit einem entscheidenden Unterschied: Wir haben ein größeres Gehirn, mit dem wir uns mehr merken können. Aber was noch wichtiger ist: Wir können unsere Erfahrungen, unser Wissen und all die vielen zum Teil so schmerzvoll erworbenen Erkenntnisse darüber, worauf es im Leben ankommt, an andere Menschen, vor allem an unsere Kinder weitergeben. Von Generation zu Generation haben Menschen so ihr Wissen und Können, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten überliefert. Auch wenn dabei immer wieder vieles von diesem gemeinsam generierten und überlieferten Wissensschatz verloren gegangen ist, so hat sich dieser Schatz doch ständig erweitert. Noch nie haben Menschen so viel gewusst und so viel vermocht wie wir heute.
Je erfolgreicher wir aber unsere Welt mit all diesem Wissen nach unseren Vorstellungen verändern, desto unausweichlicher werden auch wir selbst, wird auch unsere eigene Entwicklung von diesem Veränderungsprozess erfasst. Nie zuvor in der Menschheitsgeschichte sind in so kurzer Zeit solch dramatische und globale Umwälzungen der bisherigen Lebensbedingungen ausgelöst worden wie gegenwärtig von uns. Zwangsläufig werden nun auch wir selbst uns auf eine bisher nie dagewesene Weise verändern. Das macht ein bisschen Angst, denn wir wissen ja nicht, was dabei aus uns wird.
Dass mehr in jedem einzelnen Menschen steckt als das, was bisher aus ihm, also auch aus Ihnen oder mir, geworden ist, haben wir wohl schon immer geahnt. Sie brauchen sich ja nur kurz vorzustellen, Sie wären als kleiner Inuit am Polarkreis oder als Amazonasindianerin im tropischen Regenwald aufgewachsen. Oder meinetwegen auch hier bei uns als Kind einer arbeitslosen, alleinerziehenden Mutter oder einer wohlsituierten Akademikerfamilie. Vielleicht auch bei Eltern, die gar kein Deutsch können, womöglich sogar weder Lesen noch Schreiben gelernt haben. Überall wäre aus Ihnen oder mir etwas geworden. Aber jedes Mal eben etwas anderes. Je nachdem, in welchem Kulturkreis und unter welchen Bedingungen wir aufgewachsen wären, hätten wir ganz bestimmte der in uns angelegten Möglichkeiten besser entfalten können als andere.
Und wir hätten dann auch ein anderes Gehirn bekommen. Je nachdem, ob wir in eine komplexere oder eine weniger komplexe Lebenswelt hineingewachsen wären, und in Abhängigkeit davon, wie gut oder weniger gut wir es geschafft hätten, uns in dieser Welt zurechtzufinden, diese Welt zu verstehen und uns selbst als Gestalter dieser Welt zu erfahren, wären auch mehr oder weniger komplexe neuronale und synaptische Verschaltungsmuster in unserem Gehirn stabilisiert worden.
Genau das ist ja die wesentliche Erkenntnis, die die Hirnforscher in den letzten Jahren zutage gefördert haben: Unser Gehirn wird so, wie und wofür wir es besonders gern und deshalb auch besonders intensiv benutzen. Es muss also auf uns selbst zurückwirken, wenn wir unsere eigene Lebenswelt und damit auch die Lebenswelt unserer Kinder immer stärker verändern. Und wenn die Hirnforscher recht haben, müssen wir davon ausgehen, dass sich solche Veränderungen entweder günstiger oder auch ungünstiger auf die Entfaltung der in uns und in unseren Kindern angelegten Potentiale auswirken und zur Herausformung komplexer oder weniger komplex vernetzter Gehirne führen.
»Der Übergang vom Affen zum Menschen, das sind wir«, hatte uns Konrad Lorenz ja schon vor einigen Jahrzehnten ins Stammbuch geschrieben. Er hat nicht gesagt, wie weit wir auf diesem Weg zu dem, was wir werden könnten, bereits vorangekommen sind. Und wenn man nach wissenschaftlichen Befunden sucht, die uns Auskunft darüber geben, wie es in uns, vor allem in unseren Gehirnen aussieht und wie es künftig mit uns weitergehen wird, so findet man leider nur sehr wenig, was darauf hindeutet, dass wir diesen Übergang aus eigener Kraft schaffen könnten. Einen freien Willen haben wir nicht, unsere aus der Steinzeit mitgebrachten Verhaltensweisen lassen sich auch nicht unterdrücken, unser Unbewusstes treibt uns vor sich her, und unser Ich hat keine Ahnung davon, wer es ist, geschweige denn wie viele. Hormone steuern unsere Gefühle, und die vernebeln uns den Verstand. Das Einzige, was sich mit hoher statistischer Sicherheit voraussagen lässt, ist, dass wir im Durchschnitt, je älter wir werden, auch umso häufiger depressiv oder dement werden. Na prima. Angesichts dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse bleibt einem ja auch gar nichts anderes übrig.
Glücklicherweise gibt es aber auch noch andere wissenschaftliche Befunde. Die weisen in eine ganz andere Richtung. Von denen hört man aber nicht so oft in den Medien. Die lassen sich nicht gut vermarkten, denn sie beschreiben nicht, was an uns alles so schrecklich ist und weshalb so viele von uns so oft im Leben scheitern. Sie erzählen eher viele kleine Beispiele, die es überall in unserem Land gibt, die nicht nur zeigen, dass es möglich ist, sondern auch wie es gelingen kann, unsere eigene Lebenswelt und damit auch die unserer Kinder so zu gestalten, dass es in Zukunft immer etwas besser möglich wird, das wunderbare menschliche Potential zur Entfaltung zu bringen, das in uns allen angelegt, in jedem von uns verborgen ist.
Gern lade ich Sie in diesem Buch ein, gemeinsam mit mir herauszufinden, wie das auch bei Ihnen zu Hause, in der Schule Ihrer Kinder, in Ihrem Wohngebiet oder in Ihrer Firma gehen kann. Wonach wir dabei suchen müssten, ist nicht das Geheimnis des Erfolgs. Um in unserer gegenwärtigen Welt erfolgreich zu sein, braucht man weder seine menschlichen Potentiale zu entfalten, noch muss man beim Übergang vom Affen zum Menschen besonders weit vorangekommen sein. Falls Sie bis eben noch gehofft hatten, in diesem Buch Hinweise zu finden, wie Sie die Erkenntnisse der Neurobiologie nutzen können, um Ihr Leben, Ihre Beziehungen zu anderen Menschen, die Erziehung Ihrer Kinder oder Ihre berufliche Entwicklung in Zukunft noch erfolgreicher zu gestalten als bisher, dann schlagen Sie es jetzt lieber wieder zu. Stellen Sie es einfach in eine sehr entlegene Ecke Ihres Bücherregals. Vielleicht holen Sie es später noch einmal hervor, wenn Sie bemerkt haben, wie leicht man auf der ständigen Suche nach Erfolg in seinem eigenen Leben genau das übersieht, was ein gelingendes Leben ausmacht: Man kann es nicht »machen«, und es geht nicht allein.
Wonach wir also in diesem Buch suchen wollen, ist nicht das Geheimnis des Erfolgs, sondern das Geheimnis des Gelingens. Das Besondere an diesem Geheimnis des Gelingens besteht darin, dass man es nicht beschreiben oder erklären kann. Es muss sich, so altmodisch es klingt, offenbaren. Das heißt, dass es immer und überall da ist und wirksam wird, unabhängig von uns und unserem Zutun. Wenn es nicht so wäre, gäbe es weder unseren wundervollen Planeten noch das Leben in all seiner Vielfalt und Fülle, so wie es sich auf unserer Erde entwickelt hat. Und uns selbst mit unserem zeitlebens erkenntnisfähigen Gehirn gäbe es dann auch nicht. Das Geheimnis des Gelingens wirkt also unabhängig davon, ob wir es erkennen oder gar verstehen. Und wir können es auch nicht erzwingen, dass etwas gelingt. Deshalb ist es so ziemlich die verrückteste Idee, auf die man überhaupt kommen kann, ein Buch über etwas zu schreiben, was sich gar nicht beschreiben lässt, was sich nur mit etwas Glück – oder, um auch hier wieder ein altmodisches, aber passendes Wort zu gebrauchen, mit Gnade – dem offenbart, der offen dafür ist, es zu erspüren.
Das kann freilich nur dann gelingen, wenn wir nicht gleich nach Antworten und fertigen Rezepten suchen. Vielleicht müssten wir uns Fragen stellen. Und das müssten Fragen sein, die uns selbst dazu bewegen, durch eigenes Nachdenken und aufgrund unserer eigenen Erfahrungen nach Antworten zu suchen. Wir müssten zudem versuchen, uns dabei nicht von unseren bisherigen Vorstellungen, sondern lieber von unserer Vorstellungskraft leiten zu lassen. Und wir sollten uns schließlich an jeder Stelle unserer Entdeckungsreise kritisch fragen, ob die Antworten, die wir gefunden haben, nicht nur durch unsere eigenen Erfahrungen, sondern auch durch die aller anderen Menschen, die wir kennen und die uns nahestehen, bestätigt werden. Ich weiß nicht, ob es gelingt, aber ich lade Sie ein, es gemeinsam mit mir zu versuchen …
1.Wer ist »Wir«?
Wen meinen wir eigentlich, wenn wir »Wir« sagen? Und warum gehören zu diesem »Wir« manche dazu und andere nicht? Was zeichnet diejenigen aus, denen wir uns zugehörig fühlen? Was verbindet uns mit ihnen? Was trennt uns von den anderen? Könnte sich das auch verändern? Und wenn ja, wie? Und könnten es vielleicht auch immer mehr andere Menschen werden, die wir meinen, wenn wir »Wir« sagen?
Um der Frage nachgehen zu können, was wir sind und was wir sein könnten, brauchen wir eine Vorstellung davon, wen wir eigentlich meinen, wer dieses »Wir« ist, wer dazugehört und wer nicht. Wir müssen also eine Grenze finden, die definiert, wo unser tagtäglich so salopp dahergesagtes »Wir« beginnt und wo es aufhört.
Wenn wir »Ich« sagen, wissen wir meist recht gut, wen wir damit meinen, wo dieses »Ich« anfängt und wo es aufhört. Im Temporallappen unseres Gehirns gibt es eine Region mit sehr komplexen neuronalen Netzwerken, in denen all die vielen Eingänge verarbeitet werden, die von den Rezeptoren unserer Körperoberfläche zum Gehirn weitergeleitet werden. Deshalb wissen wir zu jedem Zeitpunkt normalerweise sehr genau, wo unser »Ich« zu Ende ist und die Welt außerhalb des eigenen Körpers beginnt. Wir wissen das auch dann, wenn es uns nicht bewusst ist. Die eigene Körpergrenze wird uns aber wieder sofort in Erinnerung gebracht und ins Bewusstsein gerufen, wenn wir mit diesem eigenen Körper irgendwo, z.B. mit dem Kopf an einen Balken angestoßen sind. »Ich Trottel«, sagen dann die meisten Erwachsenen still vor sich hin. Die kleinen Kinder sagen noch laut »blöder Balken«, weil ihre Vorstellung vom eigenen »Ich« und seinen Grenzen noch nicht so fest im Hirn einzementiert ist. Sie wachsen ja auch noch, so dass die Netzwerke zur Registrierung der eigenen Körpergrenzen im Temporallappen manchmal nicht so schnell hinterherkommen.
Im erwachsenen Zustand kann man diesen Lappen gelegentlich überlisten oder ausschalten, so dass man nicht mehr weiß, wo man zu Ende ist. Ausschalten ist einfacher. Dazu muss man nur eine Pille nehmen, die einen Wirkstoff enthält, beispielsweise einen Serotoninrezeptoragonisten, der diese Verarbeitungsprozesse im Temporallappen hemmt. Der hemmt zwar auch noch einiges andere im Hirn, aber manchmal hat man auf so einem LSD- oder Psilocybin-Trip offenbar ein Gefühl, als würde man nirgendwo aufhören und mit allem verbunden sein. Spezifischer und nebenwirkungsfreier lässt sich der Temporallappen hemmen, indem man sich in eine kosmische Verbundenheit hineinmeditiert. Dann nutzt man die Netzwerke ein Stockwerk höher, im Frontallappen, um sich selbst zu definieren. Und die sagen dann, wenn sie stark genug sind, dem Temporallappen, dass man eben nicht dort aufhört, wo er es meint. Dass muss man aber ziemlich lange üben. Das kann nicht jeder.
Was jeder heutzutage sehr gut kann, ist innerhalb seiner jeweiligen Körpergrenze zu bleiben, den Temporallappen also voll aktiv zu halten und sich dennoch dabei als jemand zu erleben, der mal dieser und mal jener sein kann, nach dem Motto »Wer bin ich und wenn ja, wie viele?«. Wie das hirntechnisch funktioniert, ist mir noch nicht ganz klar, aber es kann ja auch einfach nur eine Einbildung sein. Es gibt sogar Menschen, die sich einbilden, sie seien ganz jemand anders. Oder ihr Arm oder ihr Bein würde nicht zu ihnen gehören.
Wenn wir nach diesem kleinen Ausflug in die Unbestimmtheit des »Ichs« wieder zum Ausgang unserer Überlegungen zurückkehren, so stellt sich die Frage, ob und woher wir wissen, wen wir meinen, wenn wir »Wir« sagen. Wo das »Ich« aufhört, ist für jeden einigermaßen klar, der nicht unter Drogen steht oder gerade meditierend transpersonal unterwegs ist oder einen epileptischen Anfall im Temporallappen hat. Aber die andere Frage: »Wer sind wir und wenn ja, wie viele?«, ist jetzt wirklich eine aus neurowissenschaftlicher Perspektive sehr spannende und sehr berechtigte Frage.
Anders als beim »Ich« fangen wir erst an, uns zu begreifen. Wir haben uns weit voneinander entfernt und dabei manchmal vergessen, dass wir miteinander verbundene, voneinander abhängige und aneinander wachsende Einzelwesen sind. Jetzt finden wir allmählich unsere gemeinsamen Wurzeln wieder und beginnen ganz langsam zu verstehen, dass wir alle mit den gleichen Bedürfnissen, Hoffnungen und Ängsten unterwegs sind, alle Menschen, überall auf der Welt. Das ist neu. Das gab es so, in dieser globalen Weise, noch nie. Das ist der Aufbruch in ein neues Zeitalter. »Wieder einmal …« werden Sie vielleicht jetzt denken und dabei vor Augen haben, wie viele solcher Aufbrüche wir schon hinter uns haben. Aber möglicherweise hat das, was wir gegenwärtig erleben, eine andere Qualität.
Vielleicht dauert es tatsächlich gar nicht mehr so lange, bis sich kaum noch jemand daran erinnern kann, dass es einmal eine Zeit gab, in der die Menschen, wenn sie »wir« sagten, nicht alle Menschen meinten, die unseren Planeten bevölkern. Sind wir nicht längst schon mittendrin in diesem Prozess der Auflösung historisch gewachsener Grenzen zwischen menschlichen Gemeinschaften? Dann freilich würden wir gegenwärtig den wohl bedeutsamsten Bewusstwerdungsprozess erleben, den Menschen je durchlaufen haben. Er ist zwar schon seit Jahrhunderten an verschiedenen Stellen und auf verschiedenen Ebenen in Gang. Aber noch nie zuvor in einem solch globalen Ausmaß und mit einer solchen Beschleunigung. Diesmal hat auch niemand diesen Prozess des Zusammenwachsens, der Ausbildung dieses neuen Wir-Gefühls und dieses neuen Wir-Bewusstseins gemacht, angeordnet oder organisiert. Er läuft von ganz allein so ab. Man kann ihn wohl an manchen Stellen etwas beschleunigen oder verlangsamen. Aber aufzuhalten ist er nicht. Was hier passiert und was wir hier erleben, ist ein besonders anschauliches Beispiel für einen Selbstorganisationsprozess. Und der findet in unseren Köpfen statt. Weil wir neue Erfahrungen miteinander machen und weil diese neuen lebendigen Beziehungserfahrungen als neuronale und synaptische Beziehungsmuster in unseren Gehirnen verankert werden, bekommen wir auch entsprechend andere Gehirne. Damit können wir das »Wir« nicht nur anders denken, sondern auch anders fühlen.
Noch für unsere Urgroßeltern war es unvorstellbar, dass sich die Beziehungen allein zwischen den Völkern Europas irgendwann einmal so entwickeln würden, wie das inzwischen geschehen ist. Und noch weniger hätten sie sich vorstellen können, dass sich die Gehirne von Menschen dadurch verändern, dass sie anfangen, einander kennenzulernen, sich auszutauschen, voneinander zu lernen und miteinander Probleme zu lösen. Wenn sie damals »Wir« sagten, dann meinten sie zwar das Gleiche wie wir heute, nämlich dass man sich selbst als Teil einer Gemeinschaft versteht, zu der man sich bekennt, zu der man gern dazugehört, in der man einander so gut wie möglich hilft, Probleme zu lösen und Bedrohungen abzuwenden. Aber damals, zu unserer Urgroßeltern Zeiten, war der Kreis derjenigen, die sie meinten, wenn sie »Wir« sagten, eben doch noch sehr beschränkt. Hinter der Landesgrenze war für die meisten Schluss mit dem Wir-Bewusstsein. Bei manchen auch schon im Nachbardorf. Und bei einigen bereits hinter dem eigenen Gartenzaun. Dort lebten dann bereits die anderen. Und die gingen einem auf die Nerven, die betrachtete man als Konkurrenten, als Störenfriede und manchmal sogar als mit allen Mitteln zu bekämpfende Feinde.
Blut ist nicht dicker als Tinte
Die Soziobiologen würden jetzt argumentieren, dass wir uns wegen unserer egoistischen Gene sowieso nur dann gegenseitig unterstützen, wenn wir möglichst eng miteinander verwandt sind oder wenn es uns für unser Überleben oder für unsere Vermehrung irgendeinen Vorteil bringt, sich um einen anderen Menschen zu kümmern. Deshalb seien es immer die Mitglieder von Familienclans, die besonders eng zusammenhalten. Je intensiver sich dort jeder um den anderen kümmert, ihm in Gefahren beisteht und ihm hilft, seine Kinder großzuziehen, desto größer werde die Chance für seine egoistischen – auch in seinen Blutsverwandten vorhandenen – Gene, sich auszubreiten.
Die Realität sieht allerdings in sehr vielen Familien etwas anders aus. Und selbst wenn in der Natur gelegentlich zu beobachten ist, dass ein Löwenmännchen die noch von seinem Vorgänger gezeugten Jungen totbeißt, so heißt das noch lange nicht, dass jeder Mann die Kinder umbringt, die seine Frau aus erster Ehe mitgebracht hat. Und was für egoistische Gene sollten gar homosexuelle Partner dazu bewegen, ein ganzes Leben zusammenzuleben und sich gegenseitig auf eine oftmals liebevollere Weise umeinander zu kümmern, als das bei manchen heterosexuellen Paaren der Fall ist? Und was bringt Menschen nicht nur aus verschiedenen Familien, sondern oft sogar aus unterschiedlichsten Kulturen dazu, sich zusammenzuschließen und sich gemeinsam, mit einem starken Wir-Gefühl und Wir-Bewusstsein, für irgendetwas, das ihnen wichtig ist, auf den Weg zu machen?
Was sie zusammenbringt und zusammenhält, ist weder das dicke verwandtschaftliche Blut noch die dünne Tinte gemeinsam unterschriebener Absichtserklärungen, sondern ein Gefühl.
Not schweißt nur zusammen
Oft ist es die Not und das Elend, manchmal in Form von Hunger oder Kälte, was Menschen unterschiedlichster Herkunft dazu bringt, sich zu einer Gemeinschaft zusammenzuschließen. Solche Notgemeinschaften halten extrem gut zusammen, und ihre Mitglieder entwickeln ein sehr starkes Wir-Gefühl. Sie leisten bisweilen Übermenschliches, in Kriegs- und Wiederaufbauzeiten beispielsweise oder nach Naturkatastrophen. Hier geht es oftmals um das pure Überleben. Deshalb stellen die Einzelnen, solange die gemeinsame Bedrohung anhält, ihre eigenen Interessen zurück. Neurobiologisch handelt es sich bei dieser Bereitschaft, sich in Notfällen mit anderen zusammenzuschließen, um eine Bewältigungsstrategie zur Überwindung des Gefühls von Ohnmacht, Hilflosigkeit und Überlebensangst. Der Zusammenschluss ist eine Reaktion, nichts Freiwilliges. Ohne Not hätten die betreffenden Menschen dieses Wir-Gefühl nicht entwickelt, und wenn die Not, die gemeinsame Gefahr, das gegenwärtig herrschende Elend einigermaßen überwunden ist, zerfällt eine solche Gemeinschaft meist rascher, als man das angesichts der Stärke des Zusammenhalts im Zustand der vorher noch herrschenden Not für möglich gehalten hätte. Was eben noch wie ein »Wir-Gefühl« aussah, erweist sich jetzt als äußerst schnell vergänglich. Das Wir-Bewusstsein der Mitglieder solcher Not- und Zwangsgemeinschaften ist in ihrem Gehirn nur in der engen Kopplung mit der erlebten Not verankert. Wenn die Not vorbei ist, lässt es sich nur noch durch die Erinnerung an die gemeinsam überstandene Not vorübergehend wieder wachrufen. An Gedenktagen beispielsweise.
Angst wirkt noch stärker als Not
Angst ist noch schlimmer für uns Menschen auszuhalten als Not und Elend. Und Angst kann sich in einer menschlichen Gemeinschaft auch dann ausbreiten, wenn dort weder Not noch Elend, ja noch nicht einmal irgendeine existentielle Bedrohung herrscht. Angst vor Inflation beispielsweise oder vor der Schweinepest oder vor Terroristen. Not und Elend sind klar beschreibbare, objektiv vorhandene, sichtbare und messbare Probleme, in die eine Gemeinschaft hineingeraten, von denen sie beherrscht werden kann. Aber Angst ist immer subjektiv, ist immer das Resultat einer subjektiven Bewertung. Und wie ein einzelner Mensch eine bestimmte Situation bewertet, hängt davon ab, welche Erfahrungen er im Verlauf seines bisherigen Lebens mit diesen und ähnlichen Situationen gemacht hat. Deshalb haben manche Menschen keine Angst vor dem Gewimmel einer Großstadt oder der Reise mit einem Flugzeug oder der Fahrt auf einer Achterbahn oder dem Streit mit einem Vorgesetzten oder dem Versagen in einer Prüfung. Andere verfallen bereits in panische Angst, wenn wieder einmal gemeldet wird, dass eine neue Grippewelle im Anzug ist. Außerdem gibt es vieles, wovor Menschen Angst haben, oft ohne sich das selbst offen einzugestehen. Zum Beispiel davor, nicht von anderen gemocht, nicht von ihnen anerkannt zu sein oder aus einer Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Vor allem in der Pubertät sind Jugendliche deshalb bereit, so ziemlich alles zu tun, nur damit sie zu einer Gruppe dazugehören können.
Wenn sich Menschen aus Angst zusammenschließen, so machen sie meist auch die sehr angenehme Erfahrung, dass sie dann weniger Angst haben und dass sie gemeinsam in der Lage sind, Probleme zu lösen, an denen jeder Einzelne von ihnen bisher gescheitert ist. So eine gemeinsame Erfahrung stärkt Menschen ungemein und erzeugt auch ein Wir-Bewusstsein, das selbst dann noch weiter stabil und abrufbar bleibt, wenn die Gefahr vorbei und die Angst überwunden ist.
Aber Achtung! Wenn diese gemeinsame Problemlösung darin besteht, dass man in einer kollektiven Anstrengung andere niedermacht, unterwirft und unterdrückt, so beraubt man sich dadurch der Möglichkeit, von diesen anderen etwas lernen zu können. Dann wächst man nicht über sich hinaus, sondern an diesen anderen vorbei. Und das auch nur so lange, bis sich diese anderen wieder aufgerappelt und neue Techniken entwickelt und stärkere Verbündete gesucht haben.
Unsere Geschichtsbücher sind ein einziges leidvolles Zeugnis solcher kurzfristig erfolgreichen Feldzüge. Dort können wir auch nachlesen, wie Machthaber immer wieder versucht haben, Angst unter den Menschen ihres Einflussbereiches zu schüren, um ihnen anschließend genau das als Lösung zur Überwindung dieser Angst anzubieten, was ihren jeweiligen Interessen und ihrer Machterhaltung diente. Je verunsicherter Menschen bereits sind, desto besser gelingt diese Strategie. Man kann Menschen auf diese Weise nicht nur dazu bringen, kollektiv über diejenigen herzufallen, die von solchen Machthabern, ihren Wortführern und Meinungsmachern als gefährliche Feinde dargestellt werden. Mit der gleichen Strategie kann man ganze Gemeinschaften auch dazu bringen, vermeintliche Hexen zu verbrennen oder sogenannte Ungläubige zu unterwerfen. Und wie man Ängste schüren muss, um möglichst viele Abnehmer für Produkte zu finden, die angeblich gegen alle möglichen Gebrechen, gegen Falten und andere unheilbare Gefahren helfen, brauche ich hier nicht länger auszuführen.
Weil alle auf diese Weise und mit derartigen Absichten erzeugten Ängste nicht dazu führen, dass die Menschen eine gemeinsame, sie stärkende Erfahrung machen, stärken sie auch kein Wir-Gefühl.
Und ein Wir-Bewusstsein, das sich aus der gemeinsamen Vorstellung rekrutiert, dass man als Gemeinschaft von verängstigten Menschen am Ende machtlos bleibt und eine wirkliche Besserung nicht in Aussicht steht, ist wenig hilfreich, um über sich hinauszuwachsen. Abhilfe lässt sich dann auch nicht dadurch schaffen, dass man gemeinsam den Zustand beklagt, in den man gemeinsam hineingeraten ist.
Verbundenheit entsteht jenseits von Angst und Not
Fassen wir noch einmal bis hierher zusammen: »Wir« sagen wir auch dann, wenn wir uns mit anderen gar nicht verbunden fühlen, sondern mit ihnen nur ein Zweckbündnis zur Abwehr von Bedrohungen eingegangen sind. »Wir müssen jetzt gemeinsam ranklotzen, sonst kommen wir aus diesem Schlamassel nicht mehr heraus« – solche Angst- und Notgemeinschaften bilden Menschen immer dann, wenn sie auf unvorhergesehene, bedrohliche oder für sie in anderer Weise ungünstige Veränderungen ihrer bisherigen Lebenswelt reagieren müssen.
Erst wenn diese gemeinsame Anstrengung dazu führt, dass die Angst überwunden, die Not gemildert werden kann, haben die Mitglieder dieser Gemeinschaften eine neue, ihr Wir-Gefühl und ihr Wir-Bewusstsein stärkende Erfahrung gemacht. Ohne diese Erfahrung, gemeinsam mit anderen etwas besser als allein verstehen, etwas effektiver als allein gestalten, etwas sinnhafter als allein erfahren zu können, werden die Mitglieder einer menschlichen Gemeinschaft auch kein »Wir«-Bewusstsein entwickeln können.