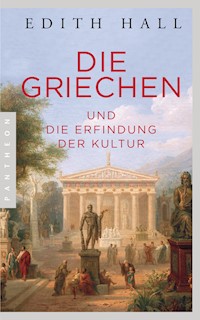19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zeitlose Weisheiten für ungewöhnliche Zeiten: Wie Aristoteles Ideen uns glücklicher machen können
Aristoteles war der erste Philosoph, der Glück als Zustand einer inneren Zufriedenheit beschrieben hat. Was hat dieser außergewöhnliche Denker, der sich mit der Frage nach dem guten, glücklichen und sinnerfüllten Leben beschäftigt hat, uns heute noch zu sagen? Erstaunlich viel, wie die britische Altertumsforscherin Edith Hall in ihrem klugen und unterhaltsamen Buch zeigt. In zehn Lektionen beschreibt sie handfest und lebensnah, wie die Ideen des Aristoteles uns glücklicher machen können. So kann uns seine Rezeptur für das Glücklichsein nicht nur bei der Entscheidungsfindung und der richtigen Partnerwahl helfen, sondern auch unsere Kommunikation verbessern oder unseren Umgang mit dem Tod verändern. Jeder kann sich dafür entscheiden, glücklicher zu werden – und dieses Buch ist der erste Schritt dazu.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Was hat Aristoteles uns heute noch über das gute, glückliche Leben zu sagen? Erstaunlich viel, wie Edith Hall in diesem klugen und unterhaltsamen Buch zeigt. In zehn Lektionen erklärt sie, wie die Ideen des außergewöhnlichen Denkers uns glücklicher machen können. So kann uns seine Rezeptur für das Glücklichsein nicht nur bei der Entscheidungsfindung und der richtigen Partnerwahl helfen, sondern auch unsere Kommunikation verbessern oder unseren Umgang mit dem Tod verändern. Jeder kann sich dafür entscheiden, glücklicher zu werden – und dieses Buch ist der erste Schritt dazu.
Edith Hall, geboren 1959, ist Professorin für Altertumswissenschaften am King’s College in London und Mitgründerin des Archive of Performances of Greek and Roman Drama an der Universität Oxford. Im Jahr 2015 erhielt sie die »Erasmus-Medaille« der Academia Europea für herausragende Verdienste um die europäische Kultur und Wissenschaft. Hall verfasste mehrere Bücher zu Themen der griechischen Geschichte und Literatur, unter anderem eine Kulturgeschichte von Homers »Odyssee« sowie eine Geschichte der antiken Sklaverei. Im Siedler Verlag erschien zuletzt »Die alten Griechen« (2017).
»Wundervoll und aktuell. […] Ein Aristoteles für unsere Zeit. Absolut empfehlenswert!« Stephen Fry
»Halls Buch ist eine bezaubernde, faszinierende Annäherung an Aristoteles’ praktische Lebensanschauung und eine hilfreiche Einführung in die Gedankenwelt des wichtigsten Philosophen der Weltgeschichte.« Publisher’s Weekly
Besuchen Sie uns auf www.siedler-verlag.de
EDITH
HALL
Was
würde
Aristoteles
sagen?
ZEHN PHILOSOPHISCHE
LEKTIONEN FÜR
das Glücklichsein
Aus dem Englischen
von Andreas Thomsen
Siedler
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel
Aristotle’s Way: Ten Ways Ancient Wisdom Can Change Your Life
bei The Bodley Head.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2018 by Edith Hall
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021
by Siedler Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Alexander Eß
Kartenillustration: Emmy Lopes © 2018
Umschlaggestaltung: Favoritbuero München,
nach einem Entwurf von Penguin Random House UK
Umschlagfoto: © Cig Harvey
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-21400-5V001
www.siedler-verlag.de
Dieses Buch ist der Erinnerung an Aristoteles
den Stageriten, Sohn von Nikomachos
und Phaestis, gewidmet
ZEITLEISTE
384 v. Chr.: Aristoteles wird in Stageira als Sohn von Nikomachos und Phaestis geboren.
ca. 372 v. Chr.: Aristoteles’ Vater stirbt, und er wird von Proxenos aus Atarneus adoptiert.
ca. 367 v. Chr.: Aristoteles geht nach Athen, um an Platons Akademie zu studieren.
348 v. Chr.: Philipp II. von Makedonien zerstört Stageira, baut es auf Bitte von Aristoteles aber wieder auf.
347 v. Chr.: Aristoteles verlässt Athen nach Platons Tod und geht zu Hermias, dem Herrscher von Assos.
345–344 v. Chr.: Aristoteles führt auf Lesbos zoologische Untersuchungen durch.
343 v. Chr.: Philipp II. lädt Aristoteles nach Makedonien ein, um seinen Sohn Alexander zu unterrichten.
338–336 v. Chr.: Aristoteles könnte in Epirus und Illyrien gewesen sein.
336 v. Chr.: Philipp II. wird ermordet und Alexander wird König Alexander III. (»der Große«). Aristoteles kehrt nach Athen zurück und gründet seine Schule im Lykeion.
323 v. Chr.: Alexander der Große stirbt in Babylon.
322 v. Chr.: Aristoteles wird in Athen wegen Gottlosigkeit angeklagt und geht nach Chalkis auf Euböa, wo er stirbt.
Kartenillustration von Emmy Lopes © 2018
Karte von Griechenland. An den fett gedruckten Orten hat Aristoteles gelebt. Die gepunkteten Bereiche markieren die griechischsprachige Welt des 4. Jahrhunderts v. Chr.
INHALT
ZEITLEISTE
KARTE
EINFÜHRUNG
1 GLÜCK
2 POTENZIAL
3 ENTSCHEIDUNGEN
4 KOMMUNIKATION
5 SELBSTERKENNTNIS
6 ABSICHTEN
7 LIEBE
8 GEMEINSCHAFT
9 MUSSE
10 STERBLICHKEIT
DANK
GLOSSAR
EMPFOHLENE LITERATUR
ANMERKUNG ZUR ÜBERSETZUNG
ANMERKUNGEN
EINFÜHRUNG
Die Worte »glücklich« (oder »happy«) und »Glück« müssen für vieles herhalten. Man kann ein Happy Meal genießen oder sich während der Happy Hour verbilligte Cocktails zu Gemüte führen. Man wirft »Happy Pills« ein, um seine Stimmung aufzuhellen, oder postet ein »happy« Emoji in den sozialen Medien. Glück ist etwas, das wir sehr hoch schätzen. Das Lied »Happy« von Pharrell Williams etwa war 2014 die Nummer eins und die meistverkaufte Single des Jahres in den Vereinigten Staaten und in dreiundzwanzig weiteren Ländern, darunter auch Deutschland. Für Williams ist Glück ein vorübergehender Moment höchster Freude, der sich anfühlt, als sei man ein Heißluftballon, der in den Weltraum entschwebt.
Unsere Vorstellungen von Glück sind reichlich verworren. Fast jeder glaubt, glücklich sein zu wollen, was in aller Regel einen dauerhaften psychischen Zustand der Zufriedenheit meint, obwohl es nicht das ist, was Williams besingt. Wenn wir zu unseren Kindern sagen, wir möchten, dass sie »einfach nur glücklich sind«, meinen wir damit einen permanenten Zustand. In unseren Alltagsgesprächen hingegen wenden wir das Konzept paradoxerweise viel häufiger auf so triviale vorübergehende Freuden wie Essen, Trinken oder Textnachrichten an. Oder auf die Begegnung mit einem Hundebaby, wie Lucy von den Peanuts es nach einer Umarmung mit Snoopy ausdrückt.* Und ein »Happy Birthday« sind ein paar genussvolle Stunden, in denen wir den Jahrestag unserer Geburt feiern.
Aber was, wenn Glück nun ein lebenslanger Daseinszustand wäre? Die Philosophie ist gespalten darüber, was genau das eigentlich bedeuten würde. Für die einen ist Glück etwas Objektives, das von außen betrachtet und von Historiker*innen eingeschätzt oder sogar gemessen werden kann. Gemeint sind damit zum Beispiel Gesundheit, eine liebevolle Familie und ein langes Leben ohne Ängste und finanzielle Sorgen. Nach dieser Definition hatte Königin Viktoria, die über achtzig Jahre alt wurde, neun gesunde Kinder großzog und überall in der Welt bewundert wurde, zweifellos ein »glückliches« Leben. Marie Antoinette dagegen war eindeutig »unglücklich«: Zwei ihrer vier Kinder verstarben noch im Säuglingsalter, sie selbst wurde vom Volk gehasst und war bei ihrer Hinrichtung noch keine vierzig.
Den meisten Büchern über Glück liegt diese objektive Definition von »Wohlbefinden« zugrunde. Gleiches gilt für die Studien, die von Regierungen in Auftrag gegeben werden, um das Glück ihrer Bürgerinnen und Bürger auf internationaler Ebene zu vergleichen. Seit 2013 begehen die Vereinten Nationen jedes Jahr am 20. März den Internationalen Tag des Glücks, der zur Bekämpfung von Armut, zur Verringerung von Ungleichheit und zum Schutz des Planeten aufruft, um auf diese Weise das weltweite Wohlbefinden messbar zu fördern.
Einige Philosoph*innen hingegen verstehen Glück als etwas rein Subjektives. Für sie ist Glück nicht gleichbedeutend mit »Wohlbefinden«, sondern mit »Zufriedenheit« oder »Glückseligkeit«. Nach dieser Auffassung kann man von außen nicht erkennen, ob jemand glücklich ist oder nicht. So ist es möglich, dass ein äußerlich heiterer Mensch innerlich an Melancholie leidet. Dieses subjektive Glück lässt sich beschreiben, aber nicht messen. Wir können also unmöglich beurteilen, welche der beiden Königinnen die Glücklichere war. Vielleicht genoss Marie Antoinette während ihres kurzen Lebens lange Stunden voller Freude, während die früh verwitwete und jahrelang zurückgezogen lebende Viktoria die meiste Zeit über zutiefst unglücklich war.
Aristoteles hat sich als erster Philosoph mit dieser zweiten, subjektiven Art des Glücks auseinandergesetzt. Er entwickelte einen ausgeklügelten, bis heute gültigen Leitfaden, wie man ein glücklicher Mensch werden kann. Aristoteles bietet alles, was man braucht, um zu verhindern, dass es einem so ergeht wie dem sterbenden Protagonisten in Tolstois Der Tod des Iwan Iljitsch (1886). Dieser muss kurz vor seinem Ende erkennen, dass er den Großteil seines Lebens mit sozialem Aufstieg vergeudet, Eigennutz über Mitgefühl und Gemeinschaftswerte gestellt und obendrein eine Frau geheiratet hat, die er gar nicht mag. Angesichts seines bevorstehenden Todes überkommt ihn der Hass auf seine Familie, die noch nicht einmal mit ihm darüber reden will. Die aristotelische Ethik umfasst alles, was moderne Denker mit subjektivem Glück assoziieren: Selbstverwirklichung, das Finden eines »Sinns«, den »Flow« der schöpferischen Auseinandersetzung mit dem Leben und »positive Gefühle«.1
Dieses Buch gibt Aristoteles’ altehrwürdige Ethik in zeitgemäßer Sprache wieder und wendet seine Lehren auf praktische Herausforderungen des realen Lebens wie das Schreiben von Bewerbungen oder die Kommunikation bei Vorstellungsgesprächen an. Man kann von Aristoteles aber auch viel über Entscheidungsfindung lernen und darüber, wie man Versuchungen widersteht oder wie man passende Freundinnen und Partner auswählt. Mit seiner Tabelle der Tugenden und Laster kann man nicht nur seinen eigenen Charakter analysieren.
An welchem Punkt seines Lebens man auch stehen mag, die Ideen von Aristoteles können einen glücklicher machen. Die meisten Philosophinnen, Mystiker, Psychologinnen und Soziologen haben im Grunde nicht viel mehr getan, als seine wesentlichen Erkenntnisse zu wiederholen. Doch es war Aristoteles, der sie zuerst formulierte, und zwar besser, klarer und ganzheitlicher als irgendwer nach ihm. Die Bestandteile seiner Rezeptur für das Glücklichsein nehmen jeweils auf einzelne Phasen des menschlichen Lebens Bezug, überschneiden sich zugleich aber auch mit allen anderen.
Als Individuum subjektiv glücklich zu werden, geht nach Aristoteles’ Auffassung mit großer Verantwortung einher. Es ist aber auch ein großes Geschenk, und fast jeder Mensch kann sich, unabhängig von seinen Lebensumständen, dafür entscheiden, glücklicher zu werden. Aber wenn man Glück als inneren, rein persönlichen Zustand begreift, was genau ist Glück dann eigentlich? Moderne Philosoph*innen nähern sich dieser Frage von drei Seiten an.
Der erste Ansatz basiert auf Erkenntnissen der Psychologie und Psychiatrie. Danach ist Glück das Gegenteil von Depression, also ein emotionaler Zustand, der als eine kontinuierliche Abfolge von Stimmungen erlebt wird. Dazu bedarf es einer positiven, optimistischen Grundeinstellung. Die kann auch jemand haben, der gut gelaunt und ohne Ambitionen den lieben langen Tag vor dem Fernseher sitzt. Diese Eigenschaft ist eine Frage des Temperaments und wohl erblich: Ein heiteres Gemüt scheint häufig so etwas wie eine Familienveranlagung zu sein.
Nach Ansicht östlicher Philosophien kann dieser emotionale Zustand durch Techniken wie die transzendentale Meditation erreicht werden. Westliche Philosoph*innen halten einen Zusammenhang mit dem Serotoninspiegel im menschlichen Körper für möglich. Nach Ansicht von Ärztinnen und Psychiatern spielt der Neurotransmitter nämlich eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung des Stimmungsgleichgewichts, depressive Menschen leiden häufig an Serotoninmangel. Eine heitere Veranlagung ist beneidenswert, aber die meisten von uns werden nicht damit geboren. Moderne Antidepressiva können Menschen helfen, die chronisch oder aufgrund von Lebenskrisen unter Depressionen leiden, indem sie den Serotoninspiegel erhöhen. Aber ist gute Laune auch gleichbedeutend mit Glück? Kann man ein Leben vor dem Fernseher als glücklich bezeichnen? Aristoteles hätte das wohl verneint, denn er sah im Ausschöpfen menschlicher Fähigkeiten eine Voraussetzung für Glück. Für John F. Kennedy etwa bedeutete Glück im aristotelischen Sinne »in einem Leben, das einem den Spielraum dafür bietet, unter Aufbietung aller Kräfte Vortreffliches zu leisten«.
Die moderne Philosophie versucht auch, dem Geheimnis des subjektiven Glücks über den »Hedonismus« auf die Spur zu kommen, den Gedanken also, dass Glück durch den Anteil unseres Lebens definiert wird, den wir damit verbringen, uns zu vergnügen beziehungsweise Vergnügen, Freude und Ekstase zu empfinden. Die Wurzeln des Hedonismus (das Wort kommt von hedone, dem altgriechischen Wort für »Vergnügen«) reichen weit zurück. Die im 6. Jahrhundert v. Chr. begründete indische Philosophieschule Charvaka vertrat die Ansicht, dass »himmlisches Vergnügen darin besteht, köstliche Speisen zu verzehren, jungen Frauen Gesellschaft zu leisten, feine Gewänder zu tragen und Parfüm, Girlanden und Sandelholzpaste zu verwenden. Nur ein Narr verausgabt sich mit Bußen und Fasten.«2 Ein Jahrhundert später entwickelte der Sokrates-Schüler Aristippos von Kyrene ein Ethiksystem, das als »hedonistischer Egoismus« bezeichnet wurde. Die von ihm inspirierte Schrift Über die Üppigkeit der alten Zeit schildert die Heldentaten vergnügungssüchtiger Philosophen. Aristippos war der Auffassung, dass man sich, wann immer möglich, den Sinnesfreuden hingeben solle, ohne sich um die Folgen zu scheren.
Der Hedonismus kam wieder in Mode, als der Utilitarismus, allen voran Jeremy Bentham (1748–1832), argumentierte, dass die Maxime für moralisch richtiges Handeln sein müsse, was immer das größte Glück für die meisten bewirke. Bentham glaubte, dass dieses Prinzip bei der Formulierung von Gesetzen helfen könne. In seiner Schrift Eine Einführung in die Prinzipien der Moral und Gesetzgebung (1789) entwickelte er sogar einen als »hedonistisches Kalkül« bezeichneten Algorithmus, um den Spaßquotienten einer bestimmten Handlung zu ermitteln. Zu den Variablen seines Quotienten gehörten neben der Intensität und Dauer der Befriedigung auch die Wahrscheinlichkeit und der Zeitpunkt ihres Eintretens. Wichtig war natürlich auch, ob sie schmerzhafte Konsequenzen haben würde. Auch die Fruchtbarkeit einer Befriedigung spielte eine Rolle, also ob weitere Vergnügungen daraus hervorgingen, und schließlich, wie viele Menschen sie erleben würden.
Dabei interessierte Bentham eher das Ausmaß als die Art des Vergnügens. Die Quantität war ihm wichtig und nicht die Qualität. Wenn also die letzten Worte des Filmschauspielers Errol Flynn – »Ich hatte verdammt viel Spaß und habe jede Minute davon genossen« – seine wahre mentale Verfassung widerspiegeln, dann muss er nach den Maßgaben des quantitativen Hedonismus ein verdammt glücklicher Mensch gewesen sein.
Aber was meinte Errol Flynn mit »Spaß« und »Genießen«? Für Benthams Schüler John Stuart Mill unterschied »quantitativer Hedonismus« nicht zwischen dem Glück von Menschen und dem von Schweinen, denen man ein permanentes körperliches Wohlbefinden verschaffen könne. Deshalb, so Mill, müsse es unterschiedliche Ebenen und Arten der Befriedigung geben. Körperliche Freuden, wie etwa der Spaß an Essen oder Sex, die wir mit Tieren gemein haben, seien »niedere« Freuden. Geistige Genüsse hingegen, wie wir sie aus den Künsten, intellektuellen Debatten oder gutem Verhalten gewinnen, seien »höhere« Freuden und damit wertvoller. Dieser philosophische Ansatz wird zumeist als vernünftiger oder qualitativer Hedonismus bezeichnet.
Unter den Philosoph*innen des 21. Jahrhunderts befürworten allerdings nur noch wenige die hedonistische Herangehensweise an das subjektive Glück. Als der Harvard-Professor Robert Nozick 1974 sein Buch Anarchie, Staat, Utopia veröffentlichte, war das ein herber Schlag für diese philosophische Richtung. Darin stellte er sich nämlich eine Maschine vor, die den Menschen ihr Leben lang angenehme Erfahrungen bescheren kann, die, obwohl simuliert, nicht von den »wirklichen« zu unterscheiden sind. Würden sich die Menschen an eine solche Maschine anschließen lassen? Wohl nur die wenigsten, denn wir wollen die Realität. Für die meisten Menschen ist subjektives Glück eben etwas, das weit über angenehme Empfindungen hinausgeht.
Nozick schrieb noch vor dem Zeitalter der massenhaften Verbreitung von Heimcomputern, und auch der Gedanke an virtuelle Realitäten lag noch in weiter Ferne. Als sein Gedankenexperiment damals von der Öffentlichkeit aufgegriffen wurde, assoziierte man es mit dem »Orgasmatron« – ein Apparat, der einem Befriedigung verschafft, ohne dass man dafür (sexuell) aktiv werden muss – aus dem Woody-Allen-Film Der Schläfer von 1973. Vielleicht werden die Menschen eines Tages genug haben von den Risiken real gelebter Erfahrungen und sich in die Sicherheit immerwährender simulierter Freuden flüchten, aber noch ist es nicht so weit. Wir wollen glücklich sein und scheinen überzeugt, dass Glück nicht nur aus angenehmen Erfahrungen besteht. Vielmehr verlangt es von uns ein nachhaltiges, sinnvolles und konstruktives Handeln. Und genau das ist es, was Aristoteles vor so langer Zeit im klassischen Griechenland beschäftigte. Er glaubte, Glück sei ein seelischer Zustand, ein Gefühl der Erfüllung und Zufriedenheit, das sich aus dem eigenen Verhalten, dem Austausch mit anderen und der Art und Weise speist, wie unser Leben verläuft. Das erfordert natürlich ein gewisses Maß an Aktivität und eine Zielsetzung. Damit sind wir beim dritten Ansatz der modernen Philosophie zur Betrachtung des subjektiven Glücks angelangt. Er beruht darauf, dass wir unsere Ambitionen, unser Verhalten und unsere Stellung in der Welt analysieren und modifizieren. Und er stammt von Aristoteles.
Aristoteles war der Überzeugung, dass man an seinen Tugenden arbeiten und seine Laster bezähmen müsse, um sich selbst zum Guten zu erziehen, denn Glückseligkeit entsteht für ihn aus der Gewohnheit, das Richtige zu tun. Wenn man seinem Kind ganz bewusst ein warmherziges Lächeln schenkt, sobald man es sieht, ist das bereits ein erster unbewusster Schritt in die richtige Richtung. Einige Philosoph*innen bezweifeln zwar, dass eine tugendhafte Lebensweise wünschenswerter ist als eine lasterhafte, doch gerade in letzter Zeit ist die »Tugendethik« in philosophischen Kreisen wieder gesellschaftsfähig geworden und wird sogar als segensreich angesehen. Für Aristoteles gehörten alle Tugenden miteinander zusammen, wohingegen heutige Denker*innen dazu neigen, sie in Unterkategorien aufzuteilen. James D. Wallace etwa unterscheidet in Virtues and Vices (1978) drei Gruppen: Tugenden der Selbstdisziplin, wie Mut und Geduld, Tugenden der Gewissenhaftigkeit, wie Ehrlichkeit und Anständigkeit, und Tugenden des Wohlwollens gegenüber anderen, wie Freundlichkeit und Mitgefühl. Die ersten beiden Tugendgruppen wirken sich positiv auf den Erfolg des Einzelnen und der Gemeinschaft insgesamt aus. Tugenden des Wohlwollens lassen sich nicht so präzise einordnen, können aber dafür sorgen, dass man auf andere sympathischer wirkt und sich auch selbst lieber mag. Tugend hat also extrinsische Vorteile: Da man glücklicher ist, wenn die Menschen um einen herum glücklich sind, ist Tugendhaftigkeit letztlich eine Frage des aufgeklärten Eigeninteresses. Aber Aristoteles war ebenso wie Sokrates, die Stoiker und der viktorianische Philosoph Thomas Hill Green auch von ihren intrinsischen Vorzügen überzeugt. Denn Tugenden, die anderen Menschen zugutekommen, leisten einen grundlegenden Beitrag zum eigenen Glück.3
In der Nikomachischen Ethik erörtert Aristoteles die Ursachen des Glücks. »Selbst wenn es nicht von Gott gesandt ist«, sagt Aristoteles, der nicht an die Einmischung der Götter in menschliche Angelegenheiten glaubte, »sondern durch Tugend und durch eine Art von Lehre oder Übung entsteht«, scheine es doch zu den göttlichsten Dingen zu gehören. Die Bestandteile des Glücks lassen sich beschreiben und analysieren wie die Gegenstände jedes anderen Wissenszweiges, etwa der Astronomie oder der Biologie. Das Studium des Glücks unterscheidet sich von diesen Wissenschaften jedoch insofern, als es ein konkretes Ziel hat, nämlich das Erreichen des Glücks. In dieser Hinsicht gleicht es eher der Medizin oder einer politischen Theorie.
Darüber hinaus hat das Glück laut Aristoteles das Potenzial, sich weit zu verbreiten, »denn durch eine gewisse Belehrung oder Bemühung könnten alle es erreichen, die in Bezug auf die Tugend nicht behindert sind«. Auch wenn die Fähigkeit zum Guten durch bestimmte Umstände und Lebenserfahrungen beschädigt werden kann, ist das Glück für die meisten Menschen tatsächlich erreichbar, wenn sie sich nur zu seiner Erschaffung entschließen. Und fast jeder kann entscheiden, sich zum Glück hinzudenken. Dazu muss man keinen Abschluss in Philosophie haben.
»Fast« jeder ist jedoch eine wichtige Einschränkung in diesem Zusammenhang. Denn Aristoteles gibt uns natürlich keinen Zauberstab an die Hand, mit dem sich einfach alles wegzaubern ließe, was dem Glück im Wege steht. Gewisse Voraussetzungen muss man schon mitbringen, um nach dem universellen Glück streben zu können. Und Aristoteles räumt ein, dass die Ausgangsbedingungen nicht für alle gleich sind. Lebensumstände, denen man sich nicht entziehen kann, können die Glückseligkeit durchaus »trüben«, wie er es ausdrückt. Wenn man etwa das Pech hat, am unteren Ende der sozioökonomischen Nahrungskette geboren worden zu sein oder keine Kinder, keine Familie und keinen geliebten Menschen zu haben oder ausgesprochen hässlich zu sein, ist es sehr viel schwieriger, das Glück zu erreichen. Aber unmöglich ist es auch dann nicht. Man muss weder reich noch stark oder schön sein, um seinen Geist mithilfe von Aristoteles zu trainieren, denn die von ihm vertretene Lebensweise ist eher auf moralische und psychologische Qualitäten ausgerichtet. Ein schwerer zu überwindendes Hindernis stellen verkommene Kinder oder Freunde dar. Und noch schwieriger wird es nach Ansicht von Aristoteles, wenn man einen guten Freund oder ein Kind an den Tod verliert.
Grundsätzlich können aber auch Menschen, mit denen es die Natur oder das Schicksal weniger gut gemeint hat, ein gutes und tugendhaftes Leben führen. »Diese Art von Philosophie, die jeder betreiben kann, unterscheidet sich von den meisten anderen Arten der Philosophie«, erläutert Aristoteles, denn sie verfolge ein praktisches Ziel im realen, täglichen Leben. Die Nikomachische Ethik, fügt er hinzu, ist »nicht wie unsere anderen (Untersuchungen) auf theoretisches Wissen ausgerichtet [...] denn wir erforschen die Gutheit nicht, um zu wissen, was sie ist, sondern damit wir gut werden, weil unsere Untersuchung sonst ganz nutzlos wäre«. Der einzige Weg, ein guter Mensch zu sein, besteht tatsächlich darin, Gutes zu tun. Man muss Menschen stets gerecht behandeln, etwa indem man seinem Partner bereitwillig anbietet, die Kinderbetreuung am Wochenende zur Hälfte zu übernehmen, oder der Putzfrau auch dann den vollen Betrag bezahlt, wenn man ihr abgesagt hat. Aristoteles führt aus, dass es nach Ansicht vieler Menschen genüge, über gutes Betragen zu reden. »Indem sie sich in Worte flüchten, meinen sie zu philosophieren und auf diese Weise gut zu werden.« Er vergleicht solche Menschen mit Kranken, »die sorgfältig dem Arzt zuhören, jedoch nichts von dem tun, was er anordnet«.
Aristotelisch zu denken bedeutet, sein Verständnis von der menschlichen Natur zu nutzen, um auf die bestmögliche Weise zu leben. Es bedeutet, dass die Natur und nicht ein jenseits davon angesiedeltes Konzept – wie Gott oder Götter – die Grundlage unserer Einschätzungen und Entscheidungen bildet. Das ist der wichtigste Unterschied zwischen Aristoteles und seinem Lehrer Platon, nach dessen Auffassung der Mensch die Antworten auf die Probleme des Daseins in einer unsichtbaren Welt immaterieller Ideen oder essentieller »Formen« jenseits der materiellen, sichtbaren Welt finden müsse. Aristoteles hingegen konzentrierte sich auf die spannenden Phänomene im wahrnehmbaren Hier und Jetzt oder, wie der Dichter und Altphilologe Louis MacNeice in Autumn Journal, canto 12, schrieb:
Aristoteles war besser, betrachtete Insekten,
Die Entwicklung der natürlichen Welt,
Betonte die Funktion, verwarf die Form an sich,
Nahm das Pferd aus dem Regal und ließ es galoppieren.
Aristoteles stellte die menschliche Erfahrung in den Mittelpunkt seines Denkens. Dafür bewunderten ihn Thomas More, Francis Bacon, Charles Darwin, Karl Marx und James Joyce zutiefst. Moderne Philosoph*innen, darunter einige der herausragenden Frauen des 20. Jahrhunderts, wie Hannah Arendt, Philippa Foot, Martha Nussbaum, Sarah Broadie und Charlotte Witt, verfassten bedeutende Werke, die stark von Aristoteles beeinflusst oder ihm sogar gewidmet sind.
Der Zustand des Glücks lässt sich laut Aristoteles nicht durch das fanatische Anwenden von Regeln und Prinzipien erreichen. Vielmehr muss man sich stets mit dem Leben selbst auseinandersetzen, mit jedem galoppierenden Pferd und seinen Besonderheiten. Ähnlich wie in der Medizin oder der Schifffahrt gibt es allgemeine Richtlinien. Doch ungeachtet aller Kenntnisse, über die Ärzte oder Kapitäne auf ihren jeweiligen Fachgebieten verfügen, werfen jeder Patient und jede Reise unterschiedliche Probleme auf, die folglich unterschiedlicher Lösungen bedürfen.
Moralisch Handelnde müssen »selbst jeweils das im Hinblick auf die Situation Angemessene erwägen«. So wird es Wochenenden geben, an denen man die Kinderbetreuung ganz oder auch gar nicht übernehmen muss. Aber nicht nur jede Situation, auch jeder Mensch ist anders, und dementsprechend variiert auch das tägliche Handeln, durch das man ein guter Mensch sein kann. Aristoteles vergleicht das mit der Situation von Sporttreibenden, von denen auch einige mehr essen müssen als andere. Als Beispiel für einen großen Esser führt er den berühmten Ringer Milon von Kroton an. Jeder Mensch muss selbst erkennen und für sich selbst entscheiden, welche Art ethischer Nahrung er benötigt, sei es, jemandem seine Hilfe anzubieten, seinen Groll abzulegen, zu lernen, sich zu entschuldigen, oder etwas völlig anderes.
Ich glaube nicht, dass ich besonders ehrenwert oder nett bin. Tatsächlich habe ich mit einigen unschönen Charaktereigenschaften zu kämpfen. Nachdem ich gelesen habe, was Aristoteles über Tugenden und Laster sagt, und offen mit Menschen meines Vertrauens darüber gesprochen habe, glaube ich, meine schlimmsten Fehler zu kennen. Ich bin ungeduldig, leichtsinnig, unverblümt, nachtragend und neige zu emotionalen Extremen. Aber Aristoteles’ Idee vom idealen Mittel zwischen den Extremen, das wir als »goldene Mitte« bezeichnen, besagt, dass all dies in Maßen durchaus in Ordnung ist. Menschen, die niemals ungeduldig sind, bringen nichts zu Ende, Menschen, die niemals Risiken eingehen, führen ein eingeschränktes Leben, Menschen, die sich der Wahrheit entziehen und weder Schmerz noch Freude zum Ausdruck bringen, sind psychisch und emotional verkümmert oder benachteiligt, und Menschen, die keinerlei Wunsch verspüren, es denjenigen heimzuzahlen, die ihnen Schaden zugefügt haben, machen sich entweder etwas vor oder schätzen ihren eigenen Wert zu gering ein.
Das Böse gibt es überall auf der Welt. Wir alle kennen sie, die Menschen oder Gruppen, die es anscheinend genießen oder sich zumindest nicht daran stören, schlechte Taten zu begehen und anderen wehzutun. Dennoch sind wir überzeugt, dass die meisten Menschen lieber Gutes tun und sich sozial verhalten, solange kein Mangel an lebenswichtigen Ressourcen sie zum Egoismus zwingt. Es fühlt sich einfach gut an, anderen Menschen zu helfen. Das Leben in Familienverbänden und Gemeinschaften scheint der Naturzustand des Menschen und somit das zu sein, was er anstrebt. Ein echter Aristoteliker lebt also in sozialen Gruppen, denkt rational und trifft moralische Entscheidungen, lässt sich durch ein vernünftiges Maß an körperlichem und geistigem Vergnügen zum Guten leiten und fördert nach Kräften sein eigenes Glück und das der anderen.
Unter den philosophischen Richtungen der Antike hat vor allem der Stoizismus von Mark Aurel, Seneca und Epiktet in der Neuzeit Anklang gefunden. Aber der Stoizismus beinhaltet nicht die Lebensfreude der Ethik eines Aristoteles, sondern ist eine eher pessimistische und düstere Angelegenheit. Er verlangt die Unterdrückung von Emotionen und körperlichen Begierden und empfiehlt, das Unglück einfach zu akzeptieren, anstatt sich aktiv mit den Herausforderungen des Alltags auseinanderzusetzen und Probleme zu lösen. Der Stoizismus lässt keinen Raum für Hoffnung, menschliches Handeln oder Aufbegehren gegen das Elend. Er prangert das Vergnügen als Selbstzweck an. Man möchte Cicero zuzustimmen, der fragte: »Wie? So ein Stoiker soll sein Publikum entflammen? Er wird es eher ernüchtern, wenn er es entbrannt empfangen hat.«
Aristoteles schrieb für Menschen, die sich in ihren Gemeinschaften engagieren. Die Epikureer ermutigten die Menschen, jeglichem Streben nach Ruhm, Macht und Reichtum zu entsagen, um ein möglichst ungestörtes Leben zu führen. Die Skeptiker waren zwar wie die Aristoteliker der Ansicht, dass man alle Annahmen infrage stellen müsse, bezweifelten jedoch, dass es wahres Wissen geben könne, und hielten allgemeine Prinzipien für ein konstruktives Zusammenleben für unmöglich. Die Kyniker stimmten mit Aristoteles darin überein, dass der Mensch ein hoch entwickeltes Tier und das Ziel des Lebens das Glück sei, das durch die Vernunft erreicht werden könne. Aber der von ihnen empfohlene Weg war unkonventioneller als der aristotelische. Für sie konnte Glück nur durch Askese erreicht werden, also durch den Verzicht auf häusliches Leben, materiellen Besitz und das Streben nach sozialen Belohnungen wie Ruhm, Macht oder Reichtum. Diogenes, ein Zeitgenosse Aristoteles’ und der berühmteste aller Kyniker, lebte halb nackt im Freien. Er hatte weder Frau noch Haus und verzichtete auf jede Form gesellschaftlichen Engagements. Nun sehnen sich viele von uns nach einer einfacheren Welt, aber nur die wenigsten wollen Familie und Staat abschaffen und das Leben eines einsamen Landstreichers führen.
Aristoteles war nicht im herkömmlichen Sinne religiös und lebte in einer Kultur, deren Religion heute keine Anhänger mehr hat, Jahrhunderte vor dem Auftauchen des Christentums und des Islam. Sein Denken ist also keinem zeitgenössischen politischen oder ideologischen Lager zuzuordnen. Tatsächlich hat er im Laufe der Jahrhunderte jüdische, christliche und muslimische Philosoph*innen gleichermaßen inspiriert und in jüngerer Zeit auch Hindus, Buddhistinnen und Konfuzianer. Keine der zeitgenössischen intellektuellen oder kulturellen Traditionen kann Aristoteles allein für sich beanspruchen. Mit einem menschlichen Geist aus so alter Zeit in Dialog zu treten hat etwas Tröstliches, denn es führt uns vor Augen, wie wenig sich ungeachtet aller technologischen Fortschritte an der menschlichen Existenz geändert hat. Es macht uns zu Mitgliedern einer menschlichen Gemeinschaft, die über Zeit und Sterblichkeit erhaben ist. Seit Hume und Kant gibt es Zweifel daran, dass die menschliche Natur der Ethik besonders förderlich ist, weil die menschliche Kultur so viele unterschiedliche Facetten hat und selbst innerhalb von Gemeinschaften keine zwei Gemüter einander wirklich gleichen. Dennoch sind die ethischen Probleme, die Aristoteles beschreibt, von einer erstaunlichen Konstanz. Wenn er das Pronomen »wir« verwendet, meint er oftmals die Menschheit als Ganzes, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In einer besonders markanten Passage seiner Metaphysik kritisiert er frühere griechische Denker wie Hesiod für ihre unwissenschaftlichen, mythischen Berichte über die Ursprünge des Universums. Er sagt, Hesiod und die anderen Kosmologen hätten »nur daran gedacht, was ihnen selbst glaubwürdig erschien, aber auf uns keine Rücksicht genommen. Denn indem sie Götter zu Prinzipien machen und aus Göttern alles entstehen lassen, erklären sie dann, was nicht Nektar und Ambrosia gekostet habe, sei sterblich geworden.« Statt mit »uns«, der Menschheit, hätten sich die frühen Kosmologen nur mit »ihnen«, den privilegierten Gottheiten, beschäftigt, für die »wir« nur eine untergeordnete Rolle spielten.
Wenn Aristoteles Menschen beschreibt, die sich knauserig benehmen oder leicht in Zorn geraten, schildert er Verhaltensweisen, die heute keinen Deut anders sind. Und er selbst eignet sich als Vorbild für nahezu alle Lebenslagen. Er hat nicht nur aus seinem eigenen Leben, seiner Familie und seinen Freundschaften eine Erfolgsgeschichte gemacht, sondern auch politische Turbulenzen überlebt. Und auch wenn es Jahrzehnte des Abwartens und der Vorbereitungen bedurfte, gelang es ihm schließlich, seine eigene Schule zu gründen und die meisten seiner Ideen zu Papyrus zu bringen.
*
Aristoteles wurde 384 v. Chr. als Sohn einer Arztfamilie in Stageira, einem kleinen, damals selbstständigen Stadtstaat an der Ostküste der Halbinsel Chalkidike geboren. Sein Vater Nikomachos scheint ein hervorragender Arzt gewesen zu sein, immerhin diente er dem Makedonenkönig Amyntas III. als Leibarzt. Doch Aristoteles’ Kindheit verlief nicht behütet. Im Alter von etwa dreizehn Jahren verlor er vor dem Hintergrund immer heftiger werdender militärischer Auseinandersetzungen in der griechischsprachigen Welt seine Eltern. Proxenos, der Ehemann seiner Schwester, nahm den Jungen auf und kümmerte sich um seine Ausbildung. Es gelang Aristoteles, sich in einer Zeit ethisch zu verhalten, als die moralischen Standards oftmals erschreckend niedrig waren. Er betrachtete das Problem als Chance und verbrachte einen Großteil seines Lebens damit, seine Erkenntnisse zu vertiefen.
Mit siebzehn zog es Aristoteles nach Athen, wo er in Platons Akademie eintrat. Nach dessen Tod im Jahr 347 v. Chr. nahm er eine Einladung an den Hof von Hermias an, dem Herrscher über Assos und Atarneus im nordwestlichen Kleinasien. Später besiegelte er die Freundschaft mit dem König, indem er dessen Tochter Pythias heiratete. Im Alter von etwa vierzig Jahren segelte Aristoteles nach Lesbos, wo er sich der Erforschung der Tierwelt widmete und somit die Zoologie begründete. Doch sein Leben nahm erneut eine Wendung, als Philipp II. von Makedonien ihn im Jahr 343 v. Chr. zum Lehrer seines jungen Sohnes berief, aus dem später Alexander der Große werden sollte. Im Nymphäum von Mieza, einer etwa fünfzig Kilometer südlich der Hauptstadt Pella gelegenen Stadt, ließ Philipp eine Schule für Aristoteles errichten. Die internationale Lage verschärfte sich durch Philipps Expansionspolitik, und Aristoteles’ Anstellung war bereits beendet, als Alexander nach der Ermordung seines Vaters dessen Nachfolge antrat. Von 338 bis 336 v. Chr. hielt sich der Gelehrte möglicherweise in Epirus und Illyrien auf dem westlichen Balkan auf.
Mit fast fünfzig ergriff Aristoteles schließlich seine Chance. Anders als in Robert Rossens Historienepos Alexander der Große von 1956 dargestellt, begleitete er Alexander nämlich nicht auf seinem Feldzug in den Osten. Er war kein junger Mann mehr und war sein Leben lang anderen zu Diensten gewesen – zuerst Platon in dessen Akademie und anschließend seinen reichen königlichen Gönnern. Doch nun war seine Zeit gekommen. Er kehrte nach Athen zurück und gründete auf dem Gelände des Lykeion seine eigene Schule, die erste Forschungs- und Lehruniversität der Welt. Obwohl er schon seit seiner Jugend ein Schreiber und Denker gewesen war, verfasste Aristoteles seine berühmten Abhandlungen nach Ansicht der meisten Gelehrten wohl erst während der zwölf Jahre als Leiter seiner Schule. Dazu sollen noch mindestens 130 weitere Schriften kommen, die nicht erhalten sind.
So ging leider auch das zweite Buch seiner Poetik verloren. Welchen Verlust das für die menschliche Kultur bedeutet, veranschaulichen Umberto Ecos Mittelalter-Krimi Der Name der Rose von 1980 und die Verfilmung mit Sean Connery aus dem Jahr 1986. Auf dem Höhepunkt der Geschichte verbrennen die letzten erhaltenen Manuskriptkopien von Aristoteles’ Gedanken zur Komödie in einem Feuer, gelegt von einem Mönch, für den alles Lachen sündhaft ist. Und so weit ist Ecos Darstellung vielleicht gar nicht von der Realität entfernt, denn tatsächlich wurden Schriften über das komische Theater in den mittelalterlichen Klöstern weitaus seltener abgeschrieben als etwa jene über Logik oder Moralphilosophie.
*
Obwohl man Aristoteles – nicht ganz zu Unrecht – nachsagt, einen eher nüchternen, kompromisslosen und schwierigen Schreibstil zu haben, finden sich in seinen Schriften auch zahllose Passagen, die vor Lebendigkeit geradezu strotzen.
Er besaß einen feinen Humor, der ihn befähigte, menschliche Schwächen mit einem Augenzwinkern zu betrachten. Er berichtet zum Beispiel von einer Feier, auf der er gemeinsam mit anderen Philosophen trank und einem Mann begegnete, der auf komische Weise die Maximen von Empedokles rezitierte – einem eher obskuren griechischen Denker, der seine Ansichten in langen Hexametern zum Ausdruck brachte. Aristoteles kannte viele Dichter persönlich und fand, dass sie oftmals von ihren eigenen literarischen Schöpfungen geradezu besessen waren, denn sie »lieben ihre eigenen Dichtungen über alle Maßen, als wären sie ihre Kinder«. Er mochte Anekdoten über harmlose Exzentriker. Etwa die Geschichte eines Mannes aus Byzantion, der sich zu einem Experten für Wettervorhersagen entwickelte, indem er beobachtete, wie die Igel, die er sich als Haustiere hielt, in nördliche oder südliche Richtung liefen. Oder die Geschichte über den Säufer aus Syrakus, der die Eier seiner Hühner bis zum Schlüpfen der Küken warmhielt, indem er sich über sie hockte und dabei unaufhörlich Wein trank.
Aristoteles behielt auch seine körperlichen Bedürfnisse im Auge. Er glaubte fest daran, dass Essen, Wein und Sex ganz wesentlich zum Glück eines Menschen beitragen können – sofern der Genuss auf konstruktive Weise und mit geliebten Menschen erfolgt. Ihn faszinierten Geschmack, Essen und Kochen und er interessierte sich für die Nahrungsmittel, die Menschen in ihren Gärten anbauten. Er hatte auch nichts gegen eine Massage und ein warmes Bad zur Entspannung einzuwenden und wusste so gut über Musik und das Erlernen von Instrumenten Bescheid, dass es sich um einen wichtigen Aspekt seines Lebens gehandelt haben muss. Und sein gewöhnlich gemäßigter Ton entgleitet ihm völlig, wenn er auf die eigensinnigen und pflichtvergessenen Frauen Spartas zu sprechen kommt, was vermuten lässt, dass er eine schwierige Beziehung zu einer von ihnen pflegte. In seiner Rolle als Vater und Onkel schreibt er von Geschenken, die Menschen ihren Kindern machen – von einem Ball zum Beispiel oder kleinen Ölfläschchen.
Die Abhandlungen über seine Forschungen und die Aufzeichnungen, die er zur Unterweisung seiner Studenten verwendete, sind inhaltlich allerdings zumeist sehr dicht und selbst in den neuesten und feinfühligsten Übersetzungen mühsam zu lesen. Andererseits war er sich durchaus im Klaren darüber, dass ein nicht speziell geschultes Publikum andere Anforderungen an die Vortragsweise eines Philosophen oder Wissenschaftlers stellte, und betrachtete beide Diskursformen als gleichwertig. Aristoteles blickte keineswegs auf »populärwissenschaftliche« Werke herab, sondern verfasste selber welche. So wissen wir, dass er auch öffentliche Vorträge hielt, die in der Antike als Exoterika bekannt waren (»exoterisch« bedeutet »nach außen gerichtet« oder »für weitere Kreise bestimmt«). Sie waren höchstwahrscheinlich in der gut verständlichen Dialogform verfasst, die Platon so populär gemacht hatte. Aristoteles selbst taucht als Teilnehmer dieser Dialoge auf, so wie Sokrates in den philosophischen Dialogen von Platon und Xenophon. Der in Stilfragen überaus bewanderte Cicero sagte, die öffentlichen Vorträge von Aristoteles seien »volkstümlich« (populariter) formuliert und hatte sicher diese Schriften vor Augen, als er den Schreibstil von Aristoteles mit einem »goldenen Strom« verglich. Die berühmteste seiner exoterischen Schriften war der Protreptikos oder Ermutigung zur Philosophie, ein beliebter Klassiker der Philosophie für »jedermann«. Ein Philosoph namens Krates stieß eines Tages darauf, »als er in einer Schusterwerkstatt saß«, und las ihn in einem Rutsch. Der Protreptikos bringt Aristoteles’ Leidenschaft für die Philosophie zum Ausdruck und beschreibt, was den Menschen am meisten von anderen Tieren unterscheidet, nämlich die schiere Kraft des menschlichen Geistes, der ihn auch dem am nächsten bringt, was Aristoteles schlicht »Gott« nennt. Obwohl die Griechen bekanntlich viele Götter anbeteten, war in der Philosophie die Vorstellung von einer höheren, einheitlichen göttlichen Kraft verbreitet, die das Universum antreibt. Und die wenigen überlieferten Fragmente des Protreptikos betonen, wie viel Spaß das Philosophieren machen kann. »Es ist schön, sich hinzusetzen und loszulegen.«
Beim Versuch, die aristotelische Philosophie wieder aufleben zu lassen, kommt man gerade als Frau nicht umhin, auf die Vorurteile hinzuweisen, die Aristoteles als wohlhabender alter Patriarch und Hausherr gegenüber Frauen und Sklaven hegte. Im ersten Buch der Politik verteidigt er bekanntermaßen die Sklaverei – zumindest die Versklavung von Nichtgriechen durch Griechen – und stellt unmissverständlich fest, dass Frauen den Männern geistig unterlegen seien. Ich habe mich allerdings nicht mit den (tatsächlich äußerst seltenen) Passagen aufgehalten, in denen er die irrige Sichtweise vertritt, Frauen und nichtgriechische Sklaven seien nicht mit den gleichen intellektuellen Fähigkeiten geboren worden wie griechische Männer.4 Aber das musste ich auch gar nicht, denn schließlich weist Aristoteles selbst wiederholt darauf hin, dass alle Ansichten immer wieder überprüft werden müssen.
In der Nikomachischen Ethik etwa schreibt er, dass Standhaftigkeit zwar eine wichtige Tugend sei, es bisweilen aber auch schädlich sein könne, allzu starr an Meinungen festzuhalten. Wenn es unwiderlegbare Beweise dafür gibt, dass die eigene Ansicht falsch ist, dann ist ein Sinneswandel sogar höchst lobenswert, mögen manche ihn auch als Unbeständigkeit verurteilen. Als Beispiel führt er das Verhalten des Neoptolemos im Philoktetes von Sophokles an. Darin wird Neoptolemos von Odysseus dazu überredet, den lahmen Philoktet zu belügen, doch als er sieht, wie Philoktet leidet, weigert er sich, die Täuschung aufrechtzuerhalten. Neoptolemos ändert also seine Ansicht. Und ich nehme an, wenn wir heute mit Aristoteles reden könnten, würde auch er seine Meinung über das weibliche Gehirn revidieren.
Obwohl traditionelle Ansichten (endoxa) laut Aristoteles durchaus ernst genommen werden und wenn nötig systematisch widerlegt werden müssen, hat er wenig für das Argument übrig, dass etwas gut ist, nur weil es auf unsere Vorfahren zurückgeht. Für Aristoteles unterscheiden sich die ersten Menschen nicht groß von den schlichteren Gemütern seiner eigenen Zeit, »daher ist es unsinnig, bei deren Auffassungen stehen zu bleiben«. Seiner Ansicht nach sollten auch schriftlich fixierte Gesetze geändert werden können, »denn wie bei anderen Fachkenntnissen so ist es auch bei der staatlichen Ordnung unmöglich, dass Vorschriften schriftlich erlassen werden, die alles genau regeln; man muss ja schriftliche Bestimmungen generell halten«.
Die traditionelle Bezeichnung für die aristotelische Denkschule lautet peripatetische Philosophie. Das Wort »peripatetisch« stammt vom Verb peripateo, das im Alt- und Neugriechischen so viel bedeutet wie »ich gehe umher«. Wie schon sein Lehrer Platon und dessen Lehrer Sokrates liebte Aristoteles es nämlich, beim Nachdenken umherzugehen. Viele bedeutende Philosophen taten es ihnen seither gleich und Nietzsche behauptete sogar, »nur die ergangenen Gedanken haben Wert«. Dennoch hätten die alten Griechen mit der romantischen Figur des einsam umherwandernden Weisen, wie ihn Rousseau in Die Träumereien des einsamen Spaziergängers (1778) beschreibt, wohl nicht viel anfangen können. Sie zogen es vor, in Gesellschaft umherzugehen und dabei die Bewegungsenergie in intellektuellen Fortschritt zu übersetzen, indem sie die Dialoge an den Rhythmus ihrer Schritte anpassten. Angesichts seines gewaltigen Beitrags zum menschlichen Denken und der schieren Anzahl seiner bahnbrechenden Werke müssen Aristoteles und seine Schüler Tausende von Kilometern in der zerklüfteten griechischen Landschaft zurückgelegt haben.
Für die alten Griechen hatte die intellektuelle Erkundung viel mit einer Reise gemein. Diese Vorstellung reicht bis zu Homers Odyssee zurück, wo seine Irrfahrten es Odysseus ermöglichen, die Länder vieler verschiedener Völker zu besuchen »und etwas über ihren Verstand zu erfahren«. In klassischer Zeit machte man bei der Entwicklung einer Vorstellung oder eines Gedankens einen metaphorischen »Spaziergang«. In einer Komödie, die etwa zwanzig Jahre vor Aristoteles’ Geburt in Athen uraufgeführt wurde, wird dem Tragiker Euripides davon abgeraten, eine tendenziöse Behauptung zu »gehen«, die er niemals belegen kann. Und in einem medizinischen, dem Arzt Hippokrates zugeschriebenen Text wird der Akt des Denkens zu einem Spaziergang zur Ertüchtigung des Geistes: »Bei den Menschen ist das Denken der Seele Umherwandeln.«
Aristoteles selbst verwendet diese Metapher zu Beginn von Über die Seele, seiner bahnbrechenden Untersuchung über die Natur des menschlichen Bewusstseins. Dort sagt er, dass wir auch Ansichten früherer Denker hinzuziehen müssen beim »Durchgang durch die Schwierigkeiten, die es im Voranschreiten zu bewältigen gilt«. Das hier verwendete Wort für »Durchgang« lautet poros, was einen Weg, eine Brücke, eine Furt, einen Pass oder eine Passage durch Meerengen, Wüsten und Wälder meinen kann. Die Physik, seine Untersuchung über Naturvorgänge, eröffnet Aristoteles mit der Einladung, nicht den Weg, sondern gleich die Schnellstraße mit ihm zu beschreiten: Der Weg (hodos) der Untersuchung muss von vertrauten Dingen ausgehen und sich auf Dinge zubewegen, die für uns schwieriger zu verstehen sind.
Der Standardbegriff für ein philosophisches Problem lautete aporia, was »Mangel an Wegen« bedeutet. Aber die Bezeichnung »Peripatetiker« blieb aus zwei Gründen an den Vertretern der aristotelischen Denkschule haften. Zum einen gründet sein gesamtes Gedankensystem auf der Begeisterung für die berührbaren Details der physischen Welt um uns herum. Aristoteles war ebenso empirischer Naturwissenschaftler wie ein Philosoph des Geistes. Seine Schriften preisen die Stofflichkeit des Universums, das wir mit unseren Sinnen erfassen können und von dem wir wissen, dass es wirklich ist. Seine Werke zur Biologie vermitteln das Bild eines Mannes, der alle paar Minuten innehält, um eine Muschel aufzuheben, eine Pflanze zu betrachten oder dem Gesang einer Nachtigall zu lauschen. Zum anderen verachtete Aristoteles – anders als Platon – den menschlichen Körper keineswegs, sondern sah den Menschen als hochbegabtes Tier, dessen Bewusstsein untrennbar mit seinem organischen Wesen verbunden ist, dessen Hände ein wahres mechanisches Wunder sind und für den das körperliche Vergnügen ein Wegweiser zu einem tugendhaften und glücklichen Leben ist. Während wir Aristoteles lesen, sehen wir ihn regelrecht vor uns, wie er seine Gedanken mit eigener Hand zu Papyrus brachte. Und das unermüdliche Gehirn, dem diese Gedanken entsprangen, war Bestandteil eines durchtrainierten Körpers, den er mochte. Der Begriff »peripatetisch« impliziert jedoch noch etwas anderes. Im Matthäusevangelium fragen die Pharisäer Jesus von Nazareth, warum seine Jünger nicht nach den strengen jüdischen Regeln leben. Und das Verb für »leben« im griechischen Text lautet peripateo. Das griechische Wort für »umhergehen« konnte also auch bedeuten »sein Leben nach bestimmten ethischen Grundsätzen führen«. Doch anstatt einen religiösen Weg einzuschlagen, entschieden sich die wandernden Jünger des Aristoteles dafür, ihrem Meister auf dem philosophischen Pfad zum Glück zu folgen.
Ich habe das Wandern immer geliebt und viele meiner besten Ideen kommen mir auf den schlammigen Reitwegen von Cambridgeshire. Ich bin eine anglikanische Pastorentochter, die im Alter von dreizehn Jahren ihren Glauben verlor. Und das vor allem deshalb, weil die Kirche darauf beharrte, dass ich als gute Christin an übernatürliche Erscheinungen glauben und Wesenheiten anbeten müsse, die für meine Sinne unsichtbar und unhörbar blieben. Ich konnte mit dem unsichtbaren Freund, den ich zuvor Gott genannt hatte, einfach nicht mehr in Kontakt treten. Dieser neue Sinn für Weltlichkeit hinterließ eine große Lücke in mir. Als kleines Kind zweifelte ich keinen Augenblick daran, als guter Mensch in den Himmel zu kommen. Doch nun fühlte ich mich wie der mit seinem Glauben ringende Ritter Antonius Block in Ingmar Bergmans Filmklassiker Das siebente Siegel (1957), der während der Pest im 14. Jahrhundert verzweifelt nach dem Sinn des Lebens sucht: »Kein Mensch kann mit dem Tod vor Augen leben in der Gewissheit, dass alle Dinge nichts sind.« Es ist vielleicht kein Zufall, dass auch Bergmans Vater ein (protestantischer) Pastor war. Ich glaubte jedenfalls nicht mehr, dass es »da draußen« im Kosmos irgendjemanden oder irgendetwas gab, das mein Leben kontrollierte und mich für tugendhafte Taten belohnte bzw. für unmoralische bestrafte. Ich wusste nicht, womit ich diese Lücke ausfüllen sollte, sehnte mich aber immer noch danach, ein guter Mensch zu sein und ein konstruktives Leben zu führen. Ja, wie so viele junge Menschen wollte ich die Welt zu einem besseren Ort machen.
In der Mitte meiner Teenagerjahre experimentierte ich deshalb kurzzeitig mit Astrologie, Buddhismus und transzendentaler Meditation und beschäftigte mich, wenn auch nur sehr flüchtig, sogar mit Alternativen wie Psychopharmaka und Spiritualismus. Ich las Dale Carnegies Klassiker Sorge dich nicht – lebe! (1948) und andere Selbsthilfebücher, blieb jedoch weiterhin auf der Suche nach einem praktikablen und von Grund auf optimistischen Moralsystem. Erst als Studentin entdeckte ich Aristoteles und hatte die Antwort. Denn er erklärt die materielle Welt mithilfe der Wissenschaft und die Moral anhand menschlicher Maßstäbe statt durch äußere, von einer Gottheit auferlegte Standards.
Aristoteles hat als Erster darauf hingewiesen, dass keine Philosophie oder Wissenschaft rein theoretisch sein kann. Dazu sind unsere Ideen, unser Selbstverständnis und unsere Erklärungen für die Welt um uns herum viel zu eng mit unseren gelebten Erfahrungen verknüpft. Aristoteles selbst lebte an acht verschiedenen Orten in Griechenland (siehe die Karte am Anfang des Buches), und im April 2016 besuchte ich sie alle, um seine Erfahrungen besser nachvollziehen zu können. Ich folgte den Spuren seines Lebens und versuchte, ein Gefühl für die Lebenswirklichkeit des Mannes zu bekommen, für die Wege, die er mit seinen Füßen beschritt, während in seinem Kopf die philosophischen Ideen heranreiften, mit denen er den Herausforderungen und Chancen des Lebens begegnete.5
Themistios, einer der bedeutendsten Aristoteles-Kommentatoren der Antike, sagte, er sei »für die Masse der Menschen nützlicher« als andere Denker. Das gilt nach wie vor. Der Philosoph Robert J. Anderson etwa schrieb 1986: »Kein anderer antiker Denker äußert sich direkter zu den Sorgen und Ängsten des heutigen Lebens als Aristoteles. Und es ist fraglich, ob irgendein moderner Denker den Menschen in diesen unsicheren Zeiten mehr zu bieten hat.«6 Tatsächlich kann Aristoteles’ praktische Herangehensweise an die Philosophie das Leben eines jeden Menschen zum Besseren wenden.
** Ihr inzwischen ikonischer Ausspruch aus dem englischen Peanuts-Original lautet: »Happiness is a warm puppy.«
KAPITEL 1
GLÜCK
Zu Beginn der Eudemischen Ethik zitiert Aristoteles eine Zeile aus der Weisheitsliteratur, die in einen alten Stein auf Delos eingemeißelt ist. In der Inschrift heißt es, die drei besten Dinge im Leben seien Gerechtigkeit, Gesundheit und die Erfüllung der eigenen Wünsche. Dem widerspricht Aristoteles entschieden. Seiner Ansicht nach ist das Glück das ultimative Ziel des Lebens. Und das besteht darin, eine Aufgabe zu finden, die einem hilft, sein Potenzial auszuschöpfen und an sich zu arbeiten, um die bestmögliche Version seiner selbst zu werden. Denn jeder agiert als sein eigener Moralbeauftragter in einer vernetzten Welt, in der Partnerschaften mit anderen Menschen von großer Bedeutung sind.