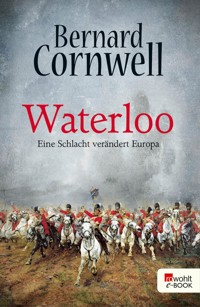
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Die berühmteste Schlacht der Geschichte – Bernard Cornwell bringt sie uns näher denn je. Platz 1 der Sunday-Times-Bestsellerliste Bernard Cornwell kennt man als meisterhaften Erzähler, doch nichts beherrscht er so glänzend wie Schlachtenbeschreibungen. Nun hat er unter Verwendung zahlreicher historischer Quellen – Tagebücher, Briefe, Depeschen, Erinnerungen – über die wohl berühmteste Schlacht der Neuzeit geschrieben: ein Sachbuch – so spannend wie seine Romane. Napoleon schlägt seine letzte Schlacht: gegen eine Allianz aus Briten, Preußen, Niederländern. Die mächtigsten Kombattanten aber heißen Regen, Schlamm, Hunger. Die Gegner des Korsen begegnen einander mit Misstrauen. Dummheit und Hochmut führen auf beiden Seiten zu fatalen Entscheidungen, doch am Ende ragen aus den Meeren von Blut und Dreck, aus den Geschichten über Versagen und Verrat auch solche von Genie und Heldentum hervor. Und der Leser weiß, wie furchtbar auch vor dem Zeitalter der industriellen Kriegsführung das Töten und Sterben an dem Ort war, den man das Feld der Ehre nennt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 514
Ähnliche
Bernard Cornwell
Waterloo
Eine Schlacht verändert Europa
Aus dem Englischen von Karolina Fell und Leonard Thamm
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Die berühmteste Schlacht der Geschichte – Bernard Cornwell bringt sie uns näher denn je. Platz 1 der Sunday-Times-Bestsellerliste
«Ich glaube, Bernard Cornwell schreibt bessere Schlachtenszenen als irgendein anderer Autor, der je gelebt hat.» (George R. R. Martin)
Ein kleines Dorf in der Nähe von Brüssel im Sommer 1815. Hier tritt Napoleon seinen letzten Kampf an: gegen eine Allianz aus Briten, Preußen, Holländern. Die mächtigsten Kombattanten aber heißen Regen, Schlamm, Hunger. Die Gegner Napoleons behandeln einander mit Misstrauen. Dummheit und Hochmut führen auf beiden Seiten zu fatalen Entscheidungen, doch am Ende, nachdem der Leser vom Autor durch Meere von Blut und Dreck gezerrt wurde, liest er neben Geschichten von Versagen und Verrat auch solche von Genie und Heldentum. Und er weiß, wie furchtbar auch vor dem Zeitalter der industriellen Kriegsführung das Töten und Sterben auf dem Feld der Ehre war.Bernard Cornwell kennt man als meisterhaften Erzähler, seine Bücher sind rund um den Globus Bestseller. Nun hat er unter Verwendung faszinierender historischer Quellen über Waterloo geschrieben: ein Sachbuch – so spannend wie seine Romane.
Über Bernard Cornwell
Bernard Cornwell, geboren 1944, machte nach dem Studium Karriere bei der BBC. Nach Übersiedlung in die USA entschloss er sich, einem langgehegten Wunsch nachzugehen, dem Schreiben. Im englischen Sprachraum gilt er als unangefochtener König des historischen Abenteuerromans. Bernard Cornwells Werke wurden in über 20 Sprachen übersetzt, die Gesamtauflage liegt bei mehr als 20 Millionen Exemplaren.
Inhaltsübersicht
«Das Feld von Waterloo, vom Picton-Baum aus», von J.M.W. Turner, circa 1833. Das Gemälde überzeichnet die Abschüssigkeit der Talhänge ganz erheblich, doch es vermittelt, wie klein das Schlachtfeld war.
Vorwort
Warum noch ein weiteres Buch über Waterloo? Das ist eine gute Frage. Es herrscht wahrlich kein Mangel an Darstellungen der Schlacht, in der Tat ist es eine der am besten erforschten und beschriebenen Schlachten der Weltgeschichte. Am Abend jenes grauenvollen Tages im Juni 1815 wusste jeder Überlebende der Schlacht, dass er etwas Einzigartiges durchgestanden hatte, und die Folge davon waren Hunderte Biographien und Briefe, die diese Erfahrung beschrieben. Und doch hatte der Duke of Wellington sicher recht, als er sagte, man könne «ebenso wenig die Geschichte eines Balls», also eines Tanzvergnügens, schreiben wie die Geschichte einer Schlacht. Jeder Teilnehmer eines Balls behält eine andere Erinnerung an das Ereignis im Gedächtnis, manch glückliche, manch traurige; und wie könnte irgendjemand in diesem Wirbel von Musik und Ballkleidern und Flirts hoffen, einen zusammenhängenden Bericht davon geben zu können, was, wann und wem geschehen ist? Waterloo allerdings war das entscheidende Ereignis zu Beginn des 19. Jahrhunderts, und seither haben Männer und Frauen versucht, ebendiesen zusammenhängenden Bericht zu liefern.
Über Folgendes herrscht Einigkeit: Napoleon greift Wellingtons rechte Flanke an, um die Reserven des Duke auf diesen Bereich des Schlachtfeldes zu locken, und startet dann einen massiven Angriff auf die linke Flanke des Duke. Der Angriff scheitert. Akt zwei ist der große Kavallerieangriff auf die rechte Mitte des Duke, und Akt drei, als die Preußen von links ins Geschehen eingreifen, ist der verzweifelte letzte Sturm der unbesiegten Garde impériale. Erweitert werden kann die Schilderung mit den Nebenschauplätzen des Angriffs auf Hougoumont und des Falls von La Haie Sainte. Als Rahmenhandlung hat diese Darstellung einiges für sich, doch die Schlacht war wesentlich komplexer, als es diese einfache Geschichte nahelegt. Den Männern, die dabei waren, erschien sie nicht einfach oder erklärbar, und einer der Gründe, dieses Buch zu schreiben, war der Versuch, einen Eindruck davon zu vermitteln, wie es war, an diesem verworrenen Tag auf diesem Schlachtfeld zu sein.
Die Überlebenden dieses Durcheinanders wären sicher von der Einschätzung irritiert, Waterloo sei nicht so wichtig gewesen und Napoleon hätte – wenn er gewonnen hätte – immer noch übermächtige Gegner und die endgültige Niederlage vor sich gehabt. Das stimmt wahrscheinlich, aber sicher ist es nicht. Wenn der Kaiser auf die Kuppe von Mont-Saint-Jean vorgestoßen wäre und Wellington in einen überstürzten Rückzug getrieben hätte, dann hätte er es immer noch mit den gewaltigen Armeen von Österreich und Russland zu tun gehabt, die auf Frankreich zumarschierten. Doch das geschah nicht. Napoleon wurde bei Waterloo gestoppt, und das verleiht der Schlacht ihre Bedeutung. Sie ist ein Wendepunkt der Geschichte, und zu sagen, die Geschichte hätte ohnehin an einem Wendepunkt gestanden, nimmt dem Moment, in dem die Wende geschah, nichts von seiner Tragweite. Manche Schlachten ändern nichts. Waterloo aber änderte fast alles.
Militärgeschichte kann verwirrend sein. Römische Zahlen (IV. Korps) treffen auf arabische Zahlen (3rd Division), und solche Bezeichnungen können Menschen ohne militärische Vorkenntnisse leicht durcheinanderbringen. Ich habe mich bemüht, zu viel Unübersichtlichkeit zu vermeiden, womöglich aber noch dazu beigetragen, indem ich die Worte «Bataillon» und «Regiment» synonym verwendet habe, obwohl sie schlicht nicht dasselbe bezeichnen. Das Regiment war eine Verwaltungseinheit in der britischen Armee. Einige Regimenter bestanden aus einem einzigen Bataillon, die meisten hatten zwei Bataillone, und ein paar hatten drei oder sogar noch mehr. Es kam äußerst selten vor, dass zwei britische Bataillone desselben Regiments Seite an Seite in einem Feldzug kämpften, und bei Waterloo bildeten nur zwei Regimenter diese Ausnahme. Das 1st Regiment of Foot Guards hatte sein 2nd und 3rd Battalion in der Schlacht, und die 95th Rifles waren mit drei Bataillonen dabei. Sämtliche weiteren Bataillone waren die einzigen Vertreter ihrer Regimenter; wenn ich mich also auf das 52nd Regiment beziehe, meine ich das 1st Battalion dieses Regiments. Gelegentlich benutze ich der Deutlichkeit halber den Begriff Gardist, obwohl die Privates der British Guards im Jahr 1815 immer noch als «Private» bezeichnet wurden.
Alle drei Armeen bei Waterloo waren in Korps unterteilt, und sowohl die britisch-niederländische als auch die preußische Armee besaßen drei Korps. Die französische Armee bestand aus vier Korps, weil die Garde impériale, auch wenn sie nicht als Korps bezeichnet wurde, im Grunde eines war. Ein Korps konnte jede Größe von 10000 bis 30000 Mann oder mehr haben und war als unabhängige Kraft gedacht, die imstande sein sollte, Kavallerie, Infanterie und Artillerie aufzubieten. Ein Korps war wiederum in Divisionen unterteilt, so war das französische 1. Armeekorps in vier Infanteriedivisionen unterteilt, jede zwischen 4000 und 5000 Mann stark, sowie eine Kavalleriedivision mit etwas über 1000 Mann. Jede Division besaß zur Unterstützung ihre eigene Artillerie. Eine Division konnte weiter in Brigaden aufgeteilt sein, so bestand die 2. Infanteriedivision des 1. Armeekorps aus zwei Brigaden, eine davon umfasste sieben Bataillone, die andere sechs. Bataillone wiederum waren in Kompanien unterteilt; ein französisches Bataillon hatte acht Kompanien, ein britisches hatte zehn. Der in diesem Buch am häufigsten verwendete Begriff ist Bataillon (manchmal Regiment genannt). Das größte britische Infanteriebataillon bei Waterloo bestand aus über 1000 Mann, im Durchschnitt aber gehörten zu einem Bataillon in allen drei Armeen etwa 500 Mann. Kurz gesagt war die Hierarchie wie folgt: Armee, Korps, Division, Brigade, Bataillon, Kompanie.
Manche Leser könnten sich an der Bezeichnung «englische Armee» stören, wenn offenkundig von der britischen Armee die Rede ist. Ich habe den Begriff «englische Armee» nur benutzt, wenn er in den Originalquellen aufgetaucht ist, weil ich anglais nicht mit britisch übersetzen wollte. Es gab keine «englische Armee», aber im frühen neunzehnten Jahrhundert war es eine gebräuchliche Bezeichnung.
Die Schlachten vom 16. und 18. Juni 1815 liefern den Stoff für eine überwältigende Erzählung. Die Geschichte schenkt den Autoren historischer Romane selten eine stimmige Handlung mit großartigen Charakteren, die innerhalb eines abgesteckten Zeitrahmens agieren, deshalb sind wir gezwungen, die Geschichte zu manipulieren, damit unsere eigenen Romanhandlungen funktionieren. Doch als ich Sharpes Waterloo geschrieben habe, ist mein eigener Plot beinahe vollständig hinter der großartigen Geschichte der tatsächlichen Schlacht verschwunden. Denn es ist eine großartige Geschichte, nicht nur wegen der Kombattanten, sondern auch in ihrem Verlauf. Sie ist ein Cliffhanger. Ganz gleich, wie oft ich Berichte von diesem Tag lese, der Ausgang ist immer noch spannungsgeladen. Die ungeschlagene Garde impériale rückt auf den Hügelkamm vor, auf dem Wellingtons angeschlagene Einheiten kurz vor dem Zusammenbruch stehen. Weiter östlich schlagen die Preußen ihre Klauen in Napoleons rechte Flanke, doch wenn die Garde Wellingtons Männer ausschalten kann, hat Napoleon immer noch Zeit, gegen Blüchers anrückende Truppen umzuschwenken. Es ist beinahe der längste Tag des Jahres, noch zwei Stunden ist es hell und damit Zeit genug, um eine oder sogar zwei Armeen zu schlagen. Wir mögen wissen, wie es ausgeht, aber wie alle guten Geschichten verträgt auch diese eine Wiederholung.
Also kommt sie hier noch einmal, die Geschichte einer Schlacht.
Einleitung
Im Sommer 1814 war Seine Gnaden der Duke of Wellington auf dem Weg von London nach Paris, um sein Amt als britischer Botschafter bei der neuen Regierung von Louis XVIII anzutreten. Man hätte erwarten können, dass er die kurze Strecke von Dover nach Calais nehmen würde, doch stattdessen fuhr er auf einer Brigg der Königlichen Marine, der HMSGriffon, über die Nordsee nach Bergen op Zoom. Er besuchte das neu geschaffene Königreich der Niederlande, eine sperrige Erfindung, halb französisch und halb holländisch, halb katholisch und halb protestantisch, das nördlich von Frankreich lag. Britische Truppen waren in den neuen Staat entsandt worden, um seinen Bestand zu garantieren, und der Duke war gebeten worden, die Verteidigungsanlagen entlang der französischen Grenze zu inspizieren. Begleitet wurde er vom «Schlanken Billy», auch bekannt als «Junger Frosch», dem zweiundzwanzigjährigen Prinz Wilhelm, Kronprinz des neuen Königreiches, der, weil er während des Spanischen Unabhängigkeitskrieges auf der Iberischen Halbinsel im Stab des Duke gedient hatte, glaubte, Talent als Militär zu besitzen. Der Duke bereiste zwei Wochen lang das Grenzland und empfahl die Instandsetzung der Festungsbauten einer Handvoll Städte, doch es ist kaum anzunehmen, dass er die Möglichkeit eines neuerlichen Krieges mit Frankreich allzu ernst nahm.
Napoleon war schließlich besiegt und ins Exil auf die Mittelmeerinsel Elba geschickt worden. Frankreich war wieder eine Monarchie. Die Kriegshandlungen waren beendet, und in Wien schmiedeten die Diplomaten den Vertrag, der die europäischen Grenzen neu festlegen würde, um zu gewährleisten, dass kein weiterer Krieg den Kontinent verwüstete.
Und Europa war verwüstet worden. Napoleons Abdankung hatte einundzwanzig Jahre währende Kriegshandlungen beendet, die in Folge der Französischen Revolution eingesetzt hatten. Die alten Regierungen Europas, die Monarchien, waren entsetzt von den Geschehnissen in Frankreich und bestürzt über die Hinrichtung Louis’ XVI und seiner Königin Marie Antoinette. Aus Furcht davor, dass sich die Ideen der Revolution in Europa verbreiten würden, waren sie in den Krieg gezogen.
Sie hatten einen schnellen Sieg über die zerlumpte Armee des revolutionären Frankreichs erwartet, doch stattdessen entflammten sie einen Weltkrieg, in dessen Verlauf sowohl Washington als auch Moskau brannten. Sie hatten in Indien, Palästina, auf den Westindischen Inseln, in Ägypten und Südamerika gekämpft, doch Europa hatte am schwersten gelitten. Frankreich hatte den ersten Ansturm überstanden, und aus den Wirren der Revolution erhob sich ein Genie, ein Kriegsfürst, ein Kaiser. Napoleons Armeen hatten die Preußen geschlagen, die Österreicher und die Russen, sie waren vom Baltikum bis zur Südküste Spaniens gezogen, und die willensschwachen Brüder des Kaisers waren in halb Europa auf den Thron gesetzt worden. Millionen Menschen waren umgekommen, doch nach zwei Jahrzehnten war alles vorbei. Der Kriegsfürst war in Gefangenschaft.
Napoleon hatte Europa beherrscht, doch es gab einen Feind, dem er niemals begegnet war und den er niemals besiegt hatte, und das war der Duke of Wellington, dessen militärisches Ansehen nur noch von dem Napoleons übertroffen wurde. Wellington war als Arthur Wesley geboren worden, er war der vierte Sohn des Earl und der Countess of Mornington. Die Wesley-Sippe gehörte zur angloirischen Aristokratie, und Arthur verbrachte den größten Teil seiner Jugend in seinem Geburtsland Irland, den größten Teil seiner Erziehung allerdings erhielt er am Eton College, wo er sich nicht wohlfühlte. Seine Mutter Anne verzweifelte beinahe an ihm. «Ich weiß nicht, was ich mit meinem linkischen Sohn Arthur machen soll», beschwerte sie sich, doch die Lösung war, wie bei so vielen jüngeren Söhnen aus Adelsfamilien, für ein Offizierspatent bei der Armee zu sorgen. Und so begann eine außergewöhnliche Karriere, als der linkische Arthur sein Talent für das Kriegshandwerk entdeckte. Die Armee erkannte dieses Talent und belohnte es. Zuerst befehligte er einen Kampfverband in Indien, wo er eine ganze Reihe erstaunlicher Siege errang, dann wurde er nach Britannien zurückbeordert und mit dem Kommando über die kleine Expeditionsarmee betraut, die versuchen sollte, Frankreich an der Besetzung Portugals zu hindern. Diese kleine Armee wurde zu dem schlagkräftigen Kampfverband, der Portugal und Spanien befreite und in Südfrankreich einmarschierte. Eine Schlacht nach der anderen wurde gewonnen. Aus Arthur Wellesley (die Familie hatte den Nachnamen Wesley abgeändert) war der Duke of Wellington und zugleich einer der beiden anerkanntermaßen bedeutendsten Soldaten seines Zeitalters geworden. Alexander I., der russische Zar, nannte ihn «Le vainqueur du vainqueur du monde», den Bezwinger des Weltbezwingers, und der Weltbezwinger war selbstredend Napoleon. Und in einundzwanzig Jahren Krieg hatten der Duke und Napoleon nie gegeneinander gekämpft.
Der Duke wurde ständig mit Napoleon verglichen, doch als er im Jahr 1814 gefragt wurde, ob er es bedaure, dem Kaiser niemals in der Schlacht gegenübergestanden zu haben, gab er zurück: «Nein, und ich bin sogar sehr froh darüber.» Er verachtete den Menschen Napoleon, bewunderte jedoch den Soldaten Napoleon, und er glaubte, die Anwesenheit des Kaisers auf dem Schlachtfeld sei 40000 Mann wert. Und der Duke of Wellington hatte, anders als Napoleon, noch niemals eine Schlacht verloren, aber gegen den Kaiser kämpfen zu müssen, konnte ihm sehr wohl diese außergewöhnliche Bilanz vermiesen.
Doch im Sommer 1814 konnte man es dem Duke nachsehen, dass er dachte, die Zeit des Kämpfens sei für ihn vorüber. Er wusste, wie gut er das Kriegshandwerk beherrschte, aber im Gegensatz zu Napoleon hatte er nie Vergnügen an der Schlacht gefunden. Der Krieg war für ihn eine bedauerliche Notwendigkeit. Wenn schon gekämpft werden musste, dann effizient und gut, aber das Ziel war der Friede. Er war inzwischen Diplomat, kein General mehr, aber alte Gewohnheiten wird man schwer los, und als er mit seinem Gefolge durch das Königreich der Niederlande reiste, sah der Duke viele Stellen, die, wie er notierte, «gute Standorte für eine Armee» wären. Einer dieser guten Standorte war ein Tal, das in den Augen der meisten Leute nicht mehr war als ein unauffälliger Streifen Ackerland. Wellington hatte immer ein scharfes Auge für Geländeformationen gehabt, konnte einschätzen, wie Hänge und Täler, Flüsse und Waldgebiete einen Befehlshaber beim Truppenkommando unterstützen oder behindern würden, und etwas an diesem Tal südlich von Brüssel erregte seine Aufmerksamkeit.
Es war ein weites Tal mit mäßig ausgeprägten Hängen. Ein kleines Gasthaus namens La Belle Alliance, «das schöne Bündnis», stand auf dem Kamm des südlichen Hangs, der auf beinahe der gesamten Länge höher war als der Kamm auf der Nordseite, der sich bis etwa 30 Meter über die Talsohle hob, also rund hundert Fuß, wobei der Abhang jedoch nirgends steil anstieg. Die beiden Höhenlinien der Hänge verliefen nicht ganz parallel. An manchen Stellen rückten sie recht dicht aneinander, doch wo die Straße nordwärts von Kamm zu Kamm führte, betrug die Entfernung zwischen den beiden Höhenlinien 1000 Meter. Es waren 1000 Meter gutes Ackerland, und als der Duke das Tal im Sommer 1814 sah, hatte er wohl hochgewachsene Roggenfelder beidseits der Straße vor sich, die intensiv von den Fuhrwerken genutzt wurde, die Kohle aus den Minen um Charleroi zu den Kaminen von Brüssel transportierten.
Der Duke sah noch viel mehr als das. Die Straße war eine der Hauptverbindungen von Frankreich nach Brüssel, wenn also ein Krieg ausbrechen sollte, wäre dies eine mögliche Invasionsroute. Eine französische Armee, die auf der Straße nordwärts zog, würde bei dem Gasthaus über den südlichen Hang kommen und das weite Tal vor sich haben. Und die Männer würden den Höhenzug des nördlichen Talhanges sehen. Höhenzug ist allerdings wirklich ein zu starkes Wort; sie würden die gerade Straße sehen, die zum Talgrund hin sanft abfiel, um dann, ebenso sanft, durch langgestreckte, wogende Getreidefelder auf der anderen Seite, wieder anzusteigen. Man denke sich diesen nördlichen Höhenkamm als Befestigungswall und statte diesen Wall nun mit drei Bastionen aus. Im Osten lag ein Dorf mit Steinhäusern, die eng um eine Kirche gruppiert waren. Wenn diese Gebäude und die außerhalb des Dorfes liegenden Gehöfte von Truppen besetzt würden, wäre es eine teuflisch schwierige Aufgabe, diese Truppen zu vertreiben. Hinter den Steinhäusern wurde die Landschaft rauer, die Hügel steiler und die Täler tiefer, kein Platz für Truppenmanöver, also stand das Dorf wie eine Festung am östlichen Ende des Höhenzugs. In der Mitte, und auf der halben Strecke Richtung Talsohle, lag am nördlichen Hang ein Gutshof namens La Haie Sainte. Es war ein massiver, gemauerter Komplex, und das Wohngebäude, die Scheunen und der Hof waren von einer hohen Steinmauer umgeben. La Haie Sainte stand einem direkten Angriff über die Straße im Weg, während sich im Westen ein großes Haus mit einem Garten befand, den eine Mauer einfriedete – das Château Hougoumont. Der nördliche Höhenzug des Tales ist also ein Hindernis mit drei Bastionen als Vorposten: dem Dorf, dem Gutshof und dem Château. Angenommen, eine Armee käme aus Frankreich, und angenommen, diese Armee wollte Brüssel einnehmen, dann würden dieser Höhenzug und diese Bastionen ihr Vorrücken behindern. Der Gegner müsste entweder die Bastionen einnehmen oder sie links liegen lassen, doch wenn er sie unbeachtet ließe, müssten sich seine Einheiten zwischen ihnen hindurchzwängen, während sie den nördlichen Abhang angriffen, und wären gefährlichem Kreuzfeuer ausgesetzt.
Die Eindringlinge würden den Höhenzug und seine Bastionen sehen, doch ebenso wichtig war, was sie nicht sehen konnten. Sie konnten nicht sehen, was jenseits des nördlichen Höhenkamms lag. Sie mochten wohl Baumkronen hinter dem Kamm erspähen, aber das Terrain im Norden war nicht einzusehen, und wenn diese französische Armee beschloss, Truppen auf diesem Nordhang anzugreifen, konnte sie nicht wissen, was auf der dahinter abfallenden Hangseite vor sich ging. Bewegten die Verteidiger weitere Einsatztruppen von einer Flanke auf die andere? Wurde dort zum Angriff gesammelt? Lauerte außer Sichtweite Kavallerie? Der Höhenzug, auch wenn er niedrig war und seine Hänge sanft, war trügerisch. Er bot dem Verteidiger enorme Vorteile. Natürlich würde sich der Gegner möglicherweise weniger entgegenkommend verhalten, als einen einfachen Frontalangriff durchzuführen. Er würde möglicherweise versuchen, den Höhenzug auf der Westflanke zu umgehen, wo das Gelände flacher war, aber der Duke merkte sich die Stelle trotzdem. Warum? Soweit er wusste, und in der Tat, soweit ganz Europa wusste, waren die Kriegshandlungen beendet. Napoleon war in die Verbannung geschickt, die Diplomaten schrieben in Wien an der neuen Friedensordnung, und dennoch legte der Duke Wert darauf, diese Stelle im Gedächtnis zu behalten, die einer einmarschierenden Armee auf dem Weg von Frankreich nach Brüssel das Leben schrecklich schwer machen würde. Es war nicht die einzige Route, die eine Invasionsarmee nehmen konnte, und nicht die einzige Verteidigungsstellung, die sich der Duke auf seiner zweiwöchigen Erkundungsmission notierte, aber der Höhenzug und seine Bastionen kreuzten eine der möglichen Invasionsrouten, denen eine französische Armee folgen konnte.
Der Duke ritt weiter, vorbei an La Haie Sainte, und kam zu einer Kreuzung auf dem Kamm des Höhenzugs und kurz darauf zu einem kleinen Dorf. Hätte sich der Duke nach dem Namen dieses Ortes erkundigt, hätte man ihm Mont-Saint-Jean gesagt, was gelinde gesagt amüsant war, denn dieser Sankt-Johanns-Berg war nichts weiter als eine leichte Erhebung in den weiten Feldern mit Roggen, Weizen und Gerste. Nördlich des Dörfchens wurde die Straße von einem großen Wald, dem Forêt de Soignes, verschluckt, und ein paar Kilometer die Straße hinauf lag eine kleine Stadt, ein weiterer unscheinbarer Ort, auch wenn es dort eine schöne Kuppelkirche und zahlreiche Wirtshäuser für durstige und müde Reisende gab. Im Jahr 1814 lebten in dieser Stadt weniger als zweitausend Menschen, allerdings hatte sie über zwanzig junge Männer an den langen Krieg verloren, und alle hatten für Frankreich gekämpft, denn die Stadt gehörte zur französischsprachigen Region der Provinz Belgien.
Wir wissen nicht, ob der Duke im Sommer 1814 in diesem Städtchen anhielt. Wir wissen, dass ihm Mont-Saint-Jean aufgefallen war, aber das nahegelegene Provinzstädtchen mit seiner schönen Kirche und den dicht gesäten Wirtshäusern? Behielt er diesen Ort im Gedächtnis?
Bald schon würde er ihn nie mehr vergessen.
Er hieß Waterloo.
Kapitel EinsGroßartige Neuigkeiten! Nap ist wieder in Frankreich gelandet. Hurra!
«Meine Insel ist keineswegs zu groß!», erklärte Napoleon, als er sich als Herrscher über Elba wiederfand, der winzigen Insel zwischen Korsika und Italien. Er war der Kaiser Frankreichs gewesen und Herrscher über vierundvierzig Millionen Menschen, nun aber, im Jahr 1814, regierte er nur noch über 223 Quadratkilometer und 11000 Untertanen. Dennoch war er entschlossen, ein guter Regent zu sein, und kaum angekommen, erließ er auch schon eine Reihe von Dekreten, um Bergbau und Landwirtschaft auf der Insel zu reformieren. Kaum etwas entging seiner Aufmerksamkeit: «Setzt den Verwalter», schrieb er, «von meiner Unzufriedenheit mit dem schmutzigen Zustand der Straßen in Kenntnis.»
Seine Planungen reichten weit über Straßenreinigung hinaus. Er wollte ein neues Hospital bauen, neue Schulen und neue Straßen, doch nie reichte das Geld. Das Frankreich der Restauration hatte zugesagt, Napoleon eine Subvention von jährlich zwei Millionen Francs zu zahlen, aber bald stellte sich heraus, dass dieses Geld niemals bezahlt werden würde, und ohne Geld konnte es keine neuen Hospitäler, Schulen oder Straßen geben. Verärgert über diesen Misserfolg zog sich der Kaiser in Unmut zurück, verbrachte seine Tage beim Kartenspiel mit seinen Bewachern und war sich ständig der britischen und französischen Kriegsschiffe bewusst, die Elbas Küsten sicherten, um dafür zu sorgen, dass er sein Liliput-Königreich nicht verließ.
Der Kaiser langweilte sich. Er vermisste seine Frau und seinen Sohn. Er vermisste auch Joséphine und war untröstlich, als die Nachricht von ihrem Tod Elba erreichte. Die arme Joséphine mit ihren schlechten Zähnen, ihrer trägen Art und ihrem grazilen Körper, eine Frau, die von jedem Mann angebetet wurde, der ihre Bekanntschaft machte, die Napoleon untreu war und der doch immer verziehen wurde. Er liebte sie, auch wenn er sich aus dynastischen Gründen von ihr hatte scheiden lassen. «Ich habe keinen Tag verbracht, an dem ich dich nicht geliebt habe», schrieb er ihr nach ihrem Tod, als würde sie noch leben, «ich habe keine Nacht verbracht, ohne dich in meine Arme zu schließen … keine Frau wurde jemals mit solcher Hingabe geliebt!»
Er langweilte sich, und er war wütend. Er war wütend auf Louis XVIII, der die vereinbarte Subvention nicht zahlte, und voller Zorn auf Talleyrand, einst sein eigener Außenminister, der nun beim Wiener Kongress für die französische Monarchie verhandelte. Talleyrand, gerissen, klug und doppelzüngig, warnte die anderen europäischen Gesandten, dass Napoleon niemals auf einer kleinen Mittelmeerinsel so nahe bei Frankreich festgehalten werden könne. Er wollte, dass der Kaiser weit weg an einen abgelegenen Ort wie die Azoren geschickt wurde, oder besser noch auf eine der Westindischen Inseln, wo das Gelbfieber grassierte, oder vielleicht auf ein Fleckchen in einem fernen Ozean, wie die Insel Sankt Helena.
Talleyrand hatte recht, während der britische Beauftragte, der nach Elba entsandt wurde, um ein wachsames Auge auf den Kaiser zu haben, unrecht hatte. Sir Neil Campbell glaubte, Napoleon habe sich in sein Schicksal ergeben, und schrieb dies an Lord Castlereagh, den britischen Außenminister. «Ich fange an zu denken», berichtete er, «dass er sich mit seinem Rückzug abgefunden hat.»
Doch der Kaiser hatte sich ganz und gar nicht damit abgefunden. Er verfolgte die Geschehnisse in Frankreich und nahm die Unzufriedenheit mit der restaurierten Monarchie zur Kenntnis. Große Teile der Bevölkerung waren erwerbslos, der Brotpreis war hoch, und diejenigen, die mit Erleichterung auf die Abdankung des Kaisers reagiert hatten, begannen nun, seiner Regierung nachzutrauern. Also fing er an, Pläne zu schmieden. Man hatte ihm eine kümmerliche Marine zugestanden, nicht annähernd groß genug, um die französischen und britischen Schiffe zu bedrohen, die ihn bewachten, und Mitte Februar 1815 befahl er, die Inconstant, die größte seiner Briggs, in den Hafen zu bringen, um, wie er anordnete, «ihren Kupferkiel zu überholen, die Lecks abzudichten und … sie wie die englischen Briggs anstreichen zu lassen. Ich will sie am 24. oder 25. dieses Monats fertig in der Bucht liegen haben.» Er befahl außerdem, zwei weitere große Schiffe zu chartern. Man hatte ihm erlaubt, tausend Soldaten nach Elba mitzunehmen, einschließlich vierhundert Veteranen aus seiner alten Garde impériale, der Kaiserlichen Garde, und ein Bataillon polnischer Ulanen, und mit diesen Einheiten würde er den Einmarsch in Frankreich wagen.
Und Sir Neil Campbell ahnte nichts. Sir Neil war ein achtbarer Mann, 1815 neununddreißig Jahre alt, und er hatte Karriere beim Militär gemacht, die beinahe 1814 geendet hätte, als er zum Militärattaché bei der russischen Armee ernannt wurde, die gerade in Frankreich einmarschierte. Er hatte Schlachten in Spanien überlebt, bei Fère-Champenoise allerdings hielt ihn ein übereifriger Kosake für einen Franzosen und verwundete ihn schwer.
Er überlebte und wurde zum britischen Beauftragten bei Seiner Hoheit Kaiser Napoleon, dem Regenten Elbas, ernannt. Lord Castlereagh betonte, Sir Neil sei nicht der Wärter des Kaisers, doch selbstverständlich gehörte es zu seinen Aufgaben, Napoleons Aktivitäten zu überwachen. Aber Sir Neil hatte sich einlullen lassen, und im Februar 1815, während die Inconstant als britisches Schiff getarnt wurde, erklärte er dem Kaiser, er müsse nach Italien segeln, um seinen Arzt zu konsultieren. Das mochte gestimmt haben, allerdings stimmte auch, dass Signora Bartoli, die Geliebte Sir Neils, in Livorno wohnte, und dorthin segelte er.
Der Kaiser wünschte Sir Neil alles Gute und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass er bis Monatsende zurückgekehrt wäre, weil die Principessa Borghese einen Ball plane, und Sir Neil versprach sein Bestes zu tun, um daran teilnehmen zu können. Die Principessa Borghese war Napoleons verführerische Schwester, die entzückende Pauline, die sich ihrem Bruder im Exil angeschlossen hatte. Geldknappheit hatte sie zum Verkauf ihres verschwenderisch ausgestatteten Hauses in Paris gezwungen, und gekauft worden war es von der britischen Regierung, die es als Botschaftsgebäude nutzte. Das bedeutete, dass es fünf Monate lang zum Sitz des Duke of Wellington wurde, der zum britischen Botschafter am Hofe Louis’ XVIII ernannt worden war. Das Haus in der rue du Faubourg Saint-Honoré ist ein Juwel und beherbergt die britische Botschaft bis heute.
Sir Neil segelte auf einer Brigg der Royal Navy nach Livorno, der Partridge, die normalerweise den Haupthafen von Elba blockierte. Mit dem Auslaufen der Partridge konnte der Kaiser sein Vorhaben umsetzen, und am 26. Februar segelte seine kleine Flotte mit nur 1026 Soldaten, 40 Pferden und 2 Kanonen nach Frankreich. Die Überfahrt dauerte zwei Tage, und am 28. Februar landete der Kaiser wieder in Frankreich. Er führte eine kümmerliche Streitmacht an, aber Napoleon war absolut zuversichtlich. «Ich werde in Paris ankommen», erklärte er seinen Soldaten, «ohne einen einzigen Schuss abzugeben!»
Mit einem Paukenschlag war der Friede beendet.
Im Winter 1814 auf 1815 trugen viele Frauen in Paris veilchenblaue Kleider. Das war nicht nur Mode, sondern mehr noch ein Code dafür, dass im Frühling das Veilchen zurückkehren würde. Das Veilchen war Napoleon. Seine geliebte Joséphine hatte bei ihrer Hochzeit Veilchen getragen, und er hatte ihr zu jedem Geburtstag einen Strauß geschickt. Vor seinem Exil auf Elba hatte er gesagt, er würde bescheiden wie das Veilchen sein. Jeder in Paris wusste, was Veilchenblau symbolisierte, und auch wenn die Franzosen anfänglich erleichtert über die Entthronung des Kaisers und das Ende der langen, verheerenden Kriege waren, fanden sie an seinem Nachfolger bald vieles auszusetzen. Die restaurierte Monarchie unter dem schwer übergewichtigen Louis XVIII erwies sich als räuberisch und unbeliebt.
Dann kehrte das Veilchen zurück. Alle erwarteten, dass die königliche Armee die lächerlich kleine Kampfeinheit Napoleons umgehend schlagen würde, doch stattdessen desertierten die Soldaten des Königs in hellen Scharen zu dem zurückgekehrten Kaiser, und innerhalb von Tagen druckten die französischen Zeitungen eine humorige Beschreibung seiner triumphalen Unternehmung. Es gibt unterschiedliche Versionen des Textes, diese hier aber war sehr verbreitet:
Der Tiger hat seine Höhle verlassen.
Das Ungeheuer war drei Tage auf See.
Der Schuft ist bei Fréjus gelandet.
Der Bussard hat Antibes erreicht.
Der Eindringling ist in Grenoble angekommen.
Der Tyrann hat Lyon betreten.
Der Usurpator ist fünfzig Kilometer vor Paris gesehen worden.
Morgen steht Napoleon vor unseren Toren!
Der Kaiser wird heute zu den Tuilerien vorrücken.
Seine Kaiserliche Majestät wird morgen zu seinen treuen Untertanen sprechen.
Seine Kaiserliche Majestät, Napoleon Bonaparte, war fünfundvierzig Jahre alt, als er den Palais des Tuileries betrat, wo eine begeisterte Menge seine Ankunft erwartete. Sie hatte sich schon Stunden zuvor versammelt. Der König, der fette Louis XVIII, war aus Paris nach Gent im Königreich der Niederlande geflohen, und auf den Teppich in seinem verlassenen Thronsaal waren Kronen gesteppt. Jemand aus der wartenden Menge versetzte einer der Kronen einen verächtlichen Tritt, sie löste sich, und so wurde offenbar, dass der königliche Besatz eine eingewebte Biene verdeckt hatte. Die Honigbiene war eines von Napoleons Symbolen, und die enthusiastische Menge ging auf die Knie, um die Kronen abzureißen und so den Teppich in seinem alten imperialen Glanz erstrahlen zu lassen.
Es wurde Abend, bis Napoleon in dem Palais eintraf. Die Wartenden hörten die Jubelgeräusche näher kommen, dann folgte Hufgeklapper im Vorhof, und schließlich war der Kaiser da, wurde auf Schultern die Treppe zum Audienzsaal hinaufgetragen. Ein Augenzeuge sagte: «Seine Augen waren geschlossen, seine Hände tasteten nach vorn, wie die eines Blinden, sein Glücksgefühl zeigte sich nur in seinem Lächeln.»
Was für einen Weg hatte er hinter sich! Nicht nur von Elba aus, sondern schon seit seiner wenig verheißungsvollen Geburt im Jahr 1769 (in dem auch der Duke of Wellington geboren wurde). Er wurde auf den Namen Nabulion Buonaparte getauft, was seine korsische Herkunft verrät. Seine Familie, die eine adlige Abstammung für sich geltend machte, war verarmt, und der junge Nabulion liebäugelte mit den Korsen, die sich verschworen, um die Unabhängigkeit von Frankreich zu erreichen, und dachte sogar daran, in die Royal Navy Großbritanniens einzutreten, dem stärksten Gegner Frankreichs. Doch stattdessen wanderte er nach Frankreich aus, französisierte seinen Namen und trat in die Armee ein. Im Jahr 1792 war er Leutnant, ein Jahr später, mit vierundzwanzig Jahren, Brigadegeneral.
Es gibt ein bekanntes Gemälde des jungen Napoleon, wie er den Großen Sankt Bernhard auf seinem Italienfeldzug überquert, der ihn schlagartig berühmt machte. Der Maler Louis David zeigt ihn auf einem sich aufbäumenden Pferd sitzend, und alles auf dem Gemälde ist in Bewegung; das Pferd bäumt sich auf, das Maul und die Augen weit aufgerissen, die Mähne windgepeitscht, am Himmel ziehen Sturmwolken auf, und der Umhang des Generals ist ein verschwenderischer Wirbel böig aufgeblähter Farbe. Doch im Zentrum dieses wildbewegten Bildes ist das ruhige Gesicht Napoleons. Er blickt verdrießlich und ernst, doch vor allem wirkt er ruhig. Das war es, was er von dem Maler verlangt hatte, und David lieferte das Bildnis eines Mannes, der sich mitten im Chaos vollkommen zu Hause fühlt.
Der Mann, der die Treppen im Palais des Tuileries hinaufgetragen wurde, hatte sich im Gegensatz zu dem jungen Helden mit dem blendenden Aussehen eines Rockstars stark verändert. Im Jahr 1815 gab es den gutaussehenden, schlanken jungen Mann nicht mehr, er war von einer dickbäuchigen, kurzhaarigen Gestalt mit schlaffem Kinn und sehr kleinen Händen und Füßen ersetzt worden. Er war nicht groß, knapp einen Meter siebzig, aber er war immer noch faszinierend. Dies war der Mann, der sich erhoben hatte, um über ganz Europa zu herrschen, ein Mann, der ein Reich erobert und wieder verloren hatte, der die Grenzen neu gezogen hatte, die Verfassung umgearbeitet und die Gesetze Frankreichs umgeschrieben hatte. Er war hochintelligent, geistreich, schnell gelangweilt, aber selten rachsüchtig. Die Welt würde bis ins zwanzigste Jahrhundert keinen seinesgleichen sehen, doch anders als Mao oder Hitler oder Stalin war Napoleon kein mörderischer Tyrann, obwohl er wie sie die Weltgeschichte veränderte.
Er war ein überragender Verwalter, doch er wollte nicht als Verwalter in Erinnerung bleiben. Vor allem war er ein Kriegsherr. Sein Vorbild war Alexander der Große. Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, im amerikanischen Sezessionskrieg, überwachte Robert E. Lee, der große General der Konföderierten, seine Truppen bei der Ausführung eines brillanten, siegreichen Manövers und sagte den denkwürdigen Satz: «Es ist gut, dass der Krieg so schrecklich ist, sonst würden wir anfangen, ihn zu mögen.» Napoleon hatte begonnen, ihn zu sehr zu mögen, er liebte den Krieg. Vielleicht war er seine größte Liebe, denn er verband die Erregung höchster Gefahr mit dem Freudenrausch des Sieges. Er hatte den präzisen Verstand eines großen Strategen, doch auch wenn der Marsch absolviert und der Gegner auf dem Flügel umgangen war, verlangte er weitere enorme Opfer von seinen Männern. Nach Austerlitz, als einer seiner Generäle die toten Franzosen beklagte, die auf dem gefrorenen Schlachtfeld lagen, gab der Kaiser scharf zurück, dass «die Frauen von Paris diese Männer in einer Nacht ersetzen können». Als Metternich, der kluge österreichische Außenminister, Napoleon 1813 ehrenhafte Bedingungen für einen Frieden anbot und den Kaiser auf die menschlichen Opfer hinwies, die eine Ablehnung zur Folge haben würde, erhielt er die verächtliche Antwort, Napoleon würde mit Freuden eine Million Mann opfern, um seine Ziele zu erreichen. Napoleon war das Leben seiner Soldaten gleichgültig, und dennoch verehrten ihn seine Männer, weil er gut mit Menschen umgehen konnte. Er wusste, wie er zu ihnen sprechen musste, konnte mit ihnen scherzen und wusste, wie man sie anfeuerte. Aber auch, wenn ihn seine Soldaten anbeteten, wurde er von seinen Generälen gefürchtet. Maréchal Augereau, ein unflätiger Zuchtmeister, sagte: «Dieser kleine Bastard von einem General jagt mir wirklich Angst ein!», und Général Vandamme, ein harter Mann, sagte, er habe «wie ein Kind gezittert», wenn er Napoleon gegenübertrat. Doch Napoleon führte sie alle zum Ruhm. Das war seine Droge, la Gloire! Und im Streben danach brach er einen Friedensvertrag nach dem anderen, und seine Truppen marschierten unter ihren Adlerstandarten von Madrid bis nach Moskau, von der Ostsee bis zum Roten Meer. Er überraschte Europa mit Siegen wie Austerlitz und Friedland, aber er führte seine Grande Armée auch im russischen Schnee in die Katastrophe. Selbst seine Niederlagen hatten gewaltige Dimensionen.
Nun musste er erneut marschieren, und er wusste es. Er schickte Unterhändler zu den anderen europäischen Mächten, sagte, er sei aufgrund des Volkswillens nach Frankreich zurückgekehrt, er wolle niemanden angreifen, und wenn sie seine Rückkehr akzeptierten, würde er in Frieden leben, doch er musste gewusst haben, dass diese Annährungsversuche abgelehnt würden.
Also würden die Adler wieder fliegen.
Der Duke of Wellington schwebte in Lebensgefahr. Ihn als Botschafter in Frankreich einzusetzen, war möglicherweise nicht der taktvollste Zug der britischen Regierung gewesen, und in Paris kochte die Gerüchteküche über ein bevorstehendes Attentat. Die Regierung in London wollte, dass der Duke Paris verließ, doch er weigerte sich, weil ihn ein solches Verhalten feige erscheinen lassen würde. Dann kam die perfekte Entschuldigung. Lord Castlereagh, der britische Außenminister und Chefunterhändler beim Wiener Kongress, wurde dringend in London gebraucht, und der Duke wurde auserkoren, ihn zu ersetzen. Niemand konnte das als feige Flucht vor der Gefahr hinstellen, denn es war offenkundig eine Beförderung, und so schloss sich der Duke den Diplomaten an, die mühsam versuchten, die Landkarte Europas neu zu zeichnen.
Und während sie debattierten, entkam Napoleon.
Fürst Metternich, der kühle, kluge, attraktive österreichische Außenminister, war vielleicht der einflussreichste Diplomat in Wien. Er war in der Nacht des 6. März sehr spät zu Bett gegangen, weil eine Zusammenkunft der wichtigsten Bevollmächtigten bis drei Uhr morgens gedauert hatte. Er war müde, und so wies er seinen Kammerdiener an, dafür zu sorgen, dass er nicht gestört wurde, aber der Mann weckte den Fürsten trotzdem um sechs Uhr morgens, weil ein Kurier eine Expressdepesche mit der Aufschrift «DRINGEND» gebracht hatte. Der Umschlag trug den Absender «Vom kaiserlich und königlichen Konsulat in Genua», und der Fürst, möglicherweise in der Annahme, dass von solch einem unbedeutenden Konsulat nichts Entscheidendes übermittelt werden würde, legte die Depesche auf seinen Nachttisch und versuchte weiterzuschlafen. Schließlich, um halb acht Uhr morgens, erbrach er das Siegel und las die Depesche. Sie war sehr kurz:
Der englische Kommissär Campbell seie so eben in dem Hafen erschienen um sich zu erkundigen, ob Napoleon zu Genua nicht habe erblicken lassen, denn von Elba seie er verschwunden, worauf in Folge der verneinenden Antwort die englische Fregatte ungesäumt wieder in die See gestochen seie.
Es mag seltsam erscheinen, dass Sir Neil Campbell nach Italien segelte, um den verschwundenen Napoleon ausfindig zu machen, statt den umherziehenden Kaiser in Frankreich zu suchen, aber es gab die weitverbreitete Annahme, Napoleon würde bei einer Landung in Frankreich im Handumdrehen von den königlichen Truppen festgesetzt. «Niemand wollte etwas von Frankreich hören», erinnerte sich der Duke of Wellington, «alle waren davon überzeugt, dass ihn das Volk abschlachten würde, wenn er dort auftauchte. Ich habe Talleyrands Worte noch im Ohr: ‹Pour la France? Non!›» Eine Landung in Italien schien viel wahrscheinlicher, zumal Napoleons Schwager Joachim Murat König von Neapel war. Murat, der seinen Thron der Großzügigkeit Napoleons verdankte, hatte seinen Frieden mit den Österreichern gemacht, dann aber erkannt, dass ihn der Wiener Kongress mit ziemlicher Sicherheit sein winziges Königreich kosten würde. Sobald er von Napoleons Flucht hörte, wechselte er erneut die Seiten und griff die Österreicher an, ein Unterfangen, das vollständig scheiterte und ihn schließlich vor ein Exekutionskommando führte.
Napoleon war natürlich nach Frankreich gegangen, aber die Diplomaten in Wien wussten tagelang nicht, wo er war, nur, dass er sich irgendwo frei bewegte. Der Kongress, bei dem gezaudert und getändelt, getanzt und debattiert worden war, zeigte plötzlich Entschlusskraft. In weniger als einer Stunde, erinnerte sich Metternich, war der Krieg beschlossen. Das ging so schnell, weil nahezu jeder, auf den es ankam, die Entscheider, in Wien anwesend war. Der König von Preußen, der Kaiser von Österreich, der Zar von Russland, alle waren dort, und Napoleons Rückkehr ließ sie schlagartig aktiv werden. Sie erklärten nicht Frankreich den Krieg, denn soweit es die Mächte in Wien anging, war Frankreich immer noch eine Monarchie, in der Louis XVIII regierte; stattdessen erklärten sie einem einzigen Mann den Krieg: Napoleon.
Vier Länder, Russland, Preußen, Österreich und Großbritannien, waren bereit, jeweils eine Armee von 150000 Mann aufzubringen. Diese Armeen würden sich in Frankreich zusammenschließen. Großbritannien war außerstande, eine Armee dieser Größe aufzustellen, also zahlte es stattdessen Zuschüsse an die anderen drei. Derweil ritten Kuriere kreuz und quer durch Europa, und einer von ihnen brachte dem Duke of Wellington einen Brief von Lord Castlereagh. «Euer Gnaden können beurteilen, wo Eure persönliche Anwesenheit dem Dienst am Staate mutmaßlich am dienlichsten ist … ob Ihr entweder in Wien verbleibt oder Ihr Euch an die Spitze der Armee in Flandern setzt.»
Der russische Zar, Alexander I., hatte keinen Zweifel, wie sich der Duke entscheiden würde. «Es ist an Ihnen», erklärte er dem Duke, «wieder einmal die Welt zu retten.»
Der Duke fühlte sich zweifellos geschmeichelt, hegte jedoch wohl eher Misstrauen gegen so hochfliegende Ansichten. Allerdings hatte er keinerlei Schwierigkeiten zu entscheiden, wo seine Anwesenheit dem Dienst am Staate mutmaßlich am dienlichsten wäre. Er antwortete der Regierung in London: «Ich gehe in die Niederlande, um das Kommando über die Armee zu übernehmen.» Er verließ Wien Ende März und war am 6. April in Brüssel.
Die Geschichte liefert selten eine so beeindruckende Auseinandersetzung. Die beiden größten Soldaten der Epoche, zwei Männer, die nie gegeneinander gekämpft hatten, sammelten nun nur 260 Kilometer voneinander entfernt ihre Truppen. Der Weltbezwinger war in Paris, während der Bezwinger des Weltbezwingers in Brüssel war.
Wusste Napoleon, dass Wellington sein Bezwinger genannt worden war? Diplomaten sind selten diskret in solchen Dingen, und es ist mehr als denkbar, sogar wahrscheinlich, dass dem Kaiser diese höhnische Bemerkung hinterbracht wurde. Sie musste ihn verärgern. Er hatte etwas zu beweisen.
Und so sammelten sich die Armeen.
In Frankreich herrschte nach Napoleons Rückkehr Verwirrung. Wer regierte? Wer sollte regieren? Ein paar Tage lang konnte niemand mit Sicherheit sagen, was vor sich ging. Colonel Girod de l’Ain war ein typisches Beispiel für viele Offiziere, die unter Napoleon gekämpft hatten. Mit der Wiederherstellung der Monarchie war er gezwungen, sich mit dem halben Sold zufriedenzugeben, und obwohl er frisch verheiratet war, wollte er sich so bald wie möglich wieder dem Kaiser anschließen. Er wohnte in den französischen Alpen, beschloss aber, nach Paris zu gehen:
Das ganze Land war in Aufruhr. Ich reiste in Uniform, aber ich beschaffte mir vorsichtshalber zwei Kokarden, eine weiße und die andere eine Trikolore, und je nachdem, welche Flagge ich an den Glockentürmen der Städte und Dörfer wehen sah, durch die wir kamen, steckte ich mir schnell die passende Kokarde an den Hut.
Als Colonel de l’Ain in Paris eintraf, stellte er fest, dass sich sein alter Regimentskommandant schon für Napoleon erklärt hatte, ebenso wie die meisten Mitglieder der königlichen Armee, trotz des Treueschwurs, den sie Louis XVIII geleistet hatten. Ihre Offiziere mochten dem Schwur vor dem König treu bleiben, aber die einfachen Soldaten hatten andere Vorstellungen. Comte Alfred Armand de Saint-Chamans befehligte das 7e Régiment de Chasseurs, und sobald er von Napoleons Rückkehr hörte, wies er sein Regiment an, sich zum Kampf bereitzumachen, «denn ich glaubte, dass wir gegen den Ex-Kaiser kämpfen würden». Sein Bataillon jedoch hatte etwas ganz anderes im Sinn:
Jemand erzählte mir, dass sich mehrere Offiziere im Café versammelt hatten und entschlossen waren, sich mit ihren Soldaten der Leichten Infanterie der Garde anzuschließen, um den Kaiser zu unterstützen, während andere Trikoloren nähen ließen, die sie den Männern geben wollten, um eine Meuterei zu provozieren … Ich begann die wahre Lage zu erkennen und meine elende Position zu begreifen. Was konnte ich tun? Jede Hoffnung, die ich gehegt hatte, dem König ein gutes, treues Regiment zur Unterstützung des Throns zur Verfügung stellen zu können, wurde in dieser Schicksalsstunde zunichte gemacht.
Die Treue der französischen Armee zu Louis XVIII schmolz rapide dahin, sodass Napoleon bald 200000 Mann zur Verfügung hatte. Tausende von Veteranen wie Colonel de l’Ain meldeten sich überdies freiwillig, doch Napoleon wusste, dass er eine noch größere Armee brauchte, um sich gegen den Angriff zu verteidigen, der ganz sicher kommen würde. Eine der wenigen Maßnahmen Louis’ XVIII, die bei der Bevölkerung Anklang gefunden hatten, war die Abschaffung der Wehrpflicht, und Napoleon zögerte, sie wieder einzuführen, da er wusste, wie verhasst sie den Franzosen war. Doch er hatte keine Wahl, denn dies würde ihm weitere 100000 Mann bringen, auch wenn sie noch ausgebildet und ausgerüstet werden mussten, bevor sie losmarschieren konnten. Also verfügte der Kaiser, dass ihm die Garde nationale, eine Lokalmiliz, 150000 Mann zur Verfügung stellen musste. Und es genügte noch immer nicht. Die Alliierten würden, wie er wusste, mehr als eine halbe Million Männer aufbieten, um ihn anzugreifen.
In Frankreich liefen in diesen ersten Wochen nach Napoleons Rückkehr fieberhafte Kriegsvorbereitungen. Pferde wurden requiriert, Uniformen genäht und Waffen repariert. Das Ganze war eine fesselnde Demonstration der administrativen Begabung Napoleons, denn bis zum Frühsommer hatte er eine Armee zum Abmarsch bereit und andere Truppenverbände zur Verteidigung an den französischen Grenzen stationiert. Er hatte noch immer nicht genügend Männer, um dem Ansturm standzuhalten, der kommen würde, und er brauchte weitere Truppenverbände, um die royalistischen Unruhen in der Vendée zu bekämpfen, einer Region in Westfrankreich, die schon immer katholisch und monarchistisch gewesen war. Doch bis zum Frühsommer verfügte Napoleon über ein Heer von insgesamt 360000 ausgebildeten Männern, von denen sich die besten in Nordfrankreich sammeln sollten, wo 125000 erfahrene Soldaten die Armée du Nord, die Nordarmee, bilden würden.
Napoleon hätte sich in diesem Sommer in der Defensive halten und die meisten seiner Männer hinter massiven Festungsbauten aufstellen können, um dann darauf zu hoffen, dass sich die alliierten Kampfverbände aufreiben würden, wenn sie gegen die Festungen anliefen. Das war jedoch nicht reizvoll. Solch ein Krieg musste auf französischer Erde ausgetragen werden, und Napoleon war nie ein passiver General gewesen. Sein Talent waren Truppenmanöver. Im Jahr 1814 hatte er eine gewaltige Übermacht vor sich gehabt, als die Preußen, Österreicher und Russen von Norden und Osten auf Paris zumarschierten, und er hatte sie mit der Geschwindigkeit seiner Truppenbewegungen und seinen Blitzangriffen verwirrt. Unter Berufsmilitärs galt dieser Feldzug als sein bester, auch wenn er in einer Niederlage geendet hatte, und der Duke of Wellington studierte seinen Verlauf sorgfältig. Napoleon selbst behauptete:
Die Kriegskunst erfordert keine komplizierten Manöver; die einfachsten sind die besten, und gesunder Menschenverstand ist unverzichtbar. Weswegen man sich fragen kann, warum Generäle Schnitzer machen; das liegt daran, dass sie versuchen, besonders klug zu sein. Die größte Schwierigkeit besteht darin, die Pläne des Gegners zu erraten, die Wahrheit aus den vielen Berichten herauszulesen. Das Übrige erfordert allein gesunden Menschenverstand; es ist wie bei einem Boxkampf: je öfter man zuschlägt, desto besser.
Der Kaiser war nicht ganz aufrichtig. Die Kriegsführung war nie so einfach, doch im Grunde verfolgte er eine einfache Strategie. Sie bestand darin, das gegnerische Heer zu spalten und dann eine Seite festzunageln, während die andere massiv angegriffen wurde. Und wie bei einem Boxkampf galt: Je härter der Schlag, desto schneller käme er zum Erfolg. Dann, wenn ein Gegner vernichtet war, würde er sich dem nächsten zuwenden. Angriff war im Jahr 1815 für Napoleon die beste Verteidigung, und es lag auf der Hand, dass derjenige Gegner zuerst angegriffen werden sollte, der sich am dichtesten bei ihm befand.
Es würde einige Zeit dauern, bis die gewaltige russische Armee Europa durchquert hatte und die französische Grenze erreichte, und die Österreicher waren im Mai immer noch nicht kampfbereit. Doch nördlich von Frankreich, in der alten Provinz Belgien, die nun zum Königreich der Niederlande gehörte, sammelten sich zwei Armeen: die britische und die preußische. Wenn er diese beiden Armeen schlagen konnte, so vermutete Napoleon, würden die anderen Alliierten den Mut verlieren. Wenn er Wellington besiegte und die Briten ans Meer zurückdrängte, konnte das sogar zu einem Regierungswechsel in London führen, der möglicherweise die Whigs an die Macht brachte, die eher geneigt wären, ihn als französischen Regenten hinzunehmen. Dann würde die gegnerische Allianz auseinanderbrechen. Es war natürlich ein gewagtes Spiel, aber jeder Krieg ist ein gewagtes Spiel. Er hätte warten können, noch mehr Männer aufstellen und ausbilden können, bis die französische Armee zahlenmäßig ebenbürtig gewesen wäre, aber diese beiden Armeen im Norden waren eine zu übermächtige Versuchung. Wenn er sie spalten konnte, dann konnte er sie schlagen, und wenn sie geschlagen werden konnten, dann würde die gegnerische Koalition möglicherweise zusammenbrechen. So etwas hatte es schon gegeben, warum also nicht auch jetzt?
Die Armee, die er nach Norden führen würde, war gut, viele erfahrene Soldaten gehörten ihr an. Wenn sie eine Schwäche hatte, dann war es ihr Führungsstab. Napoleon war früher immer von seinen Marschällen abhängig gewesen, aber von den zwanzig Marschällen, die 1815 noch lebten, hielten vier Louis XVIII die Treue, vier weitere waren zu den Alliierten übergelaufen, und zwei waren untergetaucht. Einer dieser beiden war Maréchal Berthier, der Napoleons Stabschef und ein Organisationsgenie gewesen war. Er war nach Bayern geflüchtet, wo er am 1. Juni aus einem Fenster im dritten Stockwerk der Bamberger Residenz in den Tod stürzte. Manch einer argwöhnte Mord, doch die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass er sich einfach zu weit aus dem Fenster lehnte, um einen Trupp russische Kavallerie über den Platz reiten zu sehen. Er wurde durch Nicolas Jean de Dieu Soult ersetzt, einem äußerst erfahrenen Soldaten, der aus den unteren Rängen der Armee aufgestiegen war, seine Karriere also nicht mit einem gekauften Offizierspatent begonnen hatte. Napoleon nannte ihn einmal «den größten Manövrierer in Europa», doch als Soult Truppenverbände in Spanien kommandiert hatte, war er ständig von Wellington bezwungen worden. Er war ein schwieriger Mann, empfindlich und stolz, und es musste sich noch erweisen, ob er Berthiers organisatorisches Talent besaß.
Zwei der brillantesten Marschälle des Kaisers, Davout und Suchet, waren nicht bei der Armée du Nord. Davout, ein grimmiger, erbarmungsloser Kämpfer, wurde Kriegsminister und blieb in Paris, während Suchet zum Kommandanten der Armee der Alpen ernannt wurde, ein großer Name für einen kleinen, schlecht ausgerüsteten Kampfverband. Auf die Frage, wer seine bedeutendsten Generäle seien, nannte Napoleon André Masséna und Louis-Gabriel Suchet, aber der Erste war bei schlechter Gesundheit, und der Zweite wurde zurückgelassen, um die französische Ostgrenze gegen einen österreichischen Angriff zu verteidigen.
Einen einzigen neuen Marschallsposten schuf Napoleon für die bevorstehende Kampagne, den er mit Emmanuel de Grouchy besetzte. Davout riet von der Ernennung ab, aber Napoleon bestand darauf. Grouchy war ein Aristokrat aus dem Ancien Régime und hatte das Glück gehabt, das Gemetzel der Französischen Revolution zu überleben. Er hatte sich seinen Ruf in der Kavallerie erworben; nun würde man ihm den Befehl über ein Drittel der Armée du Nord übertragen.
Dann gab es noch den Marschall, der «der Tapferste der Tapferen» genannt wurde, der sprunghafte und furchterregende Michel Ney, der sich, ebenso wie Soult, von einem einfachen Dienstgrad innerhalb der Armee emporgearbeitet hatte. Er war hitzig, rothaarig und leidenschaftlich, der Sohn eines Böttchers. Er feierte 1815 seinen sechsundvierzigsten Geburtstag, genau wie Napoleon und Wellington, und seinen Ruf als Militär hatte er sich auf einigen der blutigsten Schlachtfelder des langen Krieges verdient. Niemand zweifelte an seinem Mut. Er war ein Soldatenmarschall, ein Kämpfer, der, als Napoleon aus Elba gelandet war, Louis XVIII das berühmte Versprechen gegeben hatte, den Kaiser in einem Eisenkäfig nach Paris zurückzubringen. Stattdessen war er mit seinen Einheiten übergelaufen. Er genoss großes Ansehen aufgrund seines außergewöhnlichen Mutes und seiner vorbildhaften Führung, aber besonnen hätte ihn ganz gewiss niemand genannt. Und – eine unheilverheißende Tatsache – Soult verabscheute Ney, und Ney verabscheute Soult, und doch wurde von beiden in diesem schicksalhaften Sommer eine gute Zusammenarbeit erwartet.
Die Marschälle waren wichtig, und keiner mehr als der Stabschef, denn seine Aufgabe war es, die Wünsche des Kaisers in profane Marschbefehle zu übersetzen. Berthier war ein brillanter Organisator gewesen, hatte Schwierigkeiten vorausgesehen und sie effizient ausgeräumt, und es musste sich erweisen, ob Maréchal Soult ähnliches Organisationstalent bei dem Befehl über einhunderttausend Mann zeigte, dabei, sie zu verköstigen, ihre Bewegungen zu koordinieren und sie nach den Vorstellungen seines Kaisers in die Schlacht zu führen. Die anderen Marschälle würden die schwere Verantwortung eines unabhängigen Kommandos tragen. Wenn die Taktik des Kaisers darin bestand, einen Armeeverband an Ort und Stelle festzusetzen, während er den anderen besiegte, dann musste ein Marschall diese Festsetzung übernehmen. Bei der Eröffnung der Kampfhandlungen war es Maréchal Neys Aufgabe, Wellington zu beschäftigen, während Napoleon gegen die Preußen kämpfte, und zwei Tage später sollte Maréchal Grouchy die Preußen ablenken, während Napoleon Wellingtons Einheiten schlug. Diese Aufgaben konnten nicht erfüllt werden, indem schlicht Befehle befolgt wurden, sondern sie verlangten einfallsreiche Kampfführung. Von einem Marschall wurde erwartet, schwierige Entscheidungen zu treffen, und mit dieser Verantwortung betraute Napoleon Grouchy, der noch neu in seinem hohen Rang war, und Ney, dessen einzige Vorgehensweise in der Schlacht war, zu kämpfen wie der Teufel.
Die Armée du Nord würde in der alten Provinz Belgien zwei Armeeverbänden gegenüberstehen, von denen der preußische der größte war. Er wurde von dem zweiundsiebzigjährigen Fürst Gebhard Leberecht von Blücher geführt, der zuerst für die Schweden gegen Preußen gekämpft hatte, nach seiner Gefangennahme aber von Friedrich dem Großen in die preußische Armee aufgenommen wurde. Blücher war enorm erfahren, ein Kavallerist, der den Spitznamen Marschall Vorwärts trug, weil er so seine Männer in der Schlacht anfeuerte. Er war leutselig, wurde von seinen Männern geliebt und war für Anfälle von Geisteskrankheit bekannt, bei denen er glaubte, mit einem Elefanten schwanger zu sein, den ein französischer Infanterist gezeugt habe. Im Sommer 1815 allerdings war von solchem Irrsinn nicht das Geringste zu spüren. Stattdessen war Blücher fanatisch entschlossen, Napoleon zu besiegen. Er war schroff, mutig, und wenn er nicht der klügste General war, so hatte er doch Verstand genug, brillante Stabsoffiziere zu ernennen. Im Jahr 1815 war sein Stabschef August von Gneisenau, ein Mann mit überragenden Fähigkeiten und viel Erfahrung, von denen er manche an der Seite der Briten im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gesammelt hatte. Dieser Krieg hatte seine Meinung über die britische Armee erheblich getrübt, und Gneisenau begegnete den Fähigkeiten und Plänen der Briten mit heftigem Misstrauen. Als Freiherr von Müffling zum Verbindungsoffizier bei Wellington ernannt wurde, beorderte ihn Gneisenau zu sich, um ihn zu warnen:
Sehr auf meiner Huth zu sein, denn dieser ausgezeichnete Führer sei durch seine Verhältnisse in Indien und die Verhandlungen mit den hinterlistigen Nabobs an die Falschheit gewöhnt worden, und habe es darin zuletzt zu einer solchen Meisterschaft gebracht, daß selbst die Nabobs von ihm überlistet worden wären.
Es ist vollkommen rätselhaft, wie Gneisenau zu dieser merkwürdigen Ansicht kam, doch angesichts von Gneisenaus Kompetenzen und dem großen Wert, den Blücher auf seinen Rat legte, waren dies wohl kaum gute Vorzeichen für die künftigen Beziehungen zwischen Briten und Preußen. Es herrschte ohnehin schon Misstrauen zwischen den beiden Ländern wegen Preußens Ambitionen zur Annexion Sachsens, eine Meinungsverschiedenheit, die beim Wiener Kongress für Unfrieden gesorgt hatte. Die Briten, Franzosen und Österreicher waren derart gegen diesen preußischen Machtausbau, dass sie sich darauf verständigt hatten, eher einen Krieg anzufangen, als dies zuzulassen. Russland hegte ähnliche Ambitionen mit Blick auf Polen, und einen Moment lang sah es danach aus, als würde in Europa ein neuer Krieg ausbrechen, bei dem Preußen und Russland gegen die übrigen Staaten kämpfen würden. Dieser Krieg war abgewendet worden, aber das böse Blut war geblieben.
Nun stand die preußische Armee in der Provinz Belgien. Es war eine unerprobte Armee. Die Preußen hatten Niederlagen, Besatzung und Neuaufbau erlebt und nach der Abdankung Napoleons im Jahr 1814 die Demobilisation. Es gab gute, erfahrene Soldaten in Blüchers Armee, aber sie genügten nicht, und so wurden die Reihen mit Freiwilligen und Männern von der Landwehr, der Miliz, aufgefüllt. Der Ruf zu den Waffen im Jahr 1815 fand begeisterten Widerhall. Franz Lieber war gerade 17 Jahre alt, als er diesen Ruf vernahm, und so gingen er und sein Bruder nach Berlin, wo sie feststellten,
dass mitten auf einem Platz ein Tisch aufgestellt worden war … an dem mehrere Offiziere diejenigen aufschrieben, die sich freiwillig meldeten. Die Menge war so groß, dass wir von zehn bis ein Uhr warten mussten, bevor wir eine Gelegenheit bekamen, unsere Namen aufnehmen zu lassen.
Er trat Anfang Mai bei seinem Regiment an, wurde einen Monat lang ausgebildet, und dann marschierte seine Truppe in die Niederlande, um sich den Einheiten Blüchers anzuschließen. Lieber war fasziniert von der Entdeckung, dass ein Sergeant in seinem Regiment eine Frau war, die sich im Kampf derart hervorgetan hatte, dass ihr drei Tapferkeitsorden verliehen worden waren. Also führte Blücher im Sommer 1815 wenigstens eine Frau und 121000 Mann, auf dem Papier eine beeindruckende Armee, und doch, wie Peter Hofschröer, ein Historiker mit großen Sympathien für die Preußen, schreibt, bestand «ein beträchtlicher Anteil von Blüchers Soldaten aus frisch Einberufenen, die zwei grundlegende Manöver beherrschten: ungeordnetes Vorrücken und planloser Rückzug.» Das ist eine humorvolle Beschreibung, und wie sich zeigte, waren diese frisch Einberufenen auch zum Kämpfen imstande, doch es musste sich erweisen, ob Gneisenau seine Anglophobie überwinden und mit der Armee kooperieren würde, die sich rechts von den Einheiten Preußens sammelte.
Dies war die britisch-niederländische Armee unter der Führung des Duke of Wellington, der den berühmten Ausspruch tat, es handle sich um eine «schändliche Armee». Und das war sie, als er in Brüssel eintraf. Sie war unterbesetzt; einige der niederländischen Regimenter stammten aus der französischsprachigen Provinz Belgien, und der Duke misstraute diesen Soldaten, weil viele von ihnen Veteranen aus der napoleonischen Armee waren. Die französischsprachigen Belgier waren unzufrieden, weil ihr Land dem Königreich der Vereinigten Niederlande einverleibt worden war, und der Kaiser wusste von dieser Unzufriedenheit. Pamphlete wurden über die französische Grenze geschmuggelt und unter den belgischen Soldaten in der Armee des Duke verteilt. «An die tapferen Soldaten», war dort zu lesen, «die unter den französischen Adlern Eroberungen gemacht haben. Die Adler, die uns so oft zum Sieg geführt haben, sind zurückgekehrt! Ihr Schrei ist immer der gleiche: Ruhm und Freiheit!» Der Duke bezweifelte die Verlässlichkeit dieser Regimenter und traf die Vorkehrung, sie voneinander zu trennen und auf Bataillone aufzuteilen, deren Loyalität außer Frage stand.
Diese loyalen Bataillone waren britische Truppen sowie die 6000 Mann aus der King’s German Legion (KGL), die während des langen Spanischen Unabhängigkeitskrieges herausragend für den Duke gekämpft hatten. Die Legion war in Hannover aufgestellt worden, das freilich denselben König wie Großbritannien hatte, und im Jahr 1815 schickte Hannover weitere 16000 Mann, die sich Wellingtons Armee anschließen sollten. Diese 16000 waren nicht kampferprobt, und deshalb wurden sie, wie die niederländische Armee, auf britische oder KGL-Bataillone aufgeteilt. Dies war keine populäre Entscheidung. «Es war ein schwerer Schlag für unsere Moral», beschwerte sich Hauptmann Carl Jacobi von der 1. Hannoverschen Brigade:
Die englischen Generäle waren vollkommen unvertraut mit den Gepflogenheiten der Hannoveraner … In ihren Augen war alles mangelhaft und stand sogar der Kritik offen, wenn es nicht an englische Bedenken und Einrichtungen angepasst wurde. Es herrschte keine Kameradschaft unter den alliierten Truppen, nicht einmal unter den Offizieren. Die Unkenntnis der jeweils anderen Sprache auf beiden Seiten, der erhebliche Unterschied im Sold, und die daraus resultierenden großen Unterschiede in der Lebensführung verhinderten jede engere Gemeinschaft. Selbst unsere Landsmänner in der King’s German Legion verkehrten nicht mit uns; der fünfzehnjährige Fähnrich mit der roten Schärpe sah auf die älteren hannoveranischen Offiziere herab.
Im Sommer, als die Kampfhandlungen einsetzten, verfügte Wellington also über etwa 16000 Hannoveraner und etwas weniger als 6000 Mann aus der King’s German Legion. Die niederländische Armee, die zu seiner «schändlichen» Armee gehörte, zählte beinahe 40000 Mann, von denen die Hälfte französischsprachigen Regimentern angehörte und deshalb von zweifelhafter Verlässlichkeit war. Die übrigen Männer in seiner Armee, etwa 30000, waren Briten, und der Duke wünschte, er hätte mehr von ihnen.
Doch Großbritannien hatte gerade einen Krieg mit den Vereinigten Staaten geführt, und viele seiner besten Regimenter, Veteranen von Wellingtons Siegen, waren noch auf der anderen Seite des Atlantiks. Sie kamen zurück, und einige Bataillone fanden sich nach der Überfahrt von Amerika direkt in den Niederlanden wieder. Der Duke wäre wesentlich zuversichtlicher gewesen, wenn er seine Armee aus dem Spanischen Unabhängigkeitskrieg bei sich gehabt hätte, die eine der besten war, die je unter britischer Fahne gekämpft hatte. Ein paar Wochen vor Waterloo ging er in einem Brüsseler Park mit Thomas Creevey spazieren, einem britischen Parlamentarier, der den Duke mit großer Sorge nach dem zu erwartenden Feldzug fragte. Ein britischer Infanterist im roten Rock sah sich gerade die Statuen im Park an, und der Duke deutete auf den Mann. «Dort», sagte er, «dort. Es hängt vollständig von diesem Gut ab, ob wir die Sache meistern oder nicht. Geben Sie mir genug davon, und ich bin sicher.»
Am Ende genügte es gerade so. Knapp über 20000 britische Infanteristen würden bei Waterloo kämpfen, und sie würden sich den Hauptangriffen des Kaisers entgegenstellen. Napoleon wurde von seinen Generälen vor diesen Rotröcken und ihrer Standhaftigkeit gewarnt. Général Reille verärgerte Napoleon mit der Bemerkung, die britische Armee sei inexpugnable, unüberwindlich, während Soult dem Kaiser erklärte, die englischen Infanteristen seien «im direkten Kampf die reinsten Teufel». Und das waren sie. Der Kaiser hatte nie gegen sie gekämpft, und er tat die Warnungen ab, doch Wellington kannte ihren Wert und den ebenso hohen Wert der King’s German Legion. Vier Jahre nach der Schlacht bemerkte der Duke bei einem Gang über das Schlachtfeld von Waterloo: «Ich hatte nur etwa 35000 Mann, auf die ich mich ernsthaft verlassen konnte; bei allen übrigen sah es nur allzu sehr danach aus, dass sie davonlaufen würden.»





























