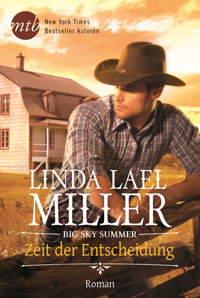8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MIRA Taschenbuch
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: eBundle
- Sprache: Deutsch
GESTÄNDNIS UNTERM WEIHNACHTSBAUM Ob verirrtes Rentier, depressives Pony oder der ältere Herr, der sich für den Weihnachtsmann hält: Nichts davon kann die hilfsbereite Tierärztin Olivia O´Ballivan erschüttern. Das schafft nur ihr neuer Nachbar Tanner Quinn mit seinem Charme. Doch der gefragte Architekt bleibt nie lange an einem Ort. Für ihn ist das Projekt im verschlafenen Stone Creek bloß ein Zwischenspiel. Auch seine Nacht mit Olivia? ZEIT DER WUNDER IN MUSTANG CREEK Das Leben in einer Großstadt wie New York hat Charlotte Morgan sich nicht so einsam vorgestellt. Erleichtert kehrt sie daher nach Mustang Creek zurück, als ihre Großtante sie braucht. Dort begegnet sie Jaxon Locke wieder, der einst ihr Herz berührte - und dann aus ihrem Leben verschwand. Das Knistern zwischen ihnen füllt sofort die magischen Winternächte, die sie miteinander verbringen … Könnte Charlotte dieses Mal tatsächlich die wahre Liebe in Jaxons Armen finden? WEIHNACHTSREZEPT FÜR DIE LIEBE Weihnachtszeit im Weißen Haus? Undercover soll David Goddard die unkonventionelle Kochbuchautorin Holly im Auge behalten. Er muss dafür sorgen, dass sie sich benimmt und nicht unangenehm in der Öffentlichkeit auffällt. Immerhin ist sie mit dem Präsidenten der USA verwandt. Eigentlich kein Problem für den erfahrenen Secret Service Agent. Doch bei den Klängen von romantischer Weihnachtsmusik und im Lichterschein der Kerzen fällt es David immer schwerer, Berufliches und Privates zu trennen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 907
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Linda Lael Miller
Weihnachten mit Linda Lael Miller (3in1)
Linda Lael Miller
Fest der Herzen: Geständnis unterm Weihnachtsbaum
Impressum
MIRA® TASCHENBUCH
MIRA® TASCHENBÜCHER erscheinen in der Harlequin Enterprises GmbH, Valentinskamp 24, 20354 Hamburg Geschäftsführer: Thomas Beckmann
Copyright © 2013 by MIRA Taschenbuch in der Harlequin Enterprises GmbH
Titel der nordamerikanischen Originalausgabe:
A Stone Creek Christmas Copyright © 2008 by Linda Lael Miller erschienen bei: Silhouette Books, Toronto Deutsche Erstveröffentlichung Übersetzt von Ralph Sander
Published by arrangement with Harlequin Enterprises II B.V./S.àr.l
Konzeption/Reihengestaltung: fredebold&partner gmbh, Köln Covergestaltung: pecher und soiron, Köln Redaktion: Mareike Müller Titelabbildung: Getty Images, München; pecher und soiron, Köln Autorenfoto: © Harlequin Enterprises S.A., Schweiz ISBN ePub 978-3-86278-930-0
www.mira-taschenbuch.de
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Der Preis dieses Bandes versteht sich einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
1. KAPITEL
Manchmal, wenn die pure Erschöpfung Olivia O’Ballivan in einen tiefen, festen Schlaf sinken ließ, hörte die Tierärztin sie nach ihr rufen – Kreaturen mit Flossen, Federn und vier Beinen.
Pferde, wild oder gezähmt, geliebte Hunde und solche, die sich verlaufen hatten, Katzen, die man am Straßenrand ausgesetzt hatte, weil sie zur Last wurden oder ihr Besitzer in hohem Alter gestorben war.
Die Vernachlässigten, die Misshandelten, die Unerwünschten, die Einsamen. Sie alle richteten die gleiche Botschaft an Olivia: Hilf mir!
Selbst wenn sie versuchte, diese Hilferufe zu ignorieren, indem sie sich im Schlaf vor Augen hielt, dass sie das alles nur träumte, half es nichts: Sie schreckte unweigerlich hoch und saß dann wie aus tiefsten Abgründen emporgerissen hellwach im Bett. Und das geschah, ganz gleich, ob sie mehrere Tage hintereinander achtzehn oder mehr Stunden gearbeitet hatte, zu etlichen Farmen und Ranches in ihrem County gefahren war, unabhängig davon, wie viel Zeit sie in ihrer Tierklinik in Stone Creek verbrachte oder wie intensiv sie sich mit den Plänen für das neue, hochmoderne Tierheim beschäftigte, das ihr berühmter Bruder und Countrymusiker Brad mit seiner letzten Filmgage finanzierte.
Heute Nacht war es ein Rentier.
Olivia richtete sich in ihrem zerwühlten Bett auf und blinzelte nach Atem ringend in die Dunkelheit. Mit beiden Händen fuhr sie sich durch ihr kurzes dunkles Haar und bemerkte, dass ihre momentane Pflegehündin Ginger ebenfalls aufgewacht war, gähnte und sich streckte.
Ein Rentier?
„O’Ballivan“, sprach sie zu sich selbst, während sie die Bettdecke zur Seite schlug und sich auf den Rand der Matratze setzte. „Diesmal hat’s dich ja wohl wirklich erwischt.“
Doch der stumme Hilferuf wollte nicht verhallen, sondern geisterte drängend durch ihren Kopf.
Nur manchmal kam es vor, dass Olivia die Tiere richtiggehend etwas sagen hörte, wenn man die wortgewandte Ginger einmal außen vor ließ. Üblicherweise war es eher eine Wahrnehmung von eindringlichen Gefühlen, oft ergänzt durch Bilder, die zusammen einen intuitiven Hilferuf bildeten. Aber dieses Rentier hatte sie klar und deutlich vor ihrem geistigen Auge gesehen, wie es verwirrt und verängstigt an einer vereisten Straße verharrte.
Sie hatte sogar die Straße erkannt: Es war die Zufahrt zu ihrem Haus, ganz weit draußen an der Landstraße, wo der windschiefe Briefkasten stand. Das arme Tier war nicht verletzt, es hatte sich nur verlaufen. Und es hatte Hunger und Durst … und schreckliche Angst. Für hungrige Wölfe und Kojoten stellte es eine leichte Beute dar.
„In Arizona gibt es keine Rentiere“, sagte Olivia zu Ginger, die ihr einen skeptischen Blick zuwarf. Der an Arthritis leidende goldbraune Mischling aus Labrador und Golden Retriever erhob sich langsam von seinem bequemen Kissen in einer Ecke des hoffnungslos vollgestopften Schlafzimmers. „Es gibt definitiv in ganz Arizona nicht ein einziges Rentier.“
„Wie du meinst“, erwiderte Ginger gähnend und trottete bereits in Richtung Tür. Olivia zog eine Jogginghose über ihre Schlafanzugshorts und griff nach einem Kapuzenshirt, das von einer Konzerttournee ihres Bruders übrig geblieben war, bevor der seinen vorzeitigen Abschied von der Bühne bekannt gegeben hatte. Dann stieg sie in die reichlich unglamourösen Arbeitsstiefel, in denen sie immer durch Wiesen, Weiden und Scheunen stapfte.
Olivia lebte in einem kleinen gemieteten Haus auf dem Land, doch sobald das Tierheim in der Stadt fertig war, würde sie in ein geräumiges Apartment in dessen Obergeschoss umziehen. Sie fuhr einen alten grauen Suburban, der früher einmal ihrem verstorbenen Großvater Big John gehört hatte, und sie wollte auch gar keinen schickeren Wagen. Nach dem Beenden ihres Veterinärmedizinstudiums hatte sie keine Energie damit verschwendet, ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen.
Von ihren Schwestern, den Zwillingen Ashley und Melissa, wurde sie zwar immer wieder ermahnt, sie solle endlich mal „die Dinge auf die Reihe kriegen“, sich einen Mann suchen und eine Familie gründen. Aber die beiden waren selbst Singles ohne Aussicht auf Flitterwochen an einem exotischen Ort und ein Haus mit weißem Gartenzaun, weshalb sie aus Olivias Sicht überhaupt kein Recht hatten, ihr irgendwelche Vorhaltungen zu machen. Das meinten die zwei wohl nur, weil Olivia ein paar Jahre älter war als sie, mit diesem Argument allerdings brauchten sie ihr schon gar nicht zu kommen.
Abgesehen davon war es ja keineswegs so, dass sie nichts von einem Ehemann und einer eigenen Familie wissen wollte – ganz im Gegenteil. Doch ihre Praxis und ihre „Dr.-Dolittle-Nummer“, wie Brad ihre zugegebenermaßen ziemlich schräge Fähigkeit der Tierkommunikation nannte, kosteten sie jeden Tag so viele Stunden, dass für andere Dinge kaum noch Zeit blieb.
Ihr gemietetes Haus war schon älteren Datums und die Garage stand daher in einigem Abstand daneben, weshalb Olivia sich mit Ginger ein paar Meter weit durch den tiefen Pulverschnee kämpfen musste, um zu ihrem Wagen zu gelangen. Ihr Wagen war keins von diesen neumodischen Autos mit allem möglichen Schnickschnack, und außerdem war er meistens total schlammverspritzt – aber er hatte sie noch nie im Stich gelassen. Ganz gleich, welches Wetter herrschte, der Motor sprang immer an, und es gab kaum eine Wegstrecke, die er nicht bewältigen konnte.
„Ich möchte ja nicht wissen, wie ein gestrandetes Rentier in Melissas kleinem roten Sportflitzer Platz finden sollte“, sagte sie zu Ginger, während sie das Garagentor öffnete. „Oder in diesem albernen Hybridauto, mit dem Ashley durch die die Gegend kurvt.“
„Also, ich hätte nichts gegen eine Runde in dem roten Sportflitzer einzuwenden“, gab Ginger zurück und kletterte die speziell angefertigte hölzerne Trittleiter hinauf, die Olivia zum Wagen gezogen hatte. Ginger wurde schließlich nicht jünger, und ihre Gelenke verursachten ihr seit ihrem „Unfall“ zwangsläufig noch mehr Probleme, also mussten Maßnahmen ergriffen werden, damit ihr das Leben erleichtert wurde.
„Davon träumst du“, konterte Olivia und schob die Trittleiter zur Seite, nachdem die Hündin es sich auf dem Beifahrersitz bequem gemacht hatte.
Sie schloss die Tür, stieg auf der Fahrerseite ein und startete den Motor, der fast schon ein biblisches Alter hatte, aber immer noch so glatt und rund lief wie am ersten Tag. „Du weißt, wie sehr sich Melissa über Hundehaare aufregt. Und was meinst du, was du zu hören bekommst, wenn du mit deinen Monsterkrallen ein Loch in die teuren Lederpolster reißt!“
„Sie mag Hunde“, beharrte Ginger und hob den Kopf, um sie anzusehen. „Sie bildet sich ja nur ein, dass sie allergisch ist.“ Die Hündin glaubte unbeirrt an das Gute in jedem Menschen, obwohl es Menschen gewesen waren, die sie auf dem Highway ausgesetzt hatten – oder besser gesagt: der rachsüchtige Freund von Gingers Vorbesitzerin, der sie aus dem fahrenden Auto geschleudert hatte, wobei ihr zwei Beine gebrochen worden waren. Olivia war nur wenige Minuten später am Ort des Geschehens eingetroffen, nachdem dieser übersinnliche Hilferuf an ihr Herz sie dazu veranlasst hatte, hinzufahren. Sie hatte Ginger geborgen und in die Klinik gebracht, wo sie mehrere Operationen und eine langwierige Genesung hatte durchstehen müssen.
Olivia schaltete die Scheibenwischer ein, musste dennoch blinzeln, damit sie durch die umherwirbelnden dicken Flocken etwas erkennen konnte. „Meine Schwester ist eine Hypochonderin.“
„Sie ist nur noch nicht dem richtigen Hund begegnet“, behauptete Ginger unbeirrt. „Und auch nicht dem richtigen Mann.“
„Fang jetzt bloß nicht von Männern an“, warnte Olivia die Hündin und hielt Ausschau nach dem Rentier in Not.
„Du wirst schon fündig werden“, meinte Ginger und hechelte, während sie nach draußen in die verschneite Nacht schaute.
„Redest du vom Rentier oder von einem Mann?“
„Sowohl als auch“, antwortete Ginger und zeigte dabei ihr Hundelächeln.
„Was soll ich nur mit einem Rentier machen?“
„Dir fällt schon was ein“, erwiderte Ginger. „Bald ist Weihnachten. Vielleicht gibt’s ja eine Vermisstenmeldung vom Nordpol. Ich würde ja auf der Website vom Weihnachtsmann nachsehen, wenn ich mit meinen Pfoten eine Tastatur bedienen könnte.“
„Von wegen“, brummte Olivia. „Wenn du das könntest, würdest du dauernd bei diesen Verkaufssendern bestellen, nur weil der Mann von UPS immer so nett zu dir ist. Dann würden wir unter Bergen von Wunderkopfkissen, Kräuterzeugs gegen Übergewicht und Mitteln für weißere Zähne ersticken.“ Ein vertrauter Schmerz regte sich zwischen ihren Schulterblättern, als sie angestrengt die Dunkelheit zu beiden Seiten der schmalen Straße mit ihren Blicken absuchte. Weihnachten. Noch so eine Sache, für die sie keine Zeit hatte, von der nötigen Begeisterung ganz zu schweigen. Aber Brad und seine ihm frisch angetraute Ehefrau Meg würden gleich nach Thanksgiving den Weihnachtsbaum aufstellen und sie notfalls kidnappen, sollte sie nicht zur Familienfeier auf der Stone Creek Ranch erscheinen – allein schon aus dem Grund, dass das Baby der beiden, Mac, vor einem halben Jahr das Licht der Welt erblickt hatte und es das erste Weihnachtsfest als junge Familie sein sollte. Erschwerend kam hinzu, dass Megs jüngere Schwester Carly im Rahmen eines Förderprogramms für hochbegabte Schüler sechs Monate in Italien verbrachte und Brad und Meg sie sehr vermissten. Ashley würde in ihrem Bed & Breakfast ihre alljährlichen Tage der offenen Tür veranstalten, während Melissa wahrscheinlich entscheiden würde, dass sie gegen Mistelzweige und Stechpalmen allergisch war, und dann überzeugende Symptome zur Schau stellen würde.
Und Olivia würde letztlich ja doch hingehen. Zu Brad und Meg, weil sie die beiden liebte und von Mac nicht genug bekam. Zu Ashley, weil sie ihre Schwester liebte und weil sie fast immer darüber hinwegsehen konnte, dass sie sich wie eine zu Lebzeiten wiedergeborene Martha Stewart aufführte. Und zu Melissa dann auch noch, um ihr Nasenspray gegen die Allergie und einen Topf Hühnersuppe zu bringen – natürlich aus der Konservendose, denn was richtiges Kochen anging, da kannte sie ihre Grenzen.
„Da ist Blitzen“, meldete sich Ginger zu Wort und ließ ein fröhliches Winseln folgen.
Tatsächlich war da im gelblichen Lichtkegel der etwas altersschwachen Scheinwerfer ein Rentier zu erkennen, das mitten im Schneegestöber am Straßenrand stand.
Olivia stoppte den Wagen, legte den Leerlauf ein und zog die Handbremse an. „Du bleibst hier“, meinte sie zu der Hündin und öffnete die Wagentür.
„Als ob ich bei dem Wetter aussteigen würde“, meinte Ginger verächtlich schnaubend.
Vorsichtig näherte sich Olivia dem Rentier, das wie erstarrt wirkte – ein kleines, schmächtiges Tier mit riesigen dunklen Augen, die im Scheinwerferlicht funkelten.
„Verirrt“, ließ das Rentier sie nur wissen, da es offenbar nicht über einen ähnlich umfangreichen Wortschatz verfügte wie Ginger. Wenn sie für die Hündin jemals ein liebevolles Zuhause finden sollte, dann würden ihr die langen Unterhaltungen mit ihr fehlen, auch wenn sie beide politisch sehr gegensätzliche Standpunkte vertraten.
Das Rentier hatte ein Geweih, also war es ein Männchen.
„Hey, Kleiner, woher kommst du denn?“
„Verirrt“, wiederholte das Rentier. Entweder war es benommen oder nicht besonders intelligent. So wie die Menschen war auch jedes Tier einzigartig, und manche von ihnen hatten die Intelligenz eines Albert Einstein, während andere etwas einfältiger waren.
„Bist du verletzt?“, vergewisserte sie sich, auch wenn sie nicht den Eindruck hatte. Dieser erste Eindruck täuschte sie so gut wie nie, dennoch gab es immer ein gewisses Restrisiko.
Keine Antwort.
Langsam ging sie weiter, bis sie nahe genug war, um das Rentier behutsam abtasten zu können. Nirgendwo klebte Blut, es waren keine offensichtlichen Knochenbrüche zu fühlen. Das schloss natürlich nicht aus, dass das Tier Verstauchungen oder Haarrisse in den Knochen erlitten hatten. Es gab keine erkennbaren Markierungen, auch keine Marke im Ohr oder etwas Ähnliches.
Das Rentier ließ sich ohne Gegenwehr untersuchen, was bedeuten konnte, dass es zahm war. Sicher war das jedoch nicht, denn so gut wie jedes Tier – ob wild oder gezähmt – hatte sich bislang von ihr anfassen lassen. Einmal war es ihr sogar gelungen, mit der Hilfe von Brad und Jesse McKettrick einen verletzten Hengst zu behandeln, der zuvor noch nie Bekanntschaft mit Hufeisen, Zaumzeug oder einem Reiter gemacht hatte.
„Es wird alles wieder gut“, sagte sie zu dem kleinen Rentier, das tatsächlich so aussah, als solle es vor den Schlitten des Weihnachtsmanns gespannt werden. Sein Fell hatte einen silbrigen Glanz, das Geweih war fein geschnitten, und das zierliche Tier war kaum größer als Ginger.
Sie zeigte mit dem Daumen über die Schulter auf ihren Truck. „Kannst du mir zu meinem Haus hinterherlaufen? Oder soll ich dich auf die Ladefläche setzen?“, fragte sie.
Das Rentier nahm daraufhin den Kopf runter. Aha, es war also schüchtern. Und erschöpft.
„Aber du hast schon einen langen Weg hinter dir, nicht wahr?“, redete Olivia weiter, während sie zum Wagen lief, die Heckklappe öffnete und die stabile Rampe herauszog, die für Ginger und andere vierbeinige Passagiere gedacht war, denen der Sprung auf die Ladefläche zu viel abverlangte.
Das Rentier zögerte, vermutlich weil es Ginger gewittert hatte.
„Keine Angst“, beruhigte Olivia es. „Ginger ist lammfromm. Geh ruhig rauf, Blitzen.“
„Sein Name ist Rodney“, verriet Ginger ihr. Sie hatte sich so gedreht, dass sie über die Rückenlehne alles beobachten konnte.
„Dasher, Dancer, Prancer oder … Rodney“, sprach Olivia gestikulierend, wobei sie dem Tier genug Raum ließ.
Rodney hob den Kopf, als sie seinen Namen aussprach, und schien etwas munterer zu werden, dann stolzierte er die Rampe hinauf und legte sich mit lautem Schnauben auf ein paar auf die Ladefläche geworfene alte Futtersäcke.
Olivia schloss die Heckklappe ganz leise, da sie das Tier nicht erschrecken wollte.
„Woher kennst du seinen Namen?“, fragte sie, kaum dass sie wieder eingestiegen war. „Außer einem ‚Verirrt‘ bekomme ich nichts aus ihm raus.“
„Er hat’s mir gesagt“, entgegnete Ginger. „Er ist noch nicht bereit, Einzelheiten über seine Vergangenheit zu berichten. Da ist auch ein bisschen Amnesie im Spiel. Ausgelöst durch das emotionale Trauma, weil er sich verlaufen hat.“
„Hast du dir wieder irgendwelche Pseudo-Seelenklempner im Fernsehen angeschaut, dass du so was weißt? Vielleicht Oprah?“
„Nur, wenn du vergisst, den Fernseher auszumachen, wenn du aus dem Zimmer gehst. Du weißt, ich kann mit der Fernbedienung nicht umgehen.“
Olivia löste die Handbremse und legte den Rückwärtsgang ein, dann fuhr sie zurück zum Haus. Vermutlich wäre es sinnvoller gewesen, das Rentier in die Praxis zu bringen, um es zu röntgen, oder zur Ranch, damit Rodney dort in der Scheune übernachten konnte.
Aber es war mitten in der Nacht, und wenn sie um diese Zeit in der Praxis das Licht einschaltete, dann würden all ihre anderen Patienten aufwachen und einen solchen Lärm veranstalten, dass die gesamte Nachbarschaft aus dem Schlaf gerissen wurde. Und auf der Stone Creek Ranch würde sie vermutlich das Baby wecken, dabei waren Brad und Meg auch so schon völlig übernächtigt.
Also musste Rodney den Rest dieser nicht mehr allzu langen Nacht bei ihr auf der überdachten Veranda verbringen. Sie würde für ihn mit einem Stapel alter Decken, von denen sie für alle Fälle immer mehr als genug hatte, ein Nachtlager herrichten, ihm Wasser geben und versuchen, ob er etwas von Gingers Leckerchen essen würde. Am Morgen konnte sie sich dann richtig um ihn kümmern, ihn in der Praxis untersuchen, ihn röntgen und eine Blutuntersuchung durchführen. Wenn er transportfähig war, konnte sie ihn zu Brad bringen und ihn in einer eigenen Box im Stall einquartieren.
Rodney trank eine ganze Schale Wasser leer, nachdem Olivia ihn durch die Tür auf die Veranda gelotst hatte. Dabei behielt er die ganze Zeit über Ginger im Auge, obwohl die weder knurrte noch sich hastig bewegte, wie es manch anderer Hund an ihrer Stelle getan hätte.
Stattdessen schaute Ginger Olivia mit einem mitfühlenden Blick an. „Ich schlafe besser hier draußen bei Rodney“, erklärte sie. „Er ist noch immer ziemlich verängstigt. Die Fahrt auf dem Truck hat ihn ein bisschen erschreckt.“
Das war von Gingers Seite ein wirklich großes Opfer, liebte sie doch ihr großes, weiches Kissen über alles. Ashley hatte es für sie genäht und dabei den weichsten Fleece verwendet, den sie finden konnte. Sie hatte es sogar mit einem Monogramm versehen. Unwillkürlich musste Olivia lächeln, als sie sich ihre blonde, kurvenreiche Schwester vorstellte, wie die an der Nähmaschine saß und unermüdlich arbeitete.
„Du bist ein guter Hund“, meinte sie und musste gegen ein paar Tränen ankämpfen, sowie sie sich vorbeugte und Gingers Kopf tätschelte.
Ginger seufzte, was so klang, als wollte sie sagen: „Was tut man nicht alles für ein Lob?“
Olivia ging ins Schlafzimmer und holte Gingers Kissen, das sie auf der Veranda auf den Boden legte, dann nahm sie den leeren Wassernapf und begab sich in die Küche, um ihn noch einmal aufzufüllen. Als sie danach erneut nach draußen kam, musste sie feststellen, dass Rodney es sich auf dem Kissen bequem gemacht hatte, während Ginger sich auf einem Stapel alter Decken eingerollt hatte.
„Ginger, dein Bett …?“
Die Hündin gähnte einmal von Herzen, legte die Schnauze auf ihre Vorderpfoten und verdrehte die Augen. „Jeder braucht nach einer Bruchlandung erst mal ein gemütliches Plätzchen“, antwortete sie schläfrig. „Sogar Rentiere.“
Das Pony war nicht besonders glücklich.
Tanner Quinn stand gegen die Stalltür gelehnt. Gerade erst hatte er die Starcross Ranch gekauft, und heute war Butterpie eingetroffen, das Lieblingstier seiner Tochter. Abgeliefert worden war es gemeinsam mit seinem eigenen Palomino-Wallach Shiloh von einem Pferdetransportunternehmen, das seine Schwester Tessa ausgesucht hatte.
Shiloh fand sich schnell in seine neue Umgebung ein, im Gegensatz zu Butterpie, der das viel größere Schwierigkeiten bereitete.
Seufzend schob Tanner seinen Hut fast bis in den Nacken. Vermutlich hätte er Shiloh und Butterpie bei seiner Schwester in Kentucky lassen sollen, wo sie das viel besungene Rispengras hatten, auf dem sie so wunderbar hin und her galoppieren konnten und das ihnen so gut schmeckte. Immerhin sollte diese Ranch weder für ihn noch für die Tiere ein dauerhaftes Zuhause sein. Er hatte das Gelände als Geldanlage zum Schnäppchenpreis gekauft, um hier zu wohnen, während er dieses Neubauprojekt in Stone Creek leitete, was längstens ein Jahr in Anspruch nehmen würde.
Dies hier war nicht viel mehr als ein weiteres von vielen Häusern, die alle nur eine Zwischenstation, aber kein Zuhause darstellten. Er kam in eine neue Stadt, kaufte ein Haus oder eine Wohnung, baute irgendein teures Gebäude, und dann zog er auch schon wieder weiter und vertraute sein vorübergehendes Quartier einem Immobilienmakler an, damit er es auf dem Markt anbot.
Dieses jüngste Projekt, ein Tierheim, fiel für ihn völlig aus dem Rahmen. Üblicherweise entwarf und errichtete er Bürogebäude, etliche Millionen Dollar teure Villen für Filmstars und Manager, und hin und wieder auch mal mit Regierungsgeldern finanzierte Schulen, Brücken oder Krankenhäuser, die im Ausland entstanden – üblicherweise in Krisengebieten.
Bevor seine Frau Katherine vor fünf Jahren gestorben war, hatte sie ihn auf seinen Reisen stets begleitet und Sophie mitgenommen.
Aber dann …
Tanner schüttelte den Kopf, um die Erinnerung zu verdrängen. Um sich damit auseinandersetzen zu können, wie Katherine ums Leben gekommen war, musste er schon eine Menge Bourbon runterkippen, und dem Teufelszeug hatte er vor langer Zeit abgeschworen. Nicht dass er jemals Alkoholiker gewesen wäre, doch die Voraussetzungen dafür hatten eine Zeit lang existiert, und dieses Leid, was damit einhergegangen wäre, wollte er seiner Tochter und sich ersparen. Er hatte die Flasche, die er in der Hand hielt, wieder zugeschraubt und sie seitdem nicht mehr angerührt.
Es hätte ihn erwischen sollen, nicht Kat. Weiter als bis zu diesem Punkt konnte er in nüchternem Zustand nicht denken.
Er wandte sich wieder dem kleinen cremefarbenen Pony zu, das verloren in seiner schicken neuen Box stand. Er war kein Tierarzt, aber das musste er auch nicht sein, um das Problem zu erkennen. Das Pferd vermisste Sophie, die jetzt in einem gut gesicherten Internat in Connecticut untergebracht war.
Ihm fehlte sie ebenfalls, und ganz sicher fehlte sie ihm mehr als dem Pferd. Doch hinter diesen hohen Mauern war sie sicher vor jenen Gruppen, die von Zeit zu Zeit Morddrohungen wegen der Bauten aussprachen, die er errichtete. Diese Schule war wie eine Festung – schließlich hatte er selbst sie entworfen und gebaut. Sein bester Freund Jack McCall, ein ehemaliger Angehöriger der Special Forces und einer der besonders einflussreichen Sicherheitsberater, hatte die Alarmsysteme installiert, die das Beste darstellten, was es auf dem Markt gab. Kinder und Enkel von Präsidenten, Kongressabgeordneten, Oscar-Preisträgern und Software-Entwicklern besuchten diese Schule, die vor allem eine Bedingung erfüllen musste – und auch erfüllte: Sie durfte Kidnappern keine Chance bieten.
Sophie hatte ihn angefleht, sie nicht dort zurückzulassen.
Noch während Tanner darüber nachdachte, klingelte sein Handy. Sophie hatte bei ihrer letzten Begegnung diesen Klingelton gewählt: die Titelmelodie aus dem Kinofilm Der Grinch.
Er selbst war natürlich der Grinch – was sonst?
„Tanner Quinn“, meldete er sich, obwohl ihm klar war, dass es kein geschäftlicher Anruf war. Diese Angewohnheit konnte er nicht ablegen.
„Ich hasse es hier!“, platzte Sophie ohne Begrüßung heraus. „Das ist hier wie ein Gefängnis.“
„Soph“, begann er seufzend. „Deine Zimmernachbarin ist die Leadsängerin deiner Lieblingsband. So schlimm kann es doch gar nicht sein.“
„Ich will nach Hause!“
Wenn wir ein Zuhause hätten, dachte Tanner. Die Wahrheit war, dass er und Sophie seit Kats Tod fast schon wie Flüchtlinge gelebt hatten.
„Honey, du weißt, ich werde hier nicht lange bleiben. Du würdest hier Freunde finden, dich an die Gegend gewöhnen, und dann müssten wir doch schon wieder woanders hinziehen.“
„Ich will zu dir“, jammerte Sophie so schmachtend, dass Tanners Herz einen Schlag lang stockte. „Ich will Butterpie. Ich will ganz normal leben.“
Sophie würde niemals normal leben, so viel stand fest. Sie war erst zwölf, und sie hatte schon jetzt Fächer, bei denen sich der Lehrstoff auf College-Niveau bewegte. Noch ein Vorteil, wenn man eine Eliteschule besuchen durfte. Die Klassen waren kleiner, die PCs waren leistungsfähig genug, um damit Satelliten zu steuern, und die Gastdozenten waren angesehene Wissenschaftler, Historiker, Linguistikexperten und Superstars der Mathematik.
„Honey …“
„Warum kann ich nicht bei dir und Butterpie in Stone Creek sein? Da würde ich bestimmt nette Leute kennenlernen!“, beharrte sie.
„Dazu kann ich nichts sagen“, antwortete er. Tatsache war, dass er selbst eigentlich noch niemanden aus Stone Creek kennengelernt hatte, da er nur für ein paar Tage in der Stadt gewesen war. Er kannte den Makler, der ihm Starcross verkauft hatte, und er kannte Brad O’Ballivan, weil er für ihn vor den Toren von Nashville einen regelrechten Palast hingesetzt hatte. Dadurch war es überhaupt erst dazu gekommen, dass er sich zu dem Auftrag für dieses Tierheim überreden ließ.
Brad O’Ballivan. Dass dieser Star der Country & Western-Szene jemals sesshaft werden würde, hätte er nie für möglich gehalten. Und doch gab es für diesen Mann jetzt nichts Wichtigeres als seine Braut Meg – und jetzt wollte er unbedingt, dass all seine ledigen Freunde auch heirateten. Wahrscheinlich dachte er, wenn er hier mitten in der Einöde die Liebe fürs Leben findet, dann müsste das bei Tanner auch funktionieren.
„Dad, bitte“, flehte Sophie schniefend. Irgendwie versetzte ihm dieser Versuch seiner Tochter, sich ihre Tränen zu verkneifen, einen tieferen Stich ins Herz, als wenn sie tatsächlich in Tränen ausgebrochen wäre. „Hol mich hier raus. Wenn ich nicht bei dir in Stone Creek wohnen darf, dann kann ich ja vielleicht wieder bei Tante Tessa bleiben, so wie letzten Sommer …“
Tanner nahm den Hut ab, ging ein paar Schritte weiter und machte das Licht aus. „Du weißt, deine Tante macht im Moment eine schwierige Zeit durch“, erklärte er ihr ruhig. Eine schwierige Zeit? Tessa und ihr nutzloser Ehemann Paul Barker waren gerade mit ihrer Scheidung beschäftigt. Unter anderem erwartete eine andere Frau von Barker ein Kind, was für Tess ein besonders hässlicher Schlag ins Gesicht gewesen war, hatte sie sich doch seit dem Einsetzen der Pubertät nichts sehnlicher gewünscht, als Mutter zu werden. Und daneben musste sie nun auch noch um ihr Zuhause kämpfen, das sie von ihrem eigenen Geld gekauft hatte. Immerhin war sie als Teenager ein erfolgreicher Fernsehstar gewesen, und all ihr Geld steckte in dieser Pferdefarm. Gegen den Ratschlag von Tanner hatte sie nicht auf einem Ehevertrag bestanden.
Wir lieben uns, hatte sie ihm gesagt, den Blick vor lauter Glückseligkeit in weite Ferne gerichtet. Paul Barker hatte natürlich keinen Cent besessen, und nur einen Monat nach der Heirat war er für all ihre Konten unterschriftsberechtigt. Während nach und nach ihre Ehe in die Brüche ging, schrumpften auch die Guthaben.
Kalte Wut regte sich in Tanner bei dem Gedanken an Barker. Auf Kats Vorschlag hin hatte er vor langer Zeit einen Treuhandfonds für Tess angelegt, und das war eine verdammt gute Idee gewesen. Bis heute hatte sie nicht die geringste Ahnung von der Existenz dieses Geldes, weil er und Kat verhindern wollten, dass Barker davon erfuhr und irgendeinen Weg fand, um darauf zuzugreifen. Vermutlich würde sich Tess weigern, auch nur einen Dollar von diesem Geld anzunehmen, weil ihr unbändiger Quinn-Stolz ihr das untersagte. Aber wenn sie tatsächlich die Farm an Barker und dessen diabolisches Dream-Team aus Anwälten verlieren sollte, dann würde sie ganz von vorn anfangen müssen. Die Frage war allerdings, ob sie zu einem Neuanfang in der Lage sein würde.
„Dad?“, fragte Sophie. „Bist du noch da?“
„Ja, ich bin hier“, antwortete Tanner und ließ seinen Blick über die nächtliche Landschaft schweifen. Das mussten mindestens dreißig Zentimeter Schnee sein, und es fiel immer noch mehr vom Himmel. Verdammt, und dabei war der November noch nicht mal vorbei.
„Kann ich nicht wenigstens über Weihnachten nach Hause kommen?“
„Soph, du weißt doch, wir haben gar kein Zuhause.“
Wieder schniefte sie. „Klar haben wir ein Zuhause“, gab sie sehr leise zurück. „Das ist da, wo du und Butterpie seid.“
Mit einem Mal brannten Tanners Augen. Das musste an dem eisig kalten Wind liegen, der ihm ins Gesicht wehte. Als er sich bereit erklärt hatte, den Job anzunehmen, da hatte er bei Arizona an drei Dinge denken müssen: Kakteen, weite Wüstenlandschaft, sechsundzwanzig Grad im Winter.
Aber Stone Creek lag im nördlichen Teil von Arizona in der Nähe von Flagstaff, einer Region mit Wäldern und roten Felsen – und gelegentlichen Schneestürmen.
Es war nicht seine Art, solche geografischen Details zu übersehen, diesmal allerdings war genau das passiert. Er hatte den Vertrag unterschrieben, weil er ihm viel Geld einbrachte und da Brad ein guter Freund war.
„Was hältst du davon, wenn ich stattdessen zu dir komme? Wir verbringen Weihnachten in New York, wir gehen am Rockefeller Center Eislaufen, wir sehen uns die Rockettes an …“
Sophie liebte New York. Sie wollte dort das College besuchen und danach Medizin studieren, anschließend plante sie sich als Neurochirurgin niederzulassen. Für ein Mädchen in diesem Alter ein ziemlich ehrgeiziges Ziel, aber diese Gene hatte sie von ihrer Mutter geerbt, nicht von ihm. Kat war nicht nur so schön wie ein Supermodel gewesen, sondern auch noch hochintelligent, hatte sie doch als Chirurgin mit dem Fachgebiet Kinderkardiologie gearbeitet. Das alles hatte sie aufgegeben, um Sophie zu bekommen und mit ihrem rastlosen Ehemann durch die Welt zu reisen, und dabei beteuert, dass es nur vorübergehend war …
„Aber dann kann ich Butterpie nicht sehen“, wandte Sophie ein und kicherte. „Ich glaube, ins Waldorf werden sie sie nicht lassen, auch wenn wir den Haustierzuschlag bezahlen.“
Unwillkürlich stellte sich Tanner vor, wie das Pony an den Blumenarrangements in der gediegenen Lobby des Hotels knabberte und dabei ein paar Pferdeäpfel auf den altehrwürdigen Teppichen verteilte. „Nein, wahrscheinlich nicht“, stimmte er ihr grinsend zu.
„Willst du nicht, dass ich zu dir komme, Dad?“, fragte sie plötzlich. „Liegt es daran? Meine Freundin Cleta sagte, dass ihre Mom sie über Weihnachten nicht nach Hause kommen lässt, weil sie einen neuen Freund hat und nicht will, dass ihr ein Kind den Spaß verdirbt.“
Cleta? Wer gab einem armen, wehrlosen Kind den Namen Cleta?
Und was für eine Mutter war das, die lieber ihren „Spaß“ hatte, als ihr eigenes Kind zu sich zu holen? Noch dazu an Weihnachten!
Tanner kniff kurz die Augen zu, dann schritt er auf das in Dunkelheit gehüllte Haus zu, in dem er sich noch nicht auskannte. Die letzten Nächte hatte er in Brads Haus verbringen können, bis hier die Stromversorgung sichergestellt und das Telefon angeschlossen worden war.
„Ich liebe dich mehr als jeden anderen Menschen auf der Welt“, versicherte er ihr und meinte jedes Wort so, wie er es sagte. Praktisch sein ganzes Handeln war darauf ausgerichtet, für Sophie zu sorgen und sie vor den anonymen und gesichtslosen Mächten zu beschützen, deren Hass er sich zugezogen hatte. „Glaub mir, hier kann ich keinen Spaß haben.“
„Dann werde ich eben weglaufen“, verkündete sie entschlossen.
„Viel Glück“, konterte Tanner, nachdem ihm sekundenlang der Atem gestockt hatte. „Dir ist genauso klar wie mir, dass diese Schule ringsherum hermetisch abgeschlossen ist.“
„Wovor hast du solche Angst?“
Dich zu verlieren. Die Kleine hatte keine Ahnung, wie groß und vor allem wie gefährlich die Welt war. Sie war erst sieben gewesen, als Kat getötet wurde, und sie konnte sich kaum an den Rückflug aus Nordafrika erinnern. Leibwächter hatten im Flugzeug die Plätze um sie herum besetzt, damit sich ihnen beiden niemand nähern konnte, während im Frachtraum der versiegelte Sarg transportiert worden war.
Die Medien hatten sich auf die Story gestürzt. „US-Bauunternehmer von Aufständischen angegriffen“, hatte eine Schlagzeile gelautet, während eine andere fragte: „Fiel Ehefrau eines amerikanischen Geschäftsmanns einem Racheakt zum Opfer?“
„Ich habe vor gar nichts Angst“, beharrte Tanner.
„Das hat was damit zu tun, was mit Mom passiert ist“, redete Sophie weiter. „Das hat Tante Tessa gemeint.“
„Tante Tessa soll sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern.“
„Wenn du mich hier nicht rausholst, dann breche ich aus, und wohin ich dann gehe, weiß ich noch nicht.“
Tanner war an der altmodischen, um das ganze Erdgeschoss verlaufenden Veranda angekommen. Das Haus besaß einen gewissen Charme, auch wenn noch viel instand gesetzt werden musste. Er konnte sich nur zu gut vorstellen, wie Sophie hier zwischen dem Gebäude und der Scheune hin und her lief, wie sie mit einem dieser gelben Busse zur Schule fuhr, wie sie Jeans anstelle einer Schuluniform trug. Wie sie Poster in ihrem Zimmer an die Wand klebte, wie sie mit ganz normalen Kindern zu tun hatte, nicht mit kleinen Prominenten mit all ihren Macken.
„Versuch es gar nicht erst, Soph“, sagte er, drehte den Knauf und drückte dann mit der Schulter die schwere Haustür auf. „Du bist in Briarwood gut aufgehoben, und von Connecticut bis Arizona ist es ein weiter Weg.“
„Gut aufgehoben?“, fauchte sie ihn an. „Ich bin hier nicht in einer Parallelwelt, weißt du, Dad? Hier passieren auch Sachen. Erst letzte Woche hat Marissa vom Kartoffelsalat in der Cafeteria eine Lebensmittelvergiftung gekriegt, und dann musste sie mit dem Hubschrauber ins Walter Reed gebracht werden. Allison Mooreland hatte einen Blinddarmdurchbruch, und sie …“
„Soph“, unterbrach er sie und schaltete in der Diele das Licht an. Wo entlang ging es zur Küche?
Sein Zimmer war irgendwo oben, aber wo?
Er hängte seinen Hut an die Garderobe, dann zog er seinen Ledermantel aus und warf ihn in Richtung eines kunstvoll verzierten Messinghakens.
Sophie schwieg. Obwohl sie sich fast am anderen Ende des Landes befand, konnte Tanner spüren, wie sie den Atem anhielt.
„Wie wär’s damit: Das Schuljahr endet im Mai, dann kommst du her und verbringst die Sommerferien hier. Dann kannst du auf Butterpie reiten, so lange du willst.“
„Im Sommer bin ich zu groß, um noch auf Butterpie zu reiten“, machte sie ihm klar. Einmal mehr fragte sich Tanner, ob seine scharfsinnige Tochter nicht besser Anwältin werden sollte. „In drei Tagen ist Thanksgiving“, fuhr sie hastig fort. „Lass mich dich zu Thanksgiving besuchen, und wenn du danach immer noch meinst, dass ich nicht brav genug bin, um bei dir zu bleiben, dann gehe ich zurück nach Briarwood und tue für den Rest des Jahres so, als würde es mir hier unheimlich gefallen.“
„Niemand hat behauptet, dass du nicht brav bist, Soph“, wandte er ein. Inzwischen war er im Wohnzimmer angekommen, wo er an einem vergilbten Wandkalender stehen blieb, den der letzte Eigentümer der Ranch hier zurückgelassen hatte. Dummerweise war er einige Jahre alt.
Sophie sagte nichts.
„In drei Tagen ist Thanksgiving?“, murmelte er erschrocken.
Durch seinen Lebensstil neigte er dazu, Feiertage völlig aus den Augen zu verlieren. Aber wenn Weihnachten für seine Tochter bereits ein Thema war, dann konnte der Truthahntag gar nicht weit entfernt sein.
„Wenn ich mich auf eine Warteliste setzen lasse, dann könnte ich noch ein Ticket kriegen“, erwiderte sie hoffnungsvoll.
Tanner schloss die Augen und ließ die Stirn gegen die Wand sinken, an der Hunderte von kleinen Löchern davon zeugten, wie viele Kalender hier schon im Lauf der Jahre mit Reißzwecken aufgehängt worden waren. „Das ist ein ziemlich weiter Weg, nur um in einem fetttriefenden Diner eine Portion Truthahn zu essen.“ Er wusste, sie stellte sich ein idyllisches Abendessen mit der ganzen Familie vor, in der Mitte auf dem Tisch den Truthahn, der eben erst aus dem Backofen geholt worden war.
„Irgendjemand wird dich schon zum Essen einladen“, entgegnete Sophie mit einer zerbrechlich klingenden Zuversicht in ihrem Tonfall. „Dann könnte ich doch einfach mitkommen.“
Er sah auf die Uhr und marschierte in Richtung Küche. Wenn sie nicht dort war, wo er sie vermutete, würde er weitersuchen müssen. Er brauchte dringend einen Kaffee. Aber ohne Jack Daniel’s.
„Du hast dir wieder einen von diesen rührseligen Thanksgiving-Filmen im Fernsehen angeschaut, wie?“, brachte er mit erstickter Stimme heraus. Es gab so viele Dinge, die er Sophie nicht geben konnte – ein geordnetes Zuhause, eine Familie, eine normale Kindheit. Doch er konnte dafür sorgen, dass sie in Sicherheit war, und das bedeutete, sie musste in Briarwood bleiben.
Eine lange, schmerzende Pause schloss sich an.
„Du wirst nicht nachgeben, richtig?“, fragte sie schließlich im Flüsterton.
„Wird dir das erst jetzt klar, Kleine?“, gab Tanner zurück und bemühte sich um einen lockeren Tonfall.
Von ihr kam nur ein sehr frustriertes Seufzen zurück, und schließlich erwiderte sie: „Na gut, aber sag nachher nicht, ich hätte dich nicht gewarnt.“
2. KAPITEL
Es war eine Schande, dass die Starcross Ranch so verfallen war, überlegte Olivia, während sie ihren Suburban über den Zufahrtsweg lenkte. Ginger saß neben ihr auf dem Beifahrersitz, Rodney fuhr auf der Rückbank mit. Das Grundstück grenzte im Westen an ihr gemietetes Anwesen an, und obwohl sie auf dem Weg in die Stadt tagtäglich an dem verwitterten Zaun und der windschiefen Scheune vorbeikam, wirkte die Ranch an diesem Morgen auf eine unerklärliche Weise noch viel verlassener.
Am Stoppschild hielt sie an, um nach rechts und links zu sehen. Die Straße war frei, aber noch ehe sie auf das Gaspedal treten konnte, traf die allzu bekannte Schwingung sie wie ein Blitz.
„O nein“, sagte sie erschrocken.
Ginger, die eifrig die verschneite Landschaft absuchte, äußerte sich nicht.
„Hast du das gehört?“, hakte Olivia nach.
Daraufhin drehte sich Ginger zu ihr um und reagierte mit einem leisen, kurzen Bellen. Offenbar hatte sie sich für den heutigen Tag vorgenommen, sich für einen ganz gewöhnlichen Hund auszugeben – als ob es so etwas wie einen gewöhnlichen Hund überhaupt geben konnte –, der zu einer intelligenten Unterhaltung nicht in der Lage war.
Der Ruf kam aus der alten Scheune auf dem Starcross-Grundstück.
Olivia ließ einen Moment lang die Stirn auf dem kalten Lenkrad ruhen. Natürlich wusste sie längst, dass Brads Freund, dieser wichtige Bauunternehmer, dort einziehen wollte, und sie hatte auch schon mindestens einen Umzugswagen gesehen. Aber ihr war nichts davon bekannt, dass er auch Tiere mitbringen würde.
„Ich könnte es ignorieren“, sagte sie zu Ginger.
„Wohl eher nicht“, gab die Hündin zurück.
„Ach, verflucht“, stöhnte sie und setzte den Blinker nach links, obwohl es in die andere Richtung nach Stone Creek ging, und fuhr zu dem alten, baufälligen Tor, das die Zufahrt zur Starcross Ranch darstellte.
Das Tor stand weit offen, also befanden sich wahrscheinlich weder Rinder noch Schafe im Stall. Selbst die blutigsten Anfänger in Sachen Viehzucht wussten, dass diese Tiere keine Gelegenheit ausließen, um auszuschwärmen, wenn sie irgendwo einen Weg nach draußen fanden. Aber irgendein Geschöpf schickte ihr aus dieser erbärmlichen Scheune einen übersinnlichen Notruf.
Ihr Wagen holperte über die mit Schlaglöchern übersäte Zufahrt und geriet auf dem Schnee und der darunter befindlichen Eisschicht ein paar Mal ins Rutschen. Als Olivia einen brandneu aussehenden roten Pick-up vor dem Haus entdeckte, drückte sie beharrlich auf die Hupe, aber niemand ließ sich blicken, um dem Lärm auf den Grund zu gehen.
Grummelnd brachte Olivia ihren Suburban vor der Scheune zum Stehen, stieg aus und knallte die Wagentür zu. „Hallo?“, rief sie.
Niemand antwortete, zumindest kein menschliches Wesen.
Das Tier in dem windschiefen Gebäude dagegen verstärkte seinen übersinnlichen Ruf, woraufhin Olivia hinlief und vor dem großen Scheunentor kurz stehen blieb und einen sorgenvollen Blick hinauf zum alles andere als vertrauenerweckenden Dach warf. Dieses Bauwerk sollte schnellstmöglich abgerissen werden, bevor noch jemand zu Schaden kam.
„Hallo?“, rief sie abermals und öffnete das Tor weit genug, um die Scheune betreten zu können.
Ihre Augen brauchten eine Weile, bis sie in der düsteren Scheune etwas ausmachen konnten. Trotz der eisigen Kälte, die einem das Knochenmark gefrieren lassen konnte, war der Himmel strahlend blau, und dementsprechend groß war der Kontrast zum Inneren des Gebäudes.
„Hier drüben“, antwortete eine lautlose Stimme, die tief und eindeutig männlich klang.
Olivia drang tiefer in die Schatten vor. Die Überreste von einem Dutzend Boxen, die früher einmal stabil und robust gewesen waren, säumten den mit Sägemehl und Stroh bedeckten Gang.
Ein großer Palomino sah sie aus einer Box zu ihrer Rechten an und bewegte den Kopf auf eine Weise, als wollte er auf die gegenüberliegende Seite zeigen.
Sie folgte der angedeuteten Richtung und schaute über die halbhohe Boxentür, hinter der sich ein kleines Pony mit gelblich-weißem Fell auf die frisch gestreuten Sägespäne hatte niedersinken lassen, um mit untergeschlagenen Läufen dazuliegen. Es sah Olivia betrübt an.
Obwohl sie rein rechtlich Haus- oder Landfriedensbruch beging, konnte Olivia einfach nicht anders und öffnete den Riegel, der die Boxentür zuhielt. Mit langsamen Bewegungen betrat sie die Box und kniete sich neben dem Pony hin, um dessen Kopf zu streicheln und zu tätscheln.
„Na du?“, sagte sie leise. „Weshalb denn diese Aufregung?“
Ein leichtes Schaudern durchfuhr das kleine Pferd.
„Ihr fehlt Sophie“, erklärte der Palomino von gegenüber.
Während sie sich fragte, wer wohl Sophie sein mochte, untersuchte sie das Tier genauer, wobei sie nicht aufhörte es zu streicheln. Das Pony machte einen gesunden, gepflegten Eindruck, und es war wohlgenährt, das konnte sie auf den ersten Blick erkennen.
Zwar begann der Palomino plötzlich laut zu wiehern, was für Olivia eigentlich Warnung genug hätte sein sollen, doch sie war viel zu sehr auf das kleine Pferd konzentriert, um von irgendetwas anderem Notiz zu nehmen.
„Wer sind Sie und was fällt Ihnen ein, sich in meine Scheune zu schleichen?“, wollte eine tiefe, energische Stimme wissen.
Olivia wirbelte so hastig herum, dass sie den Halt verlor und rücklings im Stroh landete. Als sie hochsah, blickte sie in das Gesicht eines dunkelhaarigen Mannes, der sie über die Boxentür hinweg finster anstarrte. Seine Augen waren so blau wie seine Jeansjacke, sein Cowboyhut wirkte eine Spur zu neu.
„Wer ist Sophie?“, fragte sie, während sie aufstand und sich das Stroh von ihrer Jeans wischte.
Er verschränkte nur die Arme und sah Olivia abwartend an. Er hatte als Erster eine Frage gestellt, und offenbar wollte er auch erst eine Antwort hören, bevor er etwas sagte. Nach der Art zu urteilen, wie der breitschultrige Mann dastand, würde er wohl lieber bis zum Jüngsten Tag auf ihre Antwort warten, ehe er selbst etwas erwiderte.
Schließlich gab sie nach, da sie heute noch andere Dinge zu erledigen hatte. Unter anderem musste sie den Eigentümer eines Rentiers ausfindig machen. Also setzte sie ihr gewinnendstes Lächeln auf und streckte ihm die Hand entgegen. „Olivia O’Ballivan. Ich bin Ihre Nachbarin, wenn man so will, und ich …“ Ich habe Ihr Pony um Hilfe rufen hören? Nein, so etwas sollte sie wohl besser nicht sagen. Welche Reaktion das nach sich ziehen würde, konnte sie sich nur zu gut ausrechnen. „Ich bin Tierärztin, und ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, mich bei jedem vorzustellen, der hierher in unsere Gegend zieht. Im Wesentlichen möchte ich meine Dienste anbieten.“
Die blauen Augen musterten sie, und offensichtlich hielt ihre Statur der Überprüfung nicht stand. „Ich schätze, Sie behandeln vor allem Katzen und Pudel“, gab er zurück. „Wie Sie sehen können, habe ich Pferde.“
Olivia empfand diese sexistische Bemerkung wie einen Schlag ins Gesicht. Es dauerte einen Moment, bis sie die Wirkung des Adrenalinschubs unter Kontrolle hatte. Mit überlegen lässiger Gebärde deutete sie auf das Pony und erklärte: „Dieses Pferd hat Depressionen.“
Der Hauch eines Lächelns umspielte Tanner Quinns verführerisch aussehenden Mund, amüsiert zog er eine Augenbraue hoch. Jedenfalls ging sie davon aus, dass dieser Mann Quinn war, schließlich hatte er „Ich habe Pferde“ gesagt, nicht „Wir“. Außerdem machte er auf sie nicht den Eindruck eines gewöhnlichen Ranchhelfers.
„Braucht mein Pony vielleicht ein paar bunte Pillen, damit es sich wieder besser fühlt?“, fragte er unüberhörbar ironisch.
„Das Pony braucht Sophie“, sagte der Palomino, was Mr Quinn natürlich nicht hören konnte.
„Wer ist Sophie?“, wiederholte sie.
Quinn zögerte sekundenlang. „Meine Tochter. Woher wissen Sie, wie sie heißt?“
„Mein Bruder Brad muss ihren Namen erwähnt haben“, antwortete Olivia, erleichtert darüber, dass ihr noch rechtzeitig eine halbwegs überzeugende Erklärung eingefallen war. Sie ging zur Boxentür und hoffte darauf, dass der Mann einen Schritt zur Seite machte, damit sie die Box verlassen konnte.
Das tat er jedoch nicht, sondern stand weiter wie angewurzelt da, während seine Arme auf der Türkante ruhten. „O’Ballivan“, sagte er nachdenklich. „Sie sind Brads Schwester? Sie werden das neue Tierheim leiten, wenn es eröffnet ist?“
„Ich glaube, ich erwähnte gerade, dass Brad mein Bruder ist“, konterte sie schnippisch. Sie fühlte sich ungewöhnlich aufgewühlt und in die Enge getrieben, was sie wunderte, da sie nicht unter Klaustrophobie litt. Auch wenn man sie mit ihren eins sechzig Körpergröße leicht übersehen konnte, war sie durchaus in der Lage, sich zur Wehr zu setzen. „Wären Sie jetzt so freundlich, mich aus der Box zu lassen?“
Quinn trat zur Seite und vollführte dazu noch eine tiefe Verbeugung.
„Du willst doch nicht etwa gehen, oder?“, meldete sich der Palomino besorgt zu Wort. „Butterpie benötigt Hilfe.“
„Einen Augenblick“, antwortete sie dem besorgten Pferd. „Ich werde mich darum kümmern, dass Butterpie gut versorgt ist, aber das wird ein bisschen dauern.“ Ein paar schweigsame Sekunden verstrichen, dann wurde Olivia klar, dass sie nicht wie sonst üblich eine geistige E-Mail geschickt, sondern ihre Erwiderung laut ausgesprochen hatte.
Prompt stellte sich Quinn ihr wieder in den Weg und verschränkte abermals die Arme vor der Brust. „Also“, begann er in unheilvollem Tonfall. „Ich weiß mit Sicherheit, dass ich niemandem in ganz Stone Creek gesagt habe, wie das Pony heißt, nicht mal Brad.“
Sie schluckte und versuchte vergeblich, ein Lächeln aufzusetzen. „Dann habe ich wohl gut geraten“, meinte sie und wollte um ihn herumgehen.
Er fasste nach ihrem Arm, ließ sie aber gleich wieder los.
Als Olivia ihn ansah, wurde ihr klar, dass der Palomino recht hatte. Sie konnte nicht einfach weggehen, auch wenn Tanner sie für noch so verrückt halten würde. Butterpie war in Schwierigkeiten.
„Wer sind Sie?“, fragte Tanner schroff.
„Das habe ich Ihnen bereits gesagt. Ich bin Olivia O’Ballivan.“
Tanner nahm seinen Hut ab, mit der freien Hand fuhr er sich durchs volle, etwas zottelige Haar. Wegen der Löcher im Dach war der Gang vor der Box besser beleuchtet, da sich überall Sonnenstrahlen einen Weg ins Innere bahnten. Sie konnte sehen, dass der Mann unrasiert war.
Von einem frustrierten Stöhnen begleitet fragte er: „Können wir noch mal von vorn anfangen? Wenn Sie tatsächlich Olivia O’Ballivan sind, dann werden wir bei diesem Tierheim-Projekt zusammenarbeiten müssen, und das geht wesentlich besser, wenn wir gut miteinander auskommen.“
„Butterpie sehnt sich nach Ihrer Tochter“, sagte Olivia. „Sehr sogar. Wo ist sie?“
„Im Internat“, antwortete er seufzend, als müsste er sich dazu überwinden, diese Worte auszusprechen. Seine jeansblauen Augen waren immer noch auf ihr Gesicht gerichtet.
„Oh.“ Das tat ihr für das Pony und für Sophie gleichermaßen leid. „Aber zu Thanksgiving wird Ihre Tochter doch zu Hause sein, nicht wahr?“
Tanners Miene war wie versteinert, und auch seine Augen nahmen keinen sanfteren Ausdruck an.
„Nein.“
„Nein?“ Olivias ohnehin schon angeschlagene Stimmung sank auf den Nullpunkt.
Der Mann machte einen Schritt zur Seite, nachdem er ihr eben noch den Weg versperrt hatte. Es war offensichtlich, dass sie von hier verschwinden sollte, und das so schnell wie möglich.
Nun war es Olivia, die die Arme verschränkte und eine starrsinnige Körperhaltung einnahm. „Dann werde ich das dem Pferd erklären müssen.“
„Was?“, fragte Tanner verständnislos.
Anstatt ihm zu antworten, drehte sie sich um und kehrte in die Box zurück. „Sophie ist im Internat“, sagte sie dem Tier lautlos. „Sie kann zu Thanksgiving nicht nach Hause kommen. Aber du darfst dich nicht so hängen lassen. Bestimmt kommt sie zu Weihnachten her.“
„Was machen Sie da?“, wollte Tanner wissen. Er klang gereizt.
„Ich lasse Butterpie wissen, dass sie nicht deprimiert sein soll und dass Sophie zu Weihnachten daheim sein wird.“ Er hatte sie gefragt, dann sollte er jetzt sehen, was er mit ihrer Antwort anfangen konnte.
„Sind Sie verrückt oder was?“
„Kann schon sein“, erwiderte Olivia und sagte dann in normalem Tonfall an das Pony gerichtet: „Ich muss jetzt gehen. Ich muss ein verirrtes Rentier in meine Praxis bringen, um es zu röntgen, und anschließend muss ich es zu meinem Bruder fahren, damit es dortbleibt, bis ich seinen Eigentümer gefunden habe. Aber ich werde dich bald wieder besuchen kommen, das verspreche ich dir.“
Bei diesen Worten hörte sie Tanner hinter sich leise schnauben.
„Du solltest aufstehen“, redete sie weiter auf das Tier ein. „Dann fühlst du dich auch besser.“
Diesmal war es das Pony, das ein Schnauben von sich gab, während es sich langsam aufrichtete.
Tanner stockte hörbar der Atem, als er das sah.
Behutsam tätschelte Olivia Butterpies Hals. „Das hast du toll gemacht. So ist es richtig.“
„Sie sind mit einem Rentier unterwegs?“, fragte Tanner und folgte ihr aus der Scheune.
„Sie können sich gern davon überzeugen“, gab Olivia zurück und deutete auf ihren Wagen.
Tanner näherte sich dem Fahrzeug und ging an der Beifahrertür vorbei, woraufhin Ginger ausgelassen zu bellen begann. Der Mann winkte dem Hund beiläufig zu, was Olivia zu der Erkenntnis brachte, dass er doch nicht ganz so hart und kalt war, wie er sich ihr gegenüber präsentiert hatte.
Mit dem Handschuh wischte er das hintere Seitenfenster sauber und spähte nach drinnen. „Ich glaub’s nicht!“, murmelte er entgeistert. „Das ist tatsächlich ein Rentier.“
„Hab ich doch gesagt“, meinte sie. Unterdessen bekam sich Ginger im Wageninneren fast nicht mehr ein. Die verrückte Hündin hatte eine Schwäche für gut aussehende Männer. Obwohl … eigentlich hatte sie eine Schwäche für Männer insgesamt. „Ginger, Platz!“
Zwar gehorchte Ginger, allerdings machte sie dabei eine so bemitleidenswerte Miene, als posiere sie für eine Kampagne zugunsten unerwünschter Heimtiere.
„Wo haben Sie denn ein Rentier aufgelesen?“, wunderte sich Tanner, der sie nun mit ganz anderen Augen wahrzunehmen schien.
So lächerlich dieser Gedanke auch war, wünschte sie sich in diesem Moment dennoch, sie hätte an diesem Tag irgendetwas angezogen, das sie femininer wirken ließ, nicht aber ihre üblichen Jeans, das Flanellhemd und die mit Dreckspritzern überzogene Daunenweste. Das Problem war nur, sie besaß überhaupt keine Kleidung, die sie auch nur annähernd feminin hätte aussehen lassen.
„Ich habe es gefunden“, sagte sie und öffnete die Fahrertür. „Gestern Nacht an der Zufahrt zu meinem Grundstück.“
Zum ersten Mal, seit sie Tanner vor ein paar Minuten kennengelernt hatte, lächelte er. Es war ein Lächeln, das ihr fast den Boden unter den Füßen wegzog. Seine makellos geraden Zähne strahlten in einem Weiß, das sie für natürlich hielt und nicht für Jacketkronen.
„O-kay“, redete er weiter und dehnte dabei das Wort extrem. „Dann, Dr. O’Ballivan, verraten Sie mir doch bitte mal, was ein Rentier in Arizona zu suchen hat.“
„Das werde ich Ihnen verraten“, erwiderte sie und stieg ein, „sobald ich es herausgefunden habe.“
Sie wollte die Tür zuziehen, aber er war bereits um den Wagen herumgekommen und hatte sich in die offene Tür gestellt. Den Cowboyhut hatte er inzwischen wieder aufgesetzt, und als er jetzt neben ihr stand, grinste er sie breit an. „Ich schätze, für morgen früh um zehn ist der erste Spatenstich angesetzt“, sagte er. „Da werden wir uns wiedersehen.“
Olivia nickte und wunderte sich darüber, dass sie sich auf eine unerklärliche Weise nervös fühlte.
„Hübscher Hund“, meinte Tanner.
„Man dankt“, sagte Ginger begeistert.
„Klappe“, raunte Olivia die Hündin an.
Tanner wich daraufhin verdutzt ein kleines Stück zurück, aber der schelmische Ausdruck hielt sich in seinen Augen.
„Sie waren nicht gemeint“, stellte sie hastig klar, während sie einen roten Kopf bekam.
Er musterte sie, als wollte er sie fragen, ob sie wohl vergessen hatte, ihre Tabletten zu nehmen. Es war sein Glück, dass er das dann aber doch nicht tat. Stattdessen tippte er nur an die Krempe seines Huts und machte einen Schritt nach hinten, damit Olivia die Fahrertür schließen konnte.
Kaum hatte sie den Motor angelassen, gab sie auch schon Gas, wendete in einem Zug auf dem freien Platz vor der Scheune und ließ die Ranch hinter sich zurück. „Das ist großartig gelaufen“, sagte sie an Ginger gewandt. „Wir werden uns den ganzen Tag gegenseitig auf den Füßen stehen, wenn das Tierheim gebaut wird, und er glaubt, ich bin reif für die Zwangsjacke.“
Diesmal antwortete Ginger nicht.
Eine halbe Stunde später waren die Röntgenaufnahmen erledigt, und sie hatte Rodney Blut abgenommen. Jetzt konnte das Rentier zu Brad gebracht werden.
Tanner stand auf dem Hof vor der Scheune und starrte dem Schrotthaufen auf Rädern hinterher, während er überlegte, was ihm da gerade eben eigentlich passiert war. Auf jeden Fall fühlte es sich so an, als hätte ihn ein Güterzug überrollt.
Sein Handy klingelte und holte ihn aus seiner Trance.
Er zog das Telefon aus der Jackentasche und schaute auf das Display. Der Anruf kam von Ms Wiggins, der Rektorin von Briarwood. Sie hatte sich viel Zeit mit ihrem Rückruf gelassen, immerhin hatte er schon bei Sonnenaufgang eine Nachricht auf ihren Anrufbeantworter gesprochen.
„Tanner Quinn“, meldete er sich reflexartig.
„Hallo, Mr Quinn“, begrüßte Ms Wiggins ihn. Die ehemalige CIA-Agentin Janet Wiggins war durchaus eine attraktive Frau, sofern man den Typ mochte, der mit Waffen umzugehen wusste. Tanners Fall war das nicht, aber es änderte nichts an der Tatsache, dass die Frau eine mustergültige Dienstakte und einen überzeugenden Lebenslauf vorweisen konnte. „Tut mir leid, dass ich mich erst jetzt melde. Aber die Besprechungen – na ja, Sie wissen schon.“
„Ich mache mir Sorgen wegen Sophie“, sagte er ohne Vorrede. Von dem Berg, der sich am Rand von Stone Creek in den Himmel streckte, fegte ein kalter Wind herab, der Tanner in den Ohren schmerzte. Dennoch ging er nicht zurück ins Haus, sondern blieb vor der Scheune stehen, wo die Kälte seinen ganzen Körper durchdrang.
„Das habe ich aus Ihrer hinterlassenen Nachricht heraushören können, Mr Quinn“, entgegnete Ms Wiggins freundlich. Sie war den Umgang mit übermäßig besorgten Eltern gewohnt, vor allem mit solchen, die zudem noch von ihrem schlechten Gewissen geplagt wurden. „Tatsache ist, dass Sophie nicht die einzige Schülerin ist, die über die Feiertage in Briarwood bleibt. Es gibt noch einige andere. Wir haben vor, mit allen Zurückgebliebenen eine Zugfahrt nach New York zu unternehmen, damit sie sich die Parade zu Thanksgiving ansehen können. Anschließend gehen wir mit ihnen im Four Seasons essen. Würden Sie unseren wöchentlichen Newsletter lesen, dann wüssten Sie über diese Dinge Bescheid. Wir verschicken ihn immer freitagnachmittags per E-Mail.“
Sehr schön, aber ich bin eben einer Frau begegnet, die mit Tieren redet und die glaubt, dass diese Tiere ihr antworten!
In ruhigem Tonfall erwiderte Tanner: „Ich lese Ihren Newsletter sehr aufmerksam, Ms Wiggins, und ich weiß nicht, ob es mir tatsächlich gefällt, dass meine Tochter als eine ‚Zurückgebliebene‘ bezeichnet wird.“
Ms Wiggins antwortete mit einem Kichern, das gar nicht zu einer ehemaligen CIA-Agentin passte. „Keine Sorge, diese Bezeichnung benutzen wir nicht in der Gegenwart der Schüler“, versicherte sie ihm. „Sophie geht es gut. Sie neigt bloß dazu, die Dinge etwas dramatischer hinzustellen, als sie es in Wahrheit sind, weiter nichts. Sie macht das so gut, dass ich sie momentan zu überreden versuche, sich zu Beginn des nächsten Schuljahrs für den Schauspielkurs einzuschreiben und …“
„Und Sie sind sich sicher, dass es ihr gut geht?“, fiel Tanner ihr ins Wort.
„Von all unseren Schülern gehört sie zu denen, die emotional sehr gefestigt sind. Es ist aber nun mal so, dass Kinder etwas sentimental werden, wenn es auf die Feiertage zugeht.“
Geht das nicht jedem von uns so? fragte sich Tanner. Wenn Sophie nicht bei ihm sein konnte, ließ er Thanksgiving und Weihnachten jedes Mal ausfallen. Bislang war ihm das immer problemlos gelungen, da er die letzten beiden Jahre im Ausland verbracht hatte. Sophie war in der Zeit bei Tessa geblieben, und er hatte die Geschenke für Sophie im Internet bestellt. Als ihm diese Erinnerung durch den Kopf ging, verspürte er tief in seinem Inneren ein Gefühl der Leere.
„Ich weiß ja, Sophie ist emotional ausgeglichen“, sagte er geduldig. „Aber das bedeutet nicht, dass es ihr gut geht.“
Ms Wiggins legte eine Kunstpause ein, ehe sie antwortete. „Nun, wenn Sie wollen, dass Sophie über Thanksgiving nach Hause kommt, dann werden wir selbstverständlich gerne alle notwendigen Vorbereitungen treffen.“
Tanner wollte Ja, sofort sagen. Buchen Sie einen Flug, bringen Sie sie zum Flughafen. Mir ist egal, was es kostet. Doch so etwas würde bloß einen tränenreichen Abschied nach sich ziehen, sobald Sophie in die Schule zurückkehren musste – und einen solchen Abschied konnte er einfach nicht ertragen. Jedenfalls nicht so bald.
„Es ist besser, wenn Sophie bei Ihnen bleibt“, sagte er stattdessen.
„Der Meinung bin ich auch“, stimmte Ms Wiggins ihm zu. „Solche Heimreisen in letzter Minute können für ein Kind sehr belastend sein.“
„Sie lassen von sich hören, wenn es irgendwelche Probleme gibt?“
„Selbstverständlich“, beteuerte die Frau. Wenn er sich den leicht herablassenden Unterton in ihrer Stimme nicht nur einbildete, dann hatte er ihn vermutlich auch verdient. „Wir hier in Briarwood rühmen uns damit, dass wir nicht nur auf die schulischen Leistungen der Kinder achten, sondern auch immer ihr körperliches und seelisches Wohl im Blick haben. Ich kann Ihnen versichern, dass Sophie nicht unter irgendeinem Trauma leidet.“
Tanner wünschte, er könnte nur halb so viel Überzeugung aufbringen, wie Ms Wiggins über das Telefon ausstrahlte. Ein paar Festtagsfloskeln wurden ausgetauscht, dann war das Gespräch beendet. Er klappte das Handy zu und schob es zurück in die Jackentasche.
Dann drehte er sich zur Scheune um.
Konnte ein Pferd Depressionen bekommen?
Niemals, entschied er. Bei einem Mann sah das allerdings anders aus.
Als Olivia auf den Hof gefahren kam, wurde sie von einem Schneemann begrüßt. An der Haustür hing ein aufklappbarer Truthahn aus Pappe. Brad kam soeben aus der Scheune, und gleichzeitig betrat ihre Schwägerin Meg die Veranda und lächelte ihr freundlich zu.
„Wie gefällt dir unser Truthahn?“, rief sie. „Wir bringen uns dieses Jahr richtig in Festtagsstimmung.“ Dann nahm ihr Lächeln einen etwas betrübten Zug an. „Es ist irgendwie eigenartig, dass Carly nicht hier ist, aber sie verbringt selbst eine sehr schöne Zeit.“
Grinsend zeigte Olivia auf Brad. „Redest du von dem da?“, zog sie ihren großen Bruder auf. „Ja, als Truthahn dürfte er ganz okay sein.“
Brad stellte sich zu ihr, legte einen Arm um ihren Hals und drückte sie an sich. „Sie redet von dem Papptruthahn an der Tür“, ließ er sie in einem übertriebenen Flüsterton wissen.
Olivia täuschte eine überraschte Miene vor und brachte ein „Oh!“ heraus, woraufhin Brad sie lachend aus dem Schwitzkasten entließ.
„Und was führt dich auf die Stone Creek Ranch, Doc?“, wollte er wissen.
Anstatt zu antworten, ließ Olivia ihren Blick über die vertraute Umgebung schweifen. Wie immer, wenn sie nach Hause kam, fiel ihr als Erstes auf, wie sehr ihr Großvater Big John ihr fehlte. Seit Brad seine Karriere als Country-Musiker zumindest zum Teil an den Nagel gehängt hatte, war hier viel geschehen. Er hatte die Scheune auf Vordermann gebracht, die alten Zäune ersetzt und ein Aufnahmestudio eingerichtet, das auf dem neuesten Stand der Technik war. Zumindest hatte er aufgehört, auf Tournee zu gehen. Aber auch wenn Meg, die vierzehnjährige Carly und das Baby jetzt in seinem Leben eine Rolle spielten, war Olivia nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass er tatsächlich sesshaft geworden war. So wie ihre Mutter hatte er sich schon früher ganz plötzlich wieder aus dem Staub gemacht.
„Ich habe da ein Problem“, erwiderte sie mit großer Verzögerung auf seine Frage.
Meg war wieder ins Haus gegangen, während sie mit Brad noch immer auf dem Hof stand.
„Was für ein Problem?“ Er sah sie ernst an.
„Ein Rentier-Problem“, antwortete sie und fügte in Gedanken hinzu: Ach ja, und deinen Freund, den Bauunternehmer, habe ich auch noch auf dem falschen Fuß erwischt.
Brad stutzte. „Ein … was?“
„Ich muss hier raus“, sandte Ginger ihr aus dem Wagen zu. „Und zwar sofort.“
Leise seufzend öffnete Olivia die Beifahrertür, die Hündin sprang heraus, schnupperte kurz hier und da, dann kauerte sie sich hin und hinterließ einen gelblichen Fleck im Schnee. Nachdem das erledigt war, trottete sie in Richtung Scheune davon, wohl um Ausschau nach Brads Hund Willie zu halten.
„Ich habe ein Rentier gefunden“, sagte Olivia und öffnete die hintere Tür des Suburban, um den Blick auf Rodney freizugeben. „Ich hoffe, ich kann es bei dir unterbringen, bis wir den Eigentümer gefunden haben.“
„Und wenn es niemandem gehört?“, hakte ihr Bruder nach, fuhr sich durch sein zotteliges Haar und beugte sich dann vor, um das Tier zu streicheln.
„Rodney ist handzahm“, versicherte sie ihm.
„Mag sein, aber er ist nicht stubenrein.“ Brad deutete auf die Hinterlassenschaft auf der Decke, die auf dem Rücksitz lag.
„Ich habe auch nicht erwartet, dass du ihn ins Haus holst“, machte sie ihm klar.
Brad begann zu lachen, dann streckte er die Arme aus und holte Rodney aus dem Suburban. Das Rentier war von der langen Autofahrt ein wenig wacklig auf den Beinen und sah Olivia beunruhigt an.
„Du bist hier in Sicherheit“, sagte sie zu dem Tier, dann wandte sie sich wieder Brad zu. „Er kann doch in der Scheune bleiben, oder? Ich weiß, ein paar von den Boxen stehen leer.“
„Klar“, erwiderte Brad nach einem kurzen Zögern, das etwas Komisches an sich gehabt hätte, wäre Olivia nicht so sehr in Sorge um Rodney gewesen. „Klar“, wiederholte er dann.
Da sie wusste, dass er im Begriff war, ihr die Haare zu zerwühlen, wie er es schon gemacht hatte, als sie beide noch Kinder gewesen waren, tat sie hastig einen Schritt zur Seite, um außer Reichweite zu sein.
„Ich erwarte aber eine Gegenleistung“, redete er weiter.
„Und zwar?“, fragte sie argwöhnisch.
„Du kommst an Thanksgiving zu uns. Keine Ausflüchte, dass du in deiner Klinik einspringen musst. Ashley und Melissa kommen beide, außerdem Megs Mutter und ihre Schwester Sierra.“
Diese Einladung traf sie nicht völlig unvorbereitet, schließlich hatte Meg schon vor Wochen davon geredet, Thanksgiving ganz groß zu feiern. Allerdings war es so, dass Olivia an Feiertagen lieber arbeitete, weil sie dann nicht daran denken musste, dass Big John nicht mehr bei ihnen war. Außerdem musste sie sich dann auch nicht mit der Frage herumquälen, ob ihre seit so langer Zeit verschollene Mutter womöglich plötzlich zur Tür hereingeplatzt kam, um sich mit ihren mittlerweile erwachsenen Kindern zu versöhnen, nachdem sie sie vor all den Jahren einfach im Stich gelassen hatte.
„Livie?“, fragte Brad.
„Ja, okay. Ich werde kommen. Aber ich habe über Thanksgiving Rufbereitschaft. Alle anderen Tierärzte haben Familie, und wenn es einen Notfall gibt …“
„Liv“, unterbrach er sie. „Du hast auch Familie.“
„Ich rede von Ehepartnern und Kindern“, machte Olivia ihm aufgebracht klar.
„Zwei Uhr. Du musst nichts mitbringen, und zieh irgendwas an, in dem du nicht einem Kalb auf die Welt geholfen hast.“
Sie warf ihm einen wütenden Blick zu. „Kann ich jetzt meinen Neffen sehen, oder gibt es dafür auch schon eine Kleiderordnung?“
Brad reagierte mit einem Lachen. „Ich werde Rudolph in einer schönen, gemütlichen Box unterbringen. Aber lass deine gereizte Laune besser im Wagen. Meg meint das mit der Festtagsstimmung ernst. Und weil Carly dieses Jahr nicht da ist, hat sie besonders viel Arbeit.“