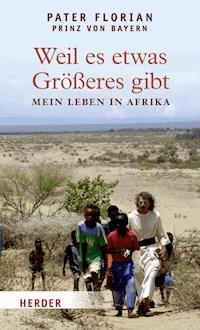
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Geboren wurde er als Franz-Josef Prinz von Bayern. Heute ist er Pater Florian, Missionsbenediktiner im Norden Kenias. Dieses Buch erzählt die außergewöhnliche Geschichte eines außergewöhnlichen Menschen, der als junger Mann einen radikalen Schritt unternimmt und aus der Welt des Adels und der festen Rollenzuschreibungen aufbricht, um sein wahres Glück als Ordensmann und Missionar in der Weite Afrikas zu finden. "Wenn ich all diese Baustellen sehe, denke ich oft: "Was habe ich eigentlich in all den Jahren getan? Gibt es denn gar keine Entwicklung?" Doch, die gibt es. Zum Beispiel an Bauten ist Illeret sehr gewachsen, sowohl die Mission als auch der Ort selbst. Die Kinder wollen in die Schule. Leider können sich die Eltern die Schuluniform, Schuhe und Examensgebühr oft nicht für alle leisten. Es ist hart, die Misere immer vor Augen zu haben und "nichts" daran ändern zu können. Doch das stimmt nicht ganz. Wir können etwas ändern, aber erst in der zweiten oder dritten Generation, und nur, wenn wir jetzt in der ersten Generation am Ball bleiben. Man sieht: Entwicklung geschieht nicht in Jahren, sondern in Generationen. Wir müssen uns damit "abfinden", dass wir nur ein Baustein im Masterplan Gottes sind. Doch das ist unsere Berufung; das gilt nicht nur für mich hier in Illeret, sondern für jeden Menschen, der an Gottes großartigem Schöpfungsplan mitarbeiten will. Das heißt einfach, dass wir unsere Grenzen akzeptieren müssen, aber auch, dass wir die Gewissheit haben, dass Gott sich um das Weitere kümmern wird. Beschränktheit heißt nicht Unfähigkeit, sondern dass wir nur sehr klein sind vor Gott. Trotzdem will er unsere Mitarbeit, jetzt und hier, jeder auf seinem Platz." (Pater Florian) Ein beeindruckendes Zeugnis vom Mut zum Aufbruch und vom Weg zu sich selbst. Mit Fotos aus Kindheit und Jugend sowie aus dem Alltag in Kenia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Florian von Bayern
Weil es etwas Größeres gibt
Mein Leben in Afrika
Verlag Herder
Buchnavigation
> Buch lesen
> Haupttitel
> Inhaltsübersicht
> Informationen zu Florian von Bayern
> Impressum
Inhaltsübersicht
Vorwort – Zu Hause in Illeret
Als ich Anfang der 1990er Jahre hier ankam, stand noch nichts bis auf ein Haus, dessen Inneres nicht mehr Platz bot als ein Zimmer. Viel hat sich getan seitdem, die Mission ist gewachsen, Mitbrüder sind dazugekommen. Alles wächst langsam, „bole, bole“, wie die Leute hier sagen. Das verlangt gute Planung und Willen zum Durchhalten. Was ist als Nächstes dran? Gerade gestern, auf dem Weg von Nairobi hierher, das sind 800 Kilometer, ist wieder einmal unser Lastwagen kaputtgegangen – die Straßen sind in einem beklagenswert schlechten Zustand, auf sie werde ich noch oft zu sprechen kommen. Jetzt steht er in der missionseigenen Werkstatt, wo die Mechaniker ihn hoffentlich wieder richten werden. Bevor das nicht gemacht ist, können wir kein neues Baumaterial holen und keine Lebensmittel, es sei denn, wir mieten eins der wenigen Autos hier am Ort. Im unteren Teil des Missionsgeländes müsste der aus Büschen gewachsene Zaun erneuert werden, damit die Ziegen nicht eindringen und alles Grün abfressen, das ihnen vor die Nasen kommt. Finanziell gesehen müsste es hinhauen, es sind Spenden aus Deutschland eingegangen. Die Kirche müsste erweitert oder ganz neu gebaut werden, sie ist einfach zu klein geworden inzwischen. Ja, es hat sich viel getan in der Zeit, seit ich hier bin. Aber es gibt noch viel zu tun.
Pater Florian
Aufbrüche, Stolpersteine
Die Nähe zur Kirche
Leutstetten, mein Heimatort – ich denke gern an ihn zurück. Nördlich des Starnberger Sees in Oberbayern gelegen, ist es der Ort, an dem ich aufgewachsen bin, an dem meine Familie lebte, ihr Zentrum hatte. Zugleich ist es der Ort, an dem mir meine Berufung in die Wiege gelegt wurde, von dem aus ich mich in die Ferne sehnte, um dieser Berufung nachzugehen.
Wir Kinder kamen zeitlich kurz nacheinander auf die Welt, sieben Geschwister innerhalb von acht Jahren. Ich bin der Zweitälteste unter den Geschwistern, 1957 geboren. Meine Schwester, Marie-Therese, ist ein Jahr älter als ich, und zwischen mir und der nächstjüngeren Schwester Lisa sind eineinhalb Jahre Unterschied.
Natürlich gab es Streitereien unter uns Geschwistern, das ist normal. Aber so etwas wie „Gruppierungen“ unter uns Geschwistern gab es nicht, im Gegenteil, wir hatten einen starken Zusammenhalt, der sich besonders dann bewies, wenn jemand von außen versuchte, uns auseinanderzubringen. Dann waren wir eine verschworene Gemeinschaft.
Für uns alle ist die Nähe zur Kirche immer Teil unseres Lebens gewesen. Zu Hause ging es nicht übermäßig religiös zu, jedoch ist die Familie tief verwurzelt in der Kirche. Das Gebet und der gemeinsame Besuch des Gottesdienstes hatten ihren festen Sitz im Familienleben. Der Glaube hat den Alltag bestimmt, und das hat uns Kinder geprägt. Für jeden von uns gab es Phasen, in denen man sich gegen manches gewehrt und auch den Glauben an sich einmal in Frage gestellt hat – wie es zum Heranwachsen und Erwachsenwerden dazugehört. Aber der Glaube, die Kirche bildete stets eine Konstante in unserem Familienleben.
Entscheidende Begegnungen
Wie jemand aber schon als Kind, das auf dem oberbayerischen Land heranwächst, zu dem Entschluss kommt, als Missionar in die Welt hinaus zu gehen, das kann man sich natürlich schon fragen.
Dazu beigetragen haben wichtige Begegnungen, die mich früh prägten. Ich denke zurück an meinen Heimatort und die Gottesdienste dort, und an meine Anfangszeit als Ministrant, in der Volksschule, eigentlich noch vor meiner Einschulung. Wir hatten einen guten Kaplan, den wir sehr mochten. Von uns Kindern im Ort – wir waren nicht viele, aber die Anzahl reichte für eine einklassige Schule mit insgesamt 21 Schülern, von der ersten bis zur achten Klasse – fanden einige Freude am Ministrieren, so auch ich. Genau kann ich es nicht sagen, aber vielleicht habe ich schon damals so etwas wie meine Berufung erfahren.
Ich erinnere mich noch gut an einige Begegnungen mit einem Missionar, der öfter bei meinen Großeltern in Wallsee zu Besuch war. Er stammte aus der Heimatpfarrei meiner Mutter, und wenn er im Salon meiner Großeltern saß und von seiner Arbeit in Papua-Neuguinea erzählte, spielte ich mit Vorliebe in seiner Nähe, um die Geschichten mithören zu können. Von Fremde, von Weite, vom Aufbruch in die Ferne, um sinnvolle Arbeit zu leisten, war darin die Rede. Die Erzählungen dieses Missionars haben mich stark beeinflusst.
Hinzu kamen Bücher. Die Romane und Erzählungen von Antoine Saint-Exupéry habe ich sehr geschätzt, und zwar weniger den „Kleinen Prinzen“ als die Prosa, die von Fliegern handeln, in denen es um Technik geht, die Schilderungen von spannenden Erlebnissen und Abenteuern. Vor allem seine feine Beobachtungsgabe für Menschen und seine Art, sie so genau und einfühlsam zu beschreiben, haben mich beeindruckt. „Der Kleine Prinz“ mag das in kleiner Form widerspiegeln, sein wichtigstes Werk für mich ist jedoch „Die Zitadelle“. Das sind kleinere Geschichten, in denen er seine Erlebnisse in der Wüste, in der Sahara verarbeitet hat. Obwohl er selbst mehrfach mit dem Flieger abstürzte, schreibt er nicht darüber, sondern über die Abstürze anderer Piloten. Die Zitadellen lagen entlang der Küste von Marokko, das aus zahlreichen kleinen Fürstentümern zusammengesetzt war, ähnlich dem alten deutschen Reich. Verfehlte ein Flieger sein Ziel, was oft vorkam, musste er notlanden und darauf hoffen, gefunden zu werden. Den freundschaftlichen Kontakt zu den nomadischen Tuareg zu pflegen war dabei lebenswichtig, denn jeder Flieger war als Soldat auch Repräsentant Frankreichs, also der Kolonialmacht. Überall nämlich nahmen die Kleinherrscher Einfluss, die sich untereinander bekriegten, sich verbündeten, mal gegen, mal mit der Kolonialmacht – das beschreibt Saint-Exupéry in einer wunderschönen Art, und dabei immer bestrebt, zwischen den Fronten zu vermitteln, Verständnis zu wecken. Aus der Lektüre dieser Erzählungen habe ich viel über Zwischenmenschliches, über diplomatische Konfliktlösungen gelernt.
Als ich älter wurde, kam ich auf ein Internat, das von Missionaren aus dem Benediktinerkloster St. Ottilien geleitet wurde. Die Wahl war nicht zufällig auf diese Schule gefallen, ich hatte damals schon den festen Wunsch geäußert, Missionar werden zu wollen, und da lag es nahe, St. Ottilien und die dortige Gemeinschaft der Missionsbenediktiner auszuwählen.
Einer der Mönche war besonders prägend für mich: Pater Johannes. Er war der Mensch, der mich auf meinem Werdegang zum Missionar begleitet hat, bis er selbst nach Afrika ausgesandt wurde und noch darüber hinaus. In Tigoni/Nairobi gehörte er der Gründungsgemeinschaft an. Ich besuchte ihn zweimal, einmal im Jahr seines Weggangs 1978, und ein zweites Mal drei Jahre später: Ein großer, stattlicher Mann, dunkelhaarig, mit einer dicken Brille. Einer, der gern selbst mit anpackt und viel zu viele Ideen hat, um sie alle umsetzen zu können, aber voller Tatkraft und Begeisterungsfähigkeit, wenn auch mitunter über das realistische Maß hinausgehend. Immer wieder aufs Neue hat er uns ermuntert, Ideen auszuspinnen, weiterzudenken, in die Tat umzusetzen, mit ihm gemeinsam, mit anderen. Durch ihn lernten wir, an uns selbst zu glauben.
Beispielsweise haben wir, das war noch zu Schulzeiten in Dillingen, wir waren in der 8. oder 9. Klasse, eine Garage, die auf dem Nachbargrundstück unserer Schule stand, gemeinsam zur Hauskapelle ausgebaut. Wir machten alles selbst, zogen Wände hoch, rissen Tore heraus. An der Einfahrt zum Kolleg gab es eine Mauer, die abgerissen werden musste, und jeder, der etwas ausgefressen hatte, musste dort mit anpacken, als eine Art Strafarbeit und um seinen Zorn loszuwerden (woher auch der Name der Mauer rührt, „Klagemauer“). Aber immer stand Pater Johannes im Hintergrund, wenn er nicht selbst mit anpackte, uns die Liebe zur Arbeit nahebrachte, zum handwerklichen Tun.
Im Kolleg in Dillingen waren wir ungefähr siebzig Schüler in den verschiedenen Altersstufen. Nachdem ich mich eineinhalb Jahre in einem Vorbereitungskurs für die Aufnahme ins Gymnasium im Fach Deutsch mit der Rechtschreibung abgemüht hatte – ein Problem, das erst viel später als Legasthenie erkannt werden sollte –, zogen meine Eltern die Konsequenzen und schickten mich auf die Munich International School am Starnberger See.
Der Übergang war schwierig, denn Englisch kam für mich als Fach hinzu und die Unterrichtssprache war ebenfalls Englisch. Zunächst schien meine Lage ziemlich aussichtslos, aber dann entwickelte sich die Sache doch recht gut. Im Grunde genommen wie mein gesamter Schulweg: Erst holperte es und war sehr mühselig, aber irgendwie klappte es dann doch. Das ist und bleibt eine Grunderfahrung in meinem Leben. Aber der Ehrlichkeit halber muss ich sagen: Richtig glücklich war ich in der Schule nie.
Als Legastheniker, also als jemand, der eine Lese-Rechtschreib-Schwäche hat, sieht man zum Beispiel Buchstaben seitenverkehrt, verwechselt sie, man verdreht Silben, das kann ganz verschieden sein. Auch heute noch, wenn ich etwas geschrieben habe, muss ich jeden Satz und jedes Wort sorgfältig ansehen, bevor ich es aus der Hand gebe. Aber es stört mich inzwischen nicht mehr besonders. Dass ich, wenn möglich, lieber auf Englisch als auf Deutsch schreibe, hat einen ganz einfachen Grund: Auf meinem Computer in der kenianischen Missionsstation zeigt ein Rechtschreibprogramm mir Fehler an und ich kann sie korrigieren. Eine wertvolle Hilfe.
Im Alter von 7 Jahren auf der Schulbank (links in der vorderen Reihe)
Die schwere Schulzeit – eine Prüfung Gottes?
Als er 14 oder 15 war, kam Franz-Josef einmal zu mir und sagte, er wolle aus der Internationalen Schule weg. Darüber war ich regelrecht erschrocken, denn endlich einmal konnte man den Eindruck haben, dass es schulisch ganz gut lief, und dann äußerte er so etwas. Andererseits waren wir zu der Zeit in einer finanziell recht prekären Lage, konnten uns eigentlich die Schule gar nicht leisten. Ich fragte ihn also erst einmal rundheraus nach seinen Beweggründen. Als Antwort kam von ihm: „In dieser Schule werde ich nie einen wirklichen Freund finden.“ Ich war bestürzt, wusste ich doch genau, dass ihn alle auf der Schule sehr gern hatten, dass er mit allen gut zurecht kam. Ja, sagte er, zurechtkomme er mit allen, aber einen wirklichen Freund werde er dort nicht finden, denn er sei weltanschaulich von seinen Mitschülern zu verschieden, sie seien zu materialistisch eingestellt, das sei ihm auf Dauer unerträglich. Und das von einem 14- oder 15jährigen, das war für mich unglaublich.
Als wir uns schließlich entschieden hatten, seinem Wunsch nachzugeben und ihn auf ein „normales“ Gymnasium zu schicken, haben sie dort nur gelacht. Ähnlich auf der Mittelschule, die man heute ja Realschule nennt: Sie waren tatsächlich so kleinkariert, von ihm Aufnahmeprüfungen in sämtlichen Fächern zu verlangen. Dabei hatten sie zum Teil ganz andere Fächer als Franz-Josef sie vorher belegt hatte. Mein Vorschlag, ihn dann eben eine Klasse zurückzustufen, stieß auf taube Ohren, sie beharrten auf ihre Aufnahmeprüfungen. Das schien uns alles so unnötig und weltfremd, dass wir von dieser Schule Abstand genommen haben.
Eine große Hilfe in dieser Angelegenheit war Pater Johannes, Benediktinerpater, Leiter des Internats der Benediktiner in Dillingen und in Erziehungsfragen ein wahres Naturtalent. Immer, wenn ich fast daran verzweifeln wollte, dass die schulischen Leistungen meiner Kinder nicht entsprechend waren, beruhigte er mich mit den Worten: „Bedenken Sie, Schule ist nur eine kurze Zeit im Leben, sie ist nicht das Wichtigste.“
Natürlich, diese ewigen schulischen Misserfolge, die damit einhergehende Ungewissheit, was beruflich werden soll, das hat Franz-Josef oft zu schaffen gemacht.
Einmal sollte eine Prüfung stattfinden, im Fach Deutsch, das war immer schlecht. Er wollte an dem Tag in die Messe gehen, noch vor Schulbeginn, und konnte nicht mit dem Rad zur Schule fahren, weil es zeitlich zu knapp geworden wäre. Ich war gerade dabei, das Rad ins Auto zu laden, da fiel mir auf, dass er wirklich Angst hatte vor dieser Prüfung, und ich sagte zu ihm: „Weißt du, ich glaube, diese ständigen Schulschwierigkeiten sind einfach eine Probe, die der liebe Gott Dir schickt, um Deine Berufung zu prüfen.“ Da schaute er mich an und sagte nur: „Mami, das weiß ich doch schon längst.“
Diesen inneren Konflikt, diese Belastung, die durch die ganzen Unwägbarkeiten zustande kam, das hatte er die ganze Zeit schon mit sich selbst ausgehandelt. Und nachdem er die neunte Klasse der Hauptschule durchlaufen hatte, hat er schließlich doch noch einen qualifizierenden Abschluss erreicht.
Der kluge Rat, Franz-Josef die Kindergarten- und Erzieherprüfung hier in Starnberg machen zu lassen, kam von Pater Johannes. Im Zuge der Gleichberechtigung mussten sie in Starnberg auch Buben in den Ausbildungsgang aufnehmen, das wusste der Pater. Damit hatte Franz-Josef am Ende einen Berufsabschluss in der Tasche, mit dem er auf das Sozialpädagogische Aufbaugymnasium in Weilheim gehen konnte, mittlerweile 18 Jahre alt. Dort aber, in Weilheim, wuchs sich seine Lese-Rechtschreib-Schwäche wieder zu einem alles beherrschenden Problem aus. Sein Cousin Luitpold, acht Jahre älter, erzählte von einem Studienfreund, der auch Legastheniker war. Dessen Vater war als Arzt und Psychotherapeut in Überlingen am Bodensee tätig und hatte seinen Sohn durch Vorlage eines ärztlich-psychologischen Attests von der Rechtschreibung „befreit“, das heißt, sie wurde in die schulischen Bewertungen nicht mit einbezogen. Zu diesem Arzt nahmen wir Kontakt auf und fuhren mit Franz-Josef hin. Er unterhielt sich eine ganze Weile mit unserm Buben und stellte ihm schließlich das Attest aus.
Doch als er das Attest in Weilheim im Schulsekretariat vorlegte, kam als Antwort bloß: Das kommt ja aus Überlingen, das ist doch ein anderes Bundesland, nämlich Baden-Württemberg, das geht uns nichts an, wir sind in Bayern. Und außerdem: „Legasthenie“, was soll denn das sein? Der Schularzt wurde eingeschaltet, erklärte ebenfalls das Attest für nichtig, da es kein bayrisches Siegel trug, und auch er konnte sich auf die Diagnose „Legasthenie“ keinen Reim machen. Kaum zu fassen, aber er schickte den Buben in die Psychiatrie. Dort saß er dann, aber man wusste nichts mit ihm anzufangen, denn es fehlte ihm ja nichts. Aus diesem Grund behielten sie ihn auch nicht lange dort.
Gemeinsam durch dick und dünn: Florian (hinten links) im Kreis seiner Geschwister
Der lange Atem – Durchhalten ist alles
Was ich wirklich gelernt habe, ist durchzuhalten, weiterzumachen: Irgendwann kommt man auf einen grünen Zweig. Oftmals auf langen Umwegen – aber es geht.
Weil das Schreiben in meiner Schulzeit sich zu einer solchen Belastung auswuchs, suchte ich woanders mein Glück und fand es im Handwerklichen. Als Kind war ich hocherfreut, als ich einen Märklin-Baukasten geschenkt bekam, versehen mit Schrauben, Platten, Stangen, aus denen ich Maschinen und Gerätschaften bauen konnte. Das lag mir sehr und kam mir und meinen Geschwistern, die wir viel mit dem Fahrrad unterwegs waren und darauf auch den Schulweg zurücklegten, zugute: So konnte ich schon früh sehr viel selbst reparieren und ausbessern. Die Mechanik allgemein war immer mein Hobby, und das nützt mir nun bei der Arbeit, Tag für Tag.
Als Kind und Jugendlicher war ich nicht stark im herkömmlichen Sinne, auch war ich nicht athletisch gebaut – aber ich habe mich nie unterkriegen lassen, ich war zäh. Nie wäre es mir eingefallen, in einer Rauferei aufzugeben, auch wenn ich mit den körperlichen Kräften schnell am Ende war, ich habe auf Zeit gespielt und durchgehalten, bis die anderen abgelassen haben, einfach, weil es ihnen zu langweilig wurde. Ich konnte immer weitermachen, auch im Sport.
Meine bevorzugte Sportart in der Schule war Cross Country, das ist Marathon, Langstreckenlauf, gerne auch querfeldein. Kurzstrecke lag mir einfach nicht, es waren die weiten Strecken, die mich reizten, die weiteren Dimensionen, der lange Atem, den man dafür braucht, Durchhalten, Ausdauer beweisen.
Ein Mitbruder in Illeret sagte einmal: „Bruder Florian kann auch drei Tage lang leben und arbeiten ohne zu essen. Ihm ist es gleich, ob es etwas zu essen gibt oder nicht, es stört ihn nicht im Geringsten.“
Daran, jemals ohne Essen gewesen zu sein, kann ich mich gar nicht erinnern, und ich kann nur sagen, dass es mich durchaus stören würde, nichts zu essen zu haben. Hier habe ich nicht mehr und nicht weniger als die Leute, die hier leben, und das ist manchmal sehr einfach. Ich komme damit aus, es reicht mir zum Leben, auch, wenn es oft karg ist, vor allem, wenn ich mit den Nomaden draußen bin. Aber auch ich kenne meine Grenzen und habe sie schon zu spüren bekommen.
Und da sind sie wieder, die langen Strecken, die ich schon in meiner Schulzeit zurückzulegen hatte, und mit ihnen der Willen durchzuhalten. Das habe ich wirklich gelernt: durchhalten, auch wenn die Aussichten alles andere als rosig sind, weitermachen – irgendwann kommt man schon auf einen grünen Zweig, wenn auch auf Umwegen und bisweilen verschlungenen Pfaden, aber es geht irgendwie. Aufgeben wäre, wie auf einem toten Gleis zu landen, von dort aus kommt man nicht weiter.
Genauso ist es mit unseren Lastwagenfahrten über die weiten Strecken über Land. Selbst wenn man fünf, zehn Mal liegen bleibt, irgendwann kommt man ans Ziel. Durchhalten ist alles, Hilfe findet sich von allein, man muss nur am Ball bleiben und weitermachen, darum geht es.
In der Entwicklungshilfe ist es ähnlich. Solange man nur den reichen Onkel spielt, der den Geldbeutel aufmacht und zahlt, kann sich nichts entwickeln, das ist nur aufgestülpt und hingestellt. Sobald die Finanzierung wegfällt, fällt das gesamte Projekt in sich zusammen. Aber wenn man es von Grund auf anschiebt, den Menschen Zeit gibt, damit umzugehen, daran zu wachsen, auch wenn es Durststrecken zu überwinden gilt, dann kann etwas Solides daraus werden. Die Menschen brauchen Gelegenheit und Bestärkung darin, zu wachsen – in persönlicher Hinsicht, in wirtschaftlicher, in religiöser, in menschlicher Hinsicht.
Weichen stellen
Die Entscheidung fiel schon in der Kindheit
Wann ich die Weichen für meinen späteren Lebensweg gestellt habe? Ich glaube, sie wurden bereits in meiner Kindheit gestellt, beim Ministrantendienst in der Leutstettener Heimatkirche. Das Gefühl, mit dem Glauben „am richtigen Ort“ zu sein, unabhängig von meinem jeweiligen Aufenthaltsort, war immer da. Wäre dem nicht so gewesen, hätte ich die Schule viel früher an den Nagel gehängt, weil es dort immer Schwierigkeiten gab. Dann wäre ich entweder in der Landwirtschaft geblieben oder hätte einen Beruf im technischen Bereich ergriffen.
Für meine Geschwister war meine Entscheidung, Missionar werden zu wollen, weder etwas Weltfremdes noch etwas Ungewöhnliches. Alles, was mit Kirche zu tun hatte, war Teil unseres Alltagslebens, das hat man gelebt, es war einfach so. Meine Familie hat mich in meinem Entschluss unterstützt. In der Schule sah es anders aus, bisweilen bin ich aufgezogen worden damit, es hat mich oft gestört, die ständigen Anspielungen von Mitschülern und sogar Lehrern, auch auf meine adelige Herkunft. Damit muss man umgehen lernen, es ist nicht böswillig gemeint, man übergeht solche Dinge oder kontert schlagfertig, wenn es möglich ist.
Unter unseren Vorfahren gab es gute und schlechte Herrscher und Politiker. Ludwig II. zum Beispiel, der oft glorifiziert wird und in einer Art Märchenwelt lebte, politisch wie wirtschaftlich aber kaum etwas vollbrachte, im Vergleich zu Ludwig I., der Mäzen der Kunst war und auch die Mission förderte, so zum Beispiel den nach ihm benannten Missionsverein ins Leben rief. Oder etwa Ludwig III., mein Urgroßvater, der sogenannte „Millibauer“, dessen Leidenschaft auch nach der Thronbesteigung die Landwirtschaft war und dessen Herz für die bäuerliche Bevölkerung schlug.
Vielleicht muss man es so deutlich sagen: Ludwig II. war politisch und wirtschaftlich nicht sehr erfolgreich, schließlich haben seine Bauprojekte und Märchenschlösser die Staatskasse ruiniert. Allerdings, das muss man ihm zugute halten, auf lange Sicht auch restauriert. Der Tourismus lebt zu einem großen Teil bis heute von ihm und seinen Stein gewordenen Träumen.
Der Urgroßvater von Pater Florian: Ludwig III. von Bayern (1845–1918), ältester Sohn des Prinzregenten Luitpold und der Prinzessin Auguste Ferdinande von Habsburg-Toskana, war der letzte der bayerischen Könige. Mit seiner unblutigen Absetzung im Jahre 1918 endete die Herrschaft des Geschlechts der Wittelsbacher, die 738 Jahre gewährt hatte. 1875 kaufte er das Schloss Leutstetten, um daraus ein landwirtschaftliches Mustergut zu machen; er blieb auch Landwirt, nachdem er 1913 zum König von Bayern ausgerufen worden war. Sein Regierungsstil, soweit er sich beurteilen lässt, denn in die Zeit seiner Regentschaft fielen Krieg und Revolution, war stark konservativ und an Rom orientiert. Dem Militärischen war er, der im Krieg gegen Preußen verwundet worden war, eher abgeneigt.
Bilder aus der Vergangenheit
Sicherlich, als Kinder adeliger Herkunft haben wir uns in der Schule mit der bayerischen Geschichte anders auseinandergesetzt als die übrigen Schüler. Bei uns zu Hause hingen und hängen sie ja bis heute, die Bilder, die Gemälde, die von jeher Fragen aufwarfen wie „Wer ist dieser, wer ist jener, zu welchem Anlass wurde das Bild gemalt?“ Das war nicht ein Lernen für den Geschichtsunterricht, sondern, zumindest in Teilen, Familiengeschichte, lebendige Geschichte, in der man zu Hause war. Der Geschichtsunterricht in der Schule war dagegen eine regelrechte Bürde, nicht, weil ich das Fach an sich nicht mochte, aber wenn der Unterricht immer auf Daten und Fakten ausgerichtet ist und man sich schwertut, sich Daten und Jahreszahlen zu merken, so wie ich, da fällt es nicht leicht, sich die Freude am Lernen über Geschichte zu erhalten.
Geschichte dennoch zu lieben hat mich mein Großvater mütterlicherseits gelehrt, Erzherzog Theodor Salvator von Habsburg, wahrhaftig ein wandelndes Geschichtsbuch. Was ich an Geschichtswissen habe, kommt zu achtzig Prozent von ihm.





























