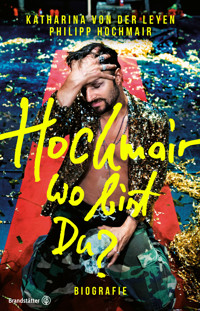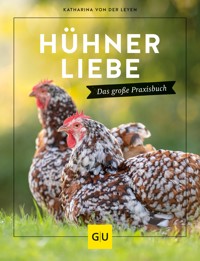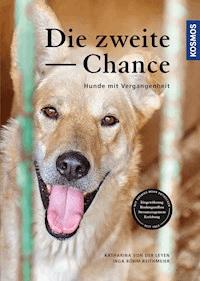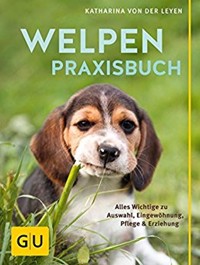19,99 €
Mehr erfahren.
»The key to life is accepting challenges«: Der Schlüssel zum Leben liegt darin, Herausforderungen anzunehmen.
Als Katharina von der Leyen an einem seltenen Hirntumor erkrankt, entscheidet sie sich, nicht dem Tod, sondern dem Leben ins Auge zu blicken. Statt Glamour und Freiheit prägen nun Krankenhauszimmer, Tumorkonferenzen und Chemotherapien ihren Alltag – und die ungewohnte Erfahrung von Hilflosigkeit.
Die Journalistin, die einst als Redakteurin der australischen Vogue und Assistentin von Lauren Hutton die Welt eroberte, erkennt beim Schreiben: Alle Stationen ihres Lebens – vom Cowgirl in New Mexiko bis zur Intensivstation – fügen sich zu einem Schicksal, das sie prägt und trägt.
Was diese Lebenserzählung so außergewöhnlich macht, ist, dass sie den Tiefpunkten und schmerzlichen Erfahrungen während der Krebserkrankung mit der gleichen kraftvollen Neugier begegnet, wie den schillernden Augenblicken und Momenten des Hochgefühls. An jedem Punkt, so verrät bereits der Titel, erkennt sie die Richtung: Weiter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Katharina von der Leyen
Weiter!
Wie Bette Davis mir das Leben rettete
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe
© 2024 Kailash Verlag, München
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Lektorat: Dr. Antje Korsmeier
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
Covergestaltung: Daniela Hofner, ki 36 Editorial Design, München
Covermotiv: © Frank Zauritz
ISBN 978-3-641-31896-3V002
www.kailash-verlag.de
The key to life is accepting challenges.
Bette Davis
Vorwort
»Der Schlüssel zum Leben ist, Herausforderungen anzunehmen«, sagte die großartige und komplizierte Schauspielerin Bette Davis einmal. Sie kannte sich aus mit dem Leben, innerhalb dessen sie in 81 Lebensjahren trotz ihres sehr unkonventionellen Gesichts in über 100 Filmen mitspielte. Sie hielt niemals damenhaft die Klappe und scheute auch nicht vor bösen oder gar gemeinen Rollen zurück. Sie spielte eiskalte Verführerinnen, wilde Furien, selbstsüchtige Hexen und skrupellose Frauen mit einer solchen Intensität und Authentizität, dass ihre Figuren häufig mit ihr selbst gleichgesetzt wurden. Sie hatte einen ungeheuren Ehrgeiz und harte Ellenbogen, mit denen sie sich in Hollywood schnell nach oben kämpfte. 1941 war sie die allererste Frau an der Spitze der Oscar-Akademie, 1942 die bestbezahlte Frau Amerikas und eine überlebensgroße Diva, deren Ruhm nicht automatisch mit ihrer Jugend und ihrem Aussehen verschwand, sondern im Alter noch einmal ganz eigene Züge annahm. Sie kämpfte für ihre Rollen sogar mithilfe von Rechtstreits und schenkte weder sich selbst noch anderen je etwas (»She did it the hard way« steht auf ihrem Grabstein). Sie wurde zehnmal für einen Oscar nominiert und bekam ihn zweimal verliehen. Als Bette Davis Anfang Oktober 1989 ihren letzten Preis beim San Sebastián International Film Festival annahm, war sie bereits durch ihre Krebserkrankung gezeichnet. Nach der Preisverleihung wurde festgestellt, dass sie zu schwach war, um in die USA zurückzukehren, und so reiste sie nach Frankreich, wo sie am 6. Oktober 1989 im American Hospital in Neuilly-sur-Seine starb.
1
Die unmittelbare Aussicht aufs Sterben kann einen fast zu Tode erschrecken. Was eigentlich albern ist: Das Leben ist gefährlich, man kann jeden Moment sterben, vom Balkon fallen, vom Traktor überfahren werden oder sich versehentlich mit einer Staubsaugerkordel erdrosseln; die Möglichkeiten sind jeden Tag endlos. Und es ist ja auch nicht so, als würden wir uns mit dem Thema an normalen Tagen nicht auseinandersetzen: Wir alle haben uns schon mit Organspendeausweisen beschäftigt, haben Patientenverfügungen oder Testamente verfasst (oder jedenfalls aufgeschrieben, wer den Hund und die Katze bekommt) und die Pateneltern der Kinder an ihre Pflichten erinnert, falls uns beim Bergsteigen im Himalaya etwas passieren sollte.
Aber wenn einem aufgrund einer schweren Diagnose eröffnet wird, dass es vielleicht gar nicht mehr lange so weitergeht wie bisher, kann man es einfach nicht fassen. Dabei wissen wir doch Bescheid. Wir alle wissen, dass heutzutage jeder Zweite Krebs bekommt: Allein in Deutschland erhalten 14 000 Patienten am Tag diese Diagnose. Wir kennen genug Leute, die mit den entsprechenden Prognosen umgehen mussten, kennen jemanden, der daran gestorben ist, und auch genug Menschen, die das Ganze gut überstanden haben. Man ist etwas rat- und hilflos mit ihnen umgegangen, hat sie besucht, wenn man ihnen nahe genug stand, oder hat sie immerhin angerufen oder ihnen geschrieben, im festen Vertrauen darauf, dass sie es schon schaffen würden.
Wenn es einen selbst erwischt, ist alles anders. Das letzte Stündlein schlägt vernehmlich, und auf einmal hängt man auf überraschende Weise an seinem Leben, das man vorher vielleicht gar nicht besonders zu schätzen wusste. Prompt fällt einem unendlich viel ein, das man noch lange nicht erledigt hat. Plötzlich wird man sich seines eigenen Verfallsdatums bewusst. Was bedeutet es denn, wenn man demnächst nicht mehr da ist?
Solche Überlegungen sind in Wirklichkeit gar nicht übel für die Menschwerdung – aber das weiß man erst hinterher. Im Augenblick der Diagnose ist man vollkommen baff. Wie konnte einem das passieren? Was bedeutet das für die Zukunft, auf die man sich immer irgendwie lässig verlassen hatte? Gibt es die überhaupt noch?
2
In meinem Fall war es mein Gehirn, das plötzlich nicht mehr funktionierte, was mich insofern empörte, als ich mich mein Leben lang eigentlich für einen ziemlichen Schlaumeier gehalten hatte. Auf einmal war mein Gehirn meine schwächste Stelle. Ich konnte nicht mehr geradeaus gehen, nicht mehr um die Kurve fahren, ich konnte nicht mehr sprechen und brauchte für einen einzigen Satz in einer E-Mail 40 Minuten, weil ich nicht mehr in der Lage war, Worte spontan und sinnvoll aneinanderzureihen. Ich war nicht nur nicht mehr ich selbst, ich war überhaupt niemand mehr, ohne Geistesblitze, ohne Schlagfertigkeit, ohne Worte.
Ich bekam Kopfschmerzen, die alles Dagewesene in den Schatten stellten. Dann wurden meine Finger taub, dann die ganze Hand, dann der Arm, dann die ganze jeweilige Körperhälfte: Erst dauerte es eine halbe Stunde, bis das Gefühl zurückkehrte, bald eine Stunde, irgendwann drei bis vier Stunden, bis ich mich wieder normal fühlte. Ein halbes Jahr lang marschierte ich erfolglos von Arzt zu Arzt, vom Spezialisten zum Facharzt. MRTs und CTs gehörten fast zu meinem Alltag. Im MRT, der Magnetresonanztomographie oder auch Kernspintomographie, werden detaillierte Schnittbilder von weichteiligen Gewebestrukturen im Körper erstellt. Dabei werden starke Magnetfelder erzeugt, die die Bilder möglich machen, ganz ohne Radioaktivität, wobei man auch krankhafte Veränderungen finden kann. Ich habe Freunde, die bei der reinen Erwähnung von »MRT« blass werden, die es auf der schmalen Liege unter einer käfigähnlichen Gesichtsmaske mit merkwürdig wummernden Geräuschen nicht aushalten können. Auch Ärzte und Schwestern fürchten Anfälle von Klaustrophobie bei Patienten und erwähnen die Möglichkeit eines solchen mindestens 18 Mal im Vorgespräch. Auf Fragebögen und Infomaterial wird man mehrfach darauf hingewiesen, dass man sich auch ein Beruhigungsmittel verabreichen lassen könne, und die Pfleger beobachten einen misstrauisch, wenn man sich einigermaßen gut gelaunt auf der fahrbaren Liege niederlegt. Man bekommt ein gummiartiges Panik-Ei in die Hand gedrückt, damit man bei wachsender Panik sofort die Schwestern informieren kann. Die Schwestern bleiben über einen Lautsprecher ständig ansprechbar: Die Gefahr ist also nicht besonders groß. Obwohl ich Klaustrophobie nicht abgeneigt bin, machte mir das MRT überhaupt nichts aus. Das ist gut so, denn im Laufe meiner Krankheit wurden bei mir mehr als 15 MRTs gemacht (meistens ohne leuchtendes Kontrastmittel, weshalb man anfangs nichts finden konnte), deren schiere Anzahl mich nachhaltig traumatisiert hätte, wäre ich der Typ dafür. Aber wer mit Punkrock und Funk Metal aufgewachsen ist, dem kann das Gewummer einer MRT-Röhre nicht viel anhaben: Ich habe auf Konzertbühnen in den vergangenen 30 Jahren ganz andere Dezibel zu hören und fühlen bekommen. Im MRT mit seinen rhythmischen Schlägen schlafe ich sofort ein wie ein Schreikind in der nächtlichen Sicherheit seines Maxi-Cosis im elterlichen PKW. Irgendwelche Gründe für meine Symptome konnte trotzdem niemand finden.
Verschiedene Neurologen gingen davon aus, dass sich die Migräne, die ich seit meinem elften Lebensjahr habe, aufgrund meines zunehmenden Alters verändert hatte, und verschrieben mir Medikamente in ständig steigender Dosierung. Dass sie absolut nichts nützten, hätte für mich ein erster Hinweis sein können. Denn Migräne-Medikamente helfen nur dann, wenn es sich bei den Kopfschmerzen auch wirklich um Migräne handelt. Bei allen anderen Arten des Kopfwehs nützen sie exakt gar nichts. Aber ich war zu sehr mit meinem Unwohlsein beschäftigt, um mich um Details zu kümmern. Mein Rücken, meine Schultern und mein Nacken waren dauerhaft verspannt, und Besuche bei der Osteopathin wurden zur Routine.
Mit den Schlafstörungen kamen Sprachstörungen. Ich rang plötzlich um Worte – ich, die ich mein Leben lang nicht auf den Mund gefallen war und sogar im Schlaf weiterredete, wenn ich bei Licht nicht fertig geworden war. Jetzt stotterte ich ständig und konnte manchmal sogar überhaupt nichts mehr sagen: Ich wollte telefonieren, aber aus meinem Mund kam nichts heraus.
Arme, Hände oder eine ganze Körperhälfte wurden immer häufiger taub, und es dauerte Stunden, bis ich mich wieder spüren konnte. Ich suchte unzufrieden und frustriert meinen Hausarzt auf und jammerte ihm vor, dass es mir noch immer nicht besser und mein Zustand, der sich nun schon über fünf Monate hinzog, mir auf die Nerven ginge. Irgendeine Ursache müsse es doch auch haben, dass ich plötzlich so stotterte. »Das ist doch kein Wunder«, sagte er, »so schnell, wie Sie reden. Ihr Mundwerk kommt halt nicht mehr mit.« Es ist wohl unnötig zu erwähnen, dass dieser Herr nicht länger mein Hausarzt ist.
Weitere Neurologen, andere Ärzte und noch mehr Untersuchungen führten zu gar nichts. Jegliche Symptome wurden von den jeweiligen Spezialisten einzeln behandelt und nicht in Zusammenhang gebracht. Ich war ständig müde, wurde ganz ohne Vorsatz immer dünner und bald sehr ungehalten, wenn meine Hühner nicht um sieben schlafen gingen, damit auch ich endlich ins Bett gehen konnte – um halb acht. Dabei leide ich eigentlich seit Jahren eher an Bettflucht und haue mir die Nächte gerne um die Ohren. Das tat ich zwar immer noch, aber anders: Ich wachte ständig auf, um dann lange nicht wieder einschlafen zu können. Ich probierte es mit Schlaf-Apps, Klaviermusik und dem Film »Weißes Rauschen«, aber Schlaf wollte sich trotzdem nicht einstellen. Ich kaufte andere Matratzen und neue Topper, stellte das Bett an eine andere Stelle, wechselte die Bettdecken – ohne Erfolg. Meine Vormittage verbrachte ich damit, irgendwie aufzuwachen, um dann nachmittags gegen das Einschlafen anzukämpfen. Am deutlichsten wurde das bei meinen Hundespaziergängen. Seit meiner Kindheit bin ich täglich mehrere Kilometer mit meinen Hunden unterwegs und werde vom Gehen nie müde: Ich bin trainiert. Ich weiß nicht, ob ich Hunde habe, weil ich so gerne laufe, oder ob ich so gerne laufe, weil ich Hunde habe – aber ich marschiere die gewaltigsten Strecken wie ein alter Soldat. Gehen ist für mich eine Art Meditation, ich höre den Vögeln zu, ich beobachte das Wild, die Bäume und die Wiesen: Auf diese Weise bereite ich mich sehr friedlich auf den Tag vor.
Und plötzlich ging das nicht mehr. Ich war nach jeder kleinen Runde so erschöpft, dass ich mich hinlegen musste. Was meinem Selbstverständnis nicht entsprach, also wollte ich mir das nicht erlauben. Ich saß todmüde am Schreibtisch und konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich hatte die Aufmerksamkeitsspanne einer Ameise, konnte Telefonkonferenzen nicht länger als zehn Minuten folgen und war auf eine grundlegende Weise unglücklich. Ich verstand nicht, was mit mir los war. Mir ging es nicht gut, aber niemandem fiel zu diesem Thema etwas ein. Ich kam im Auto nicht mehr um die Kurven und fiel einfach vom Fahrrad. Freunde sprachen von »Stress-Symptomen«, und da ich gerade ohnehin mit meiner schwindenden Kreativität haderte, erschien mir das auch ganz plausibel. Ich fühlte mich grässlich und benahm mich auch so. Ich war ungeduldig, fürchterlich bedürftig, fühlte mich dauernd einsam (was nicht zu meinen bekannten Eigenschaften gehört) und depressiv (was erst recht nicht in meinem alltäglichen Stimmungssortiment zu finden ist).
Es ist merkwürdig, wenn man sich selbst nicht mehr erkennt. Man kann sich nicht einmal bei jemand anderem über sich beschweren, denn wie sollte der andere einen verstehen können, wenn man selbst angesichts des eigenen Zustands vollkommen ratlos ist? Ich hatte eine Beziehungskrise mit meinem eigenen Körper. Ich fühlte mich von ihm betrogen, konnte aber nichts beweisen.
3
Ich lebe mit einer veränderlichen Anzahl an Hunden und Hühnern sowie vier Ziegen und zwei Schafen in einem alten Bauernhaus in der bayerischen Pampa: Außer Feldern, Wiesen und Wäldern gibt es hier nichts. Der Straßenverkehr besteht aus Traktoren und anderen Erntegeräten, und wer sich überfahren lassen möchte, muss sorgfältig planen, wann die Post geliefert wird. Eines Morgens spazierte ich mit meinen Hunden den kleinen Hügel vor meinem Haus hinunter, als mir so wahnsinnig schwindelig wurde, dass ich umfiel – aber nicht so, wie man normalerweise bei Schwindel fällt, nämlich seitlich oder nach vorne: Stattdessen kippte ich flach nach hinten. Da lag ich nun im Schnee wie ein großer zappelnder Käfer im schwarzen Daunenmantel und konnte nicht mehr aufstehen, während meine Hunde um mich herumstanden und mich ratlos betrachteten; denn üblicherweise treibe ich sie mit einem zackigen »Weiter!« voran. Nach einer halben Stunde, in der ich völlig bewegungslos den blassen Wolkenhimmel betrachtete, war mein Anfall von Fallsucht vorbei, und ich wankte benommen nach Hause.
Im Nachhinein hätte die Beschreibung dieser Art des Umfallens den verschiedenen Ärzten schon sagen können, dass sie sich möglicherweise einmal mit meinem Kopf beschäftigen sollten, denn, wie mir viele, viele Monate später ein Notarzt bestätigte: So fällt man nur, wenn mit dem Gehirn etwas nicht stimmt. Aber so richtig schlau ist man ja oft erst hinterher.
Mein Bett wurde auf einmal zu meinem zentralen Lebensort. Dabei bin ich niemand, der gerne lange schläft, ausschweifend liegen bleibt und es sich zwischen vielen Kissen gemütlich macht: Dafür habe ich immer viel zu viel zu tun, people to see, places to go. Anfang März verbrachte ich ein ganzes Wochenende zwischen meinen Kissen (nicht so, wie man es sich gerne vorstellen würde, sondern allein, unter ein paar Hunden begraben), zu schwach, um einen vernünftigen Spaziergang zu machen oder auch nur die Hühner zu füttern.
Ich beschloss, mich in ein Krankenhaus zu begeben, um mich von oben bis unten genau und mit Blick auf einen umfassenden körperlichen Zusammenhang ansehen zu lassen.
Das »genaue Ansehen« sollte dann länger dauern als gedacht. Ein junger indischer Arzt (der wirklich so jung aussah, dass ich mich kurz fragte, ob er überhaupt schon Autofahren durfte) in einer hiesigen Spezialklinik für Neurologie versicherte mir, ich würde mit meinem Leben spielen, wenn ich das Krankenhaus jetzt auch nur kurz verließe – und sei es, um mir zu Hause eine Zahnbürste und einen Schlafanzug einzupacken. Dabei warteten dort ernst zu nehmende Zahlen alleinerzogener Hunde, Hühner, Ziegen und Schafe, die ich kaum sich selbst überlassen konnte. Aber wie das so ist in Zeiten des Krieges: Man bewältigt Dinge, die man sich kaum zugetraut hätte. Innerhalb weniger Stunden schaffte ich es irgendwie, den ganzen Zoo gleichmäßig auf Bekannte, Nachbarn und Freunde zu verteilen, und legte mich am Tag darauf in ein Krankenhausbett, aus dem ich lange nicht mehr aufstehen sollte. Was zu diesem Zeitpunkt aber noch keiner ahnte.
Man geht ins Krankenhaus im festen Glauben, dass man dort nicht lange bleibt. Das soll auch so sein: Krankenhausaufenthalte sind teuer, und deshalb wird man, sofern man sich nicht gerade in akuter Lebensgefahr befindet, möglichst bald wieder entlassen. Ich war fest davon überzeugt, dass ich nach spätestens einer Woche wieder zu Hause wäre, denn ich hatte ja zu tun nach den Wochen meiner gesundheitlichen Ausfälle.
Daraus wurde nichts. Die Zusammenfassung meiner einzelnen Symptome wies die Neurologen dieser Klinik endlich darauf hin, dass wohl irgendetwas mit meinem Gehirn nicht in Ordnung war.
Die genauere Betrachtung meines Körpers begann mit einer »Lumbalpunktion«. Das verdirbt einem gleich zu Anfang jeglichen Spaß: Im Bereich der Lendenwirbel wird aus dem Wirbelkanal mit einer Nadel etwas Hirn- oder Rückenmarksflüssigkeit (auch Hirnwasser genannt) entnommen und im Labor untersucht, um mögliche Erkrankungen oder Entzündungen im Gehirn oder Rückenmark zu finden. Diese sogenannte »Liquoruntersuchung« ist genauso unangenehm, wie sie sich anhört, und man genießt das volle (üblicherweise nicht sehr ausgeprägte) Mitleid der ausführenden Ärzte. Aber es führte kein Weg daran vorbei. Es fanden sich ein paar entzündete Zellen, aber das Ganze war irgendwie diffus: Da war zwar was, aber nicht genug, um beispielsweise eine bakterielle Gehirnhautentzündung zu diagnostizieren. Was so schön einfach, weil gut behandelbar gewesen wäre. Es war die Rede von einer geschwollenen Arterie im Gehirn und »einer Art chronischer Meningitis«, aber Genaueres wusste man nicht. Ich musste mich andauernd übergeben, hinzu kamen Sehstörungen: Überall in meinem Sehfeld sah ich schwarze Punkte, aus denen nach einer Woche schwarze Wolken wurden. Lesen ging nicht mehr, Schreiben wurde schwierig (ich schrieb sozusagen »aus der Erinnerung« vor mich hin, wenn ich auch zugeben muss, dass ich das Meiste davon mittlerweile nicht mehr entziffern kann). Ich wurde »auf Verdacht« nach dem Gießkannenprinzip mit einem Medikament gegen Viren, mit starken Schmerzmitteln und mit hochdosiertem Kortison behandelt. Damit sollte mein Gehirn zum Abschwellen gebracht werden, denn die Kopfschmerzen wurden immer massiver. Das Ergebnis war, dass ich tatsächlich bald wieder besser sprechen konnte, ohne zu stottern. Dafür wirkte das Kortison bei mir wie ein Doping-Mittel: Ich redete in einem solchen Tempo, dass manchen meiner Gesprächspartner Angst und Bange wurde. Es war immerhin besser als das wirre Kauderwelsch, das ich noch kurz zuvor von mir gegeben hatte: Das war so weit gegangen, dass sich ein Freund von mir nach einem Telefonat bei einem anderen Freund erkundigte, ob ich verrückt geworden sei, weil ich so dummes Zeug gefaselt hatte. »Aber nein, gar nicht«, beruhigte ihn der andere Freund, »die hat wohl bloß was im Gehirn.«
Ich lag auf einer neurologischen Spezialabteilung, geführt von einem älteren Oberarzt mit langem grauen Zopf, Harley-T-Shirt und Jeans unter dem offenen weißen Kittel, dessen Spezialgebiet neurologische Entzündungen waren. Er war sehr bemüht um mich, ich schien ein interessanter Fall zu sein, den er nur ungern mit anderen Ärzten in der Klinik teilen wollte.
Ich lag in einem Zweibettzimmer. Eine andere Möglichkeit bot sich nicht, denn die Klinik war voll bis unters Dach. Meine Zimmernachbarin war eine recht verwirrte 76-jährige Dame, die mir erklärte, sie habe einen Schlaganfall gehabt. In Wirklichkeit hatte sie einen so massiven epileptischen Anfall erlitten wie nie zuvor, aber daran konnte sie sich ebenso wenig erinnern wie an die Tatsache, dass sie unter einer Penizillin-Allergie litt. Genau dieses Mittel bekam sie von den Ärzten, die von dieser Allergie ja nichts wussten, munter verabreicht, was bei der Patientin zu entsetzlichen Ausschlägen und Juckattacken führte, die uns beide und die Nachtschwestern um den Schlaf brachten. Ihr Sohn war Naturheilpraktiker, weshalb sie alle Tabletten, die man ihr zur Linderung oder Besserung ihres Zustandes verabreichte, prinzipiell ausschlug, weil Schulmedizin abzulehnen sei, was ihr wiederum insofern bestätigt wurde, als sie wirklich sehr an den Folgen ihrer Penizillin-Allergie litt. Ständig flogen die Tabletten in hohem Bogen durch das Krankenzimmer, einen Teil davon nahm sie ein, die anderen sammelte ich auf, manche fand ich erst wieder, wenn mein Bettzeug gewechselt wurde. Sie konnte ihre Familie nicht anrufen, weil sie selbst kein Handy hatte und mit der Telefonanlage im Zimmer nicht zurechtkam. Ich wurde zu einer Art Sekretärin für sie und erklärte ihr mehrfach täglich das Telefon, wenn ihr Mann anrief. Ich kämpfte bei den Schwestern darum, dass man ihr Essen stehen ließ oder es ihr wiederbrachte, weil sie vor lauter Schlaf zu wenig aß, und übersetzte den Ärzten alle möglichen Dinge, die sie mir erzählt, aber bei der Visite tunlichst verschwiegen hatte. Die Dame war ein Vollzeitjob, was auch den Pflegern klar war. Darum freuten sie sich auch so über mich: Ich machte meine Sache gut, auch wenn ich selbst kaum noch sprechen oder denken konnte. Man kann nur schwer zur Ruhe kommen, wenn man den ganzen Tag lang mit den Wasserstandmeldungen anderer Schwerkranker konfrontiert wird, aber so ist das nun einmal in Krankenhäusern. Immerhin waren wir nur zu zweit im Zimmer und die Bauarbeiten vor dem Fenster fingen gnädigerweise auch immer erst um sieben Uhr an. Da sind die Patienten, die ihre ersten Medikamente und Blutuntersuchungen schon um halb sechs verabreicht bekommen, längst wach. Das Frühstück dagegen kommt erst drei Stunden später, gegen neun, dafür aber schon um elf das Mittagessen und um vier Uhr nachmittags das Abendessen. Warum das so ist, ist eines der großen Rätsel der globalen Krankenhaus-Koordination, auf das es keine Antwort gibt.
Das führt dazu, dass man zu den seltsamsten Zeiten sehr hungrig wird und mit seinem Schlafrhythmus vollkommen durcheinanderkommt. Wenn ich endlich eingeschlafen war, begann meine Zimmernachbarin in ihrem Bett zu toben. Gründe gab es dafür viele: der Juckreiz, die Angst, der unberechenbare Stuhlgang, der Weg zum Klo. Manchmal wachte sie mitten in der Nacht auf und sortierte bei voller Neon-Beleuchtung ihre Wäsche. Warum, blieb ihr Geheimnis.
In einem Krankenhaus kann man nicht gesund werden. Es geht einfach nicht: Dafür bräuchte man Ruhe, Luft, Schlaf und gute Ernährung. Nichts davon gibt es dort. Im Krankenhaus geht es darum, herauszufinden, woran ein Patient leidet, und ihn dementsprechend so einzustellen, dass er entlassen und möglichst woanders gesund werden kann.
Ich vermisste mein Zuhause, als würde mir eine bestimmte Person fehlen. Ich hänge an meinem Zuhause. Nach Jahrzehnten des Nomadenlebens, in denen ich von Kontinent zu Kontinent zog, wie andere Leute Ferien machen, lebe ich seit acht Jahren zwischen München und Salzburg. Mein Hof liegt inmitten von Wiesen und Rindviechern – ein herrlicher Ort, trotz des ständigen sanften Aromas von Gülle und der Biogasanlage des Nachbarn. Mein Horizont ist unendlich, nichts stellt sich dem Blick in den Weg. Abends höre ich Füchse bellen und sehe die Nachbarskatzen, die vor meinem Hühnerstall den Mäusen auflauern, ich hindere meine Hunde daran, das Igelfutter zu fressen, und freue mich, wenn meine Schafe mich mit leisem »Mäh« begrüßen, wenn sie mich im Garten sehen. Ich vermisste entsetzlich meine tägliche Routine, bei der ich morgens noch halb schlafend die Hunde in den Garten lasse, während ich mir gleichzeitig in der Küche einen Kaffee mache und dann die Hühner aus ihren Ställen ins Freie lasse. Danach sitze ich im Schlafanzug in der Sonne vor dem Haus und trinke meinen Kaffee, während Hunde und Hühner um mich herum wichtig einzelne Grashalme begutachten und tun, was man als Haustier morgens eben so macht.
Mir fehlten die Ruhe und der Garten, ich vermisste das nasse Gras unter den Füßen in dieser schönsten aller Jahreszeiten, während ich es im Krankenhaus kaum noch schaffte, in das kleine Café neben dem Eingang zu schlurfen, um wenigstens einmal am Tag einen anständigen Kaffee zu trinken.
(Notiz am Rande: Es ist im Leben wichtig, sich rechtzeitig ein Zuhause zu schaffen, einen Ort, an den man am liebsten zurückkehrt, wo einen die Nachbarn erkennen und man nicht so viel erklären muss.)
Draußen, hinter dem Gerüst, das an der Klinikfassade errichtet worden war und wo ab sieben Uhr morgens die Bauarbeiter geräuschvoll herumturnten, war es warm und frühlingshaft. Ich konnte blühende Bäume sehen und Stare, die im ungemähten Gras nach Regenwürmern suchten. Nachts sang im Baum vor unserem Fenster eine Nachtigall mit schluchzender Stimme ihre Weisen. Es war ein guter Reminder daran, dass das Leben immer weitergeht, egal, wie man sich gerade fühlt.
4
Der Vorteil eines Krankenhauses ist, dass man genauere Untersuchungen machen kann als in einer normalen Praxis. Ich wurde buchstäblich bis ins Mark auf Zoonosen untersucht, also auf irgendwelche Infektionskrankheiten, die ich mir vielleicht über meine Haustiere eingefangen hatte, wie den (extrem seltenen) Borna-Virus, der eine tödliche Gehirnhautentzündung auslöst und über den Biss einer Spitzmaus übertragen werden kann. Da ich in den letzten Jahren keinerlei Auseinandersetzungen mit Spitzmäusen oder anderen beißenden Mitbewohnern gehabt hatte, konnte alles ausgeschlossen werden.
Zudem können sich Krankenhausärzte untereinander austauschen und verschiedene Abteilungen zusammenarbeiten, um den Beschwerden schneller auf den Grund zu kommen – anders, als wenn man sich in den jeweiligen Spezialpraxen untersuchen lässt. Aber obwohl sich der Oberarzt eigentlich große Mühe mit »meinem Fall« gab und deshalb ständig mit anderen Ärzten quer durch die Republik telefonierte, gab es kein internistisches Konzil. Ich hatte massive Blutarmut und eine deutlich vergrößerte Milz, was niemanden zu beschäftigen schien. Die Internisten wurden nicht befragt. Es kam zu keiner Diagnose und entsprechend auch zu keiner Besserung, außer dass ich von dem Kortison erst hyperaktiv wurde und schließlich depressiv. Aber da, so die ärztliche Meinung, musste ich eben durch.
Zum ersten Mal in meinem Leben erlebte ich eine massive Panikattacke mit Schnappatmung, hysterischem Weinen und allem, was sonst dazugehört. Der Grund meiner Verzweiflung war, dass mir plötzlich ums Verrecken meine Handy-PIN nicht mehr einfiel, die ich seit 25 Jahren eigentlich im Schlaf aufsagen kann. Das Handy war ausgestellt und konnte ohne PIN nicht mehr gestartet werden. Ich war felsenfest davon überzeugt, nun endgültig den Zugang zur Welt verloren zu haben und für immer in diesem Krankenzimmer festzuhängen, mit überforderten Pflegern, eiligen Ärzten, anstrengenden Zimmernachbarn und ohne Besuch (denn es herrschte Corona, Besuche waren nicht erlaubt), ohne in der Lage zu sein zu lesen und nun auch noch ohne Mediatheken. Ich konnte niemanden anrufen, der vielleicht herausfinden könnte, wie meine PIN lautete, denn da ich mir ja seit Monaten nichts mehr merken konnte, wie hätten mir irgendwelche Telefonnummern einfallen sollen? Ich geriet völlig außer mich, denn die verlorene Geheimzahl symbolisierte das, was seit Monaten der Fall war und mich zunehmend belastete: Ich hatte keine Kontrolle mehr über mein Leben. Ich weinte, als gäbe es kein Morgen, schlotterte und konnte mich überhaupt nicht mehr beruhigen. Ich hatte Herzrasen, bekam schlecht Luft und spürte einen unglaublichen Druck auf der Brust. Meine Hände zitterten, es war mir gleichzeitig entsetzlich kalt und wahnsinnig heiß, mein ganzer Körper wurde taub. Ich hatte tatsächlich das erste Mal in meinem Leben Todesangst. Wegen einer verlorenen PIN.
Ein wirklich wunderbarer, unendlich geduldiger 25-jähriger Pfleger machte drei Stunden lang mit mir Atemübungen, bis ich mich wieder einkriegte. Es war wie im Film: Atmen in eine Tüte, Ausatmen, keine Schluchzer zulassen, während der blonde junge Mann beschwichtigend über irgendetwas völlig Banales daherplauderte, bis ich mich langsam wieder beruhigte. Kaum war mein überangestrengtes Gehirn zur Ruhe gekommen, war alles wieder gut, und prompt fiel mir auch meine PIN wieder ein (Notiz am Rande: PIN und andere wichtige Zahlenkombinationen rechtzeitig in einem Notizbuch notieren, dann spart man sich die Panikattacke).