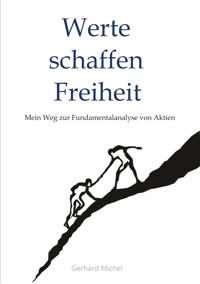
38,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Begeben Sie sich mit dem Investor und Finanzcoach Gerhard Michel auf den Weg vom Komponisten und Tellerwäscher zum fundamentalen Aktienanalysten. In diesem Buch präsentiert Gerhard Michel in verständlicher autobiografischer Form das Mindset eines Fundamentalinvestors, zeigt Fehlerquellen auf und präsentiert zielführende quantitative (zahlenbasierte) Analysetools. Vom ersten Grundgedanken der Fundamentalanalyse bis zum konkreten Formelkanon bekommt der Leser einen spannenden Einblick in die Gedankenwelt eines fundamentalen Aktieninvestors. Anfänger und Fortgeschrittene lernen neue Denkweisen kennen und bekommen Wege aufgezeigt, um z. B. den inneren Wert eines Unternehmens zu berechnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Werte schaffen Freiheit
Eine Aktie ist nicht ein Kurs oder Chart, eine Aktie ist die verbriefte Beteiligung an einem Unternehmen mit hinterlegten Werten.
In diesem Buch präsentiert Investor und Finanzcoach Gerhard Michel in verständlicher, autobiografischer Form das Mindset eines Fundamentalinvestors, zeigt Fehlerquellen auf und präsentiert zielführende quantitative (zahlenbasierte) Analysetools. Vom ersten Grundgedanken der Fundamentalanalyse bis zum konkreten Formelkanon bekommt der Leser einen spannenden Einblick in die Gedankenwelt eines fundamentalen Aktieninvestors. Anfänger und Fortgeschrittene lernen neue Denkweisen kennen und bekommen Wege aufgezeigt, um z. B. den inneren Wert eines Unternehmens zu berechnen.
Gerhard Michel ist als Referent auf Anlegerseminaren und Kongressen aktiv. Sein Wissen vermittelt er in Einzelcoachings und als Gastdozent. Weitere Informationen unter www.finanzcoachduesseldorf.de
Werte schaffen Freiheit
Mein Weg zur Fundamentalanalyse von Aktien
Gerhard Michel Finanzcoach
© 2021 Gerhard Michel Finanzcoach
Buchsatz von tredition, erstellt mit dem tredition Designer
ISBN Softcover: 978-3-347-50167-6
ISBN Hardcover: 978-3-347-50168-3
ISBN E-Book: 978-3-347-50169-0
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Hinweis: Dieses Buch will keine spezifischen Anlageempfehlungen geben und enthält allgemeine Hinweise. Das Buch spiegelt die persönlichen Ansichten des Autors, die Aussagen sind nicht als Anlageempfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes zu verstehen. Der Autor und der Herausgeber haften nicht für etwaige Verluste aufgrund der Umsetzung ihrer Gedanken und Ideen.
Für
Alexander und Konstantin
Ich spreche kein Finnisch.
Wie denn auch – ich habe es ja nicht gelernt.
Weder Finnisch noch finanzielle Bildung sind
angeborene Fähigkeiten (noch nicht einmal für Finnen).
Ich habe dieses Buch für Börsenanfänger und Börsenfortgeschrittene geschrieben. Während der Anfänger im Lauf des Lesens vielleicht die eine oder andere Stelle als schwer verständlich erachtet, so wird ein Fortgeschrittener möglicherweise am Anfang des Buches Seiten überblättern wollen.
Basierend auf meiner Erfahrung als Finanzcoach möchte ich die Anfänger dazu ermuntern, manche Stellen – vor allem ab der Mitte des Buches – mehrmals zu lesen, und den Fortgeschrittenen raten, auch den Anfang zu lesen, um das eigene Mindset durch neue Denkweisen zu erweitern.
Viel Spaß,
euer
Gerhard Michel, Investor und Finanzcoach
Inhaltsverzeichnis
Ich lerne, dass ich nichts weiß
Die Schaufensterübung – das Angestelltenrisiko
Der Elektrobetrieb – Selbstständige arbeiten für Geld
Käsebrot und Wasser – Frugalismus
Das vielleicht schlechteste Abi in NRW – das Bildungssystem
Der Pausenraum – das Rentensystem
Die Berufswahl – ein Patent, der erste echte Vermögenswert
Die Briefmarkensammlung – die Geldwertillusion
Der Grenzvorfall – Steuern und Abgaben
Der erste Mentor – arbeite kostenlos
Tellerwäscher – das Leistungsprinzip
Eine Dummheit – Konsumschulden
Glücksspiel – eine Steuer auf Unwissenheit
Das Angebot – Eigen- und Fremdkapital
Der Stammgast – vom Un-Sinn der Immobilien
Der Umzug – das Prinzip: Cashflow
Ein Besuch im Kunstmuseum – Cashflow, mehr als nur Geldfluss
Wenn ein Berg ruft – Risikodefinition
Die Speisekarte – intellektuelle Abhängigkeit
Der „fast“ Major-Deal: Warum will der Mensch mehr?
Die Gehaltsverhandlung – Selbstständigkeit im Geiste
Das zweite Restaurant – ein erster Vorgeschmack auf die Marge
Wohin mit dem Gewinn – die Cashflow-Spirale
Das Ende der Produktion – so wichtig sind die Soft Skills
Es läuft nicht: Sei bereit, Fehler zu machen
Der erste Eindruck vom Aktienmarkt: Mache keine Verluste
Ich „lerne“ von den Medien – Zeitverschwendung am Aktienmarkt
Meine erste Aktie – die Unwägbarkeiten einer Neuemission
Die Dividendenstrategie – eine Formel als Börsen-Lebensretter
Einhundertmeterlauf – quantitativ geht vor qualitativ
Emotionen – Zahlen schaffen Freiheit und Wohlbefinden
Totalverluste: Lerne lieber das Zinsdeckungsverhältnis kennen!
Der Partytipp: Triff eigene fundierte Investment-Entscheidungen
Die Charttechnik – eine Scheinwissenschaft
Daytrading – Sklave des Marktes
Der Kauf der Immobilie – darum werde ich kein Immobilieninvestor!
Mein erster Crash – Erfahrung ist das wahre Gold der Börse
Arbeiten was das Zeug hält – Definition Reichtum
Modeerscheinungen – der Euphemismus: Branchenrotation
Warum Preisfokussierung? – Gedankenexperiment: Immobilie
Ich verlege die Terrasse nach hinten – Definition: finanzielle Freiheit
Indexmitglied ja oder nein – die Börse ist kein Investor
Welcher Gewinn ist der richtige? – das verwässerte Ergebnis je Aktie
Mit welchen Zahlen möchte ich rechnen? – Vorsicht vor dem kleinen „e“
Mit dem Fahrrad zur Hauptversammlung – Zeit ist Geld
Der erste Geschäftsbericht – Geschäftsberichte und Form 10-K
Reizüberflutung – die wichtigsten Teile eines Geschäftsberichtes
Kein Zauberwerk – die Gewinn- und Verlustrechnung
Das Gleiche aus zwei Richtungen – die Bilanz
Ich mag keine Schulden – die Eigenkapitalquote
Wichtig sind die inneren Werte – der Buchwert
Ich mache zwei Gedankenzweige auf: Woher kommt der Buchwert?
Gut, aber nicht gut genug – das 1-Jahres-KGV Sei fleißig – das 7-Jahres-KGV
Die Werte-Waage – das KBGV
Welche Rendite möchte ich erzielen? – die Richtwertskala
Un(an-)fassbar: Luftgeld – die immateriellen Vermögenswerte
Noch ein defensiver Test – das Nettoumlaufvermögen
Ich brauche eine Offence – der RoA
Der Flügelstürmer – die EBIT-Marge
Zahlen, die keiner braucht – EBITDA und Eigenkapitalrentabilität
Nicht der erste Blick, aber einen Blick wert – Umsatzsteigerungen
Plötzlich stimmen manche Zahlen nicht mehr – Kapitalmaßnahmen
Das gibts nur einmal – das Ergebnis aus fortgeführtem Geschäft
Mit dem Kauf einer Aktie ist die Arbeit nicht vorbei – Quartalsberichte
Wie begegne ich Kursschwankungen? – meine Holding
Freiheitsgedanken – Investieren ist ein Marathonlauf
The Big Players – Zentralbanken
Die Vernichtung der Vermögenswerte? – Vermögenspreisinflation
Meine Lebensversicherung – die Versicherungsbranche
Deren Schadenkostenquote – meine Schadenkostenquote
Externe Datenlieferanten: Was nichts kostet, ist auch nichts wert!
Erfolgreiche Menschen können zuhören – qualitativer Wissensaufbau
Heute im Angebot: Schaufeln – qualitatives Brainstorming
Crash-Boom-Langeweile – fundamentale Börsenphasen
Diamantensuche – Diversifikation
Verkaufsgedanken – das Holding-Geschäftsführer-Ich
Zettelwirtschaft – der direkte Vergleich vor der Investitionsentscheidung
Gastronomie-Exit: Wenn man das erreicht, woran keiner glaubt
Vom Aktieneremit zum Finanzcoach
Jeder kann das erreichen, woran keiner glaubt
Ich danke …
Ich lerne, dass ich nichts weiß
Ich war 16 und fand mich unfassbar cool. Ich hatte bereits meine erste Band mitgegründet und Konzerte waren geplant. Wie es sich für einen gymnasialen Punkmusiker der 80er Jahre gehörte, wohnte ich noch bei meinen Eltern in einer recht spießigen Gegend von Düsseldorf. Es war gegen 15:00 Uhr, als es an unserer Wohnungstür klingelte. Ich war allein zu Hause und öffnete die Tür. Vor der Tür stand ein circa 30 Jahre alter Mann asiatischer Herkunft.
„Wollen kaufen Monchichi?“, sagt er und hielt die knapp 10 cm große Monchichi-Puppe am ausgestreckten Arm vor mein Gesicht. So direkt hatte mir bisher noch niemand ein Geschäft vorgeschlagen. Im Millisekunden-Takt sprang mein Blick zwischen der albernen Figur in seiner Hand und dem geübten Gesicht des Verkäufers, das mich aus funkelnden Augen und mit breitem Grinsen ansah, hin und her.
Hier stand jemand vor mir, der mehr wusste. Einer, der über meine wasserstoffblond gefärbte Punkfrisur hinweg in die Zielgerade eines abzuschließenden Geschäfts blickte. Wie ferngelenkt nickte ich auf seine Frage. „10 Mark!“, sagte er bestimmend und doch freundlich.
Ich drehte um, holte 10 D-Mark, gab sie ihm, nahm die Figur und schloss die Türe. Der Deal muss ungefähr 10 Sekunden gedauert haben. Da stand ich nun mit dem blöden Püppchen in der Hand und um wertvolle 10 Mark ärmer. In mir entbrannte ein Tobsuchtsanfall. Ich schmiss die Figur, so fest ich konnte, gegen die Wand, hatte aber sonst niemanden, an dem ich die Wut über mich selbst auslassen konnte. Als meine Eltern nach Hause kamen, erwartete sie mein Redeschwall. „Ihr habt mir nichts beigebracht. Ich bin ein Opfer der blödesten Verkaufsstrategie geworden, von der man je gehört hat. In der Schule habe ich nichts für das Leben, sondern nur für die Schule gelernt. Ich bin nicht auf das Leben vorbereitet worden!“
Ich war nun wirklich kein guter Schüler und habe nur das Allernotwendigste getan. Ich war relativ früh zu der Erkenntnis gekommen, dass viele Lehrinhalte für mich überflüssige Zeitverschwendung waren. Beweisen konnte ich diese These mit 16 Jahren noch nicht. Heute weiß ich, dass ich recht hatte.
Meine Mutter brach in Lachen aus. Sie hat mich nicht ausgelacht. Vielmehr war es das Lachen von jemandem, der die Erkenntnis des anderen wertzuschätzen weiß. „Es ist doch eine nette Figur“, sagte sie. Dann klappte sie dem Ding die beiden kleinen behaarten Plastikärmchen kurz auseinander und klammerte das Monchichi an das Elektrokabel unserer Wohnzimmerdeckenlampe. Dort hing das Plastikäffchen bis zu meinem Auszug und erinnerte mich daran, dass es etwas zu ändern galt. Dem unbekannten Verkäufer bin ich für diese Lektion bis heute dankbar.
Die Schaufensterübung – das Angestelltenrisiko
Meine erste Idee für eine Veränderung war: Ich schmeiße die Schule hin und mache eine Ausbildung. Ich war mir sicher, dass man während einer Ausbildung etwas über das echte Leben lernt. Am liebsten wäre ich Hafenarbeiter geworden. In meiner Vorstellung existierte ein romantisches Bild von ehrlichen Interaktionen und ergebnisorientierten Handlungen im Hafen. Ich wollte Praktiker sein und nicht Theoretiker – so wie die meisten Lehrer es waren.
Zu meinem Erstaunen griffen meine Eltern meinen Wunsch relativ entspannt auf und machten mir ein alternatives Angebot. „Ein Bekannter von uns ist Schaufensterdekorateur“, sagten sie. „Fahr doch ein Wochenende mit ihm mit und guck dir seine Arbeit an. Anschließend weißt du vielleicht mehr über das echte Leben.“ Ich stimmte zu.
Ich fuhr also als Praktikant nach Hamburg, um die Schaufenster einer Einzelhandelskette zu dekorieren. Erwartet hatte ich ein Abenteuer, einen Einblick in eine aktiv handelnde pulsierende Welt. Vor Ort empfingen mich jedoch Menschen, die wenig Freude an ihrer Tätigkeit ausstrahlten und die Aufregung der „echten“ Welt nicht als Genuss, sondern eher als notwendiges Übel zu betrachten schienen. Das galt übrigens nicht zwingend für den Bekannten meiner Eltern, der doch recht engagiert bei der Sache war, auch wenn es darum ging, mir auf der Fahrt klarzumachen, wie froh ich doch sein könne, die Möglichkeit auf ein Abitur und somit auf einen besseren Job zu haben. (In den 1980ern haben rund 20 % der Schüler in Deutschland Abitur gemacht. Diese Zahl ist inzwischen stark angestiegen.)
So ernüchternd dieses erste Berufstätigen-Erlebnis war, so sehr hat es sich gelohnt. Schließlich war es tatsächlich so, dass ich in den zwei Tagen in Hamburg mehr über das Leben gelernt hatte als in so manchem Schuljahr. Die Schulpausen möchte ich hier ausnehmen, denn in den Pausen lernte ich so manche wichtige Lektion.
Die Angestellten in dem Einzelhandelsbetrieb waren Ausführende. Menschen, denen jemand gesagt hatte, was sie tun sollen. Anschließend machten sie sich an die Umsetzung. Wenn sie Fehler machten, wurden sie ermahnt. Das kannte ich schon aus der Schule. Man sagte uns Schülern, was wir tun sollten, und wir haben es dann (mehr oder weniger) gemacht. Wenn man es falsch machte, bekam man eine schlechte Note. Der Bezug zur Wirklichkeit war jedoch in der Schule meist viel geringer als in der Angestelltenwelt. Der kreative Spielraum der Angestellten war überschaubar. Erstaunlicherweise schienen die Mitarbeiter in dem Einzelhandelsbetrieb sich mit ihrer Situation abgefunden zu haben. Ihnen schien das vermeintliche Sicherheitspolster des Angestelltendaseins, bestehend aus Arbeitsvertrag und Rentenaussicht, auszureichen. Das Polster ist jedoch nur ein Scheinpolster, denn gerät die Firma in Schwierigkeiten, werden die Verträge gekündigt und der Angestellte verliert seinen einzigen Kunden: seinen Arbeitgeber. Das Geschäft, in dem wir dekorierten, hatte damals viele Kunden und es war unwahrscheinlich, dass alle zugleich wegbleiben würden. Das größere Risiko liegt somit beim Arbeitnehmer mit nur einem Kunden.
So kam ich schlauer zurück, als ich losgefahren war. Ich erklärte meinen Eltern, dass ich die Schule zunächst einmal zu Ende machen werde. Auch um mir bis zum Abitur berufliche Alternativen für mein späteres Leben auszudenken.
Der Elektrobetrieb – Selbstständige arbeiten für Geld
Es galt dennoch sofort an einer anderen Stelle etwas zu ändern. Ich wohnte noch bei meinen Eltern, hatte jedoch in unserer kleinen Wohnung kein eigenes Zimmer. Über ein paar Kontakte aus der Musikszene gab es schließlich die Möglichkeit, in eine Wohngemeinschaft mit Anschluss an ein Tonstudio zu ziehen. Dies tat ich, noch bevor ich mein Abitur abschloss. Um den Auszug zu finanzieren, nahm ich einen Teilzeitjob in einem Elektroinstallationsbetrieb an. Ich wurde zu einer Art „Bürokraft für alles“ und durfte dem Meister unter anderem bei der Bearbeitung seiner Steuerunterlagen helfen. Ein spannender Einblick in ein System aus Hunderten von Zetteln auf dem Werkstattboden.
Der Betrieb lief nicht besonders, was auch an der schlechten Zahlungsmoral der Kunden lag. Der Inhaber war als Selbstständiger mit vier Angestellten voll eingespannt und hatte kaum Zeit für irgendeine andere Beschäftigung als das Leiten des Betriebes. Es gab täglich Telefonate, in denen er seiner Frau erklären musste, dass es mal wieder später wird.
Der Elektromeister arbeitete als Selbstständiger genauso mühsam für Geld, wie es Angestellte tun. Das Ergebnis war jedoch viel stärker als beim Angestellten von seinem persönlichen Einsatz abhängig. Seine Position als selbstständiger Eigentümer differenzierte ihn von seinen Angestellten dadurch, dass er einen wesentlich größeren, kreativen und strategischen Spielraum als Entscheidungsträger hatte, sowie durch die Tatsache, dass er die Steuern erst nach Abzug der Kosten bezahlen musste. Die Angestellten hatten kaum die Möglichkeit, Kosten bei der Steuererklärung geltend zu machen. Sie zahlten die Steuern vor ihren Kosten direkt, wenn sie die Lohnabrechnung erhielten.
Auf den Schultern des Chefs lastete die Verantwortung für die Arbeitsplatzsicherheit der Mitarbeiter, auch wenn der eine oder andere Mitarbeiter nicht wirklich engagiert bei der Sache war. Selbstständige tragen das Risiko des Forderungsausfalls, wenn Kunden nicht bezahlen können oder wollen. Häufig haften Unternehmer mit ihrem privaten Vermögen für die Firma. Dieses Risiko lässt sich durch die Wahl der richtigen Rechtsform (z. B. GmbH) minimieren. Der Elektrobetrieb, in dem ich arbeitete, ging kurz, nachdem ich ihn verlassen hatte, pleite. Der Elektromeister war Einzelunternehmer und haftete mit seinem gesamten Privatvermögen.
Ich erinnere mich noch gut an die Gespräche der Mitarbeiter, wenn der Chef mal nicht in der Werkstatt war. Sie haben die Pleite lange kommen sehen und schauten ihr fatalistisch entgegen.
Käsebrot und Wasser – Frugalismus
Das Zimmer, das ich in der WG bezog, hatte vier kahle Wände, Fenster aus der Nachkriegszeit und keine Heizung. Wenn man außen am Haus vorbeiging, sah man, dass die Wände schief und voller Risse waren. Vor dem Einschlafen überkam mich hin und wieder die Befürchtung, dass das Gebäude über mir zusammenstürzen könnte. Das ganze Haus hatte nur einen kleinen Kohleofen, der keinen besonders vertrauenswürdigen Eindruck machte. Eines Tages warf ich ihn an – und statt nach draußen puffte der Rauch mit einem großen Knall in die Wohnung hinein. Von diesem Tag an habe ich den Kohleofen nie wieder benutzt. Wir heizten nur selten mit dem Stromradiator, denn Heizen mit Strom, das war für uns zu teuer.
Meine Mitbewohner waren alle Musiker und ein paar Jahre älter als ich. Ich wurde als Greenhorn super aufgenommen und bekam so manche Lerneinheit in Kochen und Putzen. Ich hörte aufmerksam zu, denn hier gab es wirklich etwas zu lernen.
Auffallend waren die geringen Kosten, die der Lebensstil verursachte. Meine Nahrung bestand aus Käsebroten und Nudelgerichten. Wenn Geld ausgegeben wurde, dann wurde es in Musikinstrumente oder Musikequipment investiert. Kleidung wurde auf Flohmärkten gekauft und die Miete für das einsturzgefährdete Haus war gering. Eine Ausnahme bildete der unnötig hohe Zigarettenkonsum.
Dieses minimalistische Leben schaffte ein unmittelbares Freiheitsgefühl. Zwänge, die aus exzessivem Konsum entstehen, kamen gar nicht erst auf. Wären Konsumzwänge vorhanden gewesen, so hätten sie umgehend durch mehr Arbeit in einem Angestelltenverhältnis bedient werden müssen, und das hätte Zeit gekostet. So jedoch konnten die wenigen Bedürfnisse relativ effizient bedient werden. Die freie Zeit, die somit entstand, wurde in das Weiterentwickeln von Musikproduktionen oder in die strategische Planung neuer Musikprojekte investiert. Dieses kreative Ausarbeiten von Gedanken und Ideen sowie das Planen ihrer strategischen Umsetzung waren wichtige Bausteine zur persönlichen Entwicklung. Ich kann mich bis heute nicht erinnern, jemals nichts getan – also nicht gedacht zu haben.
Die Begriffe Sparsamkeit und Geiz sind beide negativ besetzt. Beim Begriff Geiz, der eine krankhafte, lebensverneinende Sparsamkeit beschreibt, leuchtet das ein. Sparsamkeit kann von einer Gesellschaft, die stark vom Konsum getrieben wird, nicht so einfach positiv durchgewunken werden, da Sparsamkeit zum Konsumverzicht führt und somit das Wirtschaftswachstum bremst.
Es gibt jedoch eine dritte für die Gesellschaft und den Einzelnen positive Variante, das Geld bei sich zu behalten, nämlich Konsumverzicht, um das angesparte Geld in Vermögenswerte zu investieren – der sogenannte Frugalismus. Der Begriff Frugalismus beschreibt ein Lebenskonzept, bei dem Sparsamkeit eingesetzt wird, um Freiheitsmaximierung zu erreichen. Frugalisten schaffen es mit relativ wenig Geld, ein glückliches Leben zu führen. In der Ansparphase investieren Frugalisten ihr überschüssiges Geld in Vermögenswerte, um später ein Leben in finanzieller Freiheit führen zu können. Sie erkennen, dass der Belohnungsaufschub sich lohnt, da sie durch ihn in die Lage versetzt werden, in der Zukunft größere Belohnungen zu erhalten. Geld, das aus den Vermögenswerten zum Frugalisten zurückfließt (Kapitalfluss, engl.: Cashflow), wird wiederum in Vermögenswerte reinvestiert. Daraus entsteht ein immer breiter werdender Kapitalfluss, der schließlich komplett oder in Teilen den Lebensunterhalt deckt. Für mich als Musiker bedeutete das: Sparsam leben und die somit gewonnene Zeit in das Fertigstellen von Kompositionen investieren. Dass Kompositionen – wegen des möglichen Patentschutzes – echte Vermögenswerte sind, ahnte ich damals zwar, aber belegen konnte ich es noch nicht.
Das vielleicht schlechteste Abi in NRW – das Bildungssystem
Mit fehlendem Respekt vor dem Bildungssystem und einem rekordverdächtig schlechten Durchschnitt schloss ich schließlich die Schule ab. Ich wurde sogar zum Rektor gerufen, weil er mir wegen meiner dürftigen, aber doch exakt den Anforderungen entsprechenden Leistung die Hand schütteln wollte. Es war das erste und das letzte Mal, dass ich ihm während meiner Schulzeit persönlich begegnete. (Auf meiner Schule wurde damals das Abitur nicht feierlich überreicht, wie es heute üblich ist, sondern man bekam es einfach und formlos in die Hand gedrückt.)
„Punktsumme aus 6 Leistungskursen: 102 (nötig waren mindestens 100), Punktsumme aus den Prüfungen: 100 (nötig waren mindestens 100)“, sagte er und schaute vielsagend zu mir hoch. Ich grinste ihn an und legte den Kopf leicht zur Seite. Es gab von meiner Seite nichts mehr zu sagen.
Ich – und in Teilen auch die Lehrer – wusste, dass ich Jahre meines Lebens damit zugebracht hatte, Dinge zu lernen, für die es im späteren Leben keine Anwendung geben würde. Der Ausruf eines Lateinlehrers auf die Frage, warum man dieses Fach lernen sollte, lautete: „Für hier!“, und dabei tippte er mit seinem Zeigefinger an die Stirn. Mir war klar, dass es für mich wichtigere Dinge zu lernen gab als Latein. Diese Dinge wären für mein Leben von wesentlich größerer Relevanz und auch sie wären „für hier!“ gut. Niemand hat uns jemals einen Miet-, Kredit- oder Arbeitsvertrag vorgelegt. Es gab keinen Unterricht im Verhandeln oder Argumentieren. Ich habe diesen Zustand als ungerecht empfunden, da jene Kinder, deren Eltern zum Beispiel Selbstständige oder Geschäftsführer waren oder sogar Immobilien vermieteten, eher die Chance hatten, von ihren Eltern mehr über wirtschaftliche Zusammenhänge zu lernen. Meine Eltern waren Angestellte, die keine finanzielle Bildung besaßen und mir keine vermitteln konnten. Wie ungerecht also, die Zeit mit Latein oder mathematischen Formeln, für die es keine Anwendung gibt, zu verplempern und eine gesellschaftliche Spaltung somit zu verfestigen.
Ich entschied mich, zwei Fächer ernsthaft zu verfolgen: Geschichte und Englisch. Während meines ersten Leistungskurses in Geschichte (ich habe die 11. Klasse einmal wiederholt), hatte ich einen herausragenden, engagierten Lehrer. In all den Jahren war er der Einzige, der es schaffte, dass der ganze Kurs einmal darum bat, auf die Pause zu verzichten und am Ende des Unterrichts applaudierte. Er hatte in der besagten Doppelstunde aus seiner eigenen Jugend nach dem 2. Weltkrieg erzählt. „Die Zukunft kann niemand voraussagen. Wer jedoch die Vergangenheit kennt und die Gegenwart versteht, kann recht nahe herankommen.“ Das fand ich interessant.
Englisch ist, zumindest in der westlichen Welt, die Sprache der modernen Musik und der Wirtschaft. Jeder sollte sie so gut wie möglich beherrschen. Meine Englischlehrerin tat alles, um uns die Freude am Lernen zu vermiesen. Sie kam aus der 68er-Bewegung und hatte ein recht einfaches schwarz-weißes Weltbild. Sie konnte unsere Generation, die auch nach Zwischenfarben suchte, nicht ausstehen.
Das Thema finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit spielte während der Schulzeit keine Rolle. Wir wurden zu Angestellten oder Beamten ausgebildet. Diese Ausrichtung des Bildungssystems ist nicht weiter verwunderlich, da es von Seiten des Staates und von Seiten der Unternehmen einen großen Bedarf nach Angestellten und Beamten gibt.
Für den Einzelnen und für die Gesellschaft insgesamt ist der Fokus des Schulsystems auf der Ausbildung von Angestellten leider zu kurz gedacht. Denn unsere Wirtschaft erfreut sich eines permanenten Wandels durch Innovation. Technologischer Fortschritt lässt die Gewinnmargen von einzelnen Unternehmen steigen, da zum Beispiel Technologieunternehmen mit geringeren Investitionssummen und weniger Mitarbeitern größere Margen erzielen können.
Besser wäre es für den Einzelnen, er würde als Investor an dieser großartigen Entwicklung partizipieren oder er wäre als Firmengründer ein Teil davon. Auch die Unternehmen würden von einem größeren Anteil an Investoren innerhalb einer Gesellschaft profitieren, da ihnen somit potenziell mehr Kapital für Investitionen zur Verfügung gestellt würde und sie schneller wachsen könnten. Außerdem arbeiten wirtschaftlich gebildete Angestellte in ihren Unternehmen langfristig effektiver.
Doch diese Ausbildung zum Investor oder zum Unternehmer fand nicht statt. Die weitverbreitete Meinung, dass man das Investieren nicht lernen kann, sondern dass der Erfolg eines Investors nur von Glück abhängig ist, ist genauso unlogisch wie die Behauptung, dass ein Marathonläufer einen Lauf durch Glück gewonnen hat. Die Tatsache, dass wir in unserem Bildungssystem nichts über das Investieren lernen, bedeutet weder, dass man es nicht lernen kann, noch, dass es keine allgemeingültigen Regeln und Grundsätze gibt, die den erfolgreichen Investor definieren. Ähnlich wie beim Erlernen einer Sprache gibt es für Investoren eine – man könnte es „Grammatik“ nennen –, also eine Grundlage, die ein wichtiges Gerüst bietet, um erfolgreich anlegen zu können.
Die meisten Menschen sind als Investoren leider erfolglos. Dies ist folgerichtig, da sie nie mit den Regeln oder Grundsätzen des Investierens in Kontakt gekommen sind.
Finanzieller Erfolg wird in unserer Gesellschaft jedoch als erstrebenswert angesehen. Menschen, die im Bereich Finanzen nicht erfolgreich sind, suchen daher häufig nach beruhigenden Erklärungen für ihren Misserfolg, um sich der Eigenverantwortung zu entziehen. Sie nutzen Ausflüchte wie zum Beispiel: „Diese oder jene Person hatte in finanziellen Angelegenheiten Glück und ich eben nicht.“ „Wer finanziell erfolgreich ist, hat seinen Erfolg nur seiner Skrupellosigkeit oder sogar Bosheit zu verdanken.“ „Wenn ich wollte, dann wäre ich finanziell erfolgreich, aber das Thema ist mir zu trivial.“
Solche und ähnliche Äußerungen reichen häufig als Entschuldigung aus und mindern nebenbei die Leistung des finanziell Erfolgreichen. Wer so argumentiert, kann noch weiter gehen: Da Glück nicht als Leistung gilt, böse Menschen unrecht tun und das Thema nur für einfache Geister geschaffen ist, hat jemand, der finanziellen Erfolg hat, keine Leistung erbracht. Somit könnte man ihm seine Leistung absprechen und ihm sein Vermögen sogar abnehmen.
Es ist das Unwissen über eine fremde und unbekannte intellektuelle Leistung, die einige Menschen so ablehnend reagieren lässt. Wir alle kennen den Effekt aus Reisen in fremde Länder oder vom gemütlichen Abend in einem exotischen Restaurant. Fremde reden an diesen Orten möglicherweise in einer Sprache, die wir nicht verstehen. Dies macht uns unsicher. Reden sie vielleicht über uns? Machen sie sich über uns lustig oder schmieden sie Pläne, wie sie uns beim Verlassen des Restaurants überfallen könnten? Solche Gedanken sind jedem von uns schon einmal in ähnlichen Situationen durch den Kopf gegangen, während sich die Fremden nur über das Wetter oder einen Verwandten unterhalten haben.
Hat man sich selbst jedoch etwas mit der fremden Sprache beschäftigt und ein paar Vokabeln oder Sätze gelernt, dann verschwindet das Unwohlsein relativ zügig. Derselbe Effekt stellt sich beim Erlernen finanzieller Zusammenhänge ein. Wurde einmal etwas finanzielles Grundwissen vermittelt, dann verschwinden Vorurteile und Ängste relativ schnell. Man kann Kritikern sehr schnell klar machen, dass finanzielle Bildung und die Fähigkeit, Unternehmenszahlen nachhaltig richtig zu interpretieren, immer wichtig sind, egal ob man eine Windkraftanlage, ein Solarkraftwerk oder eine Chemiefabrik errichten möchte.
Die Leistung eines Arztes oder eines Professors wird allgemein anerkannt, denn beide haben zunächst in einem uns gut bekannten Kontext gute Leistungen erbracht – nämlich in der Schule und der Universität. Manchen Menschen fällt es jedoch schwer, Leistungen anzuerkennen, die in einem ihnen fremden Kontext erzielt werden. Auf solches Unverständnis treffen Musiker genauso wie Investoren, bildende Künstler oder Sportler – und eben auch Firmengründer.
Es macht den meisten Menschen nichts aus, dass sie kein Litauisch sprechen, schließlich haben sie es in der Schule nicht gelernt und Litauisch gilt nicht zwingend als wichtige Sprache, um erfolgreich zu sein (die Litauer mögen mir bitte vergeben!). Wenn man jedoch Menschen darauf anspricht, dass sie keine finanzielle Bildung erworben haben, reagieren viele eingeschnappt, da der intelligente Umgang mit Geld als wichtig für den persönlichen Erfolg gilt. Auf die Idee, dass man ihnen das Thema in der Schule vorenthalten hat, kommen die wenigsten.
Nachdem ich vom Rektor mein Abi bekommen hatte, wanderte ich schnurstracks vor das Tor unserer Schule. Ich ging zur nächsten Telefonzelle, rief meine Eltern an und sagte: „Ich habe es. Und ich möchte nichts mehr davon hören.“
Der Pausenraum – das Rentensystem
Neben der besagten Doppelstunde Geschichte gab es noch eine Stunde, an die ich mich ganz besonders erinnere. Das Fach hieß damals Sozialwissenschaften und der Lehrer schlug ein neues Thema an, nämlich das Rentensystem. Er erklärte uns ganz nebenbei und ohne jede Dramatik, dass das deutsche Rentensystem nach dem sogenannten Umlageverfahren finanziert sei und es keine Kasse gäbe, in der die eingezahlten Rentenbeiträge angespart werden. Er sagte, dass die Rentenbeträge der Angestellten direkt an die Rentner ausgeschüttet werden und die Rentenbeiträge weder angespart noch investiert werden.
Durch mich fuhr der Blitz. Das war gegen jede Logik. Wenn man etwas nicht investiert, sondern direkt auszahlt, dann kann der Betrag nicht wachsen, im Gegenteil – abzüglich der Kosten durch die Verwaltung muss er geringer werden. Wenn nun aber immer weniger Beitragszahler auf die Welt kommen – und das war damals schon der Fall –, wie sollte das System dann funktionieren?
Ein solches System kann nur aufrechterhalten werden, wenn auf anderem Wege zusätzlich eingezahlt wird. Das Rentensystem muss daher durch Steuereinnahmen subventioniert werden. Das wiederum bedeutet, dass die Rentenbeitragszahlungen, die die Angestellten auf ihren Lohnabrechnungen sehen, nur ein Teil der von ihnen geleisteten Rentenzahlungen sind. Durch die von ihnen gezahlten Steuern zahlen sie andauernd in das Rentensystem ein, zum Beispiel, wenn sie das Licht anknipsen (Stromsteuer) oder beim Einkaufen (Mehrwertsteuer). Dieses System könnte außerdem zur Folge haben, dass die Steuern immer weiter steigen müssten, um es zu finanzieren, oder der Staat sich weiter verschulden müsste, um die Renten weiterhin bedienen zu können. Steigende Steuern bedeuten jedoch auch immer weniger Flexibilität beim Vermögensaufbau für den Einzelnen und somit weniger finanzielle Freiheit. Warum finden Menschen so ein System offensichtlich in Ordnung?
Zunächst einmal ist es leider immer noch so, dass nicht alle Menschen wissen, wie das Rentensystem funktioniert. Aber auch wenn man ihnen das Umlageverfahren erläutert, gibt es viele, die sagen: „Ist mir egal.“ Offensichtlich sind die meisten Menschen mit einer geringeren Ausschüttung als der Summe ihrer Einzahlungen zufrieden, da viele selber unter anderem wegen fehlender Disziplin und fehlender finanzieller Bildung nicht in der Lage sind vorzusorgen und somit das Thema lieber in die Hand des Staates legen – auch wenn sie dabei Verlust machen. Sie denken vielleicht: „Immer noch besser, ich habe hinterher 70 % von den 100 %, die ich eingezahlt habe. Denn sparen, das ist nicht mein Ding.“ Außerdem wäre es möglich, dass ihnen die finanziellen Probleme der nachfolgenden Generationen, die die Rentner ja permanent finanzieren müssen, egal sind. Da weniger Kinder geboren werden, verteilt sich die Last auf immer weniger Schultern.
Haben 1962 noch 6 Werktätige einen Rentner finanziert, so waren es 2015 nur noch 2,1 Werktätige. Wie aber soll sich so ein System ändern lassen, wenn auf Basis der demografischen Entwicklung (die Menschen werden zum Glück immer älter) der Anteil der Rentner oder der Menschen, die bereits an die Rente denken, bei Wahlen immer größer wird. Ein ernsthaftes Umschwenken schien unmöglich. Ich hatte eher die Befürchtung, dass die Politiker sich durch das Ankündigen höherer Rentenausschüttungen Wählerstimmen „kaufen“ könnten. Umgekehrt wäre es auch möglich, dass die vielen Rentner (2020 waren es 21,6 Millionen – gegenüber 44,8 Millionen Erwerbstätigen) nur jene Parteien wählen würden, die einen weiteren Anstieg der Rente garantieren – auch wenn das zu steigenden Steuern oder einer höheren Verschuldung des Staates führen muss.
Ich war außer mir. In der nächsten großen Pause stürmte ich in den Pausenraum, um das Thema mit Freunden zu diskutieren. „Habt ihr das mitbekommen: Es gibt keine Kasse! Die Rentenbeiträge werden nicht angespart oder investiert! Das ist kein solides System!“ Ich war mir sicher, dass meine Freunde ebenso empört waren wie ich, doch ihre Reaktion fiel völlig anders aus. Sie schauten mich an, als ob ich den Verstand verloren hätte. Ich solle mich beruhigen. Das Thema wäre doch völlig egal und kein Grund, so ein Aufhebens zu machen.
Schließlich besann ich mich wieder auf meine Punkrock-Attitüden. Wahrscheinlich hatten sie recht. Wie sieht das denn aus: Ein Punk, der sich über das Rentensystem echauffiert und dann noch beklagt, dass es keine angesparten Beiträge gibt. Ein Thema für Spießer, also weg damit!
Doch einen „Rückfall“ hatte ich kurz darauf noch. Ich habe meinem Onkel tatsächlich vorgeworfen, dass wir – die Jungen – durch die Rentenzahlungen zu stark belastet werden und auf Basis der hohen Steuern kaum noch finanziell erfolgreich sein können. Noch nie habe ich meinen sonst bei Kaffee und Kuchen immer recht entspannten Onkel so auf die Palme gebracht. „Das ist eine Unverschämtheit!“, sagte er, denn er hätte sein Leben lang „eingezahlt“.
Ich konnte ihm nicht böse sein, denn schließlich wusste er nicht, dass er nirgendwo eingezahlt, sondern immer nur an Rentner überwiesen hatte.
Die Berufswahl – ein Patent, der erste echte Vermögenswert
Bis zum Ende meiner Schulzeit hatte ich noch keine Lösung für mein Berufswahlproblem gefunden. Aber es gab auch keine wesentlichen neuen Eindrücke wie zum Beispiel die Schaufensterdekoraktions-Übung. Eins konnte ich jedoch schon einmal ausschließen: Studieren und damit weiterhin von Theoretikern lernen, das wollte ich auf keinen Fall. Ich hatte noch 15 Monate Zeit zur Entscheidungsfindung, denn so lange dauerte in den 80er Jahren die Dienstzeit bei der Bundeswehr, wenn man den Wehrdienst nicht verweigerte. Die Bundeswehr war damals noch keine Berufsarmee und man musste als junger Mann in einen der beiden Äpfel beißen: Wehrdienst oder Zivildienst.
Während der Wehrdienstzeit wuchs in mir meine Berufswahl heran und aus der sich schon länger andeutenden Idee wurde schließlich eine unumstößliche, in Granit gemeißelte Entscheidung: Ich werde Musiker. Was ich noch nicht wusste, war, dass diese Entscheidung gleichzeitig mein Eintritt in das Investorenleben war.
Die beiden Berufswege Angestellter oder Selbstständiger, die ich bis dahin kennengelernt hatte, gaben beide kein besonders verlockendes Bild ab. Beide arbeiten für Geld. Kein Ansatz, den ich ablehnte – im Gegenteil. Aber auch kein Ansatz, der mich wirklich begeisterte. Ich konnte mir nicht vorstellen, einen dieser beiden Lebensentwürfe ein Leben lang zu verfolgen. Schon die Wortwahl hat etwas Merkwürdiges: Ist der eine selbstständig und der andere dann unselbstständig, so wie ein kleines Kind, das man nicht allein zu Hause lassen kann und dem man sagt, was es zu lassen und zu tun hat?
Die Musik, das hatte ich in der Musiker-WG gelernt, bot noch eine völlig andere dritte Variante als Lebensentwurf an. Komponisten und Textdichter können ihre Kompositionen und/oder Musiktexte nämlich bei einer musikalischen Verwertungsgesellschaft (eine Art Patentamt für Musiker) anmelden. Die Verwertungsgesellschaft erstellt nach der Anmeldung ein Urheberrecht, das sich anschließend ein Leben lang im Besitz des Urhebers (Komponist/Texter) befindet. Wird das Werk veröffentlicht, so erhalten die Urheber dafür eine Vergütung (Tantiemen), die von der Verwertungsgesellschaft vom Nutzer des Werkes (z. B. einem Fernsehsender) eingetrieben wird und schließlich an die Urheber weitergereicht wird.
Im Klartext: Man komponiert einmal ein Lied und bekommt immer wieder Geld, wenn das Lied irgendwo aufgeführt wird. Man hat ein Patent erworben und besitzt somit einen echten Vermögenswert – und Investoren besitzen nun mal echte Vermögenswerte. Komponieren, das war meine Leidenschaft und die Verlockung, für diese meine geliebte Tätigkeit ein Leben lang bezahlt zu werden, die scheinbare Verheißung des Olymps.
Der Vermögenswert – in diesem Fall ein Patent – arbeitet für den Inhaber des Vermögenswertes. Dies würde mich von den Menschen differenzieren, die für Geld arbeiten, jedoch keine Vermögenswerte für sich arbeiten lassen. Natürlich geht beides auch gleichzeitig. Man kann für Geld arbeiten, zum Beispiel als Verkäufer, und Vermögenswerte für sich arbeiten lassen, zum Beispiel als Besitzer einer Aktie oder eines Patentes.
Ein echter Vermögenswert definiert sich aus der Tatsache, dass der Vermögenswert in der Lage ist, Kapitalfluss zu generieren. Kapitalfluss oder auch Cashflow ist eines der wichtigsten Wörter in der Ökonomie, von dem viele leider nicht wissen, was es bedeutet.
Wenn ich eine vermietete Immobilie besitzen würde, dann wären die Mieteinnahmen mein Kapitalfluss, der monatlich auf meinem Konto eingeht. Ich hätte einmalig eine Immobilie erworben und diese würde anschließend für mich arbeiten. Aktien erzeugen Kapitalfluss durch Dividendenausschüttungen, Anleihen schütten Coupons (Zinszahlungen) an die Gläubiger aus und Patente schütten – um bei meinem Musiker-Beispiel zu bleiben – Tantiemen aus. Andere Patentarten oder Schutzrechte, zum Beispiel das Patent an einer Software oder einer Erfindung, sind ebenfalls denkbar.
Patente sind somit einer der vier existierenden Vermögenswerte auf dieser Welt, die sich objektiv bewerten lassen. Die anderen drei objektiv bewertbaren Vermögenswerte lauten: Aktien, Anleihen und Immobilien.
Was ist jedoch mit den vielen anderen Vermögenswerten, die bei der Verwendung des Wortes Vermögenswert häufig gemeint sind? Was ist zum Beispiel mit Kunstgegenständen, Gold, Oldtimern oder Briefmarken? Es handelt sich hierbei nicht um objektiv bewertbare Vermögenswerte, da sie, wenn sie sich im Besitz einer Person befinden, keinen Kapitalfluss erwirtschaften. Somit können sie nicht für die Person arbeiten. Und da sie keinen Kapitalfluss erzeugen, lassen sie sich nicht objektiv – unabhängig von der Meinung der Marktteilnehmer – bewerten.
Die Briefmarkensammlung – die Geldwertillusion
Ich stamme aus einer Arbeiterfamilie. Mein Vater hatte nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen, als Ungelernter in einer Fabrik, die Zahn- und Mund-Reinigungsmittel herstellte, zu arbeiten, und blieb dort bis zu seiner Verrentung. Meine Mutter arbeitete viele Jahre als Reinigungskraft und war später Hausfrau. Übrigens, das Geschenk, das meine Eltern von der Mutter meiner Mutter zur Hochzeit bekommen hatten, war ein gebrauchtes Emaille-Sieb mit einem durchgerosteten zusätzlichen Loch. Meine Oma ergänzte das Hochzeitsgeschenk noch durch die Bemerkung: „Ist nicht schlimm mit dem Loch – oder? Ist ja eh ein Sieb.“ Man kam immer gut miteinander aus, aber mehr konnte sie nicht hergeben. Dieses Sieb hängt heute in unserer Küche und wir benutzen es noch.
Mein Vater und meine Mutter hatten keine finanzielle Bildung genossen und hatten sich während ihres gesamten Lebens auch nie auf die Suche nach eben einer solchen Bildung begeben. Eines Tages wurde mein Vater jedoch durch einen Bekannten auf die Idee gebracht, in eine Briefmarkensammlung zu investieren. Außer dem – für die meisten Deutschen obligatorischen Sparbuch – hatte bis dahin keine Form der Altersvorsorge stattgefunden.
Ich war 10 Jahre alt und muss zugeben, dass ich von den Bildern von Lokomotiven oder historischen Ereignissen auf den kleinen Klebebildern recht beeindruckt war. Auch das gewissenhafte Sortieren in verschiedenen Ordnern machte mir Freude. Diese etwas penible Art ist eine Eigenschaft, die einem als quantitativem Unternehmensanalysten durchaus zugutekommt. Weniger beeindruckend waren jedoch die Informationen über die Preisentwicklungen der Marken in den Briefmarkenkatalogen. Es schien doch recht lange zu dauern, bis sich ein Wertzuwachs einstellt. Um es deutlich zu sagen: Er stellte sich nie ein.
Die Marken lagen in ihren Ordnern und „taten“ nichts. Sie erzeugten keinen Kapitalfluss, wie es zum Beispiel fundamental ausgewählte Aktien getan hätten. Da mein Vater nicht über die Begeisterung an den Grafiken auf den Marken zum Briefmarkensammeln gekommen war, sondern er auf einen Wertzuwachs hoffte, hielt sich seine Freude an den Aufdrucken in Grenzen.
Während ich als kleiner Junge immer wieder in die Briefmarkenkataloge blickte und die nicht vorhandene Wertsteigerung der Marken registrierte, kamen mir die ersten Zweifel hinsichtlich der finanziellen Intelligenz meiner Eltern. An dieser Stelle gilt es zwingend zu erwähnen, dass sie großartige Eltern waren. Die über Jahrzehnte angehäufte und chronologisch komplette Sammlung steht heute in meinem Büro. Ich habe es als Erwachsener zweimal gewagt, Briefmarkenhändler auf den Wert der Sammlung hin zu befragen. Ihre Antworten waren niederschmetternd und ihr Lächeln mitleidig.
Das zweite Anlagevehikel meines Vaters war das Sparbuch. Da mein Vater, kurz nachdem ich ausgezogen war, erkrankte und meine Mutter sich mit Finanzfragen nicht beschäftigen wollte, baten mich die beiden unter anderem, auch ihre finanziellen Angelegenheiten zu erledigen. So bekam ich weitere Einblicke in ihr Anlageverhalten.
Mein Vater hatte auf seinem Sparbuch einen Betrag angehäuft, der – wie er so manches Mal bemerkte – reichen sollte, um einmal die Beerdigung für seine Frau und sich selbst bezahlen zu können. Er war Berliner, aber trotz des für Berliner typischen derben Humors war, was den Betrag – und ich glaube auch seine ernsthaften Absichten – anging, an dieser Äußerung etwas Wahres dran.
Meine Eltern haben nie Schulden gemacht, und somit plante er quasi, diesen Planeten finanziell so zu verlassen, wie er ihn betreten hatte, nämlich mit null und ohne finanzielle Folgen für die Nachwelt. Die beiden legten ihr Erspartes immer bei derselben Bank als einjähriges Festgeld an, und dieses Festgeld wurde nun mal wieder fällig.
Während unseres Gesprächs zum Thema Sparbuch äußerte sich mein Vater enttäuscht darüber, dass die Zinsen für sein Erspartes wieder gesunken waren und er jedes Jahr weniger für seine (damals noch) DMark bekommt. Dieses würde ihn aber nicht davon abhalten, wieder das gleiche Prozedere bei derselben Bank durchzuführen. Ich fragte ihn, ob er es schon einmal bei einer anderen Bank versucht hätte. Er antwortete: „Nein, und die Bank will ich gar nicht wechseln.“
Da ich seine Routine nicht zu sehr durcheinanderbringen wollte, erklärte ich ihm, dass ein Wechsel der Bank gar nicht nötig sei, um mehr Zinsen zu bekommen. Skeptisch ließ er mich gewähren. Ich suchte vier Telefonnummern von weiteren Banken heraus. Dann fragte ich meinen Vater: „Wie viel Zinsen gibt dir deine Bank?“ Er sagte: „Sie bieten mir aktuell 6 %.“
Ich rief die erste Bank an und sagte: „Wir bekommen für diesen Betrag (der für 2 Beerdigungen reichen soll) bei unserer Bank 6 % für einjähriges Festgeld. Wie viel bekommen wir bei ihnen?“ Man bot mir mehr. Dann rief ich die nächste Bank an, nannte das nun höher liegende Zinsangebot aus dem ersten Telefongespräch und fragte, welche Zinsen man uns bieten könne. Nach vier Telefonaten lag das Zinsgebot bei 7,25 % und es kam kein höheres Gebot mehr. „Jetzt gehen wir zu deiner Bank“, sagte ich.
Ich erklärte dem Angestellten der Hausbank meiner Eltern, dass wir das Konto auflösen würden, da wir ein besseres Zinsangebot bei einer anderen Bank erhalten hätten. Er fragte: „Wie viel hat man ihnen geboten?“ „7,25 %“, antwortete ich. „So viel kann ich ihnen auch bei uns anbieten“, entgegnete er. Wir nahmen das Angebot an. Somit war das Ersparte wieder für ein Jahr bei der Hausbank meiner Eltern fest angelegt.
Trotz des kleinen Triumphes ging es bei dieser Aktion eigentlich nur darum, Schlimmeres zu verhindern. Denn Geld auf dem Sparbuch ist kein Vermögenswert. Geld ist nur ein auf Vertrauen basierendes Tauschmittel und produziert nichts. Die Zinsen, die ein Sparer auf dem Festgeldkonto bekommt, waren damals gerade nur so hoch, dass sie die Inflationsrate in etwa ausgeglichen haben. Das bedeutete, wer sparte, besaß am Ende des Sparvertrags in etwa so viel wie am Anfang, da die Dinge, die man sich für das Geld später kaufen konnte, inzwischen teurer geworden waren. Es handelte sich um eine Geldwertillusion. Die Summe des Geldes ist zwar gestiegen, jedoch kaufen kann man sich nicht mehr davon als vorher.
Heutzutage, in den 2020er Jahren, liegen die Sparzinsen teilweise unter der Inflationsrate. Das bedeutet: Wer Geld auf dem Sparbuch hat, macht nicht nur keinen Gewinn, er macht sogar Verlust.
Wenn Geld jedoch kein Vermögenswert ist, dann bedeutet dies auch, dass das reine Anhäufen von Geld nicht sinnvoll ist, denn Geld selbst kann nicht für mich arbeiten. Entscheidend ist vielmehr, was man mit dem Geld macht, also was man davon kauft.
Wenn man es für Konsumgüter ausgibt, zum Beispiel für ein schickeres Auto oder eine Urlaubsreise, dann ist das Geld einfach weg und es kann nichts Produktives mehr tun.
Wenn ich es jedoch in echte Vermögenswerte, die Kapitalfluss erzeugen, investiere, dann kann es arbeiten und mich der finanziellen Freiheit ein gutes Stück näher bringen. Wenn ich das Geld, das mir aus den Vermögenswerten in Form von Kapitalfluss zufließt, wiederum in weitere echte Vermögenswerte investiere, dann kann sogar ein sich selbst verstärkender Kreislauf entstehen, der zu immer mehr Kapitalfluss führt.
„Wo bleibt denn da der Spaß? Man muss doch auch mal konsumieren, damit man Spaß hat“, wird der ein oder andere anmerken.
Spaß sollte man – im Optimalfall – am Investieren selbst haben, da es einem so viel Freude bereitet. Außerdem kann man später, wenn die eigene Cashflow-Geldmaschine aus Vermögenswerten ans Laufen gekommen ist, immer noch konsumieren – dann jedoch ohne die Geldmaschine durch eine zu große Geldentnahme abzubremsen oder zu zerstören. Ich bin in jungen Jahren 10 Jahre lang nicht in Urlaub gefahren und habe bis heute noch nie ein Auto besessen. Ich ging davon aus, dass sich Belohnungsaufschub doppelt und dreifach auszahlt, und ich behielt recht.
Der Grenzvorfall – Steuern und Abgaben
Was die Abschaffung von innereuropäischen Grenzen angeht, waren wir 1985 im Alter von rund 18 Jahren gewissermaßen unserer Zeit voraus, als wir während eines Campingurlaubs, mit fünf Freunden, von Pamplona in Spanien kommend, an die spanisch-französische Grenze fuhren. In Pamplona waren wir zufällig und ohne vorherigen Plan in die Sanfermines, eine Festlichkeit mit Stierlauf und Stierkämpfen, hineingeraten.
Fast alle Teilnehmer der Festivität trugen rote Halstücher und Schärpen zu weißem Hemd und weißer Hose. Der Alkoholkonsum war beeindruckend, jedoch für uns karneval- und altstadterprobte Düsseldorfer kein Zauberwerk. Wir wollten noch in der gleichen Nacht nach Frankreich fahren, um uns mit einer Gruppe von Freunden in Mimizan an der südfranzösischen Atlantikküste zu treffen.
Auf der Straßenkarte hatte einer von uns schnell den kürzesten Weg ausgemacht und so fuhren wir mit einem VW-Käfer und einem VWBus Kolone in Richtung eines Bergpasses. Das Wetter wurde immer ungemütlicher. Regen, Blitz, Donner, die einbrechende Dämmerung und so mancher Blick in die Abgründe der Pyrenäen ließen die Fahrt an die Nerven gehen.
Schließlich hatten die beiden Volkswagen den Bergpass mit der Grenzstation erklommen. Zu unserer Enttäuschung standen an der Grenze jedoch zwei spanische Polizisten mit Maschinenpistolen, die uns erklärten, dass um diese späte Uhrzeit die Grenze hier bereits geschlossen sei. Mit den Herren war nicht zu verhandeln. Unsere Enttäuschung war groß, denn wir hatten einige Zeit und Nerven verloren, um hierhin zu gelangen.
Auf Englisch und Französisch erkundigten wir uns nach dem nahegelegensten Grenzübergang, der jetzt noch geöffnet hatte. Die Information, die wir bekamen, bedeutete für uns: Wieder ganz zurück, zur nächsten großen Bundesstraße und noch mal von Neuem ansetzen, um durch die Berge in ein kleines Dorf mit einer noch geöffneten Grenzstation zu gelangen.
Als wir in dem Bergdorf ankamen, war es stockfinster. Auf der spanischen Seite war der Schlagbaum heruntergelassen. Hinter dem Schlagbaum lag eine kleine Brücke, die über einen Grenzfluss führte. Auf der französischen Seite war der Schlagbaum oben. Weit und breit war niemand zu sehen, keine Zöllner, keine Bewohner – nichts. Während wir über unser weiteres Vorgehen beratschlagten, fiel einem von uns auf, dass der heruntergelassene spanische Schlagbaum in der Mitte ein Gewinde hatte und man ihn leicht auseinanderschrauben konnte. Wenn man das lose Ende durch die Halterung schob, konnte man den anderen Teil des Schlagbaums, an dem das Gewicht hing, nach oben klappen und durchfahren. Die Franzosen schienen uns sowieso willkommen zu heißen, denn ihre Grenze war ja geöffnet. Sicherheitshalber entschlossen wir uns, die Aktion nicht mit angelassenem Motor durchzuführen, denn wir wollten in dem verschlafenen Dörfchen niemanden stören.
Während wir zu dritt bereits einen der beiden Wagen auf französischem Gebiet hatten, waren zwei von uns noch damit beschäftigt, den zweiten Wagen hinüber zu bugsieren. Plötzlich kam aus einem der spanischen Häuser ein in Zivil gekleideter recht aufgebrachter Herr, bewaffnet mit einer Pistole, gerannt und hielt sie unserem Freund, der sich als einziger noch auf spanischem Gebiet befand, vor. Oben am Fenster seines Hauses, das wohl die Zollstation war, stand seine Frau. Nachdem er unseren Freund auf den Boden beordert hatte, rief er zu ihr etwas hoch, was auch für nicht Spanischsprechende so etwas wie „Ruf Verstärkung!“ bedeuten konnte.
Recht zügig kamen zwei Jeeps mit einigen Polizisten und machten deutlich, dass, wenn wir vier nicht wieder inklusive der Fahrzeuge nach Spanien zurückkommen würden, es unserem Freund nicht besonders gut ergehen würde. Diese Drohung überzeugte uns. So schoben wir die Fahrzeuge wieder zurück nach Spanien. Der Polizeioffizier erklärte uns schließlich, dass es für eine weitere Klärung des Vorfalles jetzt zu spät sei, wir ihm unsere Pässe aushändigen und morgen auf der Polizeiwache vorstellig werden sollten. Die Jeeps geleiteten uns noch zu einem Parkplatz, an dem wir im VW-Bus übernachten konnten. Das feuchtschwüle Pyrenäenklima und die fünf Mann in einem VW-Bus ließen die Nacht recht stickig werden.
Am nächsten Morgen taten wir wie uns geheißen und gingen zur nahe gelegenen Polizeiwache, die im Innenbereich noch den zweifelhaften Charme der Zeit der spanischen Diktatur unter Franco versprühte. Man empfing uns mit ernster Miene und doch lag etwas Augenzwinkern in der Luft. Neben dem Offizier stand ein junger Polizist mit Maschinenpistole, um der Situation den nötigen Nachdruck zu verleihen. Wegen der mutwilligen Zerstörung von spanischem Staatseigentum (damit war der Grenzbalken gemeint, der sich übrigens problemlos wieder zusammenschrauben ließ) wären wir angeklagt und müssten zur Behebung des Schadens insgesamt 400,– DM-Mark bezahlen, dann bekämen wir unsere Pässe zurück und könnten weiterfahren.
Dieser Betrag würde ein großes Loch in unsere Urlaubskasse reißen. Bezahlen könnten wir nur mit Travellerschecks. Natürlich willigten wir ein. Wir machten jedoch darauf aufmerksam, dass es Sonntag sei und keine Bank geöffnet habe, in der wir die Schecks in Bargeld umtauschen konnten. Das mit der Bank wäre kein Problem, sagte der Beamte, nahm den Telefonhörer und rief bei der im Dorf ansässigen Bank an. Einer meiner Freunde und ich gingen in Begleitung eines Polizisten zur Bank, die eher ein Wohnzimmer mit Schreibtisch war, und tauschten die Schecks gegen Bargeld ein. Wir übergaben den Polizisten das Geld und bekamen als Gegenleistung unsere Reisepässe zurück. Anschließend fuhren wir zur gleichen Grenze, an der man uns nachts festgenommen hatte, um nach Frankreich einzureisen. Dieses Mal winkten uns die Spanier freundlich durch. Allerdings erwarteten uns einige interessiert dreinschauende französische Grenzbeamte und orderten uns auf ihren Parkplatz zur Fahrzeugkontrolle. Die Kontrolle selber dauerte nur eine Sekunde, da der französische Zöllner die noch von unserer Übernachtung im VW-Bus angesammelte Luft nicht länger ertragen konnte.
Wir wären doch die Truppe, die am Vorabend den Grenzbalken auseinandergebaut hätte, sagte er zu uns. „Wie viel haben euch die Spanier dafür abgenommen?“, fragte er mit zugekniffenen Augen. Wir nannten ihm den Betrag und er ließ uns mit einer saloppen Handbewegung weiterfahren. In welcher Kasse die von uns geleistete und nicht quittierte Abgabe am Ende landete, wissen wohl nur das Dorf und seine Bewohner.
Aber wer zahlt eigentlich Steuern und Abgaben? Die häufigste Antwort auf diese Frage lautet: „Alle.“





























