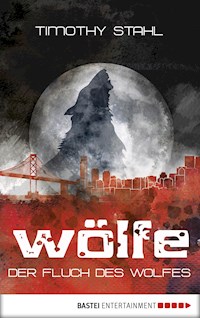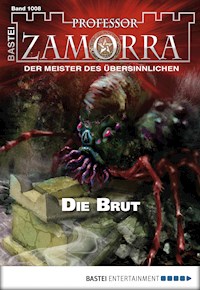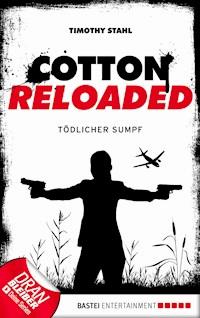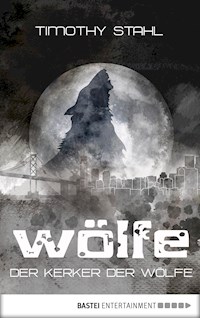Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Dieser Band enthält folgende Western: (399XE) Marshal Logan und die Hassvollen (Pete Hackett) Marshal Logan - von allen gehetzt (Pete Hackett) In Devil Town ist der Teufel los (Timothy Stahl) Am Himmel im Westen ballten sich schwarze, drohende Wolkenberge. Die Wolken falteten sich zu formlosen, tiefdunklen Gebilden zusammen und wurden von einem ungeheuren Sturm herangetrieben. Blitze zuckten vom Himmel. Fernes Donnergrollen kündete ein schweres Gewitter an. Die Herde stand in einem Talkessel. Es waren wohl an die tausend Rinder. Muhen, Brüllen und das Blöken von Kälbern erfüllte die Senke. Sie war begrenzt von Hügeln, auf deren Flanken hüfthohe Büsche wuchsen und aus deren Kuppen ruinenartige Felsgebilde ragten. Der Cowboy Stan Billings ritt rechts um die Herde herum. Es ging auf den Abend zu. Die Sonne war hinter den Wolkenbergen im Westen verschwunden. Düsternis hüllte das Land ein. Ein Reiter kam Stan Billings entgegen. Steigbügel an Steigbügel verhielten die beiden Cowboys. »Der Sturm wird in einer Viertelstunde hier sein«, sagte Stan Billings. »Es wird wahrscheinlich die Hölle. Hoffentlich spielen die gehörnten Teufel nicht verrückt.«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pete Hackett, Timothy Stahl
Inhaltsverzeichnis
Western Dreierband 3024 - Auswahlband der besten Romane
Copyright
Marshal Logan und die Hassvollen
Marshal Logan von allen gehetzt
In Devil Town ist die Hölle los!
Western Dreierband 3024 - Auswahlband der besten Romane
Pete Hackett, Timothy Stahl
Dieser Band enthält folgende Western:
Marshal Logan und die Hassvollen (Pete Hackett)
Marshal Logan - von allen gehetzt (Pete Hackett)
In Devil Town ist der Teufel los (Timothy Stahl)
Am Himmel im Westen ballten sich schwarze, drohende Wolkenberge. Die Wolken falteten sich zu formlosen, tiefdunklen Gebilden zusammen und wurden von einem ungeheuren Sturm herangetrieben. Blitze zuckten vom Himmel. Fernes Donnergrollen kündete ein schweres Gewitter an.
Die Herde stand in einem Talkessel. Es waren wohl an die tausend Rinder. Muhen, Brüllen und das Blöken von Kälbern erfüllte die Senke. Sie war begrenzt von Hügeln, auf deren Flanken hüfthohe Büsche wuchsen und aus deren Kuppen ruinenartige Felsgebilde ragten.
Der Cowboy Stan Billings ritt rechts um die Herde herum. Es ging auf den Abend zu. Die Sonne war hinter den Wolkenbergen im Westen verschwunden. Düsternis hüllte das Land ein. Ein Reiter kam Stan Billings entgegen. Steigbügel an Steigbügel verhielten die beiden Cowboys. »Der Sturm wird in einer Viertelstunde hier sein«, sagte Stan Billings. »Es wird wahrscheinlich die Hölle. Hoffentlich spielen die gehörnten Teufel nicht verrückt.«
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author / COVER EDWARD MARTIN
© dieser Ausgabe 2022 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Marshal Logan und die Hassvollen
Western von Pete Hackett
U.S. Marshal Bill Logan – die neue Western-Romanserie von Bestseller-Autor Pete Hackett! Abgeschlossene Romane aus einer erbarmungslosen Zeit über einen einsamen Kämpfer für das Recht.
Ein CassiopeiaPress E-Book
© by Author
© der Digitalausgabe 2014 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
www.AlfredBekker.de
Als ich von einer Anhöhe aus, über die die zerfurchte und aufgewühlte Poststraße führte, auf Hereford, die kleine Stadt am Tierra Blanca Creek, hinunterblickte, ahnte ich noch nicht, dass der Ort zwei Tage vorher von einem schrecklichen Verbrechen heimgesucht worden war.
Ich sah zwar auf dem Friedhof außerhalb der Stadt eine große Trauergemeinde um ein offenes Grab herumstehen, doch noch ging ich von einem natürlichen Tod des oder der Verblichenen in dem Sarg aus.
Sehr schnell sollte ich eines Besseren belehrt werden. Arglos trieb ich das Pferd unter mir an, es setzte sich prustend in Bewegung, die Hufe pochten und rissen kleine Staubfontänen in die warme Mittagsluft. Die Poststraße führte den sachten Abhang hinunter und verbreiterte sich bei den ersten Häusern Herefords zur Main Street.
Sämtliche Einwohner der Stadt schienen sich auf dem Friedhof zu befinden, denn die Ortschaft mutete an wie ausgestorben. Abgesehen von einem Hund, der neben einem Wohnhaus im Schatten lag und schlief, schien alles Leben in ihr erloschen zu sein.
Ich ritt zum Mietstall. Das Tor war verschlossen. Das Pferd am Kopfgeschirr führend stapfte ich auf sattelsteifen Beinen zum Saloon, aber auch er war nicht geöffnet. Ich band meinen Vierbeiner am Holm vor dem Saloon fest, setzte mich auf die Vorbaukante und drehte mir eine Zigarette.
Meine Geduld wurde auf eine ziemlich harte Probe gestellt. Es dauerte über eine halbe Stunde, bis die Bewohner der Stadt zu ihren Wohnungen strömten. Sie waren allesamt feierlich gekleidet; wie es sich eben gehörte bei einem Begräbnis. Der Leichenwagen fuhr an mir vorbei. Er wurde von einem dem Anlass angemessen geschmückten Pferd gezogen. Die Ladefläche war leer.
Ein Mann, es war der Salooner – ich kannte ihn von früheren Besuchen in Hereford -, näherte sich. Ihm folgten einige Männer, die sich nach der Zeremonie auf dem Friedhof wohl ein Bier oder einen Whisky gönnen wollten.
„Ah, Marshal“, begrüßte mich der Salooner. „Dass Sie in Hereford auftauchen scheint mir eine Fügung des Schicksals zu sein. In dieser Stunde haben wir Cleveland Peyton zu Grabe getragen. Er kam vorgestern ums Leben, als eine skrupellose Bande die Poststation überfiel, weil sie wahrscheinlich Geld im Tresor vermutete.“
Ich verspürte Betroffenheit, da war aber auch ein hohes Maß an Fassungslosigkeit. Mir war der Postofficer gut bekannt gewesen. Ein umgänglicher Bursche Ende der fünfzig, der bald in den Ruhestand gehen wollte, um seinen Platz für einen jüngeren Mann zu räumen. Es dauerte geraume Zeit, bis ich die Hiobsbotschaft verarbeitet hatte. „Weiß man, wer die Station überfiel?“ Meine Stimme klang rau und belegt. Ich räusperte mich, doch ich bekam den Hals nicht frei.
„Es waren vier Maskierte. Einer von ihnen dürfte älter gewesen sein, denn seine Haare waren grau. Ein fünfter Bandit wartete außerhalb der Stadt auf das Quartett. Das Aufgebot, das den Banditen folgte, zählte nämlich fünf Reiter, ehe die Bande in der Felswüste auf Nimmerwiedersehen verschwand.“
„Haben die Banditen Geld erbeutet?“, wollte ich wissen.
„Im Tresor der Station befanden sich keine hundert Dollar. Gary Peyton hat geschworen, den Mord an seinem Vater blutig zu rächen. Er ist, als das Aufgebot umgekehrt ist, alleine weiter geritten.“
Während mir der Salooner Rede und Antwort stand, schloss er den Schankraum auf und wir gingen hinein. Nach und nach erschienen weitere Gäste. Klar, dass die Männer erwarteten, dass ich der Bande folgte und sie der gerechten Bestrafung zuführte. Schließlich trug ich den Stern eines Bundesmarshals, und in Hereford gab es keinen Sheriff oder Stadtmarshal. Ich erfuhr, dass die Bande nach Westen geflohen war. Etwa fünfunddreißig Meilen weiter westlich war die Grenze zu New Mexiko. Das Gebiet zu beiden Seiten der Grenze hatte wüstenähnlichen Charakter; über zig Meilen hinweg gab es nur Felsen, unwegsame Schluchten, Sand- und Geröllhänge, Arroyos und Staub – verdammt viel Staub.
Man verschwieg mir nicht, dass Gary Peyton, der Sohn des Ermordeten, entgegen aller Mahnungen und Warnungen weiter geritten war, ohne für einen Ritt durch die Einöde ausgerüstet zu sein. Aber er war dermaßen voll Hass auf die Banditen, dass er Argumenten, die seiner Absicht widersprachen, nicht zugänglich war.
Ich kannte Gary Peyton. Er war etwas über dreißig Jahre alt und sollte die Nachfolge seines Vaters im Depot der Wells Fargo hier in Hereford antreten. Gary Peyton war alles andere als ein erfahrener Kämpfer, schon gar nicht würde er es mit einer Bande aufnehmen können, die aus fünf tödlich gefährlichen Zeitgenossen bestand. Sorge um den Burschen nistete sich in mir fest. Ich beschloss, keine Zeit zu verlieren und nach dem Mittagessen loszureiten. Während ich mich im Saloon befand, sollte im Mietstall mein Pferd versorgt werden. Ich bat den Salooner, dies zu veranlassen.
*
Eine Stunde später ritt ich am Tierra Blanca Creek nach Westen. Es war Juli und die Sonne schien heiß, die Hitze drückte Mensch und Tier den Schweiß aus den Poren und die Luft schien zu kochen. Da es schon lange nicht mehr geregnet hatte, führte der Creek nur wenig Wasser. Der Ufersaum bestand aus getrocknetem Schlamm, aus dem hier und dort skelettartiges, rindenloses Astwerk ragte, das irgendwann angespült worden war. Zwischen dem Geröll auf dem Flussgrund schossen blitzschnell und schattenhaft Forellen hin und her.
Zu beiden Seiten des Creeks erhoben sich Hügel und Felsen. Während am Fluss noch Büsche und Gras wuchsen, gediehen wenige Schritte von den beiden Ufern entfernt nur noch ungenießbares Büschelgras, dorniges Gestrüpp und niedrige Kakteen.
Das Land war menschenfeindlich, und nur Klapperschlangen, Präriehunde und Eidechsen trieben hier ihr Unwesen.
Manchmal sah ich einen Haufen Pferdedung, ab und zu verriet mir auch ein abgeknickter Zweig, dass am Ufergebüsch entlang Reiter gezogen waren. An einer Stelle gab es auf dem Ufersaum eine Anhäufung von Hufabdrücken, die den Schluss zuließen, dass hier mehrere Pferde getränkt worden waren.
Ich ließ mein Pferd im Schritt gehen. Die Sonne stand im Südwesten und ich hatte mir den Stetson tief in die Stirn gezogen, um von dem grellen Licht nicht geblendet zu werden. Um mich herum war nichts als Trostlosigkeit.
Schließlich neigte sich der Tag seinem Ende zu. Die Sonne stand wie ein Fanal über den bizarren Felsgiganten im Westen und die Ränder einiger Wolken, die sich vor sie geschoben hatten, schienen zu glühen. Die Schatten waren lang. Vor mir öffnete sich eine Schlucht, in die der Creek vor hunderttausenden, vielleicht sogar Millionen von Jahren sein Bett gegraben hatte. Die Felswände waren steil und zerklüftet, manchmal reichte der Fluss bis an sie heran.
Da das Wasser des Creeks meinem Pferd gerade bis zu den Sprunggelenken reichte, ritt ich in die Spalte hinein. Kühle Luft strömte mir entgegen, denn zwischen den Felsen war es schattig und selbst tagsüber erreichte kein Sonnenstrahl den Grund der Schlucht. Stellenweise verlief ein natürlicher Pfad am Ufer, den ich auch benutzte, denn der Flussgrund war voller Geröll und das Pferd konnte sich leicht ein Bein vertreten oder sogar brechen.
Lästige Mücken schwirrten um meinen Kopf und setzten dem Pferd zu. Als ich um einen Knick der Schlucht ritt, sah ich am Flussufer ein braunes Pferd stehen, und ich parierte unwillkürlich meinen Vierbeiner. Da sah ich auch den Mann, der am Ufersaum am Boden lag und sich nicht rührte. Das Pferd hob den Kopf und witterte mit geblähten Nüstern zu mir her.
Ich zog die Winchester aus dem Scabbard, repetierte und sicherte nach vorn sowie nach oben, tastete mit meinem Blick die Felswände ab, und als sich nirgendwo irgendeine Gefahr abzeichnete, trieb ich mein Pferd mit einem Schenkeldruck an.
Bei der reglosen Gestalt ließ ich mich aus dem Sattel gleiten, nachdem ich das Gewehr wieder im Sattelschuh versenkt hatte.
Der Mann lag auf dem Bauch. Ich drehte ihn auf den Rücken und registrierte, dass es Gary Peyton war, dessen Vater die Banditen vor zwei Tagen brutal ermordet hatten und der den unseligen Trail der Rache eingeschlagen hatte. Seine Weste und sein Hemd waren über der rechten Schulter mit Blut getränkt, das jedoch schon eingetrocknet war, und mir entging nicht das kleine Kugelloch in der Weste.
Peyton lebte, aber er war dem Tod näher als dem Leben. Er schien viel Blut verloren zu haben und war sicherlich vor Schwäche hier aus dem Sattel gekippt. Ich flößte ihm Wasser zwischen die pulvertrockenen, rissigen Lippen, es rann über sein Kinn und seinen Hals, aber irgendwann begann er mechanisch zu schlucken, seine Lider fingen an zu zucken, zu flattern, dann öffnete er die Augen und schaute mich mit dem etwas törichten Ausdruck des Nichtbegreifens an.
„Hi, Gary“, sagte ich und zog die Hand mit der Wasserflasche zurück. „Es hat dich ziemlich übel erwischt.“
Der Blick des Verwundeten klärte sich, bei ihm schien sich die Erinnerung einzustellen, ein Krächzen kämpfte sich in seiner Brust hoch, brach aus seiner Kehle und dann entrang es sich ihm: „Diese Bastarde haben meinen Dad ermordet. Ich habe sie heute Früh eingeholt, aber ich habe einen Fehler gemacht. Sie – sie knallten mir eine Kugel in die Schulter und verschwanden. Bei ihnen ist eine Frau – eine junge Frau. Ich machte mich auf den Rückweg. Aber – aber …“
Gary Peytons Stimme war zuletzt nur noch ein heiseres, abgehacktes Geflüster gewesen, jetzt verlor er die Kraft, und nur noch unverständliches Gemurmel drang aus seinem Mund. Er war zu schwach, um die Augen offen zu halten. Sein Atem ging rasselnd, die Muskeln in seinem Gesicht zuckten.
Ich musste ihn nach Hereford schaffen. Das vergrößerte den Vorsprung der Bande um viele Stunden, aber Gary Peyton benötigte Hilfe und ich konnte sie ihm nicht verweigern. Er befand sich auf der Schwelle zur Bewusstlosigkeit, und wenn er nicht sehr schnell ärztliche Hilfe bekam, würde er sterben. Ich verband ihn notdürftig, dann setzte ich ihn auf sein Pferd und band ihn fest, denn aus eigener Kraft konnte er sich sicherlich nicht mehr im Sattel halten. Um eine Schleppbahre anzufertigen fehlte es hier an geeignetem Strauchwerk, aus denen ich die erforderlichen Stangen schneiden hätte können. Der Ritt würde nicht einfach werden für Gary Peyton.
Wir machten uns auf den Weg nach Hereford. Der Verwundete bestimmte das Tempo. Sein Kinn war auf die Brust gesunken und er hatte die Augen geschlossen. Wahrscheinlich befand er sich im Dämmerzustand der Trance. Die Schatten verblassten, der Himmel färbte sich bleigrau, die Dämmerung schlich ins Land und schließlich kam die Nacht. Am Firmament blinkten die Sterne, sie lichteten die Dunkelheit kaum nennenswert, der Mond würde sich erst später über die Berge im Osten schieben.
Als ich Hereford erreichte, waren in der Stadt schon die meisten Lichter erloschen. Die Menschen hatten sich zur Ruhe begeben. Der Saloon hatte jedoch noch geöffnet. Ich ritt zum Holm, saß ab, band mein Pferd an und betrat gleich darauf den Schankraum. Nur noch fünf Männer bevölkerten ihn. Sie starrten mich an, von ihnen ging eine stumme Erwartung aus, einer ergriff das Wort, indem er rief: „Oha, Marshal, schon zurück. Haben Sie aufgegeben? Oder was ist sonst der Grund, der Sie umkehren ließ?“
„Ich bringe Gary Peyton“, antwortete ich. „Er hat die Bande eingeholt, und einer der Kerle hat ihm eine Kugel in die Schulter geknallt. Der Blutverlust ließ ihn vom Pferd kippen. Er braucht einen Arzt, der ihm die Kugel herausholt.“
„Ich sage Doc Brennan Bescheid!“, rief ein Mann und eilte aus dem Saloon. Ich bat die anderen, mir zu helfen, den Verwundeten in den Schankraum zu tragen. Gary Peyton röchelte und stöhnte. Ich bat einen der Männer, die Deckenrolle von seinem Sattel zu nehmen, die ich unter Peytons Kopf schob, nachdem die Männer ihn auf den Boden gelegt hatten.
Der Salooner brachte mir ein Glas Whisky und ich trank es. Obwohl es hochprozentiger Alkohol war, hatte ich das Gefühl, davon belebt zu werden.
Der Arzt kam und holte Peyton am Saloonboden die Kugel aus der Schulter. Dann veranlasste er, dass der Verwundete nach oben in eines der Zimmer getragen und ins Bett gelegt wurde. Dem Salooner trug er auf, Peyton mindestens dreimal am Tag mit einer kräftigenden Fleischbrühe zu füttern.
Während wir auf den Arzt warteten, hatte ich den Männern im Saloon erzählt, was ich von Gary Peyton erfahren hatte.
Der Salooner sagte: „Dann war es wohl die junge Frau, die außerhalb der Stadt auf die Bande wartete, als sie das Wells Fargo Depot überfiel. Was mag eine junge Frau veranlassen, mit einer Bande von Räubern und Mördern zu reiten?“
Das herauszufinden schwor ich mir. Ich verspürte eine fast schmerzliche Ungeduld in mir, denn die Zeit brannte mir unter den Nägeln. Mit jeder Stunde, die verstrich und in der ich nicht ritt, vergrößerte sich möglicherweise der Vorsprung der Bande. Aber sowohl ich als auch mein Pferd benötigten etwas Ruhe. Und so musste ich mich bis zum folgenden Morgen gedulden, mochte es mir noch so schwer fallen.
Mit dem ersten Hahnenschrei jedoch ritt ich los. Die Morgendämmerung vermischte sich mit dem Dunst, der über dem Land lagerte, aber die Helligkeit nahm schnell zu, die Sonne ging auf, und schließlich war ein glasklarer Tag angebrochen. Ich ritt in Intervallen, um auf diese Art und Weise schnell voranzukommen und mein Pferd nicht zu sehr zu verausgaben. Strecken des gemäßigten Galopps folgten Strecken, in denen ich das Tier im Schritt gehen ließ, sodass es sich immer wieder sehr schnell erholte und neue Energie aufladen konnte.
Ich erreichte den Platz, an dem ich Gary Peyton fand und ritt, ohne anzuhalten, daran vorüber. Die Schlucht endete und vor mir lag eine Ebene, die im Westen von einer Bergkette begrenzt wurde. Dahinter, in rauchiger Ferne zeichneten sich bläulich-grau die Umrisse eines Gebirgszuges ab, der schon auf dem Gebiet New Mexikos lag.
Auf der Ebene wuchsen dicht an dicht Kreosotbüsche. Ich ließ meinen Blick schweifen. Wenn die Banditen diese Ebene überquert hatten, mussten sie in dem bis zu drei Yards hohen Gestrüpp Spuren hinterlassen haben. Ich ritt hin und her und fand tatsächlich Hinweise, die mir verrieten, wo die Bande in die Ebene gezogen war. Hauptsächlich waren es abgeknickte Zweige, aber auch grüne Blätter, die am Boden lagen und die auf keinen Fall von selbst abgefallen waren.
Ich folgte der Spur. Sie endete in Bellview, einem kleinen Ort nördlich der Quelle des Tierra Blanca Creeks, ungefähr eine Meile jenseits der Grenze von New Mexiko. Hier hatte mein Stern keine Geltung. Dennoch nahm ich ihn nicht ab.
Es ging auf Mitternacht zu, als ich das Kaff erreichte. Nirgendwo brannte Licht. Die Nutztiere der Bewohner, die in Corrals, Pferchen und auf Koppeln außerhalb der Stadt ihr Dasein fristeten, schliefen. Das Zirpen der Grillen und das Pochen der Hufe meines Pferdes sowie hin und wieder das leise Klirren der Gebisskette waren die einzigen Geräusche, die mich umgaben.
Ich ritt zum Mietstall, das Hoftor war nur angelehnt und ich führte mein Pferd am Kopfgeschirr hindurch. Das Stalltor war allerdings abgeschlossen. Ich wusch mir am Tränketrog Staub und Schweiß aus dem Gesicht und fragte mich dabei unablässig, ob sich die Bande noch in der Stadt befand oder ob sie längst weiter geritten war.
Ich saß auf dem Rand des Tränketroges und hatte mir eine Zigarette gedreht, die ich nun genüsslich rauchte. Der Mond hing rund und prall südöstlich der Stadt am Himmel und versilberte mit seinem Licht die Dächer der Häuser. Die dunklen Flecke auf dem Erdtrabanten erinnerten an ein Gesicht, und ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass es ein höhnisches Grinsen zeigte.
Sicher, die Chance, die Bande einzuholen und zu stellen war keine große, aber an Aufgabe dachte ich nicht einen Augenblick. Im Gegenteil! Ich würde sämtliche Hebel in Bewegung setzen, um diese skrupellosen Mörder zur Rechenschaft zu ziehen.
In dem Haus, das in einem rechten Winkel zum Mietstall errichtet war, begann plötzlich ein Hund zu kläffen. Hatte er bemerkt, dass sich jemand im Hof befand, der zu nachtschlafender Zeit hier eigentlich nichts zu suchen hatte? Das Tier bellte wie von Sinnen und mein Pferd, das ich an einem der Eisenringe, die am Tränketrog festgeschraubt waren, angebunden hatte, begann nervös zu werden. Es tänzelte auf der Stelle, schnaubte und prustete und dann wieherte es hell. Das Bellen nahm an Lautstärke und Aggressivität zu. Und dann hörte ich eine schlaftrunkene Stimme rufen: „Ist da jemand?“
„Ja“, antwortete ich. „Es tut mir leid, wenn ich Sie aufgeweckt habe. Auf der Suche nach einem Platz für die Nacht für mich und mein Pferd habe ich den Stall angeritten. Allerdings hatte ich Pech.“
„Verdammt, sei still, Buster!“ Der Hund verstummte augenblicklich und ich vernahm nur noch ein leises Winseln. Der Mann erhob wieder die Stimme und rief: „Der Stall schließt am Abend um sieben Uhr. Morgens um sechs Uhr schließe ich ihn wieder auf.“
„Ich sagte es schon: Es tut mir leid …“
„Sie tun mir auch leid. Warten Sie einen Moment, Sir, ich komme hinaus und schließe ihnen den Stall auf. Ihr Pferd müssen Sie allerdings selber versorgen. Und einen Platz zum Schlafen werden Sie im Heu auch ohne mich finden.“
„Das nehme ich stark an. Vielen Dank.“
*
Der Stallbesitzer trug eine Laterne mich sich. Licht- und Schattenreflexe huschten über den Hof, als er zum Stalltor ging. Er war mit einem weißen Nachthemd bekleidet, das ihm bis zu den Knöcheln reichte. Ich zerrte mein Pferd vom Tränketrog weg. Knarrend und quietschend schwang das Tor auf, der Lichtschein huschte ins Stallinnere, ich führte das Pferd an dem Stallmann vorbei und der Geruch von Pferdeausdünstung, Heu und Stroh schlug mir entgegen.
Jetzt erst schien der Stallmann den Stern an meiner Brust wahrzunehmen, denn ihm entrang sich ein überraschter Laut und er stieß hervor: „Sie sind U.S. Marshal aus Texas? An Ihnen und Ihrem Pferd haftet der Staub der Felswüste. Sie reiten doch sicher nicht zum Spaß durch die Ödnis.“
„Ich verfolgte eine Bande, die in Hereford die Station der Wells Fargo überfallen und den Stationer ermordet hat. Es sind fünf Reiter, bei einem von ihnen handelt es sich um eine junge Frau. Die Spur führt in diesen Ort.“
„Die waren da“, kam es spontan von dem Stallmann. „Sie haben sogar eine Nacht hier im Hotel übernachtet. Ihre Pferde waren bei mir untergestellt. Die junge Frau heißt Tessa. Himmel, ich dachte mir doch gleich, dass mit diesen Leuten etwas nicht stimmt. Irgendwie wirkten sie auf mich gehetzt, rastlos. Anführer des Rudels scheint ein etwa fünfzigjähriger Bursche zu sein, den die anderen mit dem Namen Sam anredeten. Von den anderen drei Kerlen war noch keiner dreißig. Keine gerade erfreulichen Erscheinungen. Sie waren unrasiert, verstaubt und verschwitzt und ihre Pferde waren ziemlich verausgabt.“
„Nannten sie ein Ziel?“, fragte ich.
„Nein. Aber sie ritten nach Nordwesten. Dort oben liegt – etwa fünfundvierzig Meilen entfernt – Tucumcari. Von Tucumcari aus führt die Poststraße nach Westen, und zwar bis nach Albuquerque und hinauf nach Santa Fe.“
Der Stallmann verließ den Stall, um sich wieder ins sein Bett zu legen, er überließ mir aber die Laterne und ich konnte in ihrem Lichtschein mein Pferd versorgen und in einer Box abstellen. Mit dem Gewehr und der Lampe in der Hand und meiner Deckenrolle unter der Achsel stieg ich die Leiter hinauf zum Heuboden und richtete mir dort ein Lager.
Ich schlief tief und fest und wurde erst von den Geräuschen geweckt, die der Stallmann am Morgen im Stall produzierte. Draußen war es hell, denn durch die Ritzen zwischen den Brettern der Stallwand fielen schräge Streifen grellen Sonnenlichts und es waren auch Geräusche zu vernehmen, die außerhalb des Stalles entstanden.
Ich erhob mich, klopfte mir Reste vom Heu aus der Kleidung, packte mein Zeug zusammen und stieg in den Stall hinunter. „Guten Morgen“, begrüßte mich der Stallmann und grinste verkniffen. „Gut geschlafen?“
„Wie ein Murmeltier“, antwortete ich und erkundigte mich dann, ob ich irgendwo in dem Ort ein Frühstück bekommen könne. Er schickte mich zum Hotel, was meinen Absichten ausgesprochen entgegen kam, denn dort wollte ich mich sowieso nach den Banditen erkundigen, nachdem ich vom Stallmann erfahren hatte, dass sie eine Nacht im Hotel verbracht hatten.
Ich erhielt ein ausreichendes Frühstück und erfuhr einige Dinge, die mir sehr wertvoll erschienen. Der etwa Fünfzigjährige, den der Stallbursche für den Anführer des Rudels hielt, hatte sich unter dem Namen Sam Burchell ins Gästebuch eingetragen. Tessa, die junge Lady, die mit der Bande ritt, war seine Tochter, denn der Owner des Hotels hörte einige Male, wie sie ihn mit ‚Dad’ anredete. Die Namen der anderen drei Bandenmitglieder lauteten Elmer Stevens, James Shelton und Horace Brooks.
Natürlich konnten das angenommene Namen sein. Aber fürs Erste musste ich mich mit dem zufrieden geben, was ich in Erfahrung gebracht hatte. Nach dem Frühstück verließ ich die Stadt und ritt nach Nordwesten, in die Richtung also, in die auch die Bande gezogen war. Die Landschaft, die sich mir bot, war abwechslungsreich. Es gab einige Creeks, die nach Norden flossen, wo sie in den Canadian River mündeten, und in den Flusstälern gediehen Gras, üppiges Strauchwerk und Bäume. Dazwischen aber war die Vegetation karg, der Boden war sandig oder steinig. Felsen und Hügel, deren Hänge mit Geröll übersät waren und auf denen nur dorniges Strauchwerk wuchs, stellten sich mir als Hindernis in den Weg und ich musste, wenn ich nicht den halsbrecherischen Weg über sie nehmen wollte, große Umwege reiten.
Vierundzwanzig Stunden später kam ich in Tucumcari an. Es handelte sich um eine bedeutungslose Stadt an der Poststraße. Im Endeffekt waren es nur ein paar Häuser, die um die Relaisstation der Wells Fargo Postkutschenlinie errichtet worden waren.
Alles wirkte grau in grau, ärmlich, heruntergekommen, um nicht zu sagen verwahrlost. An den Gehsteigen und unter den Vorbauten hatten sich Tumbleweeds verfangen. Ein lauer Wind trieb kleine Staubwirbel über die Straße.
Ich ritt zur Pferdewechselstation. Einen Mietstall, einen Saloon, ein Hotel, eine Kirche – Dinge, die eine Stadt ausmachten -, gab es hier nicht. Ich fragte mich, wovon die Menschen hier lebten und wo sie einkauften. Ich konnte nämlich auch keinen Store entdecken. Dass sämtliche Bewohner bei Wells Fargo beschäftigt waren konnte ich mir nicht vorstellen.
Als ich vor dem Depot der Postkutschengesellschaft anhielt, traten aus verschiedenen Häusern Männer mit Gewehren in den Fäusten. Sie zielten auf mich und ihre finsteren, stechenden Blicke verhießen Unheil. Sahen die denn mein Abzeichen nicht? Zugleich mit dieser Frage schoss mir die Erkenntnis durch den Kopf, dass diese Leute wohl einen guten Grund hatten, derart misstrauisch und vorsichtig zu sein. Ich beeilte mich zu rufen: „Nur ruhig, Leute! Ich bin U.S. Deputy Marshal Bill Logan aus Amarillo.“
Die Männer näherten sich mir. Es waren ein halbes Dutzend, und ihr düsteres Schweigen vermittelte eine tödliche Bedrohung. Einer rief grollend: „Was treibt einen Marshal aus Texas in diesen Winkel New Mexikos? Vielleicht hast du dir das Abzeichen nur angesteckt, um harmlosen Leuten etwas vorzugaukeln. Vielleicht gehörst du sogar zu den vier Bastarden, die gestern hier für Furore sorgten. Kann man es wissen? Du kommst aus der Wildnis, genauso wie sie, und sieht ebenso heruntergekommen aus wie sie.“
Ich legte meine Hände übereinander auf den Sattelknauf. „Ich besitze auch einen Ausweis des ‚District Court for the Northern District of Texas’“, erklärte ich. „Und ich reite auf der Fährte der Bande, die – ich schätze mal – das Depot hier überfallen hat.“
Einer der Männer trat neben mein Pferd, während mich die anderen in Schach hielten. Hinter verstaubten Fensterscheiben sah ich die hellen Flecke von Gesichtern. „Zeig mir den Ausweis“, forderte der Bursche und streckte mir die Hand entgegen. Ich holte meine Legitimation aus der Innentasche meiner Weste, gab sie dem Mann, der schaute sich das Dokument mit Argusaugen an, nickte und meinte: „Das scheint in Ordnung zu sein. – Sie haben recht. Es ging alles so verdammt schnell. Diese dreckigen Banditen haben Cash Wheeler fast den Schädel eingeschlagen. Sie erbeuteten etwas über hundertfünfzig Dollar. Aber einem der Hurensöhne haben wir eine Kugel verpasst, als sie aus der Stadt flohen. Ich hoffe, dass er daran zugrunde geht.“
„Cash Wheeler ist der Stationer, wie?“, erkundigte ich mich.
„Ja.“
„Ist er ansprechbar?“
„Gehen Sie nur hinein. Neben dem Stationsoffice ist eine Tür, die in seine Schlafkammer führt. Dort finden sie ihn.“
Ich ließ mich vom Pferd gleiten, schlang den Zügel um den Haltebalken und stakste in die Station, wo ich auf Anhieb die Schlafkammer des Stationers fand. Er lag mit geschlossenen Augen im Bett, um seinen Kopf wand sich ein dicker, weißer Verband.
„Mister Wheeler!“
Seine Augen öffneten sich, blickten mich an, erforschten mich einen Moment, und dann sagte der bärtige Bursche, den ich auf Mitte dreißig schätzte. „Sie tragen einen Stern. Kommen Sie wegen der Sache von gestern?“
„Nicht direkt. Aber ich bin hinter den Banditen her, denn sie haben in Hereford, Texas, ebenfalls das Office der Wells Fargo überfallen und den Stationer ermordet. Ich nehme an, die Kerle traten auch bei Ihnen maskiert auf.“
„Ja. Sie hatten sich die Halstücher über den Mund und die Nase gezogen. Einem von ihnen schaute ich in die Augen. Es waren die Augen eines Reptils, eiskalt und voll Hass. Er zielte auf mich. Es war mein letzter Eindruck, ehe mich ein Gewehr am Kopf traf. Wenn ich an seinen Blick denke, läuft es mir jetzt noch eiskalt über den Rücken.“
„Ist Ihnen sonst etwas an den Kerlen aufgefallen? Irgendetwas Besonderes, an dem der eine oder andere von ihnen wieder erkannt werden kann.“
„Nein, Marshal. Ich – ich erinnere mich nur an diese Augen. Es war, als hätte mich der Tod persönlich angestarrt.“
Damit konnte ich nichts anfangen. Ich registrierte jedoch, dass der Vorsprung der Bande ziemlich geschrumpft war. Überdies war nun einer von ihnen verwundet, was sie sicherlich handicapte.
Ich wünschte dem Mann, dass er bald gesund wurde, dann ging ich wieder hinaus und stellte fest, dass die sechs Bewaffneten vor der Station auf mich warteten. „Wie heißt die nächste Stadt?“, fragte ich, „und wie weit ist sie entfernt?“
„Das kommt darauf an“, erwiderte einer der Kerle. „Wenn sie nach Westen reiten, gelangen sie nach fünfunddreißig Meilen nach Newkirk. Östlich heißt die nächste Stadt Bard, sie ist ungefähr dreißig Meilen entfernt. Aber die Banditen sind nach Norden geflohen. Da ist allerdings bis zum Canadian nur Wildnis.“
Ich band mein Pferd los und stieg auf.
Es war nicht schwer, die Spur von vier Pferden aufzunehmen, die wie von Furien gepeitscht aus dem Ort galoppiert waren. Sie führte tatsächlich nach Norden.
Während ich ritt, fragte ich mich, ob es Zufall war, dass die Bande nur Büros der Wells Fargo überfiel. Eine Antwort erhielt ich allerdings nicht. Es war jedoch nur eine bedeutungslose Frage, die in einer ganzen Reihe weiterer Fragen stand.
*
Ich stieß auf einen Lagerplatz und fand einen blutgetränkten Verband. Das Blut war fast eingetrocknet. Wahrscheinlich hatten sie hier bei dem Verwundeten den Verband gewechselt. Er schien stark geblutet zu haben. In eine Stadt im näheren Umkreis konnte sich die Bande nicht wagen, weil die Nachricht von dem Überfall die nächstgelegenen Ortschaften sicher schon erreicht hatte. Die Tatsache, dass das Blut, mit sich die Binde voll gesaugt hatte, noch nicht völlig getrocknet war, verriet mir, dass der Vorsprung der Banditen wieder geschrumpft war. Sie kamen mit dem Verwundeten nicht schnell vorwärts; ich registrierte es voller Zufriedenheit, und die Erkenntnis, dass ich ihnen ziemlich dicht auf den Fersen saß, löste fast so etwas wie ein Triumphgefühl in mir aus und beflügelte mich.
Ich war seit etwa zwei Stunden unterwegs, als vor mir zwischen den Felsen ein Reiter auftauchte. Sofort zog ich das Gewehr aus dem Scabbard, zügelte das Pferd und kniff die Augen zusammen, um schärfer sehen zu können. Der Reiter kam direkt auf mich zu, er hielt den Kopf gesenkt und sein Gesicht wurde vom Hut verdeckt. Aber auf diese Entfernung hätte ich sowieso keine Einzelheiten erkennen können.
Plötzlich kippte er vom Pferd.
Jäh kam bei mir der Argwohn und ich ließ meinen Blick in die Runde schweifen, bohrte ihn in jede Hügellücke, tastete Abhänge und Hügelrücken ab und vertraute meinem Instinkt, der mich warnte.
Nirgendwo war etwas auszumachen, das auf Gefahr hindeutete. Über den Hügeln spannte sich nur ein blauer Himmel, vor dem sporadisch weiße Wolken träge nach Osten trieben.
Ich hatte aus den Lektionen, die mir während meiner Zeit als Staatenreiter erteilt worden waren, gelernt und war vorsichtig geworden. Natürlich wollte ich dem Mann meine Hilfe nicht versagen – falls er auf Hilfe angewiesen war. Ich wollte aber auch nicht blindlings in einen Hinterhalt reiten – und dass es ein solcher war, vermutete ich. Die Bande rechnete mit Verfolgung, und sie hatte möglicherweise mich auf ihrer Fährte entdeckt.
Ich zog mein Pferd um die rechte Hand und trieb es an, lenkte es auf eine Hügellücke östlich von mir zu und befand mich wenige Minuten später zwischen den Hügeln. Nach einer halben Meile etwa schlug ich wieder die Richtung nach Norden ein. Ich hatte die Absicht, den Platz, an dem der Reiter vom Pferd gestürzt war, in einem weiten Bogen zu umreiten und mich ihm von Norden zu nähern. Meine Augen waren in ständiger Bewegung. Wenn ich auf Banditenjagd war waren mir Misstrauen und Wachsamkeit zur zweiten Natur geworden. Der kleinste Fehler konnte tödlich sein. Und in der Ödnis konnte ein Mann verschwinden wie ein Sandkorn in der Gila Wüste.
Die Winchester stand mit der Kolbenplatte auf meinem Oberschenkel, meine Hand umklammerte den Kolbenhals. Yard um Yard trug mich das Pferd nach Norden. Ich war auf ansatzlose Reaktion eingestellt und spürte jenes seltsame Kribbeln zwischen den Schulterblättern, das von der Unbehaglichkeit ausgelöst wurde, die mich befiel, wenn ich daran dachte, dass die Banditen nur darauf warteten, dass ich mich ihnen auf Gewehrschussweite näherte.
Und dieses Gefühl wurde immer intensiver.
Ich aktivierte jeden meiner Sinne, meine Nerven waren zum Zerreißen angespannt, die Atmosphäre mutete mich gefährlich und geradezu unerträglich an und ich wartete darauf, dass etwas geschah – etwas, das diese nervliche Zerreißprobe beendete.
Ich schwenkte wieder nach Westen ein und näherte mich der Nordseite der Hügel, an deren südlichen Rand der Mann vom Pferd gefallen war.
Nichts geschah.
In einer Gruppe von Sträuchern stellte ich mein Pferd ab und pirschte – das schussbereite Gewehr in der Rechten – südwärts. Dabei umging ich nicht die Hügel, sondern ich wählte den Weg über sie, denn von oben aus hatte ich teilweise einen guten Ausblick über das umliegende Terrain.
Und dann sah ich fünf Reiter, und sie kamen mir in direkter Linie entgegen. Mein Instinkt hatte mich wieder einmal mehr nicht im Stich gelassen. Der Reiter, der zwischen den Hügeln vom Pferd gefallen war, sollte mich in einen Hinterhalt locken. Nachdem ich nicht darauf hereingefallen war und mich die Bande aus den Augen verloren hatte, zog sie weiter.
Mich erfüllten unversöhnlicher Grimm und eine unumstößliche Entschlossenheit. Es waren Räuber und Mörder, zusammengesetzt aus Skrupellosigkeit, Brutalität, Hass und Heimtücke, denen nichts heilig war und denen ich das blutige Handwerk legen musste.
Langsam näherten sie sich mir. Ich stand geduckt hinter einem hüfthohen Felsen und beobachtete das Quintett. Kalte Ruhe beherrschte mich. Bald konnte ich Einzelheiten erkennen. Ein grauhaariger Mann – es musste Sam Burchell sein -, ritt voraus. Er hielt das Gewehr in der Hand, es lag quer über dem Widerrist seines Pferdes. Er war mit einer schwarzen Hose, einem grauen Hemd und einer naturfarbenen Lederweste bekleidet. Auf seinem Kopf saß ein verbeulter Calgary-Stetson von hellgrauer Farbe.
Zwei Reiter folgten ihm – zwei Kerle. Einer von ihnen saß zusammengekrümmt auf dem Pferd und sein Kopf baumelte vor der Brust. Hinter denen ritten die junge Frau und ein weiterer der Banditen. Selbst auf diese Entfernung blieb mir nicht verborgen, dass die Kleidung der fünf ausgesprochen heruntergekommen und zerschlissen wirkte. Sie hatten kein Zuhause, verbrachten ihre meiste Zeit auf dem Pferderücken und schliefen unter freiem Himmel. Das war zumindest der Eindruck, der sich in mir verfestigt hatte, nachdem ich die Reiter eingeschätzt hatte.
Sie zogen unter mir am Fuß des Hügels vorbei, und schließlich war es Zeit für mich, in Erscheinung zu treten. Also richtete ich mich auf und feuerte in die Luft. Der peitschende Knall stieß in die Senke und rollte auf der anderen Seite die Hügelflanke hinauf, die Reiter zerrten an den Zügeln, ihre Köpfe zuckten herum, sie sahen mich und griffen nach den Gewehren.
Ich jagte eine Kugel über ihre Köpfe hinweg. Aber wenn ich geglaubt hatte, dass ich sie damit einschüchtern oder zum Einhalten bringen konnte, sah ich mich getäuscht. Sie trieben die Pferde an und im nächsten Moment flogen ihre Kugeln in meine Richtung.
Das war ein eingespieltes Team.
Selbst der Bursche, der vollkommen erschöpft wirkend auf dem Pferd gesessen war, schien aus seiner Lethargie gerissen worden zu sein.
Die Detonationen verschmolzen ineinander, einige Kugeln klatschten gegen den Felsen, der mich deckte und die Querschläger jaulten markerschütternd. Der Lärm war infernalisch.
Ich feuerte am Felsen vorbei und sah ein Pferd vorne einbrechen. Es schlitterte über den Boden und der Reiter wurde abgeworfen. Mein nächster Schuss holte einen der Angreifer aus dem Sattel. Er überschlug sich einige Male am Boden und blieb mit ausgebreiteten Armen liegen.
Nun drehten die anderen ab. Ich hörte einen Mann etwas brüllen, sie feuerten nun nicht mehr und das Hufgetrappel, das ihre Pferde verursachten, entfernte sich rasend schnell. Schließlich verschwanden sie zwischen den Hügeln und Felsen.
Der Bursche, der von seinem stürzenden Pferd abgeworfen worden war und der eine ganze Zeit benommen am Boden gelegen hatte, taumelte hoch und schaute sich suchend um. Plötzlich stolperte er los, sein Ziel war das Pferd, dessen Reiter ich aus dem Sattel geschossen hatte, das bei der reglosen Gestalt stand, mit dem Schweif peitschte und in die Richtung des Mannes witterte, der sich ihm mit unsicheren Schritten näherte.
Ich feuerte dem Burschen ein Stück Blei vor die Zehenspitzen, abrupt hielt er an, schwankend wie ein Schilfrohr im Wind stand er da und starrte in meine Richtung. Er schien noch immer benommen zu sein. Ich trat neben den Felsen und rief: „Hierher, Mister. Und lass den Revolver stecken. Ich werde jeden Versuch deinerseits, mich hereinzulegen, mit einem Stück Blei quittieren.“
Während ich sprach ruhte mein Blick auf der Stelle, wo die anderen drei Banditen zwischen die Hügel geflohen waren. Aber von ihnen war nichts zu sehen. Es war, als hätte es sie nie gegeben. Aber dieser Eindruck war trügerisch …
„Na komm schon!“, rief ich und verlieh meiner Stimme einen scharfen, zwingenden Klang.
Hinkend setzte er sich in Bewegung. Bald konnte ich erkennen, dass sich bei jedem Schritt sein Gesicht verzerrte und ich sagte mir, dass er ziemliche Schmerzen haben musste. Doch das konnte auch eine Heimtücke sein, eine Finte, die mich unvorsichtig machen sollte, und so ließ ich die gebotene Vorsicht nicht außer acht und blieb wachsam. Diese Sorte war mit allen Wassern gewaschen.
Er stolperte und stürzte, konnte einen Sturz aufs Gesicht jedoch mit den ausgestreckten Armen abfangen. Keuchend blieb er liegen, sein Gesicht hatte sich gerötet und glänzte vom Schweiß. Der Bursche war scheinbar echt am Ende. Ich überwand mich und schritt langsam den Abhang hinunter, das Gewehr an der Seite im Anschlag, den Finger am Drücker. Immer wieder sicherte ich in die Richtung, in die die anderen Banditen verschwunden waren. Und ich ließ meinen Blick auch in die Runde schweifen, denn ich nahm nicht an, dass der Rest der Bande in kopfloser Flucht das Weite gesucht hatte.
Anspannung hielt mich fest im Klammergriff. Der Tod war wieder einmal allgegenwärtig, möglicherweise griff er sogar schon mit gebieterischer Hand nach mir.
*
Mein Schatten fiel auf den Burschen, der sich aufgesetzt hatte und mich mit fiebrig glänzenden Augen ansah. „Wie heißt du?“, fragte ich und ließ ihn in die Mündung meiner Winchester blicken.
„Horace Brooks. Bist du hinter uns her?“
Ich nickte. „Seit ihr in Hereford einen Toten zurückgelassen habt. Sam Burchell – ist das der richtige Name eures Anführers?“
„Ja. O verdammt, mein Bein! Wahrscheinlich ist es gebrochen. Die Schmerzen toben bis unter meine Schädeldecke.“
„Zieh vorsichtig den Revolver aus dem Holster und wirf ihn zur Seite“, gebot ich. „Hast du gehört, mein Freund? Vorsichtig.“
Er versuchte nichts. Nachdem der Sechsschüsser einige Schritte von ihm entfernt am Boden aufgeschlagen war, fuhr ich fort: „Handelt es sich bei der jungen Frau um Burchells Tochter?“
„Tessa – ja. Die beiden sind voll Hass. Wir kommen aus der Gegend von Big Spring. Burchell besaß dort eine Ranch. Es war eine Rustlerranch. Ich, Elmer und James arbeiteten für ihn. Wir stahlen die Rinder der Ranches am Sulphur Springs Creek, am Beals Creek und am Colorado River, in einem Umkreis von sechzig, siebzig Meilen also, versahen sie mit Burchells Brandzeichen, und wenn wir eine genügend große Herde beisammen hatten, verkauften wir sie an einen Viehaufkäufer in San Angelo. Das ging bis vor fünf Jahren gut.“
Brooks atmete einige Male durch, wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß aus den Augenhöhlen und knirschte mit den Zähnen. Die Schmerzen in seinem Bein mussten höllisch sein.
„Sprich weiter“, forderte ich. Mitleid konnte ich nicht empfinden.
„Die Mannschaft einer Ranch stellte uns am Johnson Draw“, presste Brooks zwischen den Zähnen hervor. „Es kam zum Kampf, sie erschossen Sams Pferd und während Elmer, James und mir die Flucht gelang, überwältigen sie Sam und er konnte von Glück reden, dass sie ihn nicht an Ort und Stelle aufknüpften. Er wurde vor Gericht gestellt und wanderte für fünf Jahre ins Zuchthaus. Vor drei Wochen wurde er entlassen. Wir holten ihn ab, und er bestand darauf, zum Johnson Draw zu reiten, um Jason Bentley, dem Ranchboss, der ihn vor Gericht brachte, die fünf Jahre blutig zu vergelten. Er ließ sich nicht davon abbringen, und Tessa unterstützte ihn. Also ritten wir …“
„Und?“
„Burchell hat Bentley aus sicherer Entfernung umgelegt, und dann sind wir nach Norden gezogen. Wir wollten nach Kansas. Aber wir hatten kein Geld, und so beschlossen wir, es uns zu beschaffen.“
„Indem ihr die Büros der Wells Fargo unterwegs überfallen habt“, fügte ich hinzu.
Der Bandit schwieg.
„Sam Burchell und Tessa ist eben die Flucht gelungen“, hub ich noch einmal zu sprechen an. „Wer ist der Mann, der bei ihnen ist?“
„Elmer Stevens. Er ist Tessas Verlobter. In Tucumcari haben sie ihm eine Kugel in die Schulter geknallt. Er ist ziemlich am Ende und geht wohl am Wundbrand drauf, wenn die Kugel nicht schnellstens aus seiner Schulter geholt wird.“