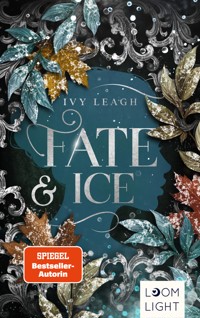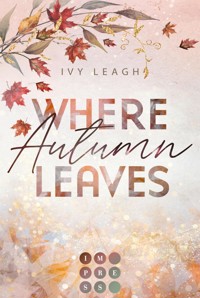9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist vorbei. Wir sollten loslassen. Aber ich weiß nicht, ob ich das kann Ich liebe meinen Job als Erzieherin, Elektro-Musik und Adrenalinkicks. Genau deshalb bin ich in diese Situation mit Otis geraten. Seit er und seine Polizeikollegen meinen letzten illegalen Rave gecrasht haben, stehe ich in seiner Schuld. Er hat mich beschützt, obwohl wir uns beide nicht ausstehen können. Und ich verstehe nicht, wieso. Das ist ein Problem. Ein großes Problem. Weil ich wirklich keine Lust auf ein gebrochenes Herz habe. Eigentlich müsste es verboten sein, sich immer in die falschen Männer zu verlieben. Aber was soll ich sagen? Ich versuche wirklich alles, um Otis aus dem Kopf zu verbannen. Aber immer wenn er mich mit diesem provokanten Blick ansieht, gräbt er Gefühle in mir aus, gegen die ich machtlos bin. Soll ich ihm vertrauen? Kann ich das überhaupt? Und was passiert, wenn ich es tue? »Where Winter falls« ist eine tiefgründige Slow Burn Romance mit einem hitzigen Haters to Lovers-Paar und viel Spice. Das aufwühlende Katz-und-Maus-Spiel zwischen Erzieherin Ella und Polizist Otis ist der zweite Band der Festival-Serie, kann aber unabhängig davon gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
ImpressDie Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Ivy Leagh
Where Winter Falls
Es liegen Welten zwischen uns. Und doch trennt uns nichts.
Tagsüber arbeitet Ella als Erzieherin, nachts veranstaltet sie als DJane verbotene Untergrund-Partys in Berlin, bei denen sie unzählige Feierwütige zum Tanzen bringt. Als eine davon hochgenommen wird, trifft Ella das erste Mal seit dem Rockfestival auf Polizist Otis und liefert sich kurzerhand eine heiße Verfolgungsjagd mit ihm. Eigentlich kann sie den ungehobelten Kerl nicht ausstehen – doch je öfter sie ihm anschließend über den Weg läuft, desto mehr entdeckt sie andere Seiten an ihm, die zeigen, dass hinter seinen Sprüchen ein tiefer Schmerz versteckt ist. Stück für Stück verliert Ella ihr Herz an Otis, auch wenn sie nicht sagen kann, auf wen sie sich da eigentlich einlässt. Und vor allem: wie ernst es ihm mit ihr ist.
WOHIN SOLL ES GEHEN?
Vorbemerkung für die Leser*innen
Vita
Buch lesen
Danksagung
Triggerwarnung
© privat
Ivy Leagh, geboren 1992, braucht bloß drei Dinge: Reisen, Koffein und das Schreiben. Nachdem sie eine Weile als freie Journalistin in Berlin und London kostenlos Konzerte besuchen und Stars interviewen durfte, verbringt sie mittlerweile ihre freie Zeit neben dem Literaturstudium lieber damit, an ihren Geschichten zu feilen. Ihrer Liebe zu Großstädten gibt sie inzwischen nur noch während ihrer Reisen nach; sie lebt wieder in ihrer Heimatstadt Würzburg.
To Queens Heath Pride
A place I call home.
VORBEMERKUNG FÜR DIE LESER*INNEN
Liebe*r Leser*in,
dieser Roman enthält potenziell triggernde Inhalte. Aus diesem Grund befindet sich hier eine Triggerwarnung. Am Romanende findest du eine Themenübersicht, die demzufolge Spoiler für den Roman enthält.
Entscheide bitte für dich selbst, ob du diese Warnung liest. Gehe während des Lesens achtsam mit dir um. Falls du während des Lesens auf Probleme stößt und/oder betroffen bist, bleib damit nicht allein. Wende dich an deine Familie, Freunde oder auch professionelle Hilfestellen.
Wir wünschen dir alles Gute und das bestmögliche Erlebnis beim Lesen dieser besonderen Geschichte.
Ivy Leagh und das Carlsen-Team
PLAYLIST »DIRTY FEMINISTS«
Boomerang – Blümchen
Eins, zwei, Polizei – Mo-Do
Barbie Girl – Aqua
Mr. Vain – Culture Beat
Boom, Boom, Boom, Boom!! – Vengaboys
You’re My Heart, You’re My Soul – Modern Talking
Kung Fu Fighting – Carl Douglas
Saturday Night – Whigfield
No Limit – 2 Unlimited
Dragostea Din Tei – O-Zone
Kiss – Vengaboys
Tragedy – Steps
Heaven Is a Place on Earth – Belinda Carlisle
What Hurts the Most – Cascada
All I Ever Wanted – Basshunter
Euphoria – Loreen
Run Away – SunStroke Project & Olia Tira
My Heart Goes Boom – French Affair
Das
Secret Rave Festival Berlin
geht ins fünfte Jahr
Der Boden bebt bis Brandenburg
2023 bringen wir den Berliner Underground zum fünften Mal in Folge zum Beben! Techno, Hardcore, Frenchcore, EDM – Hauptsache, die Erde wackelt! Ein Monat, zig Raves, krasse Locations und ein großes Finale. Die Standorte der Baby-Raves bekommt ihr am Abend vor der jeweiligen Veranstaltung, IMMER auf Discord. Die Final-Location wird ebendort bekannt gegeben.
Unsere Secret Rave Festival-Newcomer-Empfehlung
When boys come with the intention of hurting you, give’em hell, darling! Harder, Faster, Cringegasm – Dirty Feminists sind dieses Jahr unsere Hot Newcomer. Goa-Geballer, 90s & 2000s Cringe und Bass-Explosion: Das TikTok-Phänomen heizt euch im November gleich dreimal an noch geheimen Locations ein.
Gespielt wird indoor auf einem Soundsystem mit TW-Audio-Topteilen, befeuert von einer Hoellstern-Endstufe, outdoor wird improvisiert.
Sicherheitshinweis
Postet keine Namen und Gesichter auf Social Media. No-Drug-Area! Wer Drogen konsumiert, der fliegt raus. Achtet auf eure Mitmenschen. DJ-Advice: Tragt Masken.
Let’s go November-Nuclear
Euer Secret Rave Festival Berlin
WIE EIN BOOM, BOOM, BOOM, BOOM, BOOMERANGKOMMST DU IMMER WIE-BITTE NICHT.
Ella
Es ist verdammt kalt in Berlin. Deshalb stehe ich in meine dicke Winterjacke eingepackt vor Juans tragbarem DJ-Pult und muss trotzdem aufpassen, dass ich die Jog-Wheels meines Controllers nicht viel zu grob bediene. Ich habe keine Lust, etwas kaputt zu machen, in das ich mein halbes Erspartes gesteckt habe. Die Drehteller reagieren feinfühlig auf jede Berührung und produzieren so im Normalfall ein krasses Scratch-Geräusch. Im Moment fehlt mir aber in meinen vor Kälte taub gewordenen Fingern jegliches Gefühl, weshalb der Sound eben eher nach einer Katzengeburt klang. Zum Glück hat mich deshalb nur mein DJ-Partner Juan irritiert von der Seite beäugt, der im Gegensatz zu mir an Handschuhe gedacht hat. Die Gäste tanzen weiterhin das wintergraue Gras um mich herum platt – die meisten von ihnen trotz der Temperaturen oberkörperfrei.
In den letzten Wochen gingen ein paar Videos, die Juan auf unserem TikTok-Kanal geteilt hat, durch die Decke, denn er bastelt neuerdings bekannte Memes vor den Beat-Drop einiger Tracks. Ein Clip mit einer Katze hat mittlerweile über eine Million Klicks. Heute können wir die Leute zum ersten Mal endlich auch live von unserer Musik begeistern.
Als ich vor einem Jahr Juans Instagram-Account gefunden und mir die Story-Highlights angesehen habe, in denen er mit Glitzer auf den Wangen und Smokey Eyes am DJ-Pult steht, musste ich ihn anschreiben, und sei es auch nur, um ihm ein paar Komplimente zu seinem Style zu machen.
Juan ist schon viel länger im Business erfolgreich und dass er mir überhaupt auf meine Nachricht geantwortet hat, war ziemlich überraschend. Deshalb hätte ich nie gedacht, dass er mir ein paar Wochen später vorschlägt, unter einem Pseudonym mit ihm gemeinsam beim diesjährigen Secret Rave Festival aufzutreten.
Zwölf Monate später heizen wir aber tatsächlich zu zweit der Menge ein. Und der erste von drei Raves der Dirty Feminists ist richtig gut besucht.
Den November über finden überall in Berlin unzählige, illegale Raves statt, die auf Social Media als Baby-Raves bezeichnet werden. Die, an denen ich die vergangenen Festivaljahre als Gast teilgenommen habe, waren nie so voll wie unserer. Selbst wenn ich so zurückhaltend wie meine besten Freundinnen Leni und Charlie wäre, würde mich diese Tatsache verdammt stolz machen. Zugegeben, Juan kennt auch einen der Veranstalter und hat deshalb eine richtig gute Location für uns rausgehandelt.
Buntes Licht blitzt hier auf dem Teufelsberg wie Laserstrahlen über die verfallene Abhörstation der Amerikaner aus dem Kalten Krieg bis runter nach Berlin. Die Radarkuppeln hinter uns erinnern mich an gigantische Golfbälle oder bei den Temperaturen wohl eher Schneebälle, und wenn das Licht wie jetzt gerade durch ihre beschädigte Kunststoffhülle schießt, haucht es dem stillgelegten Spionagezentrum wieder Leben ein.
Gleichbleibend aggressiv hämmert unser Sound in meinen Ohren, bevor ich den Beat anschwellen lasse. Wie kleine Nadelstiche spritzt er mehr und mehr Adrenalin in meinen Körper, bis ich das Gefühl habe, dass er fast zu heftig gegen meinen Schädel drückt.
Ein letztes Mal reiße ich einen Arm hoch und schreie. Meine Kehle ist staubtrocken, schmerzt. Egal – abermals brülle ich in die tanzende Menge, die sofort auf mich reagiert. Die Menschen drängen sich dichter aneinander, Sohle an Sohle, und warten so, mit gesenkten Köpfen und zum Zerreißen angespannten, schweißnassen Oberkörpern, auf den einen Moment, den ganz allein ich bestimme. Ein abgefahrenes Gefühl.
Juan heizt den Tanzenden neben mir unterstützend weiter ein, so wie wir es geprobt haben, bis ich schwöre, ihre Anspannung auf der Zunge schmecken zu können. Jetzt gibt es nichts Wichtigeres mehr als die Musik und meine kalten Finger, mit denen ich den Pegel hoch konzentriert reguliere.
Ich warte, bis ich in den ersten Reihen einen Funken Unruhe aufkommen spüre, und dann endlich … lasse ich los. Der Beat droppt. Fäuste fliegen in die Höhe und boxen wild in den wolkenverhangenen Nachthimmel. Gebrüll und Gekreische übertönen den tiefen Bass, der die Erde zum Beben bringt. Meine Nackenhaare stellen sich auf. Obwohl ich Angst habe, bei der Sache erwischt zu werden, weiß ich, dass ich an versifften, verlassenen Orten wie dem Trümmerberg unter meinen Sohlen zu Hause bin.
Fast ein Drittel der Überreste des nach dem Zweiten Weltkrieg zerbombten Berlins landeten auf dem Teufelsberg. Eigentlich total gruselig. Doch mein Herz fühlt sich hier trotzdem so frei wie seit Wochen nicht mehr. Vielleicht weil es auch ein Trümmerberg voller Staub, Schmutz und verdrängter Erinnerungen ist.
Ich mische einzelne Textfetzen in den Song, immer Hits aus den Neunzigern und Zweitausendern, was Juans Meinung nach neben den lustigen Memes auf TikTok zum Markenzeichen der Dirty Feminists geworden und der Grund dafür ist, dass das Secret Rave Festival ausgerechnet uns als Newcomer gebucht hat. Wäre unfassbar krass, wenn Juan recht hätte und ein paar der Gäste heute nur wegen mir hergekommen sind.
Vier weitere Male hebe ich die Lyrics des Blümchen-Songs noch zum Ende jeder Bar hervor – Boom, Boom, Boom, Boom –, bevor ich eine neue Phrase aufbaue, bis auch die so weit überstrapaziert ist, dass es sich anfühlt, als ob ihr Beat meine Nervenenden kitzelt. Erst jetzt lasse ich den Beat auf Boomerang in eine neue Phrase übergehen und die Leute rasten aus.
»Willst du dir nicht mal was zu trinken holen?«, brüllt Juan über die Lautstärke hinweg in meine Richtung. Er klingt dabei ein klein wenig zu streng, als ob es allein seine Aufgabe wäre, auf mich aufzupassen. Seit der Trennung von Toni vor drei Monaten ist jeder in meinem Umfeld überfürsorglich, obwohl ich ständig demonstriere, dass alles okay bei mir ist. Wahrscheinlich sage ich das vor allem, um mich selbst davon zu überzeugen. Aber letztendlich wird auch meine Beziehung zu Toni irgendwann nur noch eine verblasste Erinnerung auf meinem eigenen Trümmerberg sein. Irgendwann habe ich ihn vergessen. Denn vergessen und verdrängen kann ich ziemlich gut. Alles, was in Kanada passiert ist, und auch den Grund, weshalb ich es nicht fertigbekommen habe, Toni im vergangenen Sommer dort zu besuchen, habe ich problemlos aus meinem Kopf gestrichen.
In einem Jahr kann sich alles verändern.
Ich hoffe so sehr, dass Charlie mit dem, was sie mir gestern beim Facetimen versprochen hat, nicht recht behält und ich schon in einem halben Jahr nicht mehr an Toni und Kanada denken muss.
»Ich übernehme solange«, fordert Juan nun und diesmal schaut er mich dabei eindringlich an. Eigentlich sehe ich nur ein Augenpaar in der Dunkelheit aufblitzen, denn der Rest seines Gesichts ist genau wie bei mir von einer schwarzen Sturmmaske bedeckt. So wollen die Veranstalter unsere Anonymität schützen und verhindern, dass wir auf Fotos und in Videos, die ins Internet gestellt werden, von der Polizei identifiziert werden können.
Darüber bin ich mehr als froh, denn ich würde jede Maskierung in Kauf nehmen, um auf Social Media nicht erkannt zu werden. Auch in keinem unserer TikTok-Videos zeige ich mein Gesicht und wenn ich meinen Job nicht riskieren will, muss das unter allen Umständen auch so bleiben.
»Ist schon in Ordnung, Juan. Ich komm klar.« Kaum habe ich abgelehnt und den Fader hochgezogen, um so einen neuen Song in den alten überlaufen zu lassen, bereue ich es, weil mein Hals vom Schreien noch immer ganz trocken ist und schmerzt. »Vielleicht geh ich doch mal schnell runter«, überlege ich es mir kurz darauf anders. »Die Loops sind alle vorbereitet. Du musst das Outro nur noch mit dem Highpass-Filter rausziehen. Bin gleich wieder da.«
Juan nickt, bevor er meinen Controller übernimmt, den wir für Outdoor-Gigs nutzen, weil er nur halb so viel gekostet hat wie seiner. »Lass dir Zeit.«
»Ganz sicher nicht.« Ich vermisse das DJ-Pult jetzt schon und am liebsten würde ich nichts anderes mehr in meinem Leben tun, als fremde Leute mit meiner Musik zum Ausrasten zu bringen. Bevorzugt nicht mehr heimlich und illegal. Aber ich weiß, wie unrealistisch es ist, vom Musikmachen leben zu können, weshalb ich den Job im Kindergarten dringend brauche, um die Miete meines WG-Zimmers zu bezahlen.
Juan hat schon in einigen größeren Clubs aufgelegt, letzten Sommer sogar auf einem Elektrofestival in Barcelona, und trotzdem arbeitet er zusätzlich in einer kleinen Marketingagentur im Prenzlauer Berg, weil das Geld sonst einfach nicht reicht. Dort gehen seine Kollegen allerdings weitaus lockerer mit seinem Nebenjob als DJ um, als es meine Chefin tun würde. Doch solange die nicht mitbekommt, womit ich mir in den kommenden Wochen noch zweimal die Nacht um die Ohren schlagen werde, bietet mein tadelloses Verhalten gegenüber den Kindern keinerlei Angriffsfläche. Zur Sicherheit ziehe ich die schützende Sturmmaske tiefer ins Gesicht.
Auf dem Weg zum provisorisch aufgebauten Getränkeverkauf gratulieren mir Fremde zu meinem gelungenen Set. Das Festival findetmittlerweile zum fünften Mal in Folge statt. Bis zum Festivalfinale Anfang Dezember, bei dem die besten DJs in und um Berlin an einer noch geheim gehaltenen Location auftreten werden, vergehen noch gut fünf Wochen. Das sind einige Abende, an denen überall in Berlin weniger bekannte DJs versuchen so viele Leute wie möglich zu ihren Raves zu locken und von sich zu begeistern, um im nächsten Jahr von den Festivalveranstaltern fürs Finale gebucht zu werden. Die diesjährigen Acts stehen schon seit Wochen fest.
Dass die Dirty Feminists überhaupt ausgesucht, zusätzlich als Newcomer gepusht wurden und gleich dreimal auftreten dürfen, ist eine riesige Ehre. Für mich, aber vor allem für ein Kollektiv bestehend aus einer Frau und einem bisexuellen Typen, das toxischen Männern den musikalischen Kampf angesagt hat. Funktioniert bestimmt nur in Berlin.
Die Erwartungen an unsere Sets sind aufgrund der Empfehlung natürlich riesig und der Neid der anderen Musiker groß, weshalb ich froh bin, dass der erste Gig heute so gut funktioniert. Es wäre unfassbar, wenn wir die Veranstalter begeistern und nächstes Jahr beim Festivalfinale auflegen dürfen.
Um noch mehr Werbung für Juan und mich zu machen, nehme ich mir vor, dem Nächsten, der mich anspricht, einen der Flyer in die Hand zu drücken, die ich in meiner Jackentasche aufbewahre und auf denen lediglich der Name unseres Kollektivs und ein QR-Code aufgedruckt sind. Der Code führt auf einen Discord-Channel, wo am Tag vor den jeweiligen Raves die Locations bekannt gegeben werden.
Aus Sicherheitsgründen darf nirgendwo Werbung aufgehängt werden, aber ein paar Flyer stellen bestimmt kein Problem dar. Doch bis zum Getränkeverkauf hält mich eh niemand mehr auf.
Als ich den Campingtisch erreiche, der als Tresenersatz dient, reicht die Frau dahinter gerade zwei Dosen Bier an einen Typen, dessen nackter Rücken voller Tätowierungen ist. Ich presse die Lippen zusammen, doch als er sich zu mir herumdreht und dabei die gepiercten Augenbrauen hochzieht, zucke ich trotzdem zusammen. Genervt von mir selbst beiße ich die Zähne aufeinander. Ich habe Toni auf einem Rave wie diesem kennengelernt, weshalb es mich nicht sonderlich überraschen sollte, dass jeder zweite Typ hier optisch meinem verdammten Ex ähnelt.
Tut es aber trotzdem, und vor allem tut es verdammt weh.
»Mega Set«, lobt der Typ. Als er sich das dunkle Haar aus der Stirn streicht und dabei schluckt, bewegt sich sein ausgeprägter Adamsapfel auf und ab. Verflixt, für genau solche Männer wie ihn habe ich eine Schwäche, womit feststeht, dass nach dem Gig nichts zwischen uns laufen wird und ich ihn besser schnell loswerde. Denn wenn ich mich in den vergangenen Monaten überhaupt für Ablenkungssex entschieden habe, dann war es jedes Mal mit jemandem, in den ich mich unter absolut keinen Umständen verlieben würde.
»Kann ich dich auf einen Drink einladen?«, fährt er fort. Er lächelt, runzelt aber nur eine Sekunde später die Stirn, als ich den Kopf schüttle.
»Ich nehme unser DJ-Motto ernst.« Wenn dir ein Mann das Herz brechen will, schick ihn zur Hölle, Baby … Der Spruch war mein Vorschlag. Unter anderem daran angelehnt, dass mir Toni in und vor Kanada gleich mehrmals fremdgegangen ist.
Auf meine Ansage hin verstärkt sich sein Stirnrunzeln. »Ich hatte nicht vor, dir irgendetwas zu brechen.«
Das glaube ich ihm sofort. Das Problem ist auch gar nicht er, sondern mein Herz. Es ist bei tätowierten Toni-Doppelgängern ziemlich masochistisch veranlagt und sehnt sich richtig danach, von ihnen in Fetzen gerissen zu werden. Dunkle Haare, Tattoos, hohe Wangenknochen und ein ausgeprägter Adamsapfel sind deshalb zu einhundert Prozent Ausschlusskriterien, weshalb ich anfüge: »Ich kauf mir trotzdem selbst was, danke.« Meine Mundwinkel zucken, was der Typ durch die Maske hindurch natürlich nicht erkennen kann.
Deshalb vertiefen sich die Falten auf seiner Stirn noch einmal mehr, als er schließlich mit den Schultern zuckt. »Geht klar, kein Ding.«
Ich rechne damit, dass er sich abwendet und geht, aber der Typ wirkt plötzlich irgendwie abgelenkt. Auch der Blick der Bedienung zuckt erschrocken zur Tanzfläche. O nein, prügelt sich dort irgendjemand? Juan meinte, dass das hin und wieder vorkommt, weshalb die Veranstalter des Festivals seit diesem Jahr den Drogenkonsum während der Raves verbieten. Allerdings ist es unmöglich zu kontrollieren, in welchem Zustand die Gäste an der Party teilnehmen. Dafür bräuchte es ein ausgebildetes Security-Team. Das gibt es auf geheimen, unangemeldeten Underground-Raves aber nicht. Kein Geld und viel zu auffällig. Während des Aufbaus vorhin sind allerdings zwei bullige Typen an uns vorbeimarschiert. Ich glaube, die sind mit den Veranstaltern befreundet, und wahrscheinlich sollen sie ein Auge darauf haben, dass niemand Schwierigkeiten macht. Doch auf die Schnelle kann ich keinen der beiden sehen.
Und als ich den Blick noch ein paar Sekunden länger über die Menge schweifen lasse, trifft er prompt auf das Problem.
Mehrere Taschenlampen, deren grelle Lichter die bunten verschlucken, und mittendrin silbern reflektierende Aufdrucke: Polizei.
»F-fuck.« Ruckartig fahre ich herum.
Der Typ zieht abermals die Augenbrauen hoch. »Die Bullen.«
Ehe ich Ach wirklich? antworten kann, macht er auf dem Absatz kehrt und rennt den Berg hinunter. Ich sehe, wie er auf halbem Weg stolpert und sein Körper ein Stück unkontrolliert rollt, bis er wieder auf die Beine kommt und schließlich aus meinem Sichtfeld verschwindet.
Verdammt.
Ein polizeilicher Vermerk in meinem Führungszeugnis ist ungefähr das Letzte, was ich im Moment gebrauchen kann. Ich erinnere mich, dass die Veranstalter im Vorfeld darauf hingewiesen haben, dass die geheimen Standorte ihrer illegalen Raves an die Polizei weitergetragen werden könnten, die dann wiederum die Party sprengen. Anmeldung auf eigene Gefahr, hat Juan gescherzt, als wir zwei unserer Beispielsets online eingereicht haben. Warum um Himmels willen hat mich diese Warnung nicht interessiert? Und wieso habe ich auch noch Scheißflyer drucken lassen?
»Polizei Berlin, stehen bleiben!«
Mit glühend heißem Gesicht drehe ich mich zurück zur Bedienung, die mich mit weit aufgerissenen Augen anstarrt.
»Das ist dein Zeichen wegzurennen!«
Ich weiß nicht, wieso ich nicht auf sie höre, sondern wie in Trance zu Juan schaue, der gerade panisch sein DJ-Pult zur Seite stößt und sich meinen Controller unter die Achsel klemmt, bevor er wegrennt, ein Polizist ihm dicht auf den Versen. Ein zweiter stürmt direkt auf mich zu.
Fuck. Fuck. Fuck.
Das Herz hämmert mir bis zum Hals, als ich loshaste.
Tja, hätte ich mal in den letzten Wochen auf meine Freundinnen gehört und mich statt mit Musik lieber mit Sport von Toni abgelenkt. Ein wenig Bewegung wäre dringend notwendig gewesen, denn das heftige Keuchen, mit dem ich gerade in Richtung eines Waldstücks einen Schritt vor den anderen setze, macht mir jetzt schon Angst. Und ich renne noch keine zwanzig Sekunden. Nach weiteren dreißig kommt Seitenstechen dazu, was bestimmt an der dicken Winterjacke liegt, in der ich mich kaum bewegen kann. Ohne nachzudenken, zerre ich meine Arme beim Rennen panisch aus den Ärmeln und befördere das Stück Stoff zur Seite.
Ich warte darauf, dass meine Beine nachgeben oder mir schwindelig wird und ich einfach umfalle. Aber ich renne weiter, immer den Berg hinab, schräg auf das Waldstück zu, und höre dabei das gleichbleibende Geräusch schwerer Schritte hinter mir, das sich unter mein panisches Getrampel mischt. Verzweifelt ringe ich nach Luft und versuche an den Schmerzen in meinem Hals vorbeizuschlucken, bis ich den Atem des Fremden hinter mir förmlich in meinem Nacken spüren kann. Schließlich ist ein lautes Keuchen zu hören und im nächsten Augenblick schlägt mein Körper unkontrolliert auf dem harten Boden auf.
Ächzend winde ich mich unter dem Gewicht, das auf mir liegt. Keine Chance.
Der Griff des Polizisten über mir ist überraschend fest und unnachgiebig. Scheiße.
Fluchend presse ich die Handflächen auf den eiskalten Boden und stemme mich gegen die Person auf meinem Rücken. Dennoch bewegt sich der Polizist keinen Zentimeter von mir weg, sondern drückt mich als Antwort grob zurück. Na toll. Kann ich mich in seinem Griff auf den Rücken drehen und ihm mein Knie in den Magen rammen? Nein, besser nicht.
Der Polizist umfasst meine Handgelenke und zieht mir die Hände so eine Sekunde später auf den Rücken. Mir bricht der Schweiß aus, ich trete mit den Füßen und hoffe gleichzeitig, dass ich den dämlichen Polizisten nicht erwische, der sich jetzt als Antwort auf mein Gezappel breitbeinig auf mich setzt, um so meinen Körper zu fixieren.
»Hab ich dich«, presst er hervor und zerrt wie zur Bestätigung abermals an meinen Händen. Ich stoße einen Schmerzenslaut aus. »Wenn du keine Mucken machst und brav aufstehst, bekommen wir das auch ohne Handfesseln hin.«
»Ich kann nicht aufstehen, wenn du auf mir sitzt«, zische ich und spüre den Drang, die Worte einzufangen und sie zurückzuschieben. Einen Polizisten duzen: teuer. In dem Viertel, in dem ich aufgewachsen bin, ist die Polizei Stammgast. Trotzdem bin ich bisher kaum mit dem Gesetz in Berührung gekommen. Aber ich weiß auch so, dass es nicht unbedingt förderlich ist, einen Polizisten zu provozieren. Er sitzt am längeren Hebel oder, in meinem Fall, auf mir drauf.
»Letzte Chance.«
Ich höre ein Klickgeräusch und eine Sekunde später spüre ich kühles Metall als Warnung an meinem linken Handgelenk entlangstreifen.
Der Polizist bewegt sich ein Stück an meinem Rücken hinunter, bis er unterhalb meines Hinterns hockt, womit er wohl verhindern will, dass ich noch mal nach ihm trete. Eine Tatsache, die dazu führt, dass ich ein wenig in Verlegenheit gerate. Wenn ein Mann mich in der Vergangenheit auf diese Weise fixiert hat, dann hatte das ehrlich gesagt immer einen anderen Grund. Meine Mundwinkel zucken und ich verpasse mir gedanklich eine Ohrfeige. Solche Gedanken sind ja mal so was von nicht angebracht, wenn ein Polizist auf mir draufsitzt. Kurzer Realitätscheck: Ich bin zwanzig und erst seit diesem Jahr mit der Ausbildung zur Erzieherin fertig. Obwohl mich viele für unzulänglich halten – ich bin mit einer alleinerziehenden Mutter im Berliner Ghetto aufgewachsen –, habe ich mich durchgebissen und eine Festanstellung als Erzieherin in einem Brennpunkt-Kindergarten in Marzahn ergattert. Dort schaffe ich nun wiederum für andere Kinder Perspektiven, damit sie niemand mehr wie Menschen zweiter Klasse behandelt, nur weil sie nicht in einem der privilegierten Bezirke Berlins aufgewachsen sind.
Doch das alles habe ich mir nichts, dir nichts aufs Spiel gesetzt und einem illegalen Rave zugestimmt. Und deshalb hockt jetzt ein Scheißpolizist auf mir, der dafür sorgen kann, dass ich meinen Job im Kindergarten verliere.
Die Vorstellung hilft. Jetzt bin ich wieder panisch.
»Ist ja gut«, murmle ich. Immerhin schaffe ich es, meinen Kopf ein Stück zur Seite zu drehen. Eine Taschenlampe liegt angeschaltet mit ihrem unteren Ende zu mir auf dem Boden. Als ich aufblicke, stelle ich fest, dass ihr Lichtschein das Gesicht des Polizisten erhellt. Ich erkenne nur eine unrasierte Wange mit hellen Stoppeln und eine Hand, die über das Kinn fährt.
Ich mustere den Polizisten, er kommt mir bekannt vor. Unschön. Schlimmer noch, mein Kooperationsversuch ist offenbar nicht bei ihm angekommen, denn in dunklem Unterton antwortet er: »Gut, dann machen wir es auf die harte Tour. Bist nicht die Erste, die darauf abfährt.«
Und nach dem Spruch befürchte ich, dass ich den Trottel wirklich kenne.
2. NOVEMBER, BERLIN
»DER HIMMEL IST BLAU, AUCH OHNE DICH. NUR ÜBERRASCHT MICH DIESE TATSACHE NICHT MEHR.«
Otis
Schon seit meinem ersten Tag hier vor zwei Wochen weiß ich, dass mir meine neuen Kollegen das letzte bisschen Glück im Leben zerstören werden. Ob sie mir allein für diesen Gedanken eine verpassen würden? Gut möglich.
Eigentlich habe ich mich auf den Brennpunktabschnitt gefreut. Hier erfolgreich zu hospitieren, bedeutet für eine Beförderung empfohlen zu werden. Als mein Chef mir vorgeschlagen hat, meiner Einsatzgruppe in Spandau für ein paar Wochen den Rücken zu kehren, um die hoch angesehene Arbeitsgruppe »Rave« in Neukölln zu unterstützen, dachte ich, das wird entspannt.
Ist es aber nicht, weil einige meiner neuen Kollegen die Sorte Polizisten sind, die Alkohol und Partys beinahe ernster nehmen als ihren Job. Bisher war ich davon ausgegangen, dass die Leute bei der Hundertschaft anstrengend wären, aber im Vergleich zu den neuen haben die alten Kollegen ein richtig weiches Herz.
Fast jeden Tag, seit ich hier bin, wurde ich vor oder nach den Schichten in irgendwelche Berliner Clubs mitgeschleppt. Die übrigen Nächte habe ich mir entweder auf der Wache oder anderweitig um die Ohren geschlagen, weshalb mein Körper gestern auch schlappgemacht hat. Ich habe mir nach der Spätschicht die Seele aus dem Leib gekotzt.
Das sollte eigentlich kein Problem sein und bei meinen alten Kollegen in Spandau wäre es das auch nicht gewesen, doch anscheinend sieht man das hier in Neukölln ein wenig anders. An meinem Spind in der Männerumkleide begrüßt mich an diesem Abend ein Blatt Papier, auf das jemand Pussy geschrieben hat, und das passiert nicht zum ersten Mal.
Mein Puls beschleunigt automatisch, wenn ich an die andere Situation vor einer Woche denke. Und ja, diese Reaktion ist total sinnbefreit. Immerhin war es nur ein bisschen Wassergeplätscher, das mich nervös gemacht hat. Keine Ahnung, weshalb es im Schreibzimmer überhaupt ein Waschbecken gibt und warum irgendjemand den Wasserhahn nicht ordentlich zugedreht hatte. Verdammt, ich hätte wenigstens die Klappe halten und das Scheißgeräusch beim Berichteschreiben wie ein richtiger Mann einfach ertragen können. Habe ich aber nicht. Stattdessen musste ich ja unbedingt in meiner ersten Woche hier auf dem Abschnitt der Arbeitsgruppenleitung ans Bein pissen.
Ganz sicher wollte ich Maxim keinen lautstarken Vortrag zum Thema Wasserverschwendung halten, aber belanglosen Mist von mir zu geben, ist in solchen Situationen mein Rettungsanker. Auch wenn ich jetzt vor Maxim und den anderen wie ein Schwächling dastehe, der bei ein bisschen Wasserplätschern die Nerven verliert.
Unwillkürlich spanne ich mich an, obwohl niemand außer mir im Umkleideraum ist. Natürlich habe ich keine Panik vor einem Scheißwasserhahn, es ist nur –
Ach, was soll’s, ich reiße den Zettel ab und zerknülle ihn.
Mir steht eh schon eine beschissene Schicht bevor.
Wenn jemand wüsste, weshalb ich viel zu häufig übermüdet und mit zum Zerreißen gespannten Nerven auf der Polizeiwache auftauche, würden sie sich mit Sicherheit noch krassere Beleidigungen einfallen lassen.
»Du siehst scheiße aus«, kommentiert Maxim beim Reinkommen, als ich gerade meine Schussweste aus dem Spind hole und über die Uniform ziehe, die ich dringend zu Hause waschen muss. Im Moment habe ich nur einfach keine Zeit, mich um solche Dinge zu kümmern.
»Lass mich raten: Gestern nach der Spätschicht die Nacht noch bei irgendeiner Alten verbracht?«
Wenn er wüsste. Ich hatte seit letzter Woche keinen Sex, vorausgesetzt Maxim lässt Oralsex überhaupt gelten. Ansonsten sind es knapp drei Wochen. Das Einzige, was mich im Augenblick herausfordert, ist mein Handy, das in den unpassendsten Momenten losklingelt. Seit Wochen kratze ich nachts meinen Vater von der Straße, und noch länger lasse ich mir vor den Kollegen und meiner Schwester Gloria pausenlos Ausreden einfallen, um ihnen nicht die Wahrheit sagen zu müssen.
Mein Vater ist spiel- und alkoholsüchtig. Ich habe keinen blassen Schimmer, was davon zuerst kam, aber ich weiß, dass ich derjenige bin, den er jedes Mal sturzbetrunken anruft und der sich dann nachts im Halbschlaf hinters Steuer quält, um ihn aus irgendeiner Berliner Spielothek abzuholen. Deshalb ist Schlaf etwas, das ich zum größten Teil mit Energydrinks und Kaffee ersetzen muss.
»Klar …« Ich gähne demonstrativ in meine Armbeuge und straffe die Schultern. »Hab grad eine Neue am Start.«
»Wird ja doch noch was aus dir.« Maxim schlägt mir respektvoll auf die Schulter und richtet das Holster an seiner rechten Seite. »Ich geh schon mal vor und lass mir von Jonas die Funkgeräte geben.« Er holt seinen Helm vom Spind und klemmt ihn sich alibimäßig unter die Achsel, bevor er mir abermals gegen die Schulter boxt und geht.
Alibimäßig. Manche stillschweigenden Abmachungen unter Polizisten sind einfach erbärmlich. Die Behörde hat festgelegt, dass Streifenpolizisten ihren Helm bei jedem Einsatz im Polizeiwagen mitführen müssen, woran sich meines Wissens auch jeder auf dem Abschnitt hält. Deshalb greife ich jetzt ebenfalls nach meinem Helm, doch aufziehen werde ich ihn später, genauso wie Maxim und viele andere Kollegen, ganz sicher nicht. Niemand tut das, außer wir werden vorab explizit darauf hingewiesen, dass während des Einsatzes Steine fliegen können. Ist heute nicht der Fall. Darum wird der Helm später im Wagen bleiben. Wenn ich keinen weiteren Spruch riskieren will, halte ich mich besser an solche unausgesprochenen Regeln, und davon gibt es viele.
Wer beispielsweise in der Hundertschaft arbeitet – und demnach nicht bei der Streifen- oder Kriminalpolizei –, der geht dem Klischee nach ständig feiern, hat pausenlos Sex und keine Angst. Das ist etwas, das noch nie in meinen Kopf wollte. Ich kenne Kollegen bei der Hundertschaft, die sich bei Einsätzen in die Hose gepinkelt haben, weil sie Panik hatten, draufzugehen, die aber mit niemandem darüber reden. Sie tun es einfach nicht. Nie. Wahrscheinlich wäre es wichtig, über solche Sachen zu sprechen, aber ich schätze, ein Helm auf dem Kopf eines Streifenpolizisten wäre ebenso nicht übel. Und den trägt hier eben auch kaum jemand.
Ich unterdrücke ein weiteres Gähnen und schnalle mir die Dienstkoppel um die Hüfte. Bei meinem aktuellen Zustand überprüfe ich gleich zweimal, ob ich alles Notwendige am Ledergürtel befestigt habe: Handschuhe, Handfesseln, Taschenlampe, Reizgas und den Schlagstock, den hier jeder als Tonfa bezeichnet. Alles da.
Ich schließe meinen Spind und kaum habe ich die Umkleidekabine verlassen, gerate ich ins Radar meiner Kollegin Victoria.
»Vegiss die Waffe nicht, Bambi.«
Nur weil ihre Hand unmittelbar neben die Handfesseln an meine Dienstkoppel wandert, halte ich das Nenn mich nicht so zurück. Bei der Hundertschaft kriegen wir die Waffe vom dafür zuständigen Waffenmeister ausgehändigt. Irgendwie kann ich mich noch nicht damit abfinden, sie hier eigenständig aus einem Schließfach holen zu müssen.
Victoria hakt zwei Finger unter den Gürtel und zieht mich so fordernd zu sich. Wenn ihr Mund es mir nach der bevorstehenden gemeinsamen Nachtschicht genauso hart wie letzte Woche besorgt, kann sie mich nennen, wie sie will, schätze ich. Also lenke ich unser Gespräch sofort in diese Richtung.
»Benutzt du die Handfesseln auch privat?«
Daraufhin lässt Victoria den Gürtel los und stößt einen Laut aus, der klingt, als hätte ihr jemand aufgetragen, in der Wohnung einer verstorbenen Person auszuharren, bis der Bereitschaftsarzt kommt, um deren Tod festzustellen. Diese Form von Einsatz stinkt wortwörtlich und zieht sich meistens über Stunden hin wie zäher Kaugummi.
Victoria lehnt sich gegen die Waffenschränke. »Du darfst mich überall festbinden, aber bestimmt nicht mit den Teilen.«
Wenn man so darüber nachdenkt, um wessen Handgelenke die schon alles gelegen haben, überzieht einen die Art von Gefühl, die ganz bestimmt nicht zu Sex führt.
»Nachvollziehbar«, murmle ich, packe dann lieber Victorias Handgelenk und ziehe sie so vom Schließfach weg, damit ich die Waffe daraus hervorholen kann.
Victoria seufzt, bevor sie mich abschüttelt. »Was ist los, Bambi? Schlecht geschlafen?«
Klar, wenn es nur das wäre. »Vielleicht liegt’s ja daran, dass du mich ständig Bambi nennst.«
»Wegen der großen braunen Augen. Ich dachte, das wär offensichtlich.«
Ich stecke die Waffe in mein Holster und verriegle den Waffenschrank wieder. »Hätte ja auch mein Charakter sein können.«
»Hätte …« Victoria lacht leise. »Aber ich achte eher auf Körperliches.«
Klar, das habe ich letzte Woche gemerkt. Ist okay für mich.
Auf dem Weg nach vorn kommen wir an zwei Kollegen vorbei, die gleich in einem der drei Funkwagen unterwegs sein werden, die am Einsatz am Teufelsberg beteiligt sind. Die Arbeitsgruppe »Rave« wurde ursprünglich von der Direktion vor Ort gegründet, um den zig illegalen Musikveranstaltungen in und um Neukölln gerecht zu werden. Mittlerweile wird sie jedoch in ganz Berlin eingesetzt, weshalb Maxim aushilfsweise Verstärkung von anderen Abschnitten anfordern darf. Ich weiß, dass er absichtlich an meinen Hundertschaftsleiter herangetreten ist, weil wir ein paar erfahrene, knallharte Leute in unseren Reihen haben, aber stattdessen wurde ich nach Neukölln geschickt. Maxim lässt keinen Tag aus, um meine Grenzen auszutesten, womit es auch keine Gelegenheit gibt, bei der ich nicht demonstriere, was für ein krasser Kerl ich bin. Die anstehenden Einsätze bieten ausreichend Möglichkeit dafür.
»Ist jedes Mal albern, wenn wir einen illegalen Rave hochgehen lassen«, sagt Maxim, als wir auf ihn zusteuern. »Ich war gestern bei einem richtig guten, der auch im Rahmen des Secret Rave Festivals stattfand.«
»Tja, muss dich als Polizist aber kaltlassen.« Victoria hakt sich bei ihm unter. »Obwohl wir uns doch eigentlich einem Befehl widersetzen können, wenn der gegen unsere Moralvorstellungen geht.«
Maxim blickt zu ihr runter und grinst. »Der persönliche Musikgeschmack hat nichts mit Moral zu tun, Vici.«
»Dafür aber mit Gut und Böse«, mische ich mich ein, woraufhin Maxim mir kurz zunickt.
»Damit schon.« Er reibt sich die Schläfe, und das ein paarmal, bevor er abermals schmunzelt. Diesmal in meine Richtung. »Du hörst Harry Styles, nehm ich an.«
An meinem ersten Tag hätte ich diesen Spruch noch als Beleidigung eingeordnet, aber mittlerweile weiß ich, dass solche Sticheleien zu Maxims Umgangston gehören und unmittelbar dazu führen, dass ich einen unbeherrschten Konter auf der Zunge liegen habe.
Ich würde lieber freiwillig stundenlang die Füße meiner Schwester massieren, wenn sie ihre Tage hat, oder mit ihr zusammen auf ein Harry-Styles-Konzert gehen, als Maxim den Sieg zu gönnen. Deshalb krame ich nach irgendeiner Info, die mir Ria über ihren Lieblingskünstler verraten hat. Das sind mindestens zwanzig am Tag, deshalb dauert es, bis ich die passende finde.
»In Watermelon Sugar geht’s um Sex und den weiblichen Orgasmus«, sage ich grinsend, zeige Maxim dabei beide Zahnreihen, so wie er es eben getan hat. »Ich gehe aber davon aus, dass dir Letzteres eher fremd ist.«
Er räuspert sich. Dann zieht er die dunklen Augenbrauen zusammen, bis sie eine einzelne ergeben, was nur dann passiert, wenn –
»Fuck, was soll das?!« Ich reibe mir den Oberarm, weil Maxims Schlag schmerzhaft auf der Haut brennt, trotz Uniform.
»Sei nicht so frech«, sagt er trocken und schielt auf meinen Helm. »Gut, dass du den dabeihast, nicht wahr? Setz ihn lieber auf, damit die Haare nicht durcheinandergeraten.«
Ria würde Maxim für diesen Spruch die Zunge rausstrecken. Um der Versuchung zu widerstehen, erinnere ich mich daran, dass Maxim als Arbeitsgruppenleiter in der Polizei-Rangordnung über mir steht und ich auf seine Beurteilung in knapp sieben Wochen angewiesen bin. Das Geld, das mit der daraus resultierenden möglichen Beförderung einhergeht, brauche ich dringend, um weiterhin die Spielschulden meines Vaters zu begleichen und Glorias Traum vom Medizinstudium aufrechtzuerhalten. Wenn die bessere Position nur nicht so viel mehr Arbeitszeit in Anspruch nehmen würde, aber ich schätze mal, damit werde ich auch irgendwie zurechtkommen. Man bringt doch immer irgendeine Form von Opfer. »Geht klar, Chef.«
Maxim glättet sein schwarzes Haar und erwidert meinen Blick. »Das, zum Beispiel, klingt wie Musik in meinen Ohren. Wir sehen uns im Funkwagen.«
Er boxt mir abermals gegen die Schulter und ich strecke ihm nun doch die Zunge raus, aber erst, als er mir seinen breiten Rücken zugedreht hat.
»Richtiger Klappspaten«, knurre ich und bekomme von Victoria nur ein Schulterzucken zurück. Sie bestätigt mir das, was niemand hier laut ausspricht: So ist es eben, beschwer dich nicht.
Nur schaffe ich das ausgerechnet bei Maxim nicht. Worüber ich mir Gedanken machen sollte, definitiv. Es sollte mich eigentlich nicht weiter kümmern, wie herablassend er mich behandelt, weil ich meinen Mitmenschen wiederum oft mit weitaus weniger Respekt gegenübertrete. Sarkasmus, Ironie und dämliche Sprüche sind mein Halt. Meine besten Freunde, die mir helfen, nicht aus Versehen etwas auszuplaudern, über das ich schweigen muss.
Mein Blick findet wieder Maxim, der sich am Eingang zur Wache mit Victorias Streifenpartnerin unterhält. Ich unterdrücke ein weiteres Gähnen.
»Sicher, dass es dir gut geht?«, will Victoria erneut wissen.
»Ich komm schon klar«, winke ich ab und hole mein Handy aus der Hosentasche, um ihr nicht noch einen verwundbaren Charakterzug zu offenbaren. Keine Nachricht. Das ist gut, weil es bedeutet, dass mein Vater mich im Augenblick nicht braucht. Allerdings beweist mir der leere Sperrbildschirm auch, dass Levy immer noch wütend auf mich ist.
Wenn einer meine Verzweiflung über die neuen Kollegen und den ganzen anderen Mist, der im Moment schiefläuft, verstehen würde, dann Levy. Er war der Einzige, dem ich so gut wie alles anvertraut habe. Levy ist unfassbar ehrlich und direkt, er trägt sein Herz auf der Zunge. Eine Angewohnheit, die mich schon immer genervt hat. Aber dafür trifft er eben mit wenigen gezielten Nachfragen direkt auf den Kern meiner Probleme und bis zum Festival im Sommer war er zu hundert Prozent verlässlich.
Ich überlege, ob ich Victoria nicht zumindest wegen ihm ansprechen sollte, weil … seit er zusammen mit seiner Freundin Charlie in Irland ist, ignoriert er alle meine Nachrichten. Und das tut einfach nur weh. So weh, dass ich mir mittlerweile jedes seiner TikToks anschaue und manchmal darunter kommentiere. Obwohl ich mir Levys Ausführungen zu sexistischem Verhalten und toxischer Männlichkeit nur noch über einen Bildschirm reinziehe, habe ich trotzdem das alberne Gefühl, dass er immer noch für mich da ist. Weil … Scheiße, es gibt im Moment echt niemanden mehr, mit dem ich reden kann.
Gloria meint, dass sie zwischen den Stühlen und in dieser Sache auch eher auf Levys Seite steht. Womit sie recht hat. Ich weiß, dass ich Levy die Wahrheit über die Todesumstände seiner Ex-Freundin Sophie schon viel früher hätte sagen müssen und nicht erst, als er mich sozusagen dazu genötigt hat, mit ihm zu reden. Dass ich aus Angst um meinen Job geschwiegen habe, tut mir leid. Wirklich, wirklich leid. Deshalb habe ich Levy vor einem halben Jahr zum Berliner Flughafen gefahren, damit er Charlie dort sagen konnte, wie sehr er sie liebt. Trotzdem hat er mich vor deren gemeinsamem Work-and-travel-Aufenthalt in Irland um eine Auszeit gebeten und die besteht anscheinend weiterhin.
»Kommst du? Der Große wird sonst ungeduldig.« Victoria nickt in Richtung Eingang, wo Maxim gerade die Hand hebt, um uns zu sich zu rufen. Damit bleibt keine Zeit mehr, um mit ihr zu reden, was mir völlig egal zu sein hat. Denn wie ich vorhin schon festgestellt habe: So ist das eben, beschwer dich nicht.
Die Fahrt auf den Teufelsberg ist zwar lang, aber zu einer ausgedehnten Unterhaltung mit Maxim kommt es nicht, weshalb ich den Kopf zurücklehne und für einen Moment die Augen schließe. Das Wageninnere riecht nach kaltem Rauch. Niemand würde auf die Idee kommen, sich im Polizeiwagen eine Zigarette anzuzünden, doch der Gestank klebt an den meisten Uniformen. Ich rauche nicht und vielleicht bin ich deshalb ständig so scheißmüde.
Schwachsinn.
Eigentlich wollte ich auf der Wache wenigstens noch einen Kaffee trinken, wo Maxim dann aber lieber meine Männlichkeit infrage gestellt hat. Nun muss ich es eben ohne hinkriegen. Ohne Fehler und ohne vor Erschöpfung umzufallen.
Maxim parkt den Polizeiwagen neben den beiden anderen. »Lächerlich«, beschwert er sich beim Abschnallen. »So wie es da oben leuchtet, hätte früher oder später eh jemand die Polizei gerufen. Die Festivalveranstalter werden jedes Jahr dreister. Wird Zeit, dass wir sie drankriegen. Bereit?« Er schlägt mit der Faust auf das Lenkrad, bevor seine Hand schon wieder grob gegen meinen Arm donnert.
Ich atme einmal tief durch, ignoriere das Pochen in meinem Oberarm, den Maxim zum x-ten Mal heute malträtiert hat, und nicke. Ab jetzt bin ich nicht mehr Otis, sondern Polizist. Ohne schlechtes Gewissen, das ich so ziemlich jedem in meinem Umfeld gegenüber habe, und vor allem ohne Angst.
Ich steige zusammen mit Maxim aus, schalte meine Taschenlampe ein und gehe neben meinen Kollegen über platt gestampftes Gras auf den Rave zu. Jetzt sehe ich auch, was Maxim eben meinte: Das Bergplateau ist bunt erleuchtet. Rote und grüne Blitzlichter zucken über das verfallene Spionagezentrum bis runter in die Stadt, basshaltige Musik schallt uns von allen Seiten entgegen. Die Veranstalter geben einen Scheiß darauf, ob sie erwischt werden. Maxim hatte gestern also den richtigen Riecher. Er hat veranlasst, dass wir vorerst in einer kleinen Gruppe vorausgehen, um nicht aufzufallen. Im Geheimen lässt sich eine illegale Veranstaltung leichter hochnehmen. Dennoch hält sich eine zweite Gruppe in der Nähe auf, falls die Nummer eskaliert. Die Eigensicherung steht immer im Vordergrund. Aber ich schätze mal, dass wir die Verantwortlichen auch zu sechst drankriegen. In spätestens einer halben Stunde ist die Party aufgelöst.
»Ich knöpf mir den DJ vor«, befiehlt Maxim, kaum sind wir oben angekommen, und nickt an der tanzenden Menge vorbei einem jungen Mann zu, der gerade passend zum zugegeben krassen Beat beide Arme in die Luft reißt, bevor sein Blick zurück zu Victoria und den anderen Kollegen wandert. »Ich will, dass ihr hinten absichert. Otis checkt die Getränkeausgabe. Irgendetwas sagt mir, dass sie hier keine Verkaufslizenz vorweisen können. Aufs Stichwort ›Polizei Berlin, stehen bleiben‹ geht’s los. Verstanden?«
»Verstanden!«, wiederholen wir gemeinsam wie als Mantra. Mit einer Hand reibe ich mir dabei über die Brust, weil es da drin während Maxims Anweisungen enger geworden ist … Verdammt, ich bin so müde, dass ich gerade nicht in die professionelle Entschlossenheit finde, die mich sonst durch jeden Einsatz trägt.
Abermals atme ich tief durch und auf Maxims Brüllen hin renne ich auf den Campingtisch zu, der als Getränkestand dient. Beim Laufen merke ich, wie zur Enge in der Brust noch ein hohles Pochen im Magen hinzukommt. Dass ich seit dem Aufstehen nur zwei Äpfel gegessen habe, muss jetzt zur Nebensache werden, weshalb ich die Zähne aufeinanderbeiße. Den tätowierten Typen, der mit gesenktem Kopf an mir vorbeihetzt, lasse ich genauso außen vor wie die Getränkeausgeberin, die genauso panisch vor mir wegläuft.
Die beiden interessieren mich nicht. Ich habe es auf die kleine Frau mit Sturmmaske neben einem Campingtisch abgesehen, auf dem rote Plastikbecher stehen. Eine Maskierung wird meiner Erfahrung nach ausschließlich von Leuten getragen, die etwas zu verbergen haben: Veranstalter eines illegalen Rave-Festivals, beispielsweise.
Das Mädchen reißt seinen Kopf unschlüssig hin und her und blickt dann in meine Richtung. Wegen der Maske kann ich es nicht erkennen, aber ich schätze mal, es ist der klassische Fuck-ich-bin-am-Arsch-Blick, wegen dem ich mich eine Sekunde lang mies fühle. Denn das DJ-Kollektiv ist wirklich gut und … zur Hölle, warum denke ich gerade überhaupt über so was nach?
Jetzt hab ich die Kleine fast aus den Augen verloren.
Frustriert schlage ich einen Bogen und renne ihr hinterher.
»Halt! Polizei!«
Ich bin mir sicher, dass ich sie nicht noch mal zum Stoppen auffordern muss, denn die junge Frau hat überhaupt keine Kondition. Ihren keuchenden Atem kann ich bis zu mir hören, als sie Kurs auf ein von Bäumen geschütztes Waldstück nimmt. Abermals ziehe ich scharf die Luft ein und ein paar Sekunden später schmeiße ich mich auf sie, woraufhin sie sich unmittelbar mit Händen und Füßen gegen mich wehrt.
Meine lautstarke Ankündigung, dass ich von der Polizei bin, soll vorrangig absichern, dass sich hinterher niemand damit rausredet, vor einem vermeintlich Kriminellen weggelaufen zu sein. Die Veranstalter des Festivals sind Profis. Sie machen keine Fehler und sie kennen alle Tricks.
Kurz und knapp biete ich ihr nun eine simple Problemlösung an, die sie mit genau solch einem frechen Spruch ablehnt, wie ich ihn nach Maxims Sticheleien heute definitiv nicht mehr hören kann. Einen Augenblick später lasse ich ihr etwas mehr Bewegungsfreiheit, die sie dazu nutzt, um ihren Kopf umständlich zu mir nach hinten zu drehen. Ich erinnere abermals daran, dass mit mir zu kooperieren gerade die beste Option ist.
Wieder gibt sie mir keine eindeutige Zustimmung, verhält sich unkooperativ und angriffslustig. Professionell bleiben, rufe ich mir daher im selben Moment in Erinnerung, in dem ich dann doch einen eher patzigen Ton anschlage.
»Gut«, sage ich. »Dann machen wir es auf die harte Tour. Bist nicht die Erste, die darauf abfährt.« Ich weiß, wie unnötig vor allem der zweite Satz ist, und schon als er über meine Lippen kommt, bereue ich ihn. Aber so läuft das ständig – ich denke etwas Bescheuertes und bevor ich den Gedanken an der Leine zurückziehen kann, ist er schon ausgerissen und über meine Lippen gehuscht.
Das ist scheiße. Schließlich bin ich eigentlich kein pubertierender Teenager mehr. Aber an manchen Tagen kann ich einfach nicht anders und das Einzige, was mein erschöpfter Verstand gerade hinbekommt, ist, zu der Erkenntnis zu kommen, dass heute so ein Tag ist.
Im nächsten Moment nehme ich ein leises Schnauben wahr, als sich die junge Frau abermals windet, und dann erst ihr heiseres Lachen, das sich daruntermischt. Sie schafft es irgendwie, ihren Oberkörper unter mir zu drehen.
»Otis?«, fragt sie belustigt, und da weiß ich, dass ich vorhin recht hatte.
Die Schicht heute wird einfach nur beschissen.
EINS, ZWEI, POLIZEIDREI, VIER – FUCK.
Ella
Sein überraschter Blick schießt von mir über seine linke Schulter in die vage Richtung seiner Kollegen nach oben und wieder zurück. Muss der Abend so enden? Das ist unfair. Augenblicklich bete ich, Juan möge eine bessere Kondition haben als ich und dem Polizisten, der ihm dicht auf den Fersen war, entwischt sein. Ich meine, es ist immerhin mein DJ-Controller, den er sich panisch unter den Arm geklemmt hat. Die Situation ist doch einfach nur beschissen. Eigentlich erwarte ich, dass ich eindeutige Geräusche vom Plateau her höre, aus denen ich mir zusammenreimen könnte, was dort passiert, aber es ist mucksmäuschenstill … bis auf das Räuspern über mir.
Im Schein der Taschenlampe erkenne ich das weißblonde Haar wieder, das an den Seiten kurz geschnitten ist und nur vorne bis in die Stirn fällt. Der krasse Kontrast zu seinen dunklen Augen und den geschwungenen dichten Brauen darüber ist mir schon damals auf dem Festival aufgefallen, aber es verwundert mich, wie vertraut er mir ist. Als hätte Otis mir erst vor ein paar Stunden einen undeutbaren Blick zugeworfen, nachdem ich meinen Mund beim Rockfestival widerwillig auf seine stoppelige Wange gepresst habe.
Auch ohne seine unangebrachte Ankündigung eben hatte ich zugegeben noch im Ohr, wie seine Stimme klingt, wenn er … respektlosen Müll von sich gibt, der anscheinend selbst im Job unentwegt seine Lippen verlässt. Diese öffnen sich exakt in dieser Sekunde.
»Schön, dass wir uns anscheinend schon kennen«, sagt er und fährt sich mit den Fingern durchs Haar. Nur den linken Ärmel seiner Uniform hat er ein Stück hochgekrempelt. »Das verkürzt die Datenaufnahme.«
»Wow, dann ist heute ja mein Glückstag.« Keine Ahnung, wieso das gerade aus mir rauskam, aber wenn sich irgendwer anmaßt, automatisch recht zu haben, nur weil er eine Uniform trägt, verfalle ich in Sarkasmus. Und ganz offensichtlich ist Otis jemand, der zwar ziemlich viel Meinung hat, dafür aber wenig Ahnung, was gleich der nächste Satz unterstreicht.
»Ich nehm mal an, du und ich, wir befinden uns dann auch nicht zum ersten Mal in dieser Position?«
Bitte was?
Ich sehe, wie er herausfordernd die Augenbrauen zusammenzieht, und das reicht aus, um meinen Puls sofort wieder in die Höhe schnellen zu lassen. In meinen Schläfen fängt es an zu pochen, denn … Das ist so typisch für Otis. Deshalb konnte ich den Typen schon auf dem Festival nicht leiden, aber wahrscheinlich ist es in meiner Situation trotzdem sinnvoller, meine Abneigung ab jetzt auf sachliche Antworten zu beschränken. Denn ich glaube nicht, dass Otis mir eine Möglichkeit einräumen wird, ihm irgendetwas zu erklären. Er wirkt eher so, als könne er mir die halbe Nacht seine Macht demonstrieren und auf meinen Oberschenkeln hocken bleiben, die unter seinem Gewicht mittlerweile taub geworden sind. Dafür spüre ich den eiskalten Boden durch meine Kleidung hindurch nun umso deutlicher. Wenn ich mich wegen Otis verkühle, dann … dann halte ich das unbeherrschte Fick dich, das mir schon die ganze Zeit auf der Zunge liegt, nicht mehr zurück. Hätte ich doch wenigstens die blöde Ja…
O nein, die Werbeflyer in den Jackentaschen. Scheiße.
Ich blicke unauffällig nach rechts und links, kann das Stück Stoff in der Dunkelheit aber nirgendwo erkennen.
Das Gespräch muss also ganz dringend ohne weitere Provokationen funktionieren. Aber wenn ich einfach alles, was Otis zu mir sagt oder in dieser Uniform ausstrahlt, an mir abprallen lasse, wird das bestimmt klappen.
»Nein, du bist der erste Polizist, der auf mir draufsitzt«, murmle ich so sanft wie möglich und lächle gezwungen, was bestimmt ziemlich minderbemittelt aussieht, er aber unter der Maske zum Glück eh nicht sehen kann. Ich schlucke und öffne den Mund, um mich ein bisschen bei ihm einzuschleimen, aber … ich schaffe es nicht, mich auf Knopfdruck in jemanden zu verwandeln, der offensichtlichen Sexismus ignoriert. Ich kann Otis nicht damit durchkommen lassen, wenn er jetzt auch noch zweideutig grinst.
Ist das diese Uniform? Denkt er, er ist der König der Welt, wenn er ein paar Angeber-Abzeichen auf der Schulter trägt?
Was auch immer Otis glauben lässt, so mit mir umspringen zu können, ich schiebe mit zusammengebissenen Zähnen hinterher: »Auch privat nicht, wenn du es genau wissen willst. Für dich also noch mal zum Mitschreiben: Es wäre mir recht, wenn wir unser Gespräch auf die Situation hier beschränken würden, an der ich absolut unschuldig bin.« Was ich gerade eindrucksvoll bewiesen habe, indem ich maskiert vor einem Polizisten weggelaufen bin.
»Es wird dich wundern, aber exakt das behaupten auch jene Leute, die so ziemlich genau das Gegenteil davon meinen«, erklärt er in gelangweiltem Tonfall, doch seine Mundwinkel zeigen weiterhin nach oben. »Ich empfehle dir auf der Wache eine bessere Ausrede, falls ich dich dorthin mitnehme. Aber natürlich gilt erst mal die Unschuldsvermutung.«
Ich nicke nur, auch wenn es mir schwerfällt, die Klappe zu halten. Otis gibt mir nämlich gerade das Gefühl, dass es zwischen uns beiden gleich gewaltig krachen wird. Wie wenig er von mir hält, strahlt doch allein schon das breitspurige Grinsen in seinem Gesicht aus. Und eigentlich auch sonst jede verdammte Faser seines durchtrainierten Körpers.
»Kleine Bitte«, sage ich kurz angebunden und bewege im selben Moment meine Beine, die deshalb zu kribbeln anfangen. »Würdest du vielleicht erst mal von mir runtergehen?«
Ohne ein weiteres Wort hebt Otis das linke Bein über mich hinweg und kniet eine Sekunde später links neben mir. »Sorry«, sagt er und hört sich dabei kein bisschen so an, als würde er die Entschuldigung wirklich so meinen. Der darauffolgende Befehl klingt auch schon wieder zynisch. »Ich muss jetzt wiederum dich bitten, die Maske abzunehmen.«
Ich lache auf, halte dann aber inne, weil Otis nicht den Eindruck macht, als würde ihn der Spruch auch an einen billigen Porno erinnern. Er sieht aus, als ob er die wenig freundliche Unterredung gern schnell hinter sich bringen würde, und auch ein kleines bisschen erschöpft.
Während ich mich aufrichte, frage ich mich, warum sich so viele kleine, tiefe Fältchen um Otis’ Augen herum bilden. An die kann ich mich gar nicht erinnern. Charlie meinte, dass er die Ausbildung zum Polizisten gemeinsam mit ihrem Freund Levy begonnen hat, dann aber nach einem Jahr für ein weiterführendes Studium empfohlen wurde und dafür an die Fachhochschule wechseln musste. Was ich damit sagen will, ist, dass Otis dementsprechend nicht viel älter als Levy sein kann, vierundzwanzig allerhöchstens, und trotzdem dominiert eine Erschöpfung seine Gesichtszüge, die ich eher von meinen älteren Kollegen kenne. Ich würde lügen, würde ich behaupten, nicht wissen zu wollen, was Otis derart mitnimmt, was nur beweist, wie bescheuert ich bin. So viel zu meinem Plan, alles, was mir an ihm auffällt, an mir abprallen zu lassen. Es ist Otis. Der Mistkerl vom Festival, der für jede Situation einen unpassend sexistischen Spruch findet, was er mir erst vor ein paar Sekunden bewiesen hat, und der …
… anscheinend keine Geduld mehr mit mir hat.
Mit Nachdruck deutet er auf die Maske. »In deinem eigenen Interesse solltest du sie sofort abnehmen. Sonst muss ich das tun.«
»Was? Nein, ich mach ja schon.« Ich zögere nicht lange und ziehe den Stoff vom Gesicht.
»Oh.« Otis starrt mich an, als hätte er gerade Hannibal Lecter persönlich davon überzeugt, sein Gesicht zu enttarnen. Es gibt also doch eine Gelegenheit, bei der selbst Otis kein Spruch einfällt. Dafür ist mein Kopf jetzt voll damit und eine Anspielung auf den Horrorstreifen kann ich mir nicht verkneifen. »Keine Angst, ich hab keinen Hunger.«
Otis nickt nur.
Unschlüssig warte ich darauf, dass er etwas sagt, aber das tut er nicht. Was mich überraschenderweise genug verunsichert, dass ich kurz erkläre: »Wegen Hannibal Lecter. Der trägt eine Maske, damit er niemanden aufisst.«
»Schon verstanden.« Ohne die Miene zu verziehen, holt Otis einfach Block und Stift aus seiner Brusttasche, um mich kurz darauf mit einem Ausdruck anzusehen, der nun auf absolut keine Gefühlsregung mehr schließen lässt. Er erinnert mich an den Blick, den er mir nach unserem Kuss zugeworfen hat. Besser, ich wechsle das Thema.
»Was passiert jetzt? Ich habe nichts getan und –«
Otis unterbricht mich. »Hast du deinen Ausweis dabei?«
Sofort schießt mir Hitze ins Gesicht, weil ich der Anweisung der Veranstalter selbstverständlich gefolgt bin und meine Papiere deshalb zu Hause liegen. Außerdem … muss Otis eigentlich so tun, als ob wir uns noch nie begegnet wären? Ist »oh« wirklich das Einzige, was er mir zu sagen hat? Es ist doch offensichtlich, dass er weiß, wer ich bin. Ja, es ist ein halbes Jahr her, dass ich ihn zuletzt gesehen habe, aber damals habe ich ihn geküsst. Auf die Wange zwar und auch nur wegen Lenis bescheuerter Flunkyball-Zusatzregel, aber trotzdem.
Ich schlucke. Schlucke alles hinunter, was Otis mir nach dem Kuss damals gesagt, wie er mich angesehen hat. Langsam schüttle ich den Kopf, presse beide Hände rechts und links von mir auf den gefrorenen Boden, um aufzustehen, worauf Otis ohne Zögern reagiert.
Ruckartig beugt er sich vor, womit mir sein Gesicht für einen kurzen Moment so nah ist, dass ich die feine Narbe oberhalb seines rechten Nasenflügels erkennen kann. Sie ist verblasst und wahrscheinlich jahrealt. Dann steht Otis auf. Die Bewegung wirbelt seinen Geruch auf. Ich rieche kalten Rauch und nehme einen muffigen Hauch ungewaschener Kleidung wahr, was mir einen unangenehmen Schauder den Rücken entlangjagt.
Ganz automatisch weiche ich zurück. Dass Otis selbst raucht, glaube ich nicht. Der Gestank haftet nur an seinen Klamotten, weil er viel Zeit unter Rauchern verbringt. Das ist bei den Kids im Kindergarten hin und wieder auch so. Allerdings wird der schwache Geruch bei ihnen von Waschmittel übertüncht, mit dem ihre Eltern die Kleidung gesäubert haben. Otis’ Uniform hingegen hat wohl schon länger keine Waschmaschine mehr von innen gesehen.
Ich will nicht über die Hintergründe dafür nachdenken, befürchte aber, dass sich das meiner Kontrolle entzieht. Und das nervt mich. Mein Kopf ist gerade ein richtiges Klischee. Aber natürlich grüble ich jetzt darüber nach, weil ich es nicht ignorieren kann, wenn mir solche Dinge an jemandem auffallen.
Ich bin Erzieherin, und manchmal kommt es vor, dass selbst kleine Veränderungen an Kindern wie ungewaschene Kleidung ein Warnzeichen sein können. Nur sollte mir klar sein, dass es eine Milliarde Gründe haben kann, weshalb Otis seine Uniform nicht regelmäßig wäscht, und wahrscheinlich muss mir keiner davon Kopfzerbrechen bereiten. Vor mir steht ein erwachsener Mann, kein Kleinkind. Warum tue ich mir dann nicht selbst einfach den Gefallen und vergesse schleunigst wieder, dass Otis, seine müden Augen mit den zig winzigen Fältchen und die ungewaschene Uniform existieren?
»Mein Ausweis liegt zu Hause«, sage ich ihm die Wahrheit, als ich mich ebenfalls aufrapple, woraufhin Otis sofort einen Schritt nach hinten macht. »Ist das ein Problem?«
»Nein, du musst ihn nicht dabeihaben. Nenn mir bitte kurz deine Daten.«
Klingt das schon wieder total kompromissunfähig und überheblich? Shit, ich hätte Otis eben die Hölle heißmachen können, als ich die Maske vom Kopf gezogen habe und er das arrogante Riesenarschloch für zehn Sekunden links liegen gelassen hat. Stattdessen darf ich jetzt dabei zusehen, wie seine Augenbrauen wieder nach oben wandern, während er mit dem Kugelschreiber zweimal auf das weiße Papier in seinem Spiralblock tippt.
»Ich kann die Daten schnell überprüfen lassen und danach entscheide ich, ob es einen Grund gibt, dich mit auf die Wache zu nehmen.«
»Es gibt keinen.«
Otis unterdrückt ein Gähnen.
Klar, drück mir ruhig rein, dass ich dir deine kostbare Zeit raube.
Aber dann fällt mir ein, dass ich erst vor ein paar Minuten bemerkt habe, dass er müde aussieht. Könnte sogar sein, dass ich länger als eine Sekunde über die Gründe dafür nachgedacht habe. Ganz vielleicht tue ich das jetzt schon wieder. Eine schlagfertige Reaktion bleibt dementsprechend aus.
»In Ordnung, dann sag mir einfach deinen Nachnamen und um den Rest kümmere ich mich«, verspricht Otis nun, aber als ich daraufhin zu ihm hochschaue, bin ich mir da irgendwie nicht so sicher, weil seine strengen Gesichtszüge kein bisschen zu seinem Friedensangebot passen. Falls es überhaupt eines war.
Abermals tippt sein Stift auf den Block. »Heißt, du kannst im Anschluss daran gehen.«
Ich vertraue ihm nicht, kein bisschen. Aber welche Möglichkeiten bleiben mir?
»Okay, hör zu«, sage ich, »das hier ist wirklich wichtig. Ich bin Erzieherin und wenn ich einen polizeilichen Vermerk in mein Führungszeugnis bekomme, dann –«
»Kann das berufliche Konsequenzen nach sich ziehen?«
Mein ganzer Körper spannt sich bei seiner Nachfrage an. »Ja.«
Otis zuckt abermals mit den Schultern. »Das kann ich verstehen.« Mehr fügt er nicht an.
Warum …? Meine Gedanken überschlagen sich, weil sein überraschendes Verständnis zig Fragen aufwirft. Weshalb sollte gerade jemand wie Otis meine Situation nachempfinden können? Empathie und Mitgefühl erwarte ich eher von Leuten wie, keine Ahnung, Charlies Freund Levy, zum Beispiel. Der hat sogar einen TikTok-Kanal, auf dem er anderen mit seiner einfühlsamen Art hilft. Aber Otis …
»Ist das jetzt irgend so eine Polizeimasche?«
»Was?«
»Ob du das nur sagst, damit ich nachgebe? Du spielst mir falsches Verständnis vor, damit ich dir vertraue und etwas zugebe, das ich nicht getan habe.«
»Ja, natürlich. Auf der Wache zerschlage ich dann kurzerhand unsere Vertrauensbasis und werfe dich zusammen mit irgendwelchen Schwerverbrechern in eine Zelle.« Er deutet eine Geste an, die meine geistige Zurechnungsfähigkeit infrage stellt.
»Wo ich deiner Meinung nach auch hingehöre, richtig?«
Otis seufzt, als er mit dem Daumen die Stelle oberhalb seines Nasenflügels massiert, wo mir vorhin die feine Narbe aufgefallen ist. »Das habe ich nicht gesagt.«
»Aber gemeint«, platzt es aus mir heraus. »Tut mir wahnsinnig leid, dass ich im Plattenbau groß geworden bin und es nur zur Erzieherin gebracht habe. Kann ja nicht jeder so … so makellos sein.«
»Wie ich?«
»Ja«, sage ich aufgebracht und bin sofort verunsichert. Mir ist auf die Schnelle kein besseres Wort eingefallen, weil Otis mich mit seinem Stiftgewackel wahnsinnig macht. Dadurch zuckt mein Blick ständig zu seinem Daumen und Zeigefinger, mit denen er den Kugelschreiber festhält, und seine Hände sind nun einmal makellos. Otis hat schöne Fingernägel, kurz und gepflegt, und jetzt frage ich mich ernsthaft, ob er regelmäßig zur Maniküre geht. Ist das etwas, das Otis tun würde? Die Vorstellung ist jedenfalls so witzig, dass ich spontan grinsen muss.
Das bemerkt Otis anscheinend nicht, denn er zuckt einmal mehr mit den Schultern. »Aha.«
Typisch. Jetzt habe ich mich ja doch von ihm provozieren lassen und viel zu lange über das nachgedacht, was er tut und sagt. Toll. Ganz, ganz toll. In meinem Magen beginnt es zu ziehen.
»Es ist ganz sicher kein Trick, wenn ich dir sage, dass ich Verständnis für deine Situation habe.« Otis’ Blick wandert langsam runter zu meinen verkrampften Händen und wieder hoch. »Ich brauche der Vollständigkeit halber aber dennoch deinen Nachnamen. Den Rest kläre ich oben mit den Kollegen. Wenn ich sage, dass ich mich darum kümmere, dann tue ich es auch.«
Ich reibe mir die Augen, weil es in ihnen anfängt verräterisch zu brennen. Das alles ist so scheiße. Ich will keine Schwäche, keine Angst zulassen und am allerwenigsten will ich, dass mich Otis’ Verständnis eigenartig berührt. Er ist ganz sicher nicht der Typ, in dessen Hände ich mein Schicksal legen möchte. Große Hände, zugegeben, mit durchtrainierten Oberarmen, superbreiten Schultern und, äh, Fingern. Die streckt er gerade mit einem Lächeln nach mir aus. Ein Lächeln, das definitiv nicht spöttisch ist, sondern versöhnlich und verständnisvoll.
»Ich verspreche es dir … Ella.«
Für einen Moment blitzt das Gefühl vom Festival wieder in mir auf. Das Gefühl nach unserem Kuss und seinen Worten. Ein völlig unangebrachtes Kribbeln, das mir dämlicherweise einreden will, dass Otis jemand ist, den ich, ganz egal, wie wenig wir uns leiden können, nachts um vier anrufen und dem ich vertrauen könnte. Was zur Hölle? Das Gefühl habe ich schon auf dem Festival nicht kapiert und dass es jetzt wieder auftaucht, macht mich wahnsinnig. Es passt so gar nicht zu meiner Vorstellung von einem Gespräch mit Otis, aber immerhin verdrängt es das unangenehme Ziehen. Zerknirscht konzentriere ich mich auf die silberfarbene Dienstnummer auf seiner Brust. Mehrfach wiederhole ich die Zahlenfolge still im Kopf, bis …
»Ella?«
Ich blicke hoch und direkt in Otis’ Gesicht, auf dem ein Ausdruck liegt, der mir verspricht, dass wir das hinkriegen. »Ja?«
»Ich brauche deinen Nachnamen.«