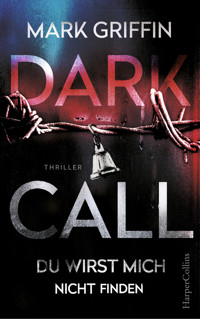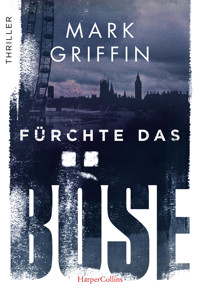11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Holly Wakefield
- Sprache: Deutsch
Ein Junge wird ermordet in einem Londoner Park gefunden, fast nackt und arrangiert, als würde er schlafen. In seiner Hand befindet sich eine Kette mit einem Engelsanhänger. Der ermittelnde Detective Inspector Bishop bittet Profilerin Holly Wakefield um Hilfe. Es ist ihr zweiter gemeinsamer Fall. Doch sie kommen dem Täter nicht auf die Spur. Stattdessen finden sie eine zweite Leiche. Zahlreiche Jungs im Teenageralter werden in London vermisst. Wie viele von ihnen hat der Mörder bereits auf dem Gewissen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
HarperCollins®
Copyright © 2020 für die deutsche Ausgabe by HarperCollins in der HarperCollins Germany GmbH, Hamburg
© 2019 by Mark Griffin Originaltitel: »When Angels Sleep« Erschienen bei: Piatkus, London
Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur AG, Zürich Coverabbildung: kzww, sergio34 / Shutterstock E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783959679121
www.harpercollins.de
Widmung
Für meine wundervolle Schwester Melissa und ihre drei gescheiterten Attentatsversuche auf mich, als wir noch Kinder waren. Ihre Unterstützung, ihre Liebe und ihr Verständnis kennen keine Grenzen.
Für meine großartige Nichte Natalie, die eines Tages die Fackel tragen und andere leiten wird.
Und für meinen Freund MJ.
Mögen wir alle achtsam unseren Weg gehen.
Eins
Der Mann sang auf der Heimfahrt von der Arbeit leise vor sich hin.
Er hatte eine sehr schöne Stimme. Wohlklingend, hatte sein Gesangslehrer einmal zu ihm gesagt – wie eine Nachtigall, die man im Dunkeln fliegen lässt. Früher in der Schule oder in der Kirche hatte er beim Singen immer die Augen geschlossen und seine Gedanken treiben lassen.
Es gibt keine Schönheit in meinem Leben, hatte er oft gedacht. Keine Magie. Aber ich spüre die Liebe. Sie kommt näher. Jeden Tag ein Stückchen näher.
Mit dreizehn hatte man ihn gebeten, dem Chor beizutreten – eine große Ehre an einer Schule mit zweihundert Schülern. Noch im selben Jahr hatte man ihn gefragt, ob er an Weihnachten in der St Mary’s Church in Chigwell das Solo singen wolle, und als seine Mutter zwischen all den anderen Müttern und Vätern in einer der hölzernen Bänke gesessen und ihm zugehört hatte, war er für einen ganz kurzen Augenblick im Himmel gewesen. Danach hatte es keinen Applaus gegeben, und er war auch nicht mit einer Umarmung empfangen worden, aber das flüchtige Lächeln hatte ihm ausgereicht. Das war jetzt bald zwanzig Jahre her. Wie sehr er sich seitdem verändert hatte.
Er bog in seine Einfahrt ein, parkte den Wagen und stieg aus. Es war Februar und kalt. Gräuliche Schneeklumpen bedeckten den Rasen, und der Boden war glatt vor Nässe. Ein kurzes Winken, damit die durch einen Bewegungsmelder gesteuerte Lampe anging und er das Schloss sehen konnte, dann sperrte er die Tür auf. Das Haus war dunkel. Es war immer dunkel. Schwarze Holztäfelung, triste braune Fußböden. Im Flur ein schauerlicher Garderobenständer mit einem Elefantenfuß als Sockel. Er schaltete das Licht ein. Tiffanyglas, das gummibärchenbunte Flecken an die Wände warf. Er stellte seinen Koffer auf dem Garderobenständer ab und rief die steile Treppe hinauf.
»Hi, Mum!«
»Bist du es?«
»Ja!«
»Du bist aber früh dran.«
»Ich gehe nachher noch aus.«
»Was?«
»Ich gehe noch aus. Weißt du nicht mehr?«
Er ging in die Küche und stellte den Kessel auf den Herd, um sich eine Tasse Tee zu machen. Fünf Minuten später legte er zwei Würstchen in die Bratpfanne und sah zu, wie sie, dicken Fingern gleich, vor sich hin brutzelten, bis sie auf allen Seiten gebräunt waren. Er kochte Erbsen, schnitt die Würstchen in mundgerechte Stücke, butterte zwei Scheiben Vollkornbrot, stellte alles zusammen auf ein Tablett und legte Besteck dazu.
Die Treppenstufen knarrten erstaunlich wenig für ein altes Haus wie dieses, ein ungeliebtes Relikt aus viktorianischer Zeit. Er saugte zweimal die Woche, doch der Staub legte sich sofort wieder auf die Oberflächen, als würde ihn jemand darübersieben. Oben angekommen, konnte er sich nicht verkneifen, mit dem Finger über das Geländer zu streichen. Er wandte sich nach links, ging an zwei Schlafzimmern sowie dem Bad vorbei und betrat das Zimmer seiner Mutter. Die Vorhänge waren bereits zugezogen, das einzige Licht kam von einer Lampe auf dem Nachttisch. Wie eine riesige Krähe saß die fünfundsechzigjährige Frau im Bett. Von Kissen gestützt, die ausgemergelten Arme auf der Bettdecke, das Nachthemd aus schwarzer Spitze bis zum Hals zugeknöpft. Ihr Kopf hing nach vorn und war leicht zur Seite geneigt. Ihr Blick schien ihm überallhin zu folgen, auch wenn sie gar nicht ihren Kopf bewegte.
»Wo willst du denn hin?«
»Das habe ich dir doch gesagt, Mum. Eine Betriebsfeier.«
»Eine Betriebsfeier?«
Behutsam stellte er das Tablett mit dem Abendessen auf ihren Schoß.
»Na, komm. Iss, bevor es kalt wird.«
Seine Mutter starrte den Teller an, dann nahm sie Messer und Gabel und begann zu essen. Geräuschvoll kaute sie ein Stückchen Wurst. »Wann bist du zurück? Als du das letzte Mal weggegangen bist, dachte ich, du wärst tot.«
»Könnte spät werden. Wir gehen in den Cosy Club, das ist …«
»Die Einzelheiten interessieren mich nicht. Ich hoffe doch, ich habe dich nicht zu einem dieser Jungen erzogen, die einem immer alles haarklein erzählen müssen, sobald man ihnen eine Frage stellt?«
»Nein, Mum. Natürlich nicht.«
Einige Erbsen waren auf die Bettdecke gerollt, wo sie herumkullerten wie winzige Murmeln. Der Mann wollte sie einsammeln, doch ein kurzer Schlag mit der Gabel auf seine Finger ließ ihn innehalten.
»Ich bin noch nicht fertig damit. Hör auf zu glucken! Und wo ist mein Tee?«
»Den habe ich vergessen«, sagte er und verließ rasch das Zimmer.
Unten setzte er noch einmal den Kessel auf und kochte seiner Mutter eine Tasse Tee. Er legte zwei Kekse auf einen kleinen Teller und kehrte nach oben zurück. Als er ins Zimmer kam, fummelte sie gerade an der Nachttischlampe herum. Die Glühbirne flackerte, als würde sie SOS morsen.
»Mum, was machst du denn da?«
»Ich will nur diese … Das tut sie ständig.«
»Alles halb so schlimm. Warte.« Er stellte den Tee und die Kekse aufs Bett, ging auf die andere Seite des Zimmers und schob dort ihren Rollstuhl zur Seite. Kniete sich neben das Waschbecken und öffnete die kleine Tür dahinter. Er verschwand im Nebenraum, und als er etwa eine Minute später wiederkam, hatte das Licht aufgehört zu flackern. Er schloss die Tür und schob den Rollstuhl an seinen Platz zurück. »So, bitte sehr. Jetzt brennt sie ordentlich. Ich muss mich dann auch fertig machen.«
Er hatte bereits am Morgen geduscht und sich rasiert. Nun öffnete er den Koffer, den er auf seinem Bett zurechtgelegt hatte. Betrachtete die sorgsam gefalteten Kleidungsstücke darin und legte noch ein Paar flache Schuhe sowie ein iPhone dazu. Er schenkte sich selbst ein Lächeln im Spiegel, doch es erstarb abrupt, als ihn eine plötzliche Traurigkeit überkam. Hör auf, ermahnte er sich und fasste nach dem Medaillon des Heiligen Judas Thaddäus, das er um den Hals trug. Hör auf. Hör auf. Sein Blick ging zur Decke, von wo aus der gemalte Engel ihn beobachtete. Er hielt einen Moment lang inne.
Als er zurück ins Zimmer seiner Mutter kam, schlief diese bereits. Ihr Schnarchen klang wie Wellen, die sanft an den Strand schlugen. Der Mann war unsicher, ob er sie wecken sollte, aber …
»Ich gehe jetzt, Mum.«
»Hmm …«, machte sie.
Er beugte sich zu ihr herab und gab ihr einen Kuss auf die Wange. Roch ihren Atem, ihr altes Haar. Sie blinzelte ihn aus ihren wässrigen, zusammengekniffenen Augen an und wischte sich etwas Wurstfett vom Kinn.
»Wo ist Stephen?«, flüsterte sie.
»Warte nicht auf mich«, sagte er, obwohl es ihm die Kehle zuschnürte.
Er nahm das Tablett mit nach unten. Wusch ab, räumte alles weg und stellte fürs Frühstück eine Schachtel Weetabix auf dem Küchentisch bereit.
»Tschüs, Mum!«, rief er nach oben, ehe er in den Flur trat. Doch er ging nicht. Er öffnete die Haustür, schlug sie wieder zu und stand dann mucksmäuschenstill da. Lauschte auf leise Schritte oder das Scharren von Möbeln. Wagte kaum zu atmen. Fünf Minuten. Zehn. Nichts. Dann erhaschte er einen Blick auf sein Bild im Flurspiegel, und die Traurigkeit brach über ihn herein wie eine schwarze Flutwelle. Er ließ den Kopf auf die Brust sinken und weinte eine geschlagene Minute lang. Es war ein Weinen, von dem er nicht wusste, ob es jemals wieder aufhören würde, und der Schädel tat ihm weh, und sein Herz pochte, und sein Gesicht sah furchtbar aus, aber das war ihm egal. Er konnte nichts sehen, weil alles verschwommen war und ihm nichts mehr wirklich erschien, und er spürte auch keine Schmerzen, denn Schmerzen gab es nicht mehr – es gab nur noch die ewige, dumpfe Last seiner Traurigkeit.
»Was bin ich nur für einer …«, schniefte er. Doch nach einer Weile hatte er sich wieder gefangen, denn tief im Innern kannte er die Antwort.
Er war ein einsamer Mann, der so viel Liebe zu geben hatte und nicht wusste, wohin damit.
Zwei
»Bist du betrunken?«
Das war eine gute Frage.
Etwa zwei Stunden zuvor hatte jemand einen Nagel in Holly Wakefields Kopf geschlagen, und sosehr sie sich auch bemühte, ihn zu finden, sie bekam immer nur Haare zu fassen. Ungewaschene Haare. Stinkige Haare. Zigaretten und Rhabarber-Gin.
»Könnte sein«, antwortete sie mit schleppender Zunge.
Sie brachte sich in eine aufrechte Position und öffnete die Augen, orientierungslos und verängstigt wie eine neugeborene Spitzmaus. Und dann war da auf einmal ein Gefühl, das sie lange nicht mehr gehabt hatte: Ihr Magen krampfte sich zusammen. Sie schloss die Augen wieder, als der Raum sich um sie zu drehen begann, und überlegte, ob sie sich womöglich gleich übergeben würde.
»Musst du dich übergeben?«
Wieder eine ganz ausgezeichnete Frage. Detective Inspector Bishop war wirklich in Topform.
»Möglich.«
Halt es zurück. Halt es zurück. Um Gottes willen, halt es zurück.
Wessen Vorschlag war es gewesen, um halb fünf Uhr morgens Schnäpse zu trinken? Es hatte am Vorabend um acht Uhr mit Gin Tonics angefangen. Ein Wiedersehen mit den Mädchen aus Blessed Home, dem Kinderheim, in dem sie aufgewachsen war. Valerie, Sophie Savage, Michelle, Joanne, Zoe. Gin in zweiundsechzig verschiedenen Geschmacksrichtungen? Wer hätte das überhaupt für möglich gehalten?
Danach hatten sie beschlossen, was essen zu gehen.
In Soho. Wo auch sonst?
Im Balans in der Old Compton Street – oder?
Gegen zwei Uhr hatte man sie rausgeschmissen, und sie waren in einen Privatclub in der Shaftesbury Avenue weitergezogen. The Connaught oder so. Nein – The Century Club, so hieß er. Valerie war Mitglied, deshalb hatte man sie reingelassen. Sie waren bis zum bitteren Ende geblieben. Im Club hatte die Party erst richtig begonnen. Sophie war auf einen der Kellner scharf gewesen, und der hatte ihnen einen unglaublich komischen Witz über einen Mann erzählt, der betrunken nach Hause kommt und sich noch einen Tee machen will. Wie ging der noch gleich? Ein Betrunkener kommt nach Hause und macht sich einen Tee. Im Bett fragt er seine Frau, ob Kanarienvögel Füße haben … Nein, das stimmte so nicht.
»Der Kanarienvogel …«
»Was?«, sagte Bishop.
»Leise. Das war der Witz von gestern Abend. Ich versuche mich daran zu erinnern. Der war echt lustig.«
War es ein Kanarienvogel? Vielleicht war es auch ein Wellensittich oder ein Papagei? Es würde ihr schon wieder einfallen. Und wenn nicht, konnte sie immer noch eins der Mädels fragen. Ach – die Mädels. Ihre Mädels. Allesamt erwachsen geworden. Alle wunderschön und klug und stark und großartig. Knallhart, wenn es sein musste. Gute Freundinnen. Nostalgie pur bis zur letzten Runde. Ab vier Uhr waren die Drinks umsonst gewesen, sie hatten auf der Terrasse Zigarren geraucht, und dann hatte das Singen angef…
Jemand führte sie irgendwohin. Sanfte Hände. Eine an ihrer Schulter, die andere in ihrem Rücken.
»Wo gehen wir denn hin?«
»Zur Toilette.«
»Ich glaube, das geht schon.«
Magenkrampf Nummer zwei, und gleich darauf ein metallischer Geschmack hinten am Gaumen. Sie spürte, wie ihre Kiefer sich öffneten und ihr Körper kurz davor war …
»Bitte nicht zuschauen, bitte nicht zuschauen«, flüsterte sie.
Die Hände halfen ihr, sich auf den Boden zu setzen, und sie spürte die flauschige Badematte unter ihren Knien. Wie von selbst umgriffen ihre Finger den Rand der WC-Schüssel, und im nächsten Moment kam ihr alles hoch.
Er hielt ihre Haare, während sie sich erbrach.
Und noch einmal erbrach.
»Gut gezielt«, sagte er. Sie hatte keine Ahnung, ob das sarkastisch gemeint war.
Ob er jetzt immer noch auf mich steht?
Als sie fertig war, musste sie plötzlich lachen, weil ihr die Pointe des Witzes wieder eingefallen war. Es ging um Zitronen! Der Betrunkene fragt seine Frau, ob Zitronen kleine gelbe Füße haben. Nein, sagt seine Frau, und daraufhin meint der Betrunkene: Oh, dann habe ich wohl den Kanarienvogel in den Tee gedrückt.
»Genial«, sagte sie, ehe sie sich mit dem Handrücken den Mund sauber wischte. Auf einmal ergab alles einen Sinn.
»Besser?«
Sie saßen mittlerweile im Brickwood Coffee & Bread, einem kleinen Frühstückscafé in Balham im Südwesten von London. Nacktes Gemäuer und Holzbalken an den Wänden, dazu ein üppiges Angebot an hausgemachten, vollwertigen Speisen und langsam geröstetem Kaffee. Holly hatte sich gegen etwas zu essen entschieden und nur einen Grünkohlsmoothie bestellt. Er hatte geschmeckt wie das, was der Rasenmäher übrig ließ, aber immerhin war er ihr nicht wieder hochgekommen. Braver Magen. Hab dich lieb. Jetzt schlürfte sie einen schwarzen Kaffee.
»Stinke ich nach Kotze?«, wollte sie wissen.
»Nach Kaffee und Schlafmangel, das rieche ich bis hier.«
»Was soll ich sagen? Ich habe eben Klasse.« Sie lächelte, und plötzlich fiel ihr ein, dass sie sich noch nicht mal die Zähne geputzt hatte. Die Kellnerin brachte Bishops englische Frühstücksplatte. Bei ihrem Anblick erschauerte Holly, als wäre sie einem Horrorfilm entsprungen.
»Ist das Black Pudding?«
»Ja, willst du auch welchen?«
»Eher würde ich meine eigenen Füße essen.«
»Was ist aus deinem ursprünglichen Plan geworden? ›Heiße Schokolade und danach vielleicht noch ein schöner Film, falls wir Lust haben‹?«
»Wir hatten die besten Absichten, aber dann ist alles ziemlich schnell außer Kontrolle geraten. Gutes Essen. Gute Drinks. Ich mag meine Mädels.«
»Ich weiß«, sagte er schmunzelnd. »Hattest du vergessen, dass wir zum Frühstück verabredet waren?«
»Nein.«
Doch.
Als sie um halb sieben kurz hinter der Wohnungstür zusammengebrochen und auf dem Bauch ins Schlafzimmer gerobbt war, war es ihr ganz kurz wieder eingefallen.
»Ich habe was für dich«, sagte er.
»Einen zweiten Kaffee?«
»Wenn du möchtest.«
Er bestellte noch einen Kaffee, dann reichte er ihr einen dünnen Hefter aus Pappe ohne Etikett oder Aufschrift auf der Vorderseite. Sie wollte ihn aufschlagen, doch er schloss ihn sanft in ihren Händen.
»Nicht während des Frühstücks«, sagte er. »Das ist der Abschlussbericht des letzten Falls.«
Ein Duo, das einem so richtig die Laune vermiesen konnte. Beide Killer waren richtige Mistkerle.
Es war fast vier Monate her, seit DI William Bishop von der Metropolitan Police bei ihr angerufen und sie gebeten hatte, ein Wohnzimmer zu besichtigen, in dem die ermordeten und grausam verstümmelten Leichen von Jonathan und Evelyn Wright lagen. Er war Arzt gewesen, sie seine treu sorgende Ehefrau. Vierzig gemeinsame Jahre, ausgelöscht durch einen Flachhammer und eine scharfe Klinge.
Angela Swan, die Gerichtsmedizinerin, hatte während der Autopsie festgestellt, dass die Verletzungen von Evelyn mit denen aus einem älteren Mordfall übereinstimmten. Drei Wochen zuvor war Rebecca Bradshaw, Flugbegleiterin bei British Airways, getötet worden. Der Mörder hatte ihren Leichnam wie eine lebensgroße Plastikpuppe auf ihrem Bett drapiert. Aufgeschlitzte Pulsadern. Der Kopf war ihr auf die Brust gesackt, als schliefe sie. Drei Morde, eine ähnliche Vorgehensweise, und ehe sie sich’s versah, hatte Holly es mit einem Serienmörder zu tun.
Bis dahin war ihr Leben in eher ruhigen Bahnen verlaufen. Nun ja … ihre Eltern waren ebenfalls durch einen Serienmörder ums Leben gekommen, und sie war im Heim aufgewachsen … Aber sie schätzte sich trotzdem glücklich. Sie war fleißig gewesen, hatte die Schule beendet und dann Kriminologie studiert. Aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen mit dem Tod hatte sie sich immer für das Warum interessiert. Warum töten Sie, Herr Soziopath? Wie kommt es, dass Ihr Gehirn tick-tick macht statt tick-tock?
Mittlerweile lehrte sie Verhaltenspsychologie am King’s College in London. Den Rest ihrer Arbeitswoche verbrachte sie im Wetherington Hospital in der Cromwell Road im Royal Borough of Kensington and Chelsea, wo sie sich um psychisch erkrankte Patienten mit Hang zum Töten kümmerte.
Zusammen mit DI Bishop war es ihr gelungen, zwei der brutalsten und cleversten Mörder zu fassen, die England je gesehen hatte. Die Spur hatte – wie romantisch – zu einem Cottage am Meer nahe Hastings geführt. Am Ende hatte sich der eine das Genick gebrochen, und Holly hatte dem anderen den abgebrochenen Oberschenkelknochen eines seiner früheren Opfer ins Herz gerammt. Alles in allem zwei ereignisreiche Wochen.
Die Staatsanwaltschaft hatte kurz erwogen, wegen des Todes der beiden Männer Anklage gegen sie zu erheben, doch der Commissioner und Chief Constable Franks hatten zu ihren Gunsten interveniert, und die Ermittlungen waren schnell wieder eingestellt worden. Zum ersten Mal seit Langem hatte Holly das Gefühl gehabt, dass es Menschen gab, die ihr helfen wollten. Dass sie nicht allein war. Dass sie so etwas wie eine Familie hatte. Sie betrachtete Bishop, während sie mit der Akte spielte. Sie brannte darauf, darin zu lesen, doch stattdessen legte sie sie beiseite.
»Ich will niemals erfahren, wo sie begraben sind«, sagte sie.
»Das dachte ich mir schon.«
Ihr nächster Kaffee kam, und sie trank ihn in einem Zug aus.
»Ich habe endlich wieder ein Leben, William«, sagte sie. »Ich verkrieche mich nicht mehr in meiner Wohnung. Ist ganz nett hier draußen unter den Menschen.«
»Weil die Menschen ganz nett sind. Die meisten jedenfalls. Wann hast du deinen nächsten Arzttermin?«, wollte er wissen.
»In ein paar Stunden.«
»Soll ich dich hinfahren? Oder abholen?«
»Ja, bitte. Vielleicht finde ich sonst den Weg nicht.« Sie lächelte, und im nächsten Moment klingelte sein Telefon. Holly beobachtete ihn während des Gesprächs. Er sah jünger aus als dreiundvierzig. Vielleicht war er beim Frisör gewesen, oder das Licht schmeichelte ihm. Er lauschte eine Weile, dann legte er stirnrunzelnd auf. Warf Holly einen Blick zu und widmete sich wieder seinem Frühstück. Unentschlossenheit – flüchtig, aber spürbar.
»Ich muss los.« Er winkte der Kellnerin, damit sie die Rechnung brachte. »Es tut mir leid, Holly.«
»Was ist passiert?«
»Eine Leiche. Ein neuer Fall.«
»Kann ich mitkommen? Ich sollte besser mitkommen. Warte kurz, ich bin gleich …«
»Nein. Bleib sitzen. Geh zu deinem Arzttermin. Vergewissere dich, dass alles in Ordnung ist.«
»Es ist alles in Ordnung, Bishop. Ich will helfen.«
»Das glaube ich gern, aber es ist noch zu früh.«
»Sag mir wenigstens, worum es geht.«
»Ich rufe dich später an.«
Er legte genügend Geld auf den Tisch und ging. Die Kellnerin kam zurück, noch ehe die Tür des Cafés hinter ihm ins Schloss gefallen war.
»Mehr Kaffee?«
Holly gelang ein Lächeln, auch wenn es vielleicht etwas zittrig aussah.
»Immer her damit.«
Drei
Ihr Bruder Lee las ein Buch, als sie seine Zelle betrat.
Er knickte mit großer Sorgfalt eine Ecke um, klappte das Buch zu und legte es mit dem Titel nach unten auf den Tisch. Holly nahm ihm gegenüber Platz. Neutrale Körpersprache. Neutraler Gesichtsausdruck.
»Wir geht’s dir heute, Lee?«
»Ganz prima. Und dir? Was ist mit dem gebrochenen Bein und dem eingeschlagenen Schädel?«
»Tun immer noch weh.«
»Ja, dein Gesicht bringt mich um.« Er versuchte sich an einem Lächeln, gab es jedoch rasch wieder auf. »Tut mir leid, die Gespräche hier sind so öde. Die Therapeuten. Du bist die Einzige, die meinen Humor versteht. Mit der ich ein bisschen Spaß haben kann.«
»Wann war deine letzte Sitzung bei Mary?«
»Mary, Mary, kleiner Dickkopf, wie wächst ihr Garten denn?«, zitierte er den alten Kinderreim und tat so, als würde er an einem Joint ziehen. »Wahrscheinlich miserabel. Wir haben uns vor zwei Tagen gesehen.«
»Worüber habt ihr diesmal gesprochen?«
»Gardenien und Rosen, Feen und versteckte Baumhäuser.«
»Ernsthaft?«
»Nein. Wir reden über alles Mögliche. Sie hat mir ein neues Medikament verschrieben. Ich nehme alles bunt durcheinander. Sie meint, es würde mir helfen, aber es macht mich müde. Reizbar.«
»Was hat sie dir denn verschrieben?«
»Clozapin. Dreckszeug.«
»Das wusste ich nicht. Tut mir leid.«
»Ist ja nicht deine Schuld, Schwesterherz.«
»Sonst noch irgendwelche Nebenwirkungen?«
»Unterleibskrämpfe. Nichts Schlimmes. Nicht so, als würde ich ein Kind gebären oder so.«
»Was ist das für ein Buch?«, erkundigte sie sich.
Er drehte es um und warf einen Blick auf den Titel.
»Einführung in das Migrationsmuster der gemeinen britischen Schnecke.«
»Wie liest es sich so?«
»Zäh. Eine packende Geschichte von Verdauung und Ausscheidung.« Eine kurze Pause. »Ich kann es übrigens an dir riechen.«
»Was?« Sie schnupperte an ihrer Jacke, an ihren Haaren. »Den Alkohol? Nein, kannst du nicht. Ich habe geduscht.«
»Spaß gehabt gestern Abend?«
»Ja.«
»Ich hatte auch einen schönen Abend. Ich habe Instant-Nudeln gegessen und mir in meiner Zelle einen runtergeholt.«
»Das ist keine Zelle, es ist ein Zimmer.«
»Ach so, natürlich. Hotel Wetherington, ich vergaß. In dem Fall wüsste ich gern, bei wem ich mich beschweren kann, mein Wasserbett hat nämlich ein Loch, und der Massagesessel geht ständig aus.« Er war offenbar zu Scherzen aufgelegt. »Oh, und außerdem riecht alles nach Kartoffelbrei und Pisse. Als was würdest du diesen Ort denn bezeichnen?«
»Als eine geschlossene psychiatrische Einrichtung.«
»Damit machst du ihn mir auch nicht gerade schmackhafter, Schwesterherz. Wie wäre es hiermit: sehr schöne Einzimmerwohnung, in einem begehrten Viertel Londons gelegen, Gemeinschaftskantine fußläufig erreichbar. Die Wohnung ist möbliert mit einem Einzelbett, einem Tisch und zwei Stühlen sowie einer modernen, fest installierten Musikanlage und profitiert von bruchsicheren Kunststofffenstern mit wunderschönem Panoramablick auf die umliegenden Backsteinmauern.«
»Sehr witzig.«
»Außerdem in der Ausstattung enthalten sind unzuverlässige Elektrik, Besucherparkplätze am Straßenrand sowie ein kleiner, aber gepflegter Garten hinter der Anlage, der jeden Tag für eine Stunde, in der Regel unmittelbar vor dem Dunkelwerden, betreten werden darf.«
»Bist du fertig?«
»Obschon einer der Nachbarn etwas komisch riecht und so tut, als würde er eine Katze ficken, wann immer er auf dem Klo sitzt, ist die Immobilie zum sofortigen Einzug bereit. Und ein Ärzteteam steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung.«
»Bist du jetzt fertig?«
»Ja.«
Sie schwiegen eine Zeit lang. Während Holly ihren Bruder im trüben Licht musterte, kamen die vertrauten Schuldgefühle in ihr hoch. Lee war zwei Jahre älter als sie und hatte aus nächster Nähe miterlebt, wie ihre Eltern von einem Serienmörder, dem die Presse den Spitznamen »die Bestie« gegeben hatte, ermordet worden waren. Holly selbst war wenige Minuten später gekommen und hatte nur noch das Ergebnis der grausigen Tat gesehen. Im Grunde hatte sie erst mit sechs Jahren begonnen, ihren Bruder wirklich wahrzunehmen. Lärm, der ihr auf die Nerven ging und sie nachts nicht schlafen ließ. Geschwisterrivalität in jungen Jahren, die sich jedoch legte, sobald sie keine Eltern mehr hatten. Nach dem Mord hatten sie wochenlang wie Kletten aneinandergehangen, und auch als sie älter wurde, war er immer für sie da gewesen. Hatte sie in den Arm genommen, wenn es ihr schlecht ging. Sie auf die Wange geküsst, wenn es sonst niemanden gab, der es hätte tun können. Er hatte ihr stets versichert, dass alles gut werden würde. Sie fragte sich, ob er in gewisser Weise nicht sogar recht behalten hatte.
Jetzt, mit achtunddreißig, war Lees Gesicht bleich und eingefallen. Im Jahr zuvor hatte der Klinikvorstand eine mögliche Entlassung auf Bewährung diskutiert, und man hatte Holly gebeten, mit ihm über den Mord an seinem Liebhaber zu sprechen. Sie sollte versuchen, ihm Informationen zu entlocken, die andere Therapeuten bislang nicht aus ihm herausbekommen hatten. Es hatte funktioniert, aber freigekommen war er dennoch nicht. Seitdem war er sehr niedergeschlagen. Wahrscheinlich würde er den Rest seines Lebens im Wetherington Hospital verbringen – und nachdem die Hoffnung erloschen war, spürte er die Finsternis nun umso stärker, das wusste sie.
»Du siehst aus, als hättest du abgenommen«, sagte sie.
»Ich glaube nicht.«
»Ich möchte, dass du immer deinen Teller leer isst. Auch wenn dir die Eier nicht schmecken. Einfach alles aufessen, okay?«
Er nickte zerstreut. Sein Blick geisterte durch den Raum.
»Ich habe mein ganzes Leben zurückgelassen, als ich hierhergekommen bin.«
»Ja, natürlich.«
»Nein, ich meine, im wahrsten Sinne des Wortes. In einem Plastikbeutel am Empfang. Ich muss oft an diesen Plastikbeutel denken.«
»Warum?«
»Ich frage mich, ob er noch da ist. Ob er in irgendeinem dunklen Schrank liegt und Staub ansetzt, oder … könnte er auch noch was anderes ansetzen?«
»Wahrscheinlich nicht. Aber er ist auf jeden Fall noch da.«
»Und wartet auf mich?«
»Ja.«
»Das war mein Leben, bevor ich verhaftet wurde. Alles in dem Beutel. Eigentlich nicht viel. Drei Pfund und vierzehn Pence. Eine halbe Packung Pfefferminzbonbons. Mein Wohnungsschlüssel, mein Autoschlüssel und noch ein anderer Schlüssel, den ich mal in der Latimer Road in East London gefunden habe. Keine Ahnung, wem er gehört oder in welche Tür er passt. Das finde ich traurig.«
»Wieso?«
»Weil jetzt irgendjemand seinen Schlüssel vermisst.«
»Ich wette, er oder sie hat sich inzwischen einen neuen machen lassen.«
»Aber das ist nicht dasselbe, oder?« Er seufzte. Atmete ein. »Ein Kassenbon von M & S. An dem Nachmittag, als ich verhaftet wurde, hatte ich einen Geflügelsalat gegessen. Die Plastikgabel war noch in meiner Tasche. Weiß der Himmel, wieso. Ich glaube, sie war in eine Papierserviette eingewickelt. Was wir alles aufbewahren. Wie Gefühle, stimmt’s? Es fällt uns einfach schwer, loszulassen. Drei Streifen Zimtkaugummi. Eine Treuekarte von Starbucks. Eine Treuekarte von Waterstones. Eine Treuekarte von Boots. Ich bin ganz schön treu, was? Das ist mein Leben in einem Plastikbeutel. Er liegt irgendwo in einer Schublade und wartet darauf, dass ich ihn holen komme. Aber ich weiß genau, dass es nie passieren wird. Kann Kaugummi eigentlich schlecht werden?«
»Weiß nicht.«
»Hat wahrscheinlich die Haltbarkeit eines nuklearen Isotops. Bei dem Scheiß, den sie da reintun. Sie töten uns heimlich, still und leise, und wir sind einfach so glücklich in unserer Ahnungslosigkeit.«
Die Hände bequem über dem Bauch gefaltet, lehnte er sich auf seinem Stuhl zurück.
»Ich möchte jetzt bitte mein grottenschlechtes Buch weiterlesen. Aber schön, dass du gekommen bist.«
Sie küsste ihre Fingerspitzen und legte sie sanft auf seinen Handrücken. Stand auf und zog sich die Jacke an.
»Wie geht’s dem Detective?«, fragte er.
Sie überlegte kurz, dann schüttelte sie den Kopf.
»Wir lassen es ruhig angehen.«
»Was meinst du, wird es langsam Zeit, dass ich ihn kennenlerne? Dass du ihm den Rest deiner Familie vorstellst?«
»Nein.«
Er hob das Buch auf und fand die Stelle, an der er stehen geblieben war.
»Weiß er über mich Bescheid?«
»Nicht, dass du mein Bruder bist.«
»Interessant. Fände er das wohl gut? Natürlich nicht. Weiß er alles über dich?«
»Nein.«
»Geheimnisse in einer Beziehung sind nie gut, Holly. Am besten, man legt alles offen, dann hat man es hinter sich.«
»Sagt der Mann in der Gummizelle.«
»Sagt die Frau, die vom Weg abgekommen ist.«
Vier
Das kalte, mechanische Surren des Kernspintomografen.
Holly lag in der Röhre. Blass, die Lippen leicht geöffnet, die Augen wie im Schlaf geschlossen. Das braune Haar war ihr so stramm aus der Stirn gekämmt, dass ihr Gesicht hohl wirkte. In dem weißen Krankenhausnachthemd hätte sie genauso gut auf einem Sektionstisch in der Pathologie liegen können.
»Holly?«
Ihre Lider zuckten, dann schlug sie die Augen auf. Sie waren dunkelbraun, aber das Weiß durchzogen winzige rote Äderchen. Zu wenig Schlaf, zu wenig Zeit, zu wenig von allem. Sie starrte an die Decke der metallenen Röhre, während es um sie herum summte und sirrte, als läge sie in einem Heißluftofen für Menschen.
»Wie fühlen Sie sich?«
»Wie ein Kebab.« Ihre Kehle war trocken. Kratzig.
»Noch zwei Minuten.«
Super, dachte sie. Noch einhundertzwanzig Sekunden, um über Bishop nachzudenken. Darüber, wo er war und warum sie nicht bei ihm war. Im Dezember hatten sie einige schöne Abende miteinander verbracht. Heiße Schokolade, ihr abendliches Ritual nach achtzehn Uhr. Gemütliche Gespräche auf dem Sofa und dann Fernsehen. Netflix – aber keine Krimiserien, das war ihre eiserne Regel. Sie fragte sich, ob sie dieses Jahr Zeit füreinander finden würden. Vielleicht konnten sie mal richtig essen gehen. Oder ins Kino. Cocktails trinken? Allerdings nicht heute. Heute lag sie in einer Röhre aus Metall und wartete darauf, dass der Facharzt beurteilte, wie weit sie sich von den Verletzungen erholt hatte, die ihr Gegner ihr während ihres finalen Kampfs zugefügt hatte.
Du lebst deinen Traum, Holly. Vielleicht sollte sie sich eine Katze anschaffen? Ja, genau, sie würde sich eine Katze kaufen und in die Cotswolds ziehen oder so. Nett und beschaulich. In den Cotswolds herrschte ein signifikanter Mangel an Sadisten und Mördern. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht waren sie einfach nur noch nicht erwischt worden.
»Alles klar, Holly. Wir sind fertig«, sprach die Stimme Gottes zu ihr. »Sie können sich jetzt wieder bewegen.«
Sie wollte sich nicht bewegen. Heute wollte sie ganz still daliegen und nichts tun. Heute wollte sie einfach nur schlafen.
Sie saß in einem Sessel im Büro des Facharztes.
Dr. Breaker lautete sein Name. Er war in den Vierzigern, hager, trug eine Brille mit Drahtgestell und hatte ihr schon bei ihrer ersten Begegnung erzählt, dass er an den Wochenenden gerne Gleitschirm flog. Als ob sie das einen Scheißdreck interessierte.
»In Anbetracht der Brutalität des Angriffs scheinen Sie sich erstaunlich rasch erholt zu haben«, sagte er. »Die rechte Augenhöhle ist noch nicht ganz wiederhergestellt. Leiden Sie unter Sehstörungen? Zickzacklinien am Rand Ihres Gesichtsfelds?«
»Nein.«
Er klemmte die bunten Scans an einen Leuchtkasten und studierte sie mit der Akribie eines Mannes, dem seine Arbeit große Freude bereitet. »Es ist kein Ödem des Hirngewebes zu sehen, das sind gute Neuigkeiten. Nichtsdestotrotz müssen wir Ihren neurologischen Zustand weiterhin beobachten. Das Wichtigste für Ihre Genesung sind in jedem Fall Ruhe und Erholung. Wie klingt das?«
Holly legte die Hände auf die Armlehnen ihres Sessels und fand einen losen Faden, an dem sie herumzupfen konnte. Sie kaute langsam einen Kaugummi, als verlange ihr diese Handlung ein Höchstmaß an Konzentration ab.
»Gut.«
»Wie steht es um Ihr Erinnerungsvermögen?«
»Manchmal, wenn ich einen Raum betrete, vergesse ich, was ich eigentlich wollte. Aber ich glaube, das ist normal.«
»Ist es nicht.«
»Für mich schon.«
Er nickte bedächtig, ohne zu blinzeln.
»Trinken Sie Alkohol?«, fragte er.
»Ich habe seit Wochen keinen Tropfen mehr angerührt. Wahrscheinlich sogar seit Monaten.«
»Gut. Es ist besser, wenn Sie in dieser Phase Ihres Genesungsprozesses Alkohol vermeiden.«
»Klar.«
Er klappte mit einer Bewegung seines Handgelenks ihre Krankenakte zu.
»Sie sind kerngesund«, sagte er.
»Danke, Doc.«
»Aber wir sollten noch weitere Tests machen.«
Sie entledigte sich des Krankenhausnachthemds und zog etwas an, das einer von den Toten wiederauferstandenen Frau besser zu Gesicht stand. Einen schwarzen Kaschmirpullover, Jeans, Schuhe mit flachen Absätzen, dazu ein Hauch Make-up. Als sie zu ihrem Wagen ging, stellte sie überrascht fest, dass Bishop draußen auf sie wartete. Sie schenkte ihm den Schatten eines Lächelns.
»Ist dir klar geworden, dass du ohne mich nicht leben kannst?«
»So ähnlich. Was meint der Arzt?«
»Dass ich im Arsch bin.«
»Du liebe Zeit. Das hätte ich dir auch sagen können.« Er machte eine Pause. »Willst du ein Stück mit mir fahren?«
Bei ihrer Autotür angekommen, zögerte sie kurz. Sie musste ihm die Frage stellen.
»Geht es um den neuen Fall?«
Er sah sie an. Gab nichts preis.
»Leiste mir Gesellschaft.«
Fünf
London: angeschlagen und Brexit-müde, aber nicht totzukriegen.
Im Spätnachmittagsverkehr ging es nur langsam voran. Sie fuhren Richtung Norden über die Tower Bridge. Rechts der Tabakhafen, links Aldgate, dominiert von den Hochhäusern Dutzender Banken und Versicherungskonzerne. Dann durch Whitechapel, Heimat von Jack the Ripper und Wirkungsort der Kray-Zwillinge. Kurz darauf hatten sie den Autobahnring hinter sich gelassen. Weiter in Richtung Norden. Die Hochhaustürme und Wohnblocks wichen frostbedeckter Landschaft, baumbewachsenen Hügeln und einem diesigen Himmel in der Ferne.
Obschon es kalt war, hatte Holly das Fenster heruntergelassen.
Sie mochte die Weite. Seit sie eines kalten Abends im vergangenen November um ein Haar lebendig begraben worden wäre und in einer Schlammgrube um ihr Leben gekämpft hatte, fühlte sie sich in geschlossenen Räumen unwohl. Eingesperrt. Sie sah Bishop mehrmals vor Kälte erschauern, doch er sagte keinen Ton. Beklagte sich nicht.
»Wie läuft es so bei dir?«, erkundigte sie sich. »Bei der Arbeit, meine ich. Das habe ich dich heute Morgen gar nicht gefragt.«
»Ach, du weißt schon. Das Übliche. Ich warte immer noch auf das größere Büro.«
»Wie geht es Sergeant Ambrose?«
»Läuft durch die Gegend wie ein Zombie. Kriegt nicht genug Schlaf. Aber immer wenn er kurz davor ist, zusammenzuklappen, sieht er sich das neueste Foto von seiner kleinen Tochter an, und alles ist vergessen.«
Eine Pause.
»Weihnachten war ruhig«, sagte er.
»Bei mir auch.«
»Ja?«
»Ja.«
Wanstead Park war ein östlicher Teil des Epping Forest, im Londoner Bezirk Redbridge gelegen. Das ganze Gebiet maß etwa neunzehn Kilometer von Nord nach Süd und vier Kilometer von Ost nach West und bestand aus Wald, Grasflächen, Heide- und Ginsterlandschaft mit Dutzenden von Seen und Teichen unterschiedlicher Größe. Sie näherten sich von Süden her über die Warren Road, deren alter Kiesbelag im Laufe der Jahrzehnte durch unzählige Reifen und Millionen von Füßen platt gewalzt worden war. Ein Golfplatz zu ihrer Linken, und kurz darauf gelangten sie an eine Reihe von Zufahrtstoren. Ohne zu zögern, nahm Bishop die Zufahrt, die mit The Glade beschildert war und von der aus ein breiter, schlammiger Pfad in östliche Richtung an Heerscharen brauner Bäume und totem Farnkraut vorbeiführte. Als der Weg sich gabelte, bogen sie ein weiteres Mal links ab. Sie fuhren durch eine Kuhle, und das Auto scheute wie ein junges Pferd beim Springreiten.
»Sorry«, sagte er.
Ein kurzer Ruck am Zügel, und das Tier hatte das Hindernis gemeistert. Ein Stück voraus kamen mehrere Gebäude in Sicht. Weit abgelegen. Verlassene Häuser mit zerborstenen Fensterscheiben.
Bishop hielt vor einem alten L-förmigen Gebäude. Efeu rankte an den Wänden empor, und wildes Gras wuchs neben den Stufen, die zu einer hölzernen Eingangstür hinaufführten. Blätternde Farbe. Verzogenes Holz. Es standen bereits zwei andere Autos davor – ein Streifenwagen und ein Zivilfahrzeug der Polizei. In der Ferne spannte ein Constable Flatterband zwischen den Bäumen. Es sah aus wie die Girlande bei einem Sommerfest.
Auf einmal bemerkte Holly ein anhaltendes tiefes Geräusch im Hintergrund, von dem sie nicht wusste, was es war. Sobald sie die Autotür öffnete, erkannte sie es. Hunde. Eine Kakofonie aus Gebell. Sie folgte Bishop unter der Flatterbandgirlande hindurch zur Tür. Er drückte auf die Klingel.
»Glaubst du ernsthaft, bei dem Lärm hört das jemand?«
»Er erwartet uns.«
Die Tür wurde einen Spaltbreit geöffnet, und ein Mann erschien. Schäbig gekleidet, nach nassem Hund stinkend, mit grauen Haaren und zerfurchtem Gesicht. Sein Blick ruhte auf Bishop.
»Dachte mir schon, dass Sie es sind.«
»Mr. Greyson.«
»Na, dann kommen Sie mal rein. Wollen Sie einen Kaffee oder einen Tee?«
»Für mich nicht, danke.«
Holly schüttelte den Kopf.
Sie folgten ihm ins Innere. Ein schmaler Flur mit Linoleumboden und einer Sicherheitstür am hinteren Ende. Als er sie öffnete, kam dahinter ein Raum voller Zwinger mit jaulenden Hunden zum Vorschein, die wie pelzige Gefängnisinsassen ihre Vorderpfoten durch die Gitterstäbe hängen ließen.
»Rette jetzt seit siebzehn Jahren Hunde«, sagte Greyson. »Vor zwei Jahren ist mir die Förderung gestrichen worden, aber dank Spenden geht es weiter. Gute Leute hier in der Gegend. Wenn Sie mal einen Hund als Haustier möchten, melden Sie sich bei mir.«
»Machen wir«, sagte Bishop.
Sie gelangten in eine kleine Küche mit einer Werkbank, einem Tisch und Stühlen. Auf einem Schwarz-Weiß-Fernseher lief ein obskurer alter Film, der Hollys Aufmerksamkeit erregte. Es kam ihr vor, als wäre sie in der Zeit zurückgereist. Wann hatte sie zuletzt einen Schwarz-Weiß-Fernseher gesehen? Das Zimmer schien sauber und gepflegt, doch abgesehen von einigen vergilbten Fotos, die mit Magneten am Kühlschrank befestigt waren, fehlte jede persönliche Note.
»Möchten Sie vielleicht noch mal wiederholen, was Sie mir bereits gesagt haben, Mr. Greyson?«
»Nicht wirklich. Aber wenn’s sein muss …« Er warf Holly einen Blick zu. »Für Sie, denke ich mal, Miss.« Er brühte sich einen Kaffee auf und gab nacheinander mehrere Löffel Zucker hinein. Er wollte Zeit schinden. Das Unvermeidliche hinauszögern.
»Mr. Greyson?«
»Jep.« Er hörte auf, in seiner Tasse zu rühren, und fixierte Holly mit eingesunkenen Augen. »Ich wohne hier. Seit zweiundzwanzig Jahren schon. Stehe immer um halb acht auf, um mit den Hunden rauszugehen. An der Shonks Mill Road entlang. Kennen Sie die?«
»Nein«, sagte Holly.
»Eine halbe Meile von hier. Ich bin mit ihnen durchs Farndickicht so wie immer, und dann haben sie auf einmal angefangen, verrücktzuspielen. Haben was gerochen. Sind hin und her gerannt und haben wie wild gekläfft. Ich hatte drei von ihnen an der Leine, konnte sie aber nicht halten. So was ist mir noch nie passiert. Sie sind schnurstracks durchs Schilf und hoch ans andere Ufer. Ich habe sie gerufen. Gebrüllt habe ich, aber wenn Hunde erst mal eine Witterung in der Nase haben, hören sie auf niemanden mehr. Immer im Kreis sind sie gelaufen, und geheult haben sie. Ich dachte schon, es ist Vollmond. Dann hörte ich sie bellen. Aber das war kein normales Bellen, zwischendurch haben sie geknurrt, als würden sie bedroht. Ich bin ihnen hinterher, und als ich bei ihnen ankam, irrten ein paar von ihnen völlig orientierungslos herum. Aber Ripper – das ist mein Ridgeback – stand im Gebüsch auf einem kleinen grasbewachsenen Hügel. Zähne gebleckt, das Fell gesträubt, bereit zum Angriff. Als ich zu ihm gegangen bin, hat er sich beruhigt.« Greyson machte eine Pause. Fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und straffte ein wenig die Schultern.
»Und dann habe ich ihn gesehen. Den toten Jungen.«
Kahle Bäume und Schatten begleiteten Holly und Bishop auf ihrem Weg.
Ein Stück voraus sahen sie mindestens ein Dutzend Polizisten. Scheinwerfer waren aufgestellt worden, Fotoapparate klickten, Blitzlichter flammten auf, doch ansonsten herrschte Stille. Niemand sprach. Man hörte nur das leise Schmatzen von Ledersohlen auf feuchtem Laub, während die Polizisten umhergingen. In der kalten Luft des Nachmittags konnte man ihren Atem sehen.
Bishop streifte sich Latexhandschuhe über und reichte auch Holly ein Paar, während er sie zu einer kleinen Gestalt führte, die zwischen zwei grünen Büschen am Boden lag. Er sagte nichts. Musste er auch nicht. Holly trat an ihm vorbei, um besser sehen zu können.
Der Junge war nackt, abgesehen von einer weißen Unterhose. Er lag auf der rechten Körperseite, die Beine angewinkelt, die Unterarme über der Brust gekreuzt. Sein Kopf ruhte auf einem sauberen weißen Kissen. Das Gesicht war oval und sehr blass, beinahe weiß. Er hatte kurzes dunkles Haar. Seine klaren, grünen Augen waren geöffnet, und auch der Mund stand leicht offen, als wolle er einatmen.
»Wie viele Kinder wurden letztes Wochenende als vermisst gemeldet?«, fragte sie.
»Einhundertsiebenundfünfzig.«
»An einem einzigen Wochenende?«
Bishop nickte, als sie sich zu ihm umdrehte.
»In London gibt es durchschnittlich knapp fünfhundert vermisste Kinder pro Woche«, sagte er. »Die meisten sind aus Heimen abgehauen. Sie wollen Mum und Dad besuchen oder fühlen sich auf der Straße besser aufgehoben. Aber einige von ihnen …«
Holly nickte zerstreut.
»Riechst du das? Zitrone oder so.«
»Nein.«
Sie fragte sich, ob sie sich den Geruch nur einbildete. Schaute von der Leiche zu den dunkler werdenden Bäumen. Es war so still, dass sie das Rascheln der Blätter hören konnte. Irgendwo schrie ein Vogel.
»Keine Reifenabdrücke? Schleifspuren?«, fuhr Bishop fort. »Er muss also hierhergetragen worden sein. Er ist klein. Sieht nicht sonderlich schwer aus.«
»Tag, Bishop. Tag, Holly.«
Holly wandte sich um und sah Angela Swan auf sie zusteuern. Ein Assistent reichte ihr einen Vliesoverall, und sie stieg mit der gleichen Selbstverständlichkeit hinein, mit der andere Menschen sich ein Paar Handschuhe überstreifen. Holly schenkte ihr ein Lächeln. Sie mochte Angela. Vertraute ihr.
»Tut mir leid, dass ich spät dran bin – Theatervorstellung mit den Kindern. Jetzt muss Mutter Gans ihr goldenes Ei alleine finden.« Sie wandte sich an Bishop. »Was wollen Sie zuerst?«
»Todesursache.«
Sie beugte sich über die Leiche wie ein Jäger über sein erlegtes Wild. Ging auf die Knie und legte dem Kind eine Hand an die Stirn. Es folgten federleichte Berührungen an Magen, Oberkörper, Kopf.
»Erdrosselt.« Sie deutete auf eine schwache purpurne Strieme am Hals. »Aber er wurde nicht hier getötet. Leichenflecke an Brust, Schultern und Oberschenkelvorderseiten. Er hat mindestens sechs Stunden auf dem Bauch gelegen, ehe er hergebracht wurde, und ich würde sagen, er liegt noch keine zwölf Stunden hier. Es gibt keinen Tierbefall.«
»Alter?«
Angela öffnete den Mund des Jungen. Der Unterkiefer klappte fast sofort wieder zu, und sie musste ihn mit einer Klemme fixieren, um mit der Taschenlampe in die Mundhöhle leuchten zu können. »Die Zähne sind alle intakt, das bleibende Gebiss ist vollständig ausgebildet, er muss also mindestens zwölf Jahre alt sein. Zwischen zwölf und vierzehn, würde ich sagen.«
Behutsam tastete sie die Arme des Jungen ab. Wandte sich dann seinen Händen zu, die so drapiert waren, dass sie jeweils auf der gegenüberliegenden Schulter lagen.
»Ich glaube, er hält was in der Hand. Holly, könnten Sie … es ist schwer zu erkennen.«
Bishop reichte Holly seine Taschenlampe. Sie trat auf Angela zu und richtete den Lichtkegel aus, während die Gerichtsmedizinerin vorsichtig die zweigähnlichen Finger des Jungen auseinanderbog. Darunter kam eine dünne Kette mit einem silbernen Anhänger zum Vorschein. Eine winzige Figur mit ausgebreiteten Flügeln.
»Was ist das?«, fragte Bishop.
Einige Sekunden verstrichen, in denen Holly beinahe eine Art Wehmut überkam. Dann sagte sie:
»Ein Engel.«
Sie nahm die Kette, betrachtete sie und reichte sie an Bishop weiter, ehe sie aufstand. Ihr linkes Bein war eingeschlafen, und sie verzog das Gesicht, als der Blutfluss kribbelnd wieder in Gang kam. Sie warf noch einen kurzen Blick auf die Leiche, dann nickte sie und ging davon.
Als Bishop sie einholte, war sie bereits auf der anderen Seite des Waldstücks. Starrte die Baumlinie an. Roter Himmel. Roter Sonnenuntergang. Er wirkte beunruhigt, und es dauerte lange, bis er etwas sagte.
»Du meintest, du bist bereit dafür. Stimmt das wirklich?«
Sie schnappte nach Luft, als sie spürte, wie die Angst sie zu überwältigen drohte. Ihr Körper versteifte sich. Doch sie kannte die Antwort auf seine Frage.
»Natürlich.«
Sie warf noch einen letzten Blick zu den nackten Bäumen und in den kalten Himmel, ehe sie langsam zum Wagen zurückging.
Sechs
Als Holly an diesem Abend nach Hause kam, zog sie sich die Jacke aus und stellte ein Fertigmenü in die Mikrowelle. Goss sich ein großes Glas Rotwein ein und trank einen Schluck, ehe sie ins Wohnzimmer zurückging. Das Licht am Anrufbeantworter blinkte. Eine neue Nachricht. Sie drückte auf Play.
Eine Mitteilung von der Hausverwaltung. Das Pärchen in Nummer zwei wolle den Flur im Erdgeschoss renovieren lassen. Schlichtes Weiß, passend zum Rest des Gebäudes, aber natürlich bedeute das Abdeckplanen, Handwerker auf Leitern und offene Farbeimer. Ob die Bewohner in den nächsten Wochen beim Hereinkommen bitte besondere Vorsicht walten lassen könnten? Die Arbeiten sollten morgen beginnen. Man entschuldige sich für die Unannehmlichkeiten.
Pling machte die Mikrowelle. Holly leerte den Inhalt der dampfenden Menüschale auf einen Teller und setzte sich aufs Sofa. Betrachtete das gerahmte Harland-Miller-Cover über dem Kamin: Death – What’s In It For Me? Während der letzten Ermittlung hatte sie es abgenommen und die Wand als Tafel benutzt. Sie war zugepflastert gewesen mit Filzstiftnotizen und Daten, Zeitleisten und Fragezeichen. Mit Bildern der Mörder und ihrer Opfer, deren tote Augen jede ihrer Bewegungen zu verfolgen schienen. Nach Abschluss des Falls hatte sie die Wand mit Bleiche geschrubbt. Es hatte etwas Therapeutisches gehabt, den Killern in ihrem Haus und den gequälten Gesichtern ihrer Opfer Lebwohl zu sagen. Jetzt erstrahlte die Wohnzimmerwand wieder in unschuldigem Hellblau, und der Harland Miller hing an seinem angestammten Platz. Links auf dem Kaminsims stand eine Vase mit Glockenblumen, rechts eine Genesungskarte von Bishop, noch aus der Vorweihnachtszeit. Die einzige, die sie aufgehoben hatte. Werden Sie schnell wieder gesund, Holly. Schlicht. Ein Mann, der auf dem Papier nicht viele Worte verlor. Dafür sagten seine Augen umso mehr.
Sie schaltete den Fernseher ein, doch die Stimmen der Personen am Bildschirm gerieten in den Hintergrund, als sie die Akte aufschlug, die Bishop ihr mitgegeben hatte, und die Fotos des Jungen aus dem Wald studierte. Weiße Haut. Braunes Laub. Tot auf tot.
Sie stellte sich vor, dass der Junge wieder am Leben wäre. Regelte seinen Herzschlag von null auf eine Ruhefrequenz von fünfundachtzig hoch. Seine Lungen pumpten wieder Sauerstoff. Blut strömte durch seine Adern. Sein junger Kopf voll mit Lachen und Träumen. Gespräche mit Klassenkameraden. Steine kicken in der Pause auf dem Schulhof. Lachtränen, wenn jemand einen blöden Witz erzählt hatte. Eine Hand, die sich im Unterricht meldete. Fragen, die nie beantwortet wurden. Diese strahlend grünen Augen hatten gesehen, wer ihm das angetan hatte. Vielleicht hatte der Täter ihn angelächelt. Vielleicht hatten sie zusammen gelacht. Mutter. Vater. Ein Freund der Familie? Ein Fremder? Wen hast du angeschaut, als du gestorben bist? Was hast du in seinen Augen gesehen?
Sie erinnerte sich an das Forschungsgebiet der forensischen Optografie aus dem neunzehnten Jahrhundert. Zu keinem Zeitpunkt war die Faszination der Öffentlichkeit für Mord und Tod so groß gewesen wie in der viktorianischen Ära. Zu jener Zeit war man der Ansicht, man könne das Abbild des Mörders in den Augen seines toten Opfers erkennen. Man hielt es für möglich, dass die Netzhaut ein Bild vom Moment des Todes speichert – vom Letzten, was das Opfer zu Lebzeiten erblickt hat. Schließlich begann sogar die Polizei, die Optografie bei der Untersuchung von Mordfällen zu nutzen. Walter Dew berichtete von einer solchen Untersuchung bei Mary Jane Kelly, einem der Opfer von Jack the Ripper. Doch die vermeintliche Wissenschaft ging bald als typischer Hokuspokus des neunzehnten Jahrhunderts in die Geschichte ein.
Aber was hatte dieser Junge in seinen letzten Momenten gesehen? Hass. Zorn. Ja. Aber auch noch etwas anderes. Etwas wie Liebe. Das Kissen unter seinem Kopf, die Zärtlichkeit, mit der er abgelegt worden war. Und dann noch die Halskette in seiner Hand.
Du siehst aus wie ein Engel. Wollte der Mörder, dass du ein Engel wirst?
Sie fand die Fotos vom Kettenanhänger in der Akte. Die Konturen der kleinen Figur waren noch klar und scharf. Sie erkannte die schmalen Wangen des Engels, seine geschlossenen Augen, die zu beiden Seiten ausgebreiteten Flügel. Er hielt etwas in seinen Händen. Einen Stab, eine Blume, ein Schwert?
Sie stellte ihr Essen beiseite und klappte ihren Laptop auf. Googelte Engel und erhielt annähernd eine halbe Milliarde Suchergebnisse. Engel Gottes, Erzengel, Halbengel, Engel als Repräsentanten der Tugenden. Engelsfürsten. Die sieben Wochentage: Michael, Gabriel, Raphael, Raguel, Lucifer, Ariel, Uriel. Seraphim, Cherubim. Der Erzengel Michael mit dem Schwert – hin und wieder wurde er auch mit einem Schild dargestellt. Ein Bezwinger des Teufels und Verteidiger in der Schlacht. Gabriel, der Bote Gottes im Lukas-Evangelium und im Buch Daniel. Der gefallene Engel? Manche Darstellungen zeigten ihn mit einer Lilie. War es das, was der Engel an der Kette in der Hand hielt?
Ein gefallener Engel?
Sie spürte, wie schnell ihr Herz klopfte, als das Telefon plötzlich läutete. Es war Bishop. Sie betrachtete den Apparat zunächst eine Zeit lang und rieb sich die Augen, ehe sie ranging.
»Hey«, sagte sie. »Bist du noch auf der Wache?«
»Alle machen Spätschicht und Überstunden. Wir haben drei Mannschaften draußen im Wald, zusammen mit einer Hundestaffel, die das Gelände durchkämmen. Eine erste Suche ist abgeschlossen, aber das Gebiet ist riesig. Warte.« Seine Stimme wurde kurz leiser, dann war er wieder da. »Die Wache ist voll mit besorgten Eltern, und wir haben den Jungen immer noch nicht identifiziert. Die Autopsie ist für morgen neun Uhr angesetzt«, sagte er. »Schaffst du es?«
»Ich komme.«
»Danke, Holly.« Das Schweigen zwischen ihnen dehnte sich. Bishop räusperte sich. »Ich wollte nur noch sagen … beim letzten Fall. Ich weiß, dass du beinahe getötet worden wärst.«
Auf einmal war sie atemlos, als wäre sie gerannt. Sie zwang sich zum Sprechen.
»Ja.«
»Ich sorge dafür, dass so was nicht noch mal passiert«, sagte er. »Ich verspreche dir, ich passe auf dich auf. Okay?«
Sie nickte, antwortete jedoch nicht.
»Willst du, dass ich zu dir komme?«
Das war verlockend, aber …
»Nein, mir geht es gut. Ich brauche einfach ein bisschen Ruhe.«
Sie schwieg lange und spielte derweil mit ihrem Essen. Als sie das nächste Mal sprach, wählte sie ihre Worte sehr sorgfältig.
»Bishop, der Fundort im Wald mag auf den ersten Blick friedlich ausgesehen haben, fast wie eine Seite aus einem Märchenbuch. Aber der Mörder will uns etwas sagen.«
»Was?«
»Dass er verwirrt ist, verloren und wütend. Unfassbar wütend. Und diese Wut hat er ausagiert, sie ist jetzt real geworden. Ich habe noch nicht viele Informationen, aber ich könnte schon mal mit einem vorläufigen Profil anfangen.«
»Danke, Holly. So schnell es geht.«
Er legte auf, und schlagartig war es ganz still. Die Wand über dem Kamin musste dringend gefüllt werden. Sie verspürte den Drang, mit dem Unvermeidlichen zu beginnen. Doch vorher musste sie noch etwas erledigen. Sie stand auf, betrat das Nebenzimmer und schaltete das Licht ein. Dies war ihr Murderabilia-Raum: ein kleines Museum, in dem sie ihre makabre Sammlung aus Habseligkeiten und Trophäen von Serienmördern und ihren Opfern aufbewahrte. Außer ihr war Bishop der einzige Mensch, der diesen Raum jemals betreten hatte. Sie fragte sich, ob er sich dessen bewusst war. Wie hatte er es genannt? Ihren »gruseligen Todesraum«. Es war kein Ort für Zartbesaitete, das stand fest.
Annie Chapmans Leiche war um sechs Uhr am Morgen des 8. September 1888 aufgefunden worden. Sie war das zweite der »kanonischen fünf« Ripper-Opfer und hatte zum Zeitpunkt ihres Todes ein schwarzes Kleid getragen. Holly berührte den Saum des Kleides im Vorbeigehen. Viktorianische Spitze. Es gab nichts Zarteres, Filigraneres.
An Ständern, ausgestellt wie die Banner einer längst vergessenen Armee, hingen Messer, Stricke und Gürtel, die dazu benutzt worden waren, Menschen zu erstechen, zu verstümmeln und zu strangulieren. Auf einer walisischen Kommode waren mehrere Stücke ausgestellt, die sie bei Auktionen ersteigert hatte: Lord William Russells Schnupftabakdose aus Ahorn-Wurzelholz, im Deckel war ein Cabochon in einer Rosette aus Gold eingelassen. Russell war in Mayfair am 6. Mai 1840 von seinem Schweizer Kammerdiener François Courvoisier ermordet worden. Die Tabakdose hatte man unter seinem blutigen Kopfkissen gefunden.
Ein Brief des Engländers James Berry, der von 1884 bis 1891 als Henker gearbeitet und mit seiner Methode des Langen Falls, die die seelischen und körperlichen Qualen der Delinquenten verringern sollte, maßgeblich zur Weiterentwicklung der Wissenschaft des Erhängens beigetragen hatte.
John Christies Mahagonikommode vom Rillington Place Nummer 10, obenauf seine Bibel, eselsohrig und vergilbt, aufgeschlagen bei Epheser 1:7 In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade.
Vor einem edwardianischen Schreibtisch blieb sie stehen. Wem hatte er gehört? Natürlich. John Haigh, dem Säurebad-Mörder. Sie zog die kleine Schublade in der Mitte auf. Hörte den Gegenstand darin, bevor sie ihn sah.
Ein Messingglöckchen.
Da war es. Es lugte aus den Schatten hervor wie ein winziges lichtscheues Geschöpf. Es war schlicht und schmucklos, besaß aber eine unglaubliche Macht. Dieses Glöckchen war im letzten Fall die Visitenkarte der Mörder gewesen. Ihr Erkennungsmerkmal, das sie bei jedem Mord zurückließen, um die Tat für sich zu reklamieren. Bishop hatte es ihr nach den Anhörungen gegeben in der Annahme, sie würde es vielleicht behalten wollen. So gut kannte er sie. Sie nahm das Glöckchen heraus, tippte sacht mit dem Finger dagegen und wurde durch ein helles, blechernes Klingeln belohnt.
Ein- oder zweimal in der Woche hatte sie immer noch Albträume oder Visionen, in denen der Mörder aus der Dunkelheit auftauchte. In einer Hand hielt er das Messer, die andere hatte er um ihren Hals geschlungen, bereit, ihr Leben auszulöschen, so wie man eine Kerze ausbläst. Und manchmal, wenn sie fernsah oder las, rechnete sie halb damit, dass er plötzlich hinter ihrem Sofa auftauchen und ihr ins Ohr flüstern würde: Auch wenn es ein gewaltsamer Tod sein wird, so hat der Tod doch immer etwas sehr Friedliches und Beruhigendes. Das verspreche ich.
Sie legte das Glöckchen wieder in die Schublade, knallte sie zu und kehrte ins Wohnzimmer zurück. Dort stand sie einige Sekunden lang vor dem Kamin, ehe sie den Harland Miller von der Wand nahm und stattdessen das Foto vom Gesicht des toten Jungen aufhängte.
Er würde sie beobachten.
So lange, bis es vorbei war.
Sieben
Holly stieß die Doppeltüren auf und spürte sogleich, wie ihr ein Schwall kalter Luft entgegenschlug.
Noch wenige Schritte, dann stieg ihr auch der Geruch in die Nase: kalt, mit einer großzügigen Dosis Verwesung. Angela und Bishop standen zu beiden Seiten des Sektionstischs. Bei ihrem unbeholfenen Eintreten drehten sie sich um und hoben die Köpfe.
»Der Verkehr. Tut mir leid«, sagte Holly. Bishop nickte kaum merklich. Seine Erleichterung stand ihm ins Gesicht geschrieben.
»Ich wiederhole jetzt nicht alles, was ich schon DI Bishop gesagt habe«, begann die Gerichtsmedizinerin. »Aber ich sorge dafür, dass Sie eine Kopie meines Berichts erhalten.«
»Vielen Dank.«
Angela zögerte einen Moment, ehe sie sich die weiße Atemmaske über Mund und Nase zog. Während sie arbeitete, sprach sie in ein Mikrofon, das von der Decke hing.
»Neun Uhr sechsundzwanzig. Außer DI Bishop und mir ist nun auch NHS-Profilerin Holly Wakefield eingetroffen, um der Autopsie des im Wanstead Park aufgefundenen und bislang nicht identifizierten Jungen beizuwohnen.«
Sie schlug das grüne Tuch zurück, mit dem der Leichnam zugedeckt war. Weiße Haut spannte sich über Rippen, die als grünliche Streifen erkennbar waren. Die Hände des Jungen lagen nun seitlich am Körper in Hüftnähe, die knochigen Ellbogen berührten den kalten Tisch.
»Seine Körpergröße beträgt einhundertzweiundsechzig Zentimeter, das ist Durchschnitt für einen Jungen zwischen zwölf und vierzehn. Er wiegt achtundvierzig Kilo, was für die entsprechende Altersgruppe eher unterdurchschnittlich ist.« Sie beugte sich über die Leiche. »Die Augen sind geöffnet. Die Iris sind grün, Hornhaut ist eingetrübt. Petechiale Einblutungen der Bindehaut erkennbar. Durchmesser der Pupillen beträgt …« Ein rascher Blick auf den Pupillenmesser … »null Komma vier Zentimeter. Die Haare sind dunkelbraun und an der längsten Stelle circa neun Zentimeter lang.«
Angela öffnete den Mund des Jungen.
»Es liegt keine Obstruktion der Atemwege vor. Die Schleimhäute der Epiglottis, Glottis, des Recessus piriformis, der Trachea und Hauptbronchien sind anatomisch korrekt geformt. Die Mandeln wurden entfernt, der Eingriff wurde vor mindestens fünf Jahren vorgenommen. Keine weiteren Verletzungen erkennbar, auch keine Läsionen der Schleimhäute.« Eine Pause. »Da ist allerdings eine kleine entzündete Stelle in der rechten Buccalhöhle, dort, wo sie mit der Zunge in Kontakt kommt. Die umliegenden Papillen sind ebenfalls gerötet.«
Sie griff nach einer Pinzette und führte sie in den Mund des Jungen ein. Ein sanftes Ziehen, gleich darauf förderte sie einen winzigen durchsichtigen Splitter zutage.
»Auf den ersten Blick sieht es aus wie Plastik, aber ich lasse es analysieren.«
Sie legte den Splitter in eine Petrischale, schloss den Mund des Jungen wieder und begann, seinen Hals zu betasten. Zog sich die Vergrößerungsleuchte heran. »Zungenbein, Schilddrüsenknorpel und Ringknorpel weisen Frakturen auf. Es gibt eine einzelne Ligaturmarke am Hals, wiederum mit Anzeichen petechialer Blutungen, die darauf hindeuten, dass der Junge noch am Leben war, als er stranguliert wurde.« Sie drehte den Kopf des Jungen auf die Seite. »Die Drosselmarke ist zweieinhalb Zentimeter breit und verläuft in einem umgekehrten ›V‹ von hinten um den Hals herum, was nahelegt, dass der Täter ihn von vorne stranguliert hat. Er hat ihn dabei angesehen. Möglicherweise hat er auf ihm gesessen. Die Arme etwa hier …« Sie deutete auf eine Stelle in der Nähe des Halses. Hob leicht die Ellbogen an. »Er hat ihn also eher mit Gewalt hochgehoben als nach unten gedrückt.«
»Was war die Tatwaffe? Ein Draht? Ein Strick?«
»Kein Strick. Vielleicht ein Stoffseil oder Ähnliches. Die unteren Bereiche der Handgelenke weisen verfärbte Partien und Hämatome auf, das heißt, der Junge war fixiert. Außerdem habe ich unter seinen Fingernägeln kleine Überreste von Holzpolitur und weißem Kunststoff gefunden. Wo immer er war, es sieht danach aus, als hätte er versucht, sich durch Kratzen zu befreien.« Sie drehte die Hände des Jungen um. Strich mit ihren Fingern über seine Handinnenflächen und hinauf bis zu den Unterarmen.
»Eins hat mich überrascht. Es wurden keine sexuellen Handlungen vorgenommen.« Sie richtete sich langsam auf. »Und der Körper weist keine alten Narben, Male oder Tätowierungen auf. Das Opfer scheint auch keine verheilten Knochenbrüche zu haben, aber ich werde ihn vorsichtshalber noch röntgen. Zusammenfassend in Bezug auf seinen allgemeinen Gesundheitszustand würde ich sagen, dass er nicht anorektisch, aber extrem dünn ist. Die Muskeln sind leicht unterentwickelt. Nicht gerade ein athletischer Typ, um es mal so zu sagen. Wahrscheinlich hat er einen Großteil seines Lebens im Sitzen verbracht – nicht beim Fußballspielen im Park, eher vor dem Computer. Allerdings würde es mich sehr wundern, wenn wir es mit einem Ausreißer oder einem Straßenkind zu tun hätten. Dafür wirkt er zu gepflegt. Jemand hat ihn lieb gehabt.«
Sie trat vom Sektionstisch zurück und trank einen Schluck aus einem Becher mit der Aufschrift SCHLECHTESTE MUM DER WELT. Las dann etwas von einem Blatt Papier ab. »Weiter zur Toxikologie. Blut aus dem rechten Rippenfell und Galle wurden zur Analyse ins Labor gebracht. Wir warten noch auf die Ergebnisse. Mageninhalt war nicht vorhanden. Könnte sein, dass ihm ein Diuretikum verabreicht wurde, sein Urin wies einen sehr hohen Ammoniakgehalt und eine orangebraune Farbe auf, was auf Dehydration hinweist. Die geringe Zahl roter Blutkörperchen und erhöhte Leberenzym-Werte legen nahe, dass er über einen längeren Zeitraum hinweg nichts mehr gegessen hatte. Keine orale Nahrungsaufnahme für mindestens zwei Tage und nur minimale Flüssigkeitszufuhr. Gerade genug, um ihn am Leben zu erhalten. Die Toxikologie hat ebenfalls nachgewiesen, dass er eine hohe Dosis Fentanyl erhalten hat.«
»Fentanyl?«
»Ein Opiat, es wird als Schmerzmittel und zur Betäubung eingesetzt. In diesem Fall war es mit einer kleinen Menge Heroin verschnitten. Es wurde ihm vor der Strangulation verabreicht. Keine Einstichstelle an der Leiche, auch keine Überreste eines Pflasters. Meine Vermutung: Er hat es entweder inhaliert oder als Tablette geschluckt. Nun zum Gesicht des armen Jungen.« Sie fuhr die Kontur seiner Wimpern mit einem Wattebausch nach. »Hier wird es sehr interessant. Auf Körper und Gesicht lag ein sehr feiner Niederschlag, bestehend aus ätherischem Öl der Katzenminze, Sojaöl und Citronella. Irgendwelche Ideen dazu?« Es war eine rhetorische Frage. »Selbst gemachtes Insektenschutzmittel.« Eine Pause. »Warum man eine Leiche damit einsprüht, ist mir allerdings schleierhaft.«
»Weil der Mörder nicht wollte, dass er Fliegen anzieht«, sagte Holly.
Angela richtete sich auf und warf ihr einen Blick zu. »Wie bitte?«
»Der Mörder wollte nicht, dass er Fliegen anzieht«, sagte sie leise. Sie konnte den Blick nicht vom Gesicht des Jungen losreißen, von den Schatten in seinen Wangen, den spröden Lippen. »Er wollte nicht, dass sie überall auf ihm herumkrabbeln.«
Angela nickte flüchtig, ehe sie sich wieder der Leiche widmete.
»Die Haut um die Augen ist leicht gerötet und geschwollen, ebenso die Grenzlinie des Lippenrots, er muss also allergisch auf einen der Inhaltsstoffe reagiert haben. Es sieht so aus, als hätte der Täter ihn sorgfältig gesäubert, ehe er ihn in den Wald gebracht hat, wahrscheinlich um Fasern und andere Spuren zu entfernen. All das hat lange gedauert, vermutlich mehrere Stunden. Sie haben es mit einem Mörder zu tun, der sich gern Zeit lässt. Und es gibt keine Fremd-DNA. Er hat Handschuhe getragen und war sehr, sehr vorsichtig.«
Sie deckte den Jungen wieder zu, trat einen Schritt zurück und zog sich die Maske herunter.
»Um die Identifizierung anzuschieben, habe ich DNA-Proben an die nationale Datenbank und Fingerabdrücke an die Vermisstendatenbank geschickt. Ich habe auch seine Zähne röntgen lassen, die Bilder gehen heute Nachmittag an die nationale kieferorthopädische Datenbank. Aber wenn wir ihn nicht im System haben – wovon ich leider ausgehe –, hilft uns das bei seiner Identifizierung kein Stück weiter.«
»Ist Ihnen sonst noch was aufgefallen?«
»Abgesehen von dem Insektenspray und der Tatsache, dass der Kopf auf ein Kissen gelegt wurde?« Sie lächelte gequält. »Nein. Ein ganz gewöhnlicher Killer, der eine Vorliebe für junge Knaben hat.«
Acht
Holly und Bishop fuhren im Aufzug nach oben und begaben sich schweigend zum Ausgang.
Er hielt ihr die Tür auf, und sie traten hinaus in die Kälte. Die Zweige der Bäume regten sich nicht. Ihr Laub war schon lange abgefallen und verfault. Holly lehnte sich gegen das Geländer der Treppe und schüttelte in übertriebener Nachsicht den Kopf.
»Der Geruch im Wald. Citronella. Ich wusste, er kam mir bekannt vor.« Sie drehte sich zu ihm um. »Ich hatte mal einen Patienten, Justin Trevago. Er hat über einen Zeitraum von sechs Monaten drei Mädchen umgebracht. Es fing immer als Einbruch an – das hat er jedenfalls zu seiner Verteidigung vorgebracht. Ich glaube das aber nicht. Ich bin mir absolut sicher, dass er von Anfang an einen Tötungsvorsatz hatte. Er hat sie erwürgt und nach dem Tod Geschlechtsverkehr mit ihnen gehabt. Hinterher hat er sie wieder zugedeckt, als würden sie schlafen. Er hat sie auf die Stirn geküsst, ihnen Gute Nacht gesagt und ist gegangen. Er war sehr vorsichtig. Hat immer Handschuhe getragen und ein Kondom benutzt. War am ganzen Körper gewachst, um keine Haare am Tatort zu hinterlassen. Aber am Ende wurde ihm der Gutenachtkuss zum Verhängnis. Man hat seine DNA an den Stirnen der Mädchen gefunden.«
»Warum hat er das getan?«
»Warum er getötet hat?«
»Nein, warum hat er die Kinder danach wieder zugedeckt? Warum hat er es so aussehen lassen, als würden sie immer noch schlafen? Als wäre gar nichts passiert?«