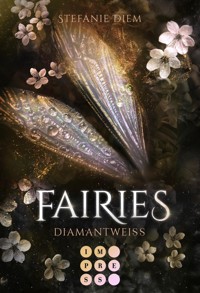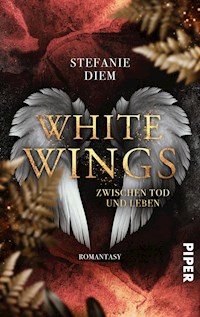5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Wundervoll
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Engel und Dämonen, Exorzismus und die drohende Apokalypse in Verbindung mit einer aufwühlenden Liebesgeschichte – für alle LeserInnen von Marah Woolf und Stella Tack »Ich hoffe, du kannst vergessen, sonst wird dich die Dunkelheit mit in die Tiefe reißen.« Aufgrund ihrer übersinnlichen Fähigkeiten wird die 17-jährige Lena in ein katholisches Internat in Deutschland gesteckt. Dort jedoch werden im Geheimen junge Mädchen in uralter, naturverbundener Magie ausgebildet und so wird Lena zu einer White Wing. Während ihrer Ausbildung zeigt sich vermehrt in ihr eine andere, dunkle Seite, die eng mit dem mysteriösen Nikolas der benachbarten Schule verknüpft ist. In Lena vereinen sich die Kräfte von Licht und Dunkelheit und machen sie zur ultimativen Waffe im drohenden Kampf gegen Dämonen. Doch wem kann sie in diesem Kampf vertrauen, wenn sie niemandem vertrauen darf? »Für mich jetzt schon ein Jahreshighlight 2022. Es war von Anfang an spannend und aufregend sowie empfand ich die Liebesgeschichte in der Story einfach prickelnd. Eine hundertprozentige Leseempfehlung meinerseits.« ((Leserstimme auf Netgalley)) »Spannende Unterhaltung, die mit diesem Band noch nicht abgeschlossen ist, sondern mit einem entsprechenden Cliffhanger endet. Die Charaktere und der Plot sind überzeugend dargestellt, man rätselt und hofft, erlebt und vermutet vieles, und wird dennoch immer wieder überrascht.« ((Leserstimme auf Netgalley))
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »White Wings – Zwischen Licht und Dunkelheit« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2021
Redaktion: Natalie Röllig
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Giessel Design
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
PROLOG
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
EPILOG
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
PROLOG
»Es war einfach unglaublich still. Daran kann ich mich noch am meisten erinnern.« Ein Mädchen mit dunkelbraunen Locken saß auf einem breiten Stuhl in einem ansonsten recht karg eingerichteten altmodischen Büro, die Hände ineinandergelegt, den Blick gesenkt. Sie war etwa zehn Jahre alt, genauso wie die anderen Mädchen und Jungen, die teilweise standen oder auf weiteren bereitgestellten Stühlen zusammengekauert saßen.
»Bis auf die keuchenden Laute«, warf ein Junge leise ein, und ein weiterer stimmte nickend zu.
»Ja, die Jackie hat so seltsam geatmet.« Das Mädchen, das zuvor gesprochen hatte, sah kurz auf und nickte.
»Hat sie verwirrt auf euch gewirkt oder als wäre sie nicht sie selbst? Wirkte sie krank?« Der Mann, der den Kindern hinter einem wuchtigen Schreibtisch aus massivem Mahagoni gegenübersaß, blickte sie interessiert über seine randlose Brille hinweg an. Vor ihm lag ein Block, auf dem er sich eifrig Notizen machte. Er trug eine bereits recht abgewetzte schwarze Lederjacke über einem weißen T-Shirt, und vor seiner Brust baumelte ein Messingkreuz an einer dünnen Kette.
»Schon irgendwie«, antwortete einer der Jungen. »Sie hat vor sich hingestarrt und gekeucht. So ging’s los.«
Zwei Kinder stimmten ihm zu, der Rest schwieg.
»Was ist anschließend passiert?« Der Priester rückte seine Brille zurecht.
Die Kinder warfen sich verstohlene Blicke zu. Schließlich war es wieder die Brünette mit den Locken, die antwortete.
»Da hat ein Mann gesprochen. Ganz leise, wie aus weiter Ferne und irgendwie dumpf. Wir haben uns umgesehen, bis uns aufgefallen ist, dass die Stimme von Jackie kam.«
»Ja, wir haben gedacht, sie hat einen MP3-Player oder so an oder will uns einen Schrecken einjagen, aber dann haben wir gesehen, dass sie einfach nur so dasitzt, vor sich hinstarrt und aus ihrem Mund diese Stimme kommt. Es war so schrecklich.« Dem Mädchen, das nun gesprochen hatte, war das Grauen deutlich anzusehen. Sie war blass wie alle Kinder in diesem Raum und zitterte unmerklich.
»Müssen sie das wirklich alles noch mal erzählen? Sie haben doch der Polizei bereits gesagt, was sie wissen«, warf nun eine Frau mittleren Alters ein, die sich ebenfalls im Raum befand und das ganze Geschehen mit kritischen Blicken und vor der Brust verschränkten Armen beobachtete.
Jetzt wandte sich der Mann mit dem Messingkreuz ihr zu. Er wirkte streng, sein Blick aus blaugrünen Augen bohrte sich förmlich in ihren. Er rieb sich kurz über das Kinn mit dem leichten Bart.
»Ich habe versprochen, mein Möglichstes zu geben, um der Familie zu helfen. Und um dieses Versprechen halten zu können, muss ich alles über den Abend in Erfahrung bringen, meine liebe Frau de Gies.«
Sie seufzte daraufhin und drehte sich lächelnd zu den Kindern. »Ihr habt es gleich geschafft, das verspreche ich euch.«
Nach einem weiteren vernichtenden Blick zu dem Herrn nahm sie wieder ihre kritische, überwachende Position ein.
»Also?« Er sprach die Kinder erneut direkt an. »Was hat die Stimme gesagt? Hat sie zu euch gesprochen?«
Verstohlene Blicke. Schließlich meldete sich einer der Jungen zu Wort. »Ja und nein. Wir haben nicht verstanden, was sie gesagt hat. Zumindest am Anfang nicht, aber irgendwann hat Jackie ihren Kopf gedreht und zu Lena geschaut. Da war es klar, dass sie mit ihr spricht.«
Der Mann schrieb eifrig mit. »Was hat die Stimme von Lena gewollt?«
Der Junge schluckte, ehe er antwortete. »Sie hat sie beschimpft und provoziert.«
»Kinder«, mischte sich Frau de Gies nochmals ein. »Ihr dürft ruhig sagen, dass Jackie und Lena sich nicht leiden konnten. – Pater, ich versichere Ihnen, es war lediglich ein kleiner Streit.«
Der Pater legte seinen Stift beiseite und warf Frau de Gies einen prüfenden Blick zu. »Vielleicht ist es besser, Sie warten draußen.«
»Was? Und lasse Sie mit den Kindern allein? Auf keinen Fall.«
Der Pater verzog kurz den Mund. Ihm war anzusehen, dass er zu einer Erwiderung ansetzen wollte, es aber bleiben ließ. Stattdessen wandte er sich von Neuem an die Mädchen und Jungen.
»Kinder, ich möchte, dass ihr eines versteht. Eure Freundin Lena hat Jacqueline geholfen, ihr sogar das Leben gerettet. Und ihr wisst, dass Jacqueline an diesem Abend nicht sie selbst war, richtig?«
Wieder sahen sich die Kinder der Reihe nach an, Verständnis zeigte sich in ihren Gesichtern, und schließlich nickten sie einvernehmlich.
»Gut, meine Aufgabe ist es, herauszufinden, wie Lena das angestellt hat. Es ist nämlich ganz und gar nicht einfach, einem Mädchen in solch einer Situation zu helfen.«
»Sie hat sie einfach umarmt«, antwortete die Brünette leise und zuckte mit den Schultern.
»Umarmt?«, hakte der Pater nach.
»Ja.« Ein blondes Mädchen rückte auf ihrem Stuhl etwas nach vorn. »Sie hat sie einfach umarmt.«
»Und dann?«
»Jackie hat angefangen, zu schreien. Mit ihrer eigenen und der fremden Stimme und ist plötzlich zusammengebrochen.« Der Junge zitterte, auch wenn er versuchte, dies mit einer aufgesetzten, coolen Miene zu überspielen.
Die Blondine begann leicht zu wimmern. »Wir dachten, sie wäre tot.«
»Aber das war sie zum Glück nicht.« Der Pater notierte eifrig.
»Gott sei Dank«, fuhr Frau de Gies dazwischen. »Sind wir jetzt fertig?«
»Eine Frage noch«, warf der Pater ein, und die Kinder, die bereits aufgesprungen waren, hielten inne.
»Habt ihr danach etwas Eigenartiges gespürt? Eine Veränderung an Lena oder Jackie?«
Das Mädchen mit den Locken drehte sich um. »Lena hat geleuchtet. Ganz kurz. Und es war ein Flimmern in der Luft, wie wenn etwas ganz heiß ist und so verschwommen aussieht, verstehen Sie, was ich meine?«
Der Pater lächelte das Mädchen an. »Ich danke euch, ihr könnt gehen.«
»Na endlich.« Frau de Gies seufzte erleichtert und öffnete die Tür. Die Kinder strömten eilig nach draußen, nur ein Mädchen mit rötlichen Haaren blieb zurück und stellte sich schließlich direkt vor den Schreibtisch. Der Pater sah auf.
»Ja, Emily?«
»Wird Jackie wieder gesund?«, fragte sie mit heller, leiser Stimme.
Er legte den Stift beiseite, presste für einen Moment die Lippen aufeinander und rang sich ein Lächeln ab.
»Ich möchte nicht lügen, Emily, und ich würde so gerne sagen, ja, das wird sie, kann dir darauf jedoch keine Garantie geben. Für den Moment sind die Voraussetzungen gut. Und sie ist in den besten Händen. Wir vertrauen auf Gott. Er wird ihr helfen, nicht wahr?«
Die Kleine nickte zögernd, wurde dann unsanft am Oberarm gepackt.
»Emily, die anderen sind schon fast auf dem Parkplatz. Komm jetzt endlich! – Pater Antonio, auf Wiedersehen.«
»Immer wieder eine Freude, Frau de Gies.«
Damit fiel die Tür knarzend ins Schloss, und Pater Antonio saß allein in seinem dunklen Büro. Er schrieb noch einige weitere Notizen in sein Buch, bevor er ein Bild hervorholte. Es zeigte ein überaus hübsches Mädchen mit dunkelblonden Haaren, durch das sich rötliche Strähnen zogen. Sie blickte ernst, und ihre schön geformten Lippen hielt sie zusammengepresst, wohingegen die grünblauen Augen vorwurfsvoll in die Kamera gerichtet waren.
Pater Antonio legte die Stirn in Falten und stützte sein Kinn auf seine zu einer Faust geballten Hand ab.
Kapitel 1
Sieben Jahre später
USA, Kalifornien, Bakersfield
»Jaaaaaaa!« Penny warf euphorisch ihre bereits an einigen Stellen durchlöcherte Tasche in die Luft, stellte sich breitbeinig vor mich und streckte die Hände nach oben.
Ich lächelte leicht und beobachtete sie.
»Sommer!«, fuhr sie fort und begann, sämtliche Blätter, Bücher und Stifte einzusammeln, die sich bei dem Wurf in alle Richtungen auf dem gepflasterten Boden verteilt hatten. »Ich sag dir, ich bin so froh, dass ich den Laden hier ein paar Wochen nicht mehr sehen muss. Und ich freu mich schon so wahnsinnig auf den Sommer! Baden, Jungs, Partys!« Sie warf dem Betonblock hinter uns einen giftigen Blick zu, schulterte ihre Tasche und hakte sich bei mir unter.
Gemeinsam gingen wir die hohen Stufen hinunter zu den Parkplätzen. Ich schwieg, obwohl ich insgeheim ihrer Meinung war. Endlich Sommerferien, kein Lernen mehr, kein stundenlanges Brüten über langweiligen Texten, Theorien, Abhandlungen, keine Lehrer, die einen mit Zukunftsplänen und Zensuren nervten.
»Hast du es dir noch mal überlegt?«, fragte Penny.
Ich seufzte. »Tut mir leid. Es geht nicht.«
»Ich verstehe immer noch nicht, warum. Hey, es ist nur L. A., nicht die Hölle! Und außerdem ist ja Laurie dabei, sie passt schon auf uns auf. Kannst du das nicht irgendwie deinen Eltern erklären?«
Ich lächelte wieder matt und schüttelte den Kopf. »Nein, ich fürchte, da kann sie nichts umstimmen. Sie kennen deine Schwester und wissen, wie« – ich machte Anführungszeichen in der Luft – »verantwortungsbewusst Laurie ist. Tut mir leid.«
Penny zog einen Schmollmund, dann reckte sie theatralisch das Gesicht nach oben. »Du weißt schon, was du verpasst, ja? Unendliche Möglichkeiten und Jungs, die noch nie ein Mädchen der Bakersfield High erblickt hat!«
Ich verzog den Mund. »Ach ja?«
»Nun ja, genau kann man das nicht sagen, aber ich gehe mal davon aus, dass zumindest achtzig Prozent der Mädels hier die dortigen Jungs noch nicht gesehen haben. Ich meine – hallo? Wir leben in Bakersfield, dem Durchreiseort nach Vegas.«
Ich lachte und nickte.
Wir blieben vor einem dunkelblauen Honda Accord stehen, der hier und dort bereits eingedellt war und dessen Lack auch schon bessere Tage gesehen hatte. Penny kramte in ihrer Tasche nach dem Schlüssel und schloss auf. Wie immer klemmte die Beifahrertür, und ich musste mich ein paarmal dagegen werfen, bis sie aufsprang und ich auf dem mit einem Ed-Hardy-Totenkopf versehenen Sitz Platz nehmen konnte.
Da startete sie auch schon den Motor, der röhrend aufheulte, und manövrierte den Wagen aus der Parklücke.
»Ich muss noch schnell ins Krankenhaus zu meiner Mom, ist das okay für dich?«
Ich presste die Lippen zusammen und hörte mich sagen: »Klar.« Ich hasste Krankenhäuser. Allein der Geruch machte mich fertig. Das jedoch war nicht der eigentliche Grund, weswegen ich medizinische Einrichtungen so gut wie möglich mied.
»Du kannst auch im Auto sitzen bleiben, wenn du willst.«
Penny kannte mich gut.
Zu meinem eigenen Erstaunen schüttelte ich den Kopf. »Nein, nein, ich begleite dich natürlich.«
Pennys Mom hatte vor wenigen Tagen eine Operation am Kniegelenk gehabt, die so weit gut verlaufen war.
»Wann darf sie denn wieder nach Hause?«, erkundigte ich mich und hielt mich am seitlichen Haltegriff fest, als Penny wie üblich stark in die Bremsen stieg angesichts einer plötzlich umschaltenden Ampel. Natürlich hatte diese zuvor ausreichend lange auf Gelb gestanden. Penny entschied sich gerne im letzten Moment dafür, nun doch nicht aufs Gas zu drücken.
»Keine Ahnung, hoffe bald«, antwortete Penny und lehnte sich lässig aus dem geöffneten Fenster.
Die Sonne brannte wie üblich heiß auf uns herab, als wir den runden Vorplatz des Memorial Hospitals betraten, und wir waren froh, ins kühlere, klimatisierte Innere treten zu können. Sofort befiel mich dieses eigenartige und mittlerweile so vertraute Gefühl. Mein Herz schlug schneller, ich zitterte unmerklich und wurde nervös – als säße ich vor einer Klassenarbeit, auf die ich nicht vorbereitet war.
»Alles in Ordnung?«, fragte Penny, der meine Veränderung natürlich nicht entgangen war.
»Alles gut. Es ist nur, du weißt ja, dass …«
»Du nicht gern in Krankenhäuser gehst, jaja. Aber wie gesagt, du kannst gern auch draußen im Auto warten.«
Erneut versicherte ich ihr, dass alles in Ordnung sei. Ich wollte mir keine Blöße geben, und verdammt, ich würde es doch wohl schaffen, meine beste Freundin zu ihrer Mutter zu begleiten.
Penny zuckte mit den Schultern und ging weiter.
Mrs. Walker lag auf der Station für Orthopädie, und bereits auf dem Weg dorthin wurde das Gefühl übermächtig. Kurz vor der Glastür, hinter der der Gang zu den einzelnen Zimmern lag, hielt ich inne und atmete tief durch. Penny beobachtete mich kritisch.
»Ist dir schlecht? Musst du dich übergeben?«, fragte sie.
Ich schüttelte den Kopf, obwohl ihre Sorge gar nicht so unberechtigt war.
»Hör zu, ich glaube, es ist besser, du gehst runter in die Kantine, holst dir was zu trinken und zu essen und wartest da auf mich. Ich beeil mich, ja?«, schlug sie vor, und dieses Mal nickte ich.
Als die Glastür hinter Penny zufiel, stürmten die Bilder auf mich ein, und dieses Mal kamen sie zusammen mit unglaublichen Kopfschmerzen. Ich wollte mir am liebsten die Hände auf die Schläfen pressen, stattdessen zwang ich mich, die Stufen zurück nach unten zu gehen. Langsam, eine nach der anderen.
Endlich unten kam mir ein älterer Mann entgegen. Mit der rechten Hand umklammerte er einen klapprigen Infusionsständer, an dem eine halb leere Flasche baumelte. Einige Rollen daran stellten sich quer, sodass er jetzt mit beiden Händen nach der Stange greifen und schieben musste, während er an mir vorbeiging. Er lächelte matt, und in diesem Moment durchzuckte es mich wie ein Stromschlag.
»Drei Tage«, sagte eine helle Stimme in meinem Kopf, und ich sah ihn vor mir, in seinem Krankenhausbett liegend, schwächer, blasser. Drei verschwommene Personen saßen bei ihm, eine Frau hielt seine Hand, als er die Augen für immer schloss. Ich wartete, bis das Adrenalin nachließ und die Bilder verschwammen. Der Mann blieb stehen und sah mich prüfend an, bevor er mich anlächelte und dann seinen Weg samt Infusionsständer fortsetzte.
Ich ließ den Atem entweichen, den ich instinktiv angehalten hatte, und schüttelte den Kopf.
Dann suchte ich nach der Kantine und lief achtlos in ein junges Paar hinein, das ich Trampel jäh auseinandergerissen hatte. Ich konnte gerade noch ein kleines »Sorry« hauchen, da durchfuhr mich ein erneuter Stromschlag.
»Mai«, hörte ich eine Stimme.
Ich wurde von einer Welle der Euphorie und Freude erfasst, die mich mitriss, und ohne es zu wollen, sagte ich: »Herzlichen Glückwunsch! Es wird ein Mädchen!«
Die beiden hielten inne, sahen erst einander, dann wieder mich an, und ich wurde mir bewusst, was ich soeben getan hatte. Schnell versuchte ich, das wieder hinzubiegen.
»Oh, entschuldigen Sie bitte, ich habe Sie verwechselt.«
Ich musste einen hochroten Kopf haben, zumindest fühlte es sich so an. Daher wandte ich mich eilig von beiden ab und spürte ihre Blicke in meinem Rücken, als ich schneller wurde und fieberhaft nach dem Ausgang suchte. Raus. Ich musste hier einfach nur raus.
Ich steuerte auf die große gläserne Drehtür zu und lief natürlich prompt in jemanden hinein.
Ich stolperte, konnte mich noch rechtzeitig abfangen, um nicht zu stürzen, stieß ein schnelles »Sorry« aus und wollte weiter. Da hielt mich mein Gegenüber sanft am Handgelenk fest.
»Alles in Ordnung?«, fragte jemand mit einer warmen, tiefen Stimme.
Wie in Zeitlupe drehte ich mich um.
Kapitel 2
Die Zeit blieb gefühlt stehen. Ich sah ihn an, blickte in zwei hellblaue Augen, in denen kleine goldene Lichtpunkte aufleuchteten, betrachtete sein ebenmäßiges Gesicht, das wie aus einem Gemälde zu sein schien. Perfekt. Das war das passende Wort für den Jungen, der vor mir stand und mich ebenso gebannt anstarrte wie ich ihn. Die Energien, die zwischen uns flossen, waren unbeschreiblich, stark und mächtig. Es fühlte sich an, als ob sich alles um mich herum drehte, und unglaubliches Glück durchströmte mich. Und mein Herz, es schlug so schnell, dass es mir beinahe Angst machte.
Irgendwann jedoch wurde es zu viel. Mir wurde schwindlig. Das Blut raste nur so durch meinen Körper, mein Kopf schmerzte, als ob er dabei wäre, auseinanderzubrechen, und schließlich gaben meine Beine nach. Ich sackte wie in Zeitlupe in mich zusammen. Kurz bevor ich auf dem Boden aufprallte, merkte ich, wie mich starke Arme umfassten, ich atmete ein und spürte Wärme und Geborgenheit, bevor die Dunkelheit nach mir griff und mich mit sich zog.
Ich ging über verdorrtes Land, rissige, ausgetrocknete Erde, aus der hier und dort schwarze, tote Äste nach oben ragten, als würden sie ihre Arme Hilfe suchend gen Himmel recken. Doch von dort würde keine Hilfe kommen, nie mehr. Alles war verloren.
Unter mir knackte etwas, als ich mich vorsichtig weiterbewegte. Es war das Skelett eines toten Wesens, ich vermutete, ein Tier, welches durch meinen Tritt in sich zusammenfiel. Die Sonne hing flammend rot und von tiefschwarzen Schwaden umringt am Himmel, als würde sie bluten. Vielleicht tat sie das auch. Ich kratzte mich am Hals und stellte fest, dass meine Haut sich in Fetzen löste. Aber ich spürte keinen Schmerz. Schon lange nicht mehr. Die Fähigkeit, zu fühlen, hatte ich schon lange verloren.
Ich ging in die Knie, wollte weinen, schreien, doch der einzige Laut, der über meine Lippen kam, war ein Keuchen, als ich fiel. Ich fiel durch den Boden hindurch, verlor jeglichen Halt und sank in die Unendlichkeit.
Ich merkte erst, dass ich schrie und mich wand, als mich links und rechts Hände an den Oberarmen packten, meinen Körper in die Waagrechte brachten und in weiche Kissen drückten.
»Schschsch, Liebes, alles gut, wir sind da. Alles ist gut«, hörte ich die beruhigende Stimme meiner Mutter dicht an meinem Ohr und merkte, wie sich mein Körper langsam entspannte. Mom war bei mir.
Es war ein Traum gewesen. Alles nur ein schrecklicher Traum. Mein keuchender Atem wurde ruhiger, und auch mein Herzschlag verlangsamte sich. Ich wagte es, die Lider zu öffnen, und blickte in die grünen Augen meiner Mutter, die mich sanft anlächelte. Sie bemühte sich, freundlich zu wirken, doch ich kannte den Ausdruck. Sie sorgte sich unglaublich um mich, und ich konnte es ihr nicht verdenken.
Ich hatte bereits zu einem Lächeln angesetzt, entschied mich jedoch im letzten Moment dagegen. Stattdessen wanderte mein Blick zu meiner Linken, und erwartungsgemäß saß dort mein Vater.
Seine sanften braunen Augen waren auf mich gerichtet, und er lächelte.
»Was machst du nur für Sachen?«, fragte er schließlich kopfschüttelnd, und Mom seufzte.
»Ich nehme an, ich bin immer noch im Memorial?«, hakte ich nach und blickte mich im Zimmer um.
Kahles Krankenhauszimmer, weiße Decken und Wände, links von mir ein Vorhang, der mich vom Patienten nebenan abtrennte, rechts von mir eine schlichte Holzwand, in die kleine Schranktüren eingearbeitet waren.
Meine Mutter nickte und stellte sich aufrecht hin.
»Du hattest Glück im Unglück, würde ich sagen.«
Ich zog die Stirn kraus. »Ihr hättet mich sonst nicht in ein Krankenhaus gebracht, wäre ich nicht schon in einem gewesen, richtig?«
Meine Eltern warfen sich kurze Blicke zu, ehe sich meine Mutter wieder an mich wandte. An ihrer ernsten Miene konnte ich die Antwort jedoch ablesen.
»Nein, hätten wir nicht. Wir kennen die Diagnose bereits, die die Ärzte stellen werden.«
»Schizophrenie?«, mutmaßte ich, und sie nickte.
»Aber wir wissen natürlich, dass das nicht stimmt«, fügte sie hinzu und streichelte mir liebevoll den Arm.
Ich atmete tief durch, schloss die Augen, und als ich sie wieder öffnete, fragte ich leise: »Und was, wenn es stimmt?«
Sie sah mich verwundert an. »Wie kommst du denn darauf, Liebes? Auf keinen Fall.«
»Aber diese Visionen, Mom. Das ist doch nicht normal. Und heute …« Ich schluckte, überlegte, was ich ihr alles erzählen konnte.
»Was heute?«, hakte sie nach und rückte etwas näher.
Ich biss mir auf die Lippen, rang für einen Moment mit mir. »Na ja, ich habe schon wieder den Tod eines Menschen vorausgesehen und habe gespürt, dass eine Frau schwanger ist. Die Visionen werden immer realer. Ich kann sie bald nicht mehr vom wahren Leben unterscheiden. Alles verschwimmt ineinander.«
Ich strich mir eine rötliche Haarsträhne aus dem Gesicht, die sich aus meinem streng geflochtenen Zopf gelöst hatte. Wieder diese Blicke zwischen ihr und meinem Vater, die ich nicht ausstehen konnte.
»Lena, Liebes«, setzte er in einem verständnisvollen Ton an, da wurde er von einem Mann in einem weißen Arztkittel unterbrochen, der das Zimmer betrat. Sein Blick galt zuerst mir, dann der Akte, die er in der Hand hielt.
Meine Mutter ging schnell ein paar Schritte zur Seite, als sich der Arzt neben mein Bett stellte und mich freundlich anlächelte.
»Hallo Magdaleeena«, sprach er meinen Namen wie üblich recht holprig und englisch mit einem I statt einem E aus. »Ich bin Dr. Wayland. Wie geht es dir?«
Ich schielte zu meiner Mutter, die reglos neben dem Arzt stand, und zuckte mit den Schultern. »Soweit ganz gut, glaube ich.«
Ich hörte selbst, wie unsicher das klang. Der Arzt warf mir einen skeptischen Blick zu.
»Hast du irgendwelche Beschwerden?«, hakte er weiter nach und hielt nun einen Stift bereit, um sich Notizen in der Akte zu machen.
Ich verneinte, und er notierte etwas.
»Ist dir kalt? Warm?«
»Angenehm.«
»Bist du oft müde, antriebslos?«
Ich verneinte, dachte aber an so manche Schulstunde, in der ich k. o. mit dem Kopf auf der Tischplatte gelegen hatte angesichts des unglaublich interessanten Unterrichts. Einmal war ich tatsächlich für wenige Sekunden weggedöst. Trotzdem blieb ich bei meiner Antwort.
»Hast du in letzter Zeit übermäßig zugenommen?«
Ich erschrak und überlegte, ob ihm klar war, welche Emotionen seine Frage im Kopf einer Siebzehnjährigen auslösten – überhaupt in jedem Kopf einer Frau. Und auf eine andere Frau im Raum war wie immer Verlass.
»Na hören Sie mal, meine Tochter ist sehr schlank und durchtrainiert durch ihr Cheerleading, das sehen Sie doch? Es ist offensichtlich, dass sie nicht übermäßig zugenommen hat. Da hätte sie ja zuvor magersüchtig sein müssen.«
Der Arzt reagierte nicht wirklich auf den Einwand meiner Mutter, sondern machte sich stumm Notizen, ehe er seine Fragerei fortsetzte.
»Gut. Hast du an dir schon einmal Bewegungsstörungen wie Muskelzucken oder Schlafstörungen bemerkt?«
Ich schüttelte vehement den Kopf.
»Hören Sie«, mischte sich meine Mutter wieder ein. »Meine Tochter ist nicht verrückt.«
Der Arzt warf zuerst mir, dann ihr einen skeptischen Blick zu. Nun legte er zum ersten Mal, seit er dieses Zimmer betreten hatte, die Akte weg und nahm meine Mutter ein Stück beiseite. Dennoch konnte ich verstehen, was er leise zu ihr sagte.
»Mrs. Bergmann.« Wie viele Amerikaner sprach er unseren Nachnamen eher wie einen Burger aus – Börgmän. »Ihre Tochter lag hier und hat von der drohenden Apokalypse, den sieben Plagen und sonstigen Dämonen gesprochen, die die Erde heimsuchen werden.«
Mehr brauchte er gar nicht zu sagen. Ich sah förmlich, wie es hinter Moms Stirn arbeitete. Verzweifelt suchte sie nach einer guten Erklärung für mein Verhalten, irgendwie schien ihr aber keine einzufallen. Wie denn auch? Nicht einmal ich selbst konnte es mir erklären.
Seit der eigenartigen Sache vor sieben Jahren, nach der wir Hals über Kopf aus Deutschland geflohen waren (meine Eltern bezeichneten es als Auswanderung aufgrund des neuen Jobs meines Dads, ich als Flucht vor meinem Verhalten und den Folgen), passierten mir immer häufiger komische Dinge. Zunächst traten die Halluzinationen vereinzelt auf, oftmals nur einmal im Jahr oder gar nicht. Danach häuften sie sich, und in den letzten beiden Jahren überfielen sie mich so oft, dass ich bereits mehrmals hatte vom Unterricht fernbleiben müssen. Natürlich hatte ich die Symptome einer Schizophrenie gegoogelt und wollte mich sogar einmal selbst an einen Psychiater wenden, doch meine Mutter hatte mich jedes Mal davon abgehalten. Ihrer Meinung nach war ich einfach ein wenig gestresst von der Schule und benötigte Ruhe. In meinem Alter angeblich vollkommen normal.
»Nun ja, sie hatte schon immer eine rege Fantasie, unsere Lena. Aber ich versichere Ihnen, dass sie wirklich gesund ist.«
»Nun, physisch gesund ist sie, wir müssen natürlich noch einige Tests machen, aber soweit sieht es gut aus«, warf Dr. Wayland ein. »Wie es allerdings mit Ihrer Psyche aussieht …«
»Mit ihrer Psyche sieht es auch gut aus«, mischte sich nun mein Vater streng ein und allein am Tonfall erkannte ich, dass er in dem Moment keine Widerworte duldete. Leider wusste das Dr. Wayland noch nicht.
»Hören Sie, Mr. Bergmann«, versuchte es der Arzt versöhnlich. »Ich weiß ja, es ist schwer, sich einzugestehen, wenn jemand aus der eigenen Familie psychiatrische Hilfe benötigt. Und ich möchte hier auch niemandem etwas unterstellen. Wie gesagt, wir möchten noch einige Tests mit ihr machen, auf physischer und psychischer Ebene. Sie wollen sicherlich auch, dass diese Anfälle aufhören, nicht wahr?«
Oh, geschickter Schachzug. Ich sah gespannt von meinem Vater zu meiner Mutter und wartete auf ihre Reaktionen, doch auf Mom war wie immer Verlass.
»Was für Anfälle? Das heute war lediglich eine Reaktion auf die Hitze. Das schlägt ihr manchmal auf den Kreislauf«, erklärte sie sachlich, trat näher zu mir und strich mir liebevoll über den Arm.
Dr. Wayland seufzte. »Gut, ich kann sie nicht gegen ihren Willen hierbehalten. Aber …«
»Und wenn ich mich gerne in Behandlung begeben möchte?«, schaltete ich mich dazwischen und spürte, wie meine Mutter ihren Griff um mein Handgelenk verstärkte. Dr. Wayland sah überrascht auf. Anscheinend hatte er damit nicht gerechnet. Um ehrlich zu sein, nicht einmal ich.
»Du weißt also, dass etwas mit dir nicht stimmt, nicht wahr, Lena?« Beinahe triumphierend schaute er zu meinen Eltern. Mom war zu einer Art unbeweglicher Säule erstarrt, während mein Vater zwischen ihrer und meiner Aussage hin- und hergerissen schien. Er wirkte aber weder zornig noch freundlich, sondern verzog einfach nur das Gesicht.
Ich seufzte und schloss für einen kurzen Moment die Augen.
Dass etwas mit mir nicht stimmte.
Das war mir bereits klar, seit ich ein kleines Mädchen gewesen war, welches einer Klassenkameradin einen derartigen Schock versetzt hatte, dass diese in die Klapse hatte eingewiesen werden müssen. Mom hatte damals zu mir gesagt, der Teufel lebe in mir, ein Satz, für den sie sich zwar gefühlt tausendmal entschuldigt hatte, der jedoch bis heute an mir nagte.
Wie würde wohl ein Psychiater reagieren, wenn ich ihm all meine besonderen Fähigkeiten auflistete?
»Ich denke, mit mir ist alles in Ordnung«, sagte ich und hörte selbst die Resignation in meiner Stimme. Der Arzt sah mich skeptisch an und atmete schließlich tief ein und aus.
»Gut, ich möchte mich noch kurz mit einem Kollegen beraten, dann …«
»Nein.« Meine Mutter trat vehement vor ihn. »Wir werden unsere Tochter jetzt mitnehmen.«
Der Arzt sah offensichtlich ein, dass er verloren hatte, und nickte resignierend.
»Du weißt, du kannst jederzeit Hilfe bekommen«, sagte er leise zu mir – und an meine Eltern gerichtet in lauterem Ton: »Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun.«
Doch davon ließen sie sich nicht im Geringsten beirren und wandten ihre volle Aufmerksamkeit mir zu.
Wir waren kaum zu Hause angekommen, da klingelte es bereits an der Haustür, und Penny stürmte herein. Sie war außer sich, ihre ohnehin wilden, dunklen Haare umrahmten ihr Gesicht wie eine Mähne, und ihre große Brille saß schief auf ihrer ebenfalls recht großen Nase. Abgehetzt setzte sie sich zu mir aufs Sofa, auf welches mich meine Mutter verwiesen hatte.
»Du hast mir vielleicht einen Schrecken eingejagt, als ich dich nirgends mehr finden konnte!«, plapperte sie mit aufgerissenen Augen los. »Ich habe solche Ängste ausgestanden, das glaubst du nicht!«
Ich lächelte sie an und freute mich ehrlich über ihren Besuch. Penny war immer da, wenn ich sie brauchte, und wusste genau, wie sie mich aufheitern konnte.
»Aber zum Glück war da dieser absolut heiße« – sie blinzelte theatralisch – »Typ in der Lobby, der mir erklärt hat, dass er dich hat einweisen lassen.«
Angesichts meiner wohl etwas erschrockenen Miene fügte sie schnell hinzu: »Oh, er hat eine rücksichtsvollere Ausdrucksweise benutzt, warte mal, er sagte so was wie: ›Ich hab mich um sie gekümmert.‹«
Sie zuckte vielsagend mit den Augenbrauen, und mir wurde plötzlich ganz anders zumute. Hitze stieg in mir auf, gemeinsam mit dem Bild des blonden Jungen, der mich so in seinen Bann gezogen hatte, dass ich doch tatsächlich ohnmächtig geworden war. Schnell nahm ich meine Hand vors Gesicht. Wie hatte ich ihn nur vergessen können?
»Gott, das ist alles so peinlich!«
Penny legte mir mitfühlend eine Hand aufs Knie. »Ach Süße, so schlimm wird es schon nicht sein. Oder was haben die Ärzte gefunden? Bist du sehr krank? Oder hast du nur einen an der Waffel?«
Sie lachte lautstark über ihren eigenen Witz, doch ich konnte nicht mitlachen. Schnell erkannte sie, dass sie den Bogen überspannt hatte, und setzte eine ernste Miene auf.
»Jetzt sag mal, was fehlt dir? Wieso bist du einfach zusammengeklappt?«
»Die Ärzte haben nichts gefunden, zumindest rein physisch bin ich gesund.«
»Also hast du tatsächlich … ähm, ich meine …« Sie brach ab und biss sich auf die Unterlippe.
»Wirklich einen an der Waffel? Keine Ahnung.« Ich zuckte mit den Schultern.
»Wie ist das Ganze denn passiert? War dir schwindlig oder schlecht?«
»Nein, ich wollte gerade nach draußen, frische Luft schnappen, da war plötzlich dieser Junge, und ich bin genau in ihn hineingelaufen.«
»Oh, wie romantisch!« Sie seufzte schwärmerisch. »Hat er dich aufgefangen, wie es sich gehört?«
Ich lächelte und spürte, wie ich rot wurde. »Ja, schon irgendwie. Dann wurde mir schlecht, ich bekam schreckliche Kopfschmerzen und ja, das war alles.« Ich hielt inne und dachte an diesen sagenhaften und auch irgendwie schrecklichen Moment zurück.
Penny runzelte die Stirn. »Hm, das klingt ja irgendwie sehr … wie soll ich sagen … seltsam.«
»Ich weiß noch nicht mal, wie er heißt«, sagte ich und hörte selbst die Enttäuschung in meiner Stimme.
»Aber ich«, erwiderte sie zu meiner Überraschung. »Er heißt Jonathan Prince und war nur zu Besuch im Krankenhaus. Er lässt freundlich grüßen und hofft, dass es dir bald wieder besser geht. Ich wollte noch nach seiner Nummer fragen, da war er schon weg. Aber du kennst ja meine Devise: Wenn es sein soll, treffe ich ihn wieder.«
Ich zog erstaunt die Augenbrauen hoch und wollte schon sagen: »Du triffst ihn wieder?«, riss mich aber im letzten Moment zusammen und lachte nur.
»Du bist einfach so herrlich optimistisch, Penny.«
»Schätzchen, man muss optimistisch sein in dieser Welt, sonst kann man nicht überleben. Außerdem ist da ja noch das World Wide Web.«
Wieder musste ich grinsen. »Und du meinst wirklich, es gibt nur einen Jonathan Prince in Bakersfield und Umgebung?«
Sie ließ sich wie üblich nicht beirren. »Zumindest keinen zweiten, der so verdammt perfekt aussieht und auch noch so freundlich und hilfsbereit ist.«
Schon hatte sie ihr Handy gezückt und tippte und scrollte darauf herum.
»Und? Wie viele Ergebnisse?«, fragte ich, nachdem sie bereits eine Weile auf das Display gestarrt hatte.
Sie seufzte. »Zu viele.«
Ich nickte triumphierend, aber auch ein wenig traurig. Sie würde ihn nie finden, zumindest nicht in den sozialen Netzwerken, dessen war ich mir eigenartigerweise sehr sicher.
»Das entmutigt mich kein bisschen. Wie gesagt, wenn es sein soll, führt uns das Leben wieder zueinander.«
Ich lachte kurz auf, und sie legte ihr Handy beiseite.
»So, jetzt wieder zu dir. Was sagen denn die Ärzte?«
Ich schwieg und überlegte, ob ich ihr ernsthaft erzählen sollte, dass der Arzt mich am liebsten hätte in Therapie schicken wollen. Penny war meine beste Freundin, aber meine abnormen Visionen und Fähigkeiten hatte ich bisher recht gut vor ihr verheimlichen können, obwohl es in der letzten Zeit immer schwieriger geworden war, da die Anfälle häufiger auftraten. Ich wusste, dass ich es ihr irgendwann erzählen musste.
»Wie gesagt: dass mir körperlich nichts fehlt. Mom ist der Meinung, ich sei einfach von der Schule gestresst.«
Penny nickte. »Da kann sie durchaus recht haben. Die haben uns in der letzten Zeit ganz schön rangenommen. Gott sei Dank sind jetzt erst einmal Ferien, und dann beginnt unser letztes Jahr. Kannst du das glauben? Bald ist die High-School vorbei. Schon heftig, oder?«
Sie lehnte sich auf dem Ledersofa zurück, verschränkte die Arme hinter dem Kopf und sann über ihre Zukunft nach. Letzteres vermutete ich einfach mal. Im Hintergrund hörte ich meine Mutter telefonieren und überlegte selbst, wie meine Zukunft aussehen würde. Ich schluckte. Mein letztes High-School Jahr. Danach hieß es vermutlich Abschied nehmen von Penny. Sie war clever, eine der Jahrgangsbesten und ich zweifelte nicht daran, dass sie an einem guten College angenommen wurde. Bei mir sah es da anders aus. Ich war keine schulische Leuchte und hatte, ehrlich gesagt, noch überhaupt keinen Plan vom Leben. Natürlich würde ich versuchen, irgendwie aufs College zu kommen, aber was, wenn ich es nicht schaffte? Schnell wechselte ich das Thema.
»Wie geht es denn deiner Mom?«, fragte ich, und Penny lächelte.
»Sie darf morgen nach Hause. Zum Glück. Ich meine, sind wir mal ehrlich, ich bin jetzt nicht wirklich dafür geschaffen, den Haushalt bei uns zu schmeißen, oder?«
»Lena, hast du Hunger? Ich könnte Schnitzel machen«, rief in dem Moment meine Mutter aus der Küche, und wie aufs Stichwort begann mein Magen zu knurren. Panierte Schnitzel waren mein absolutes Leibgericht und erinnerten mich immer ein klein wenig an Deutschland.
»Gerne«, rief ich zurück, dann fiel mein Blick auf den sehnsüchtigen von Penny, und hastig fügte ich hinzu: »Kann Penny auch mitessen?«
Eigentlich war es vielmehr eine rhetorische Frage, denn Penny aß so oft bei uns, dass sie schon fast zur Familie gehörte. Zu meiner Überraschung kam Mom mit einer ernsten Miene ins Wohnzimmer.
»Hallo, Penny, schön, dass du nach Lena siehst«, wandte sie sich zunächst an meine Freundin, bevor sie mich ansah. »Um ehrlich zu sein, möchten dein Vater und ich uns heute Abend gerne mit dir über etwas unterhalten, unter sechs Augen, wenn du verstehst. – Nichts gegen dich, Penny, du bist uns immer ein willkommener Gast, nur heute geht es leider nicht.«
»Klar, Mrs. Bergmann, kein Problem.« Auch sie sprach unseren Namen wie einen Burger aus, aber bei ihr klang das immer irgendwie süß. Meine Mutter war blass und wirkte angespannt, was sich jetzt auf mich übertrug. Was hatten die beiden wohl Wichtiges mit mir zu besprechen?
Obwohl die Schnitzel so wie immer schmeckten, bekam ich so gut wie keinen Bissen hinunter, denn die Stimmung war so angespannt, dass sie mir förmlich auf den Magen schlug.
Jeder schnitt schweigend kleine Stücke von seinem Fleisch ab, schob sich die Gabel so vornehm wie möglich in den Mund und kaute anschließend darauf herum, als wäre es das Köstlichste auf Erden, obwohl es sich für mich im Moment eher wie Kaugummi anfühlte, den man bereits seit Stunden im Mund herumschiebt, zäh und trocken. Leises Schmatzen, gefolgt von weiteren Schneide- oder Trinkgeräuschen, gepaart mit dem monotonen Ticktack der Wanduhr erfüllten den Raum. Meine Mutter blickte auf ihren Teller, als müsste sie ihn genauestens studieren, und mein Vater starrte einfach nur vor sich auf sein Glas, in Gedanken meilenweit weg.
»Pennys Mom darf morgen nach Hause«, sagte ich schließlich, weil ich diese Stille nicht mehr aushielt.
Mom sah kurz auf und lächelte. »Das freut mich für sie. Und natürlich auch für Penny.«
Wieder Schweigen. Wieso sprach denn niemand dieses Thema an, welches vorhin noch so unglaublich wichtig und dringend schien?
Zu meiner Überraschung war es Dad, der das Wort ergriff.
»Ich hatte heute Vormittag noch ein Gespräch mit Mr. Souther«, sagte er und nahm einen Schluck, ehe er mich direkt ansah. Mr. Souther war mein Klassenleiter, und daher ahnte ich bereits, in welche Richtung sich die Thematik weiterentwickeln würde.
Ich sah meinen Vater erwartungsvoll an, erwiderte jedoch nichts.
»Er sagt, deine Leistungen nehmen kontinuierlich ab. Wenn es so weitergeht, sieht es nicht gut aus für deinen Abschluss im nächsten Jahr, von den College-Bewerbungen ganz zu schweigen.«
Ich seufzte, legte Messer und Gabel beiseite und trank nun auch einen Schluck. »Ich weiß ja, Dad, aber ich möchte nicht unbedingt aufs College, ich …«
»Das sagt doch auch niemand«, mischte sich nun meine Mutter ein, und ihre Stimme klang in meinen Ohren um einiges lauter als die ruhige, tiefe Stimmlage meines Dads. »Mäuschen, ich glaube, du hast tiefschürfende Probleme.«
Oh, welch gehobene Wortwahl. Tiefschürfend. In meinem Innersten wusste ich, dass es für mich das Beste wäre, jetzt zu schweigen und sie einfach nur anzustarren, doch ich ging auf ihren Satz ein.
»Nur weil ich im Krankenhaus ohnmächtig geworden bin?«
Meine Eltern sahen sich an, und ich konnte genau beobachten, wie sie stumm vereinbarten, dass mein Vater sich ab sofort zurückzog und nur in Notfällen das Wort ergreifen sollte.
»Du weißt genau, was ich damit meine, und ich möchte dir sagen: Es ist nichts Schlimmes daran, wenn man sich Hilfe holt.«
Ich runzelte die Stirn. »Ich dachte, du bist dagegen, dass ich zu einem Psychiater gehe?«
Sie stieß ein kleines Lachen aus. »Gott bewahre, ich bin immer noch dagegen. Diese Quacksalber, die deine ganze Lebensgeschichte aus dir herauspressen und dafür horrende Summen einsacken, nur um dir am Schluss doch nicht helfen zu können. Nein, nein.« Sie wirkte verunsichert. Eine ganz neue Seite an ihr.
»Was willst du mir sagen, Mutter? Ich habe schlechte Zensuren, ja, gebe ich zu. Ich war in letzter Zeit öfter unkonzentriert, ja, aber ich rapple mich wieder hoch. Ich büffle, das versprech ich euch. Ich schaff das schon, wirklich.«
Sie seufzte wieder, und mein Vater hatte mittlerweile in Rekordzeit seinen Teller geleert, während ich dazu übergegangen war, Messer und Gabel beiseitezulegen.
Jetzt legte auch Mom ihr Besteck neben dem Teller ab, stützte die Ellbogen auf den Tisch und verschränkte die Finger unter dem Kinn. Dann atmete sie tief durch, und der Blick, den sie mir nun schenkte, erschreckte mich.
»Es geht um die Tatsache, dass du … wie soll ich sagen … über gewisse Fähigkeiten verfügst, die ich – und das muss ich leider zugeben – ignoriert habe, so gut es ging. Schon damals, als die Sache mit Jackie passiert ist, habe ich dir vorgespielt, ich wüsste nicht, was mit dir geschieht.«
Ich zog die Augenbrauen hoch. »Du hast gesagt, ich sei verrückt, ich hätte Jackie provoziert, obwohl alle anderen das Gegenteil behauptet haben. Jackie hat mich provoziert, nicht ich sie. Ich … ich meine, du hättest dabei sein sollen …«
Bilder stiegen in mir auf. Der wahnsinnige Blick, Jackies Fingernägel, die unkontrolliert über die Tischplatte kratzten und dort Furchen hinterließen. Diese seltsame Stimme … Schnell schüttelte ich den Kopf, um nicht mehr daran denken zu müssen. Damit hatte all das angefangen. Das war mein Schlüsselerlebnis, und wenn ich hätte zu einem Therapeuten gehen dürfen, wäre dies das Erste gewesen, was ich ihm erzählt hätte.
»Nein, ich möchte nicht mehr daran denken. Es ist Vergangenheit, und ich kann euch nur versprechen, ich werde mich bessern.«
Mom seufzte und schwieg für einen Augenblick, den mein Vater ausnutzte.
»Deine Mutter möchte dir auf ihre Art sagen, dass sie glaubt, du besitzt übersinnliche Fähigkeiten.«
Ich sah erst ihn und dann sie entgeistert an.
»Ich verstehe euch langsam nicht mehr. Ihr sagt diesem Dr. Wayland, ihr glaubt, ich sei einfach nur gestresst und dass mein Verhalten ganz normal sei. Und jetzt sagt ihr, ihr glaubt, ich hätte übersinnliche Fähigkeiten?« Ich fuhr mir durch die Haare. »Ich weiß selbst nicht, was mit mir los ist. Manchmal habe ich ja auch das Gefühl, dass ich nicht von dieser Welt bin, aber was, wenn das alles wirklich nur sehr real wirkende Halluzinationen sind? Was dann? Ich habe Angst, dass ich mich in einer Art eigenen Welt verliere und bald nicht mehr weiß, was wirklich ist und was nicht!« Ich schob meinen Stuhl zurück und stand auf. »Für mich wird es immer wahrscheinlicher, dass das der Anfang einer psychischen Störung ist, und hättet ihr mich damals vor sieben Jahren schon in Therapie geschickt, wäre es sicher nicht schlimmer geworden.« Ich warf meine Serviette auf den Teller, drehte mich um und wollte aus dem Zimmer stürmen, da sagte meine Mutter leise: »Deine Großmutter war auch so wie du.«
Ich hielt inne, machte in Zeitlupe kehrt und sah sie verblüfft an. »Wie bitte?«
Mom hatte ihren Blick wieder auf ihren Teller geheftet und sagte noch leiser als zuvor: »Sie hatte dieselben Visionen, konnte oft tagelang im Voraus den Tod eines Menschen vorhersagen oder wusste, wann eine Schwangerschaft vorlag oder eintreten würde. Und sie war in der Lage, Menschen auf wundersame Art zu heilen.«
Ich sank wieder auf meinen Stuhl. »Wieso hast du mir das nie erzählt?«
Sie zuckte mit den Schultern, und in ihren Augen standen Tränen. Dad strich vorsichtig über ihre Hand, die jetzt auf der Tischplatte lag, und sah sie mitfühlend an.
»Weil ihre Geschichte kein gutes Ende nahm.«
Die Stille, die nun über dem Raum lag, war so voller Spannung, dass man es beinahe knistern hörte. Wollte ich wirklich wissen, was mit meiner Großmutter geschehen war?
»Was ist passiert?« Ich sprach die Worte ruhig und so leise aus, dass sie kaum zu hören waren.
Mom seufzte und atmete wiederholt tief ein und aus, ehe sie sprach. »Eines Tages kamen Menschen zu ihr, die sie mitnahmen. Sie hatte versucht, einen kleinen Jungen zu heilen, war jedoch gescheitert, sodass er verstarb. Man beschuldigte sie, eine alternative Therapiemethode angewendet zu haben, die ihm mehr geschadet als geholfen habe, und bezichtigte sie der fahrlässigen Tötung.«
Ich blieb stocksteif sitzen, unfähig, mich zu bewegen.
»Sie wurde für unzurechnungsfähig erklärt und in eine Anstalt eingewiesen, in der sie einen Monat später starb. Ich habe sie nur ein einziges Mal besuchen können.«
Eine Gänsehaut überzog über meinen Körper. »Aber du … du hast mir doch erzählt, sie … sie starb in einem Kloster?«
Ein kleines Lächeln huschte über ihr Gesicht, das ihre Augen allerdings nicht erreichte und schnell Tränen wich, die ihr über die Wangen rannen. »Ich konnte dir die Wahrheit nicht erzählen, nicht nachdem ich auch an dir solche Fähigkeiten bemerkt habe, lange bevor das mit Jackie passiert ist.«
Ich sah auf, glaubte nicht, was ich da hörte.
»Du warst drei Jahre alt, bist gerade in den Kindergarten gekommen und hast draußen mit einem anderen Mädchen Fangen gespielt. Sie ist hingefallen, hat sich das Knie aufgeschürft und blutete. Du bist einfach hingegangen, hast darüber gestreichelt, und die Verletzung war verschwunden. In diesem Moment wusste ich, du bist wie sie.«
Sie machte eine kleine Pause, nahm ihre Serviette zur Hand und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht.
»Und mir war klar, dass ich dich beschützen musste. So erzählte ich dir, dass deine Oma eine Ordensschwester war, die in ihrem Konvent gestorben ist. Und ich hab mir geschworen, dich nie in Therapie zu geben, komme, was wolle. Ich weiß nicht, was sie in dieser Anstalt mit ihr gemacht haben, aber ich wusste, ich musste dich davor schützen.«
Ich schluckte, verarbeitete diese Informationen erst einmal.
»Aber, Mom, damals waren die Psychiatrien doch nicht so wie heute. Außerdem musst du mich ja nicht einweisen. Ich kann Stunden bei einem Therapeuten nehmen. Das tun heutzutage viele, auch viele an meiner Schule … Ich …«
Mom schüttelte vehement den Kopf und hob die Hand, um mich zu unterbrechen.
»Nein, kein Psychiater und kein Therapeut der Welt kann dir helfen, das weiß ich jetzt.« Sie schluckte ein weiteres Mal, hob dann den Kopf und sah mir direkt in die Augen. »Aber … und das weiß ich jetzt auch, wenn wir nichts unternehmen, wird es schlimmer und schlimmer. Die Macht wird dich über kurz oder lang in die Knie zwingen, wenn du nicht lernst, mit ihr umzugehen.«
»Die Macht?« Ich runzelte die Stirn. »Mom, so langsam glaube ich, ein Therapeut würde uns beiden nicht schaden, Obi-Wan Kenobi.«
»Das ist kein Spaß, Lena!« Sie wurde laut und schob beim Aufstehen den Stuhl zurück. »Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich weiß, wir hätten dich vor sieben Jahren schon dorthin schicken müssen, und ich weiß, dass ich das vielleicht nie wiedergutmachen kann, aber …«
»Moment.« Ich streckte die Hand abwehrend nach vorn. »Wohin schicken? Was soll das heißen?«
Wieder einmal atmete sie durch, schloss die Augen, wappnete sich.
»Ich hatte heute ein Gespräch mit einem« – sie schien nach dem richtigen Wort zu suchen, was mich nur noch mehr verwirrte – »Institut in Deutschland, das sich auf solche Fälle wie dich spezialisiert hat, und ich … wir konnten dich dort unterbringen. Du wirst ab September dort zur Schule gehen.«
Kapitel 3
Ich war sprachlos, wusste wirklich nicht, was ich sagen sollte. Ich sah sie einfach nur mit offenem Mund an, sie und meinen Vater, die einander zunickten und sich trostspendende Blicke zuwarfen.
»Ich soll zurück nach Deutschland? Das ist nicht euer Ernst«, sagte ich schließlich. »Nein, das mach ich nicht. Auf gar keinen Fall. Das könnt ihr nicht von mir verlangen. Ich habe mir hier ein neues Leben aufgebaut – wie ihr übrigens auch – mit neuen Freunden. Ich kann unmöglich zurück nach Deutschland. Das geht nicht. Wie stellt ihr euch das überhaupt vor, so kurz vor dem Abschluss?«
»Du verstehst nicht ganz. Die Sache ist nicht verhandelbar. Wir haben dich bereits angemeldet.« Meine Mutter klang jetzt wieder ernst, gefasst, sie war ganz Herr der Situation – dachte sie zumindest.
»Aber noch ist nicht alles entschieden«, fügte mein Vater in versöhnlicherem Ton hinzu und erntete dafür von Mom einen vernichtenden Blick. »Du musst in der nächsten Woche eine kleine Prüfung absolvieren, die darüber entscheidet, ob du wirklich aufgenommen wirst. Also ist noch alles in der Schwebe.«
Wenn Blicke töten könnten, würde mein Vater in dem Moment wie ein Häufchen Asche in sich zusammenfallen.
Ich lachte auf und griff mir fahrig in die langen Haare. »Ich glaube das einfach nicht. Ihr denkt doch nicht allen Ernstes, dass ich nächste Woche nach Deutschland fliege, um einen Test für eine Schule oder ein Institut, wie du es nennst, zu machen, obwohl ich bereits weiß, dass ich da niemals hingehen werde?«
»Ich sage es noch einmal, die Sache ist nicht verhandelbar.« Moms Stimme war hart. Sie klang beinahe wie eine Richterin, die das Urteil verkündete.
»Und selbst wenn ich dorthin fliege – ihr glaubt nicht allen Ernstes, dass ich diesen Test bestehe?«
Ein Lächeln legte sich auf die Lippen meiner Mutter. »O doch, das glaube ich.«
Ich fasste es nicht, dass ich tatsächlich hier war. Ich sah mich um, blickte zum Himmel, über den unaufhörlich Flugzeuge zogen. Einige landeten, andere waren gerade gestartet. Was hätte ich dafür gegeben, wieder in einem von ihnen zu sitzen, auf dem Weg zurück.
Es war ungewöhnlich heiß für Deutschland, auch für Mitte August. Ich war zwar mittlerweile an Hitze gewöhnt, begann dennoch in meinem langärmligen Shirt und der Jeans, die ich vorsichtshalber angezogen hatte, zu schwitzen.
»Puh, ganz schön heiß«, sagte meine Mutter hinter mir und setzte sich ihre Sonnenbrille auf die Nase, während sie nach einem Taxi Ausschau hielt. Dad manövrierte in der Zwischenzeit unsere Koffer hinter uns durch die Gegend.
Auf den Feldern, an denen wir wenig später mit unserem Mietwagen entlangfuhren, wurde reichlich Mais geerntet, die Wiesen wirkten trocken, und selbst die Vögel schienen der brennenden Sonne aus dem Weg zu gehen.
Etwas mehr als eine Stunde dauerte die Fahrt, vorwiegend über eine im Vergleich zu den Dimensionen der Interstates in den USA recht schmale, an vielen Stellen lediglich zweispurige Autobahn. Das letzte Stück der Strecke bestand aus einer kleinen Landstraße, die sich in unzähligen Kurven über das hügelige Land erstreckte und dabei oftmals durch Wälder und Einöden führte, bis wir eine größere Ortschaft passierten.
Der Marktplatz gefiel mir überraschend gut. Mit seinem Kopfsteinpflaster, dem barocken Brunnen, den schmucken Cafés und Läden wirkte er unglaublich gemütlich. Die vielen Sonnenschirme und großen Blumenkübel, aus denen Geranien in sämtlichen Rottönen leuchteten, verliehen dem Ganzen ein leicht mediterranes Flair.
Etwas außerhalb der Ortschaft tauchte vor uns ein wuchtiges, aber zugegeben beeindruckendes Bauwerk auf. Ein lang gezogenes Kirchengebäude mit runden Türmen und unzähligen Nebenbauten thronte auf einem mit Veilchen und weiteren Blumen bepflanzten Hügel, überwachte sozusagen die Stadt majestätisch von außerhalb.
Dad fuhr die Straße entlang, die um die gigantische Kirche herumführte und dann auf einem Parkplatz endete.
Mir stockte der Atem. »Nicht euer Ernst, oder? Sagt mir nicht, euer Institut ist ein Kloster. Nein, nein und nochmals nein, ihr steckt mich nicht in ein Kloster!« Ich hatte die Hände zu Fäusten geballt und starrte entsetzt auf die hohen Mauern, die die Kirche und sämtliche Gebäude, die damit verbunden waren, umgaben. In Gedanken sah ich mich schon in einer schwarzen Kutte durch mittelalterliche Gänge huschen, in gebückter Haltung mit stets gefalteten Händen.
»Hm«, sagte Dad und starrte auf das Navigationsgerät des Leihwagens. »Nein, wir sind hier schon richtig.«
»Oh, sehr schön«, erwiderte ich giftig. »Das habt ihr ja geschickt angestellt. Verkauft mir dieses Institut als Schule für meine magischen Fähigkeiten, und jetzt entpuppt es sich als katholisches Kloster, das mir meine Hexenkräfte austreiben soll, oder wie stellst du dir das vor, Mom?«
Meine Mutter schwieg, doch an ihrem angespannten Gesichtsausdruck erkannte ich, dass sie sich zusammenriss, um mir keine patzige Antwort zu geben.
»Das Internat gehört zum Kloster, ja, befindet sich jedoch in einem anderen Gebäude, so hat man es mir gesagt. Ich werde kurz mal nachfragen.« Damit stieg sie aus dem Auto und schritt den gepflasterten Weg entlang, der zu einem der großen Anbauten führte, die auf mich wie ein Gefängnis wirkten.
»Komm, wir nutzen die Zeit und vertreten uns etwas die Beine«, schlug mein Vater vor und öffnete nun seinerseits die Autotür.
Ich atmete noch ein paarmal durch, in der Hoffnung, die Wut und Frustration in mir etwas zu zügeln, und stieg dann auch aus. Und tatsächlich, als ich einen Fuß auf den rauen Asphalt des Parkplatzes setzte, durchzuckte mich ein überwältigendes Gefühl. Dies hier war kein gewöhnlicher Ort. Ich spürte eine unglaubliche Energie. Im Boden zu meinen Füßen, in den Blättern und der Rinde der großen Birken, die den Parkplatz säumten, ja sogar in den dicken Mauern, die so bedrohlich auf mich wirkten. Ich nahm einen tiefen Atemzug. Die Luft hier war so frisch und rein, wie ich sie in Bakersfield noch nie erlebt hatte.
»Herrlich, nicht?«, sagte neben mir mein Vater, der mich lächelnd beobachtete und ebenfalls tief ein- und ausatmete.
Ich konnte nicht anders und nickte, sah staunend auf die weiten Wiesen vor uns und atmete noch einmal tief durch. Meine Sinne wirkten wie geschärft, jedes Geräusch war mit einem Mal lauter, jedes Objekt deutlicher, jedes Gefühl intensiver. Was für ein eigenartiger Ort war das hier?
In diesem Moment kam eine winkende Person auf uns zu. Mom. In der Hand hielt sie einen Zettel, mit dem sie eifrig wedelte.
»Die Schule ist dort drüben, auf der anderen Seite der Straße.«
Sofort drehte ich mich in die Richtung, in die sie immer noch deutete, und entdeckte ein ähnlich wuchtiges barockes Bauwerk. Es war wie die Kirche lang gezogen, besaß mehrere breite Eingänge, die über Treppen zu erreichen waren, viele Mauervorsprünge, Dächer und kleine Türme. Direkt davor lag ein größerer Teich, in dem zwei Springbrunnen ihre Fontänen links und rechts einer Brücke in die Lüfte spritzten, die zur doppelflügligen Eingangstür führte. Ich verengte die Augen zu Schlitzen. Für mich wirkte auch dieses Gebäude wie ein Gefängnis und sah mir noch immer viel zu sehr nach Kloster aus, aber die eigenartige Energie, die hier alles erfüllte, hatte mich neugierig gemacht. Vermutlich spürte ich innerlich, dass ich hierhergehörte, auch wenn mein Verstand das noch nicht akzeptieren wollte.
Mom hatte uns inzwischen erreicht und zeigte mir das Blatt in ihren Händen. Santa Luzia stand in großen, verschnörkelten Buchstaben über einem Bild, welches exakt das lang gezogene Haus auf der anderen Straßenseite zeigte.
»Santa Luzia«, sagte ich stirnrunzelnd und sah meine Mutter prüfend an. »Was hast du noch mal gesagt? Kein Kloster?«
Mom schüttelte den Kopf. »Ist es auch nicht. Die Schule wird zwar von Nonnen geführt, gehört aber nicht unmittelbar zum Kloster, zumindest nicht mehr.«
Ich verzog den Mund.
»Na komm schon, hör dir zumindest an, was die Schwestern dir zu sagen haben, und schau dir die Räume an. Wenn es dir absolut nicht zusagt, verspreche ich dir, musst du nicht bleiben. Aber …« Sie sah mich traurig an. »… dies hier ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, dich zu retten, glaub mir. Kein Psychiater der Welt wird es verstehen. Sie hier schon.«
Ich war immer noch nicht überzeugt, folgte meinen Eltern schließlich. Eine kleine Brise kam auf, umwirbelte mein Haar, und ich glaubte, irgendetwas flüstern zu hören, da rief mir Mom zu, die den Abstand zu mir mittlerweile vergrößert hatte: »Jetzt komm schon her, Lena!«
Ich beeilte mich, zu den beiden aufzuschließen.
Ein kleiner Weg führte von einem schmiedeeisernen, weit offen stehenden Tor direkt zur Brücke über den Teich mit den Springbrunnen und dann über breite Stufen den Hügel hinauf, wo er auf einem gepflasterten Hof endete. Ich stemmte schwer atmend die Hände in die Hüften – die Treppe war doch steiler gewesen als angenommen – und betrachtete skeptisch die vielen Eingänge.
Auch meine Mutter runzelte die Stirn. »Ich denke, wir nehmen am besten die goldene Mitte«, sagte sie und deutete auf den Eingang unmittelbar vor uns.
Ich zuckte die Schultern und folgte ihr widerstandslos.
Im Innern der Schule empfing uns eine angenehme Kühle, die jedoch nicht von einer Klimaanlage zu kommen schien, sondern von den dicken Mauern und kalten steinernen Wänden in der barocken Empfangshalle herrührte. Links und rechts führten wuchtige Marmortreppen mit ebenfalls aus Marmor bestehenden Säulen in die oberen Etagen, und direkt vor uns, unterhalb der Balustrade, ragte die weiße Gipsstatue einer Frau empor, die die Arme majestätisch zur Seite streckte.
»Oh«, sagte meine Mutter, und ich wusste nicht, ob das Begeisterung oder Verwunderung ausdrückte.
Ein Mädchen kam soeben aus einer Seitentür und machte sich daran, die linke der beiden Treppen hinaufzusteigen, da rief meine Mutter sie zu sich.
»Hallo, wir … ich … meine Tochter soll heute eine Aufnahmeprüfung ablegen. Wo befindet sich denn die Anmeldung?«
Das auffällig hübsche Mädchen mit den dichten schwarzen Augenbrauen, die allerdings überhaupt nicht zu dem ansonsten roten Haar passten, musterte uns der Reihe nach eingehend, und ich wurde das Gefühl nicht los, dass ich sie von irgendwoher kannte.
»Das hier ist der Schuleingang. Das Sekretariat befindet sich vorne im Verwaltungstrakt. Einmal wieder raus, nach rechts zum Seitenflügel und dort die erste Tür. Es steht auch angeschrieben.«
Sie nickte uns zu und setzte ihren Weg die Treppe empor fort, nicht ohne unglaublich mit dem Hintern zu wackeln.
Wir fanden das Sekretariat tatsächlich ziemlich schnell, das im Gegensatz zur barocken Schuleingangshalle wie ein normales Büro aussah, mit einem breiten, hohen Empfangstresen, hinter dem eine freundliche Dame mittleren Alters saß und uns herzlich willkommen hieß.
»Sie müssen Familie Bergmann sein, ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Anreise?«
Ich musste unwillkürlich grinsen. Sie war seit Langem die erste Person, die unseren Familiennamen richtig aussprach. Irgendwie ungewohnt.
»Danke, ja, der Flug war ruhig und auch die Fahrt hierher ohne große Staus«, erwiderte meine Mutter lächelnd und reichte ihr einige Papiere.
»Das freut mich. Manchmal geht es auf der A96 doch recht wild zu.« Die Sekretärin lachte. »Ich werde der Mutter Oberin gleich Bescheid geben, dass Sie da sind.«
»So viel zum Thema ›kein Kloster‹«, zischte ich meiner Mom zu, während die Empfangsdame im Korridor verschwand. »Mutter Oberin?«
»Die Schule gehört definitiv nicht zum Kloster, ich habe dir schon gesagt, dass sie von Nonnen geführt wird. Ist es da so verwunderlich, dass die Schulleiterin eine ehrwürdige Mutter ist?«
Ich bezweifelte stark, dass die Schule nicht zum Kloster gehörte, aber gut. Jetzt war ich hier, ein Zurück würde es so schnell nicht geben. Allerdings musste ich zugeben, dieser Ort hatte etwas Besonderes. Ich fühlte es mit jeder Faser meines Körpers.
Etwa zehn Minuten später kam die Frau zurück in Begleitung einer älteren Ordensschwester. Sie war bekleidet mit der typischen Nonnenkluft: pechschwarze Kutte, kleiner weißer Kragen, schwarze Kopfbedeckung, breites Kreuz um den Hals. Gleich als sie den Raum betrat, suchte sie mit ihren Augen hinter den runden, altmodischen Brillengläsern nach mir und musterte mich prüfend.
Mom, die offensichtlich nicht recht wusste, wie man diese Frau anzusprechen hatte, knickste leicht. »Ehrwürdige Mutter, es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen.«
Ich verkniff mir ein Lachen und dachte insgeheim: »Mom, das ist doch keine Königin«, obwohl ich zugeben musste, dass sie tatsächlich ein bisschen wie eine wirkte, wie sie so dastand, die Hände ineinander gefaltet, den Kopf leicht erhoben. Ja, ein bisschen wie die Queen.
»Mutter Oberin oder einfach nur Oberin genügt vollkommen. Herzlich willkommen in Santa Luzia.« Sie reichte meiner Mutter die Hand. »Sie müssen Magdalena sein?«, wandte sie sich an mich, und ich nickte.
»Ja, ich bin Magdalena Bergmann«, antwortete ich und hoffte, dass ich meine Unsicherheit gut überspielt hatte.
»Mein Name ist Mutter Maria Helena, Schulleiterin des Internats. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu können. Eine Schwester wird Ihnen gleich im Anschluss die Zimmer zeigen. Den Aufnahmetest habe ich für morgen angesetzt, ich hoffe, das passt Ihnen?«
»Ach, wir nehmen gerne ein Zimmer in einem Hotel unten in der Stadt«, mischte sich plötzlich mein Vater ein und erntete dafür einen strengen Blick der Oberin.
»Das ist nicht nötig. Für die Dauer des Aufnahmeprozesses sind Sie unsere Gäste. Das ist bei jedem unserer Schüler so«, erklärte sie sachlich, aber in einem Ton, der keine Widerworte duldete, und ich fragte mich unwillkürlich, was sie denn mit »Aufnahmeprozess« meinte.
»Frau Scheufer, geben Sie bitte Schwester Ava Bescheid, ja?«
Die Sekretärin nickte und ging zum Telefon.
»Ich muss mich jetzt leider entschuldigen, unsere Novizin, Schwester Ava, wird Ihnen die Zimmer und restlichen Räume wie den Speisesaal und die Gärten zeigen. Spätestens zum Abendessen sehen wir uns wieder.«
Ohne ein weiteres Wort war sie verschwunden. Meine Mutter sah mich und Dad achselzuckend an, und ich war mir sicher, dass diese Oberin tatsächlich wie eine Königin die Schule regierte.
Schwester Ava war mir im Gegensatz zu ihrer Chefin vom ersten Augenblick an sympathisch. Ihr Schleier war anders als die der meisten Schwestern hier weiß anstatt schwarz, und sie erklärte mir, dass sie eine Novizin war, also praktisch noch in der Nonnenausbildung.
Ende der Leseprobe