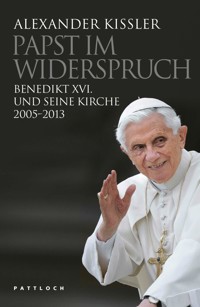4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Phrasen regieren uns. Sie täuschen etwas vor, was nicht da ist: einen klugen Gedanken, eine tiefe Einsicht, eine hohe Moral. Sie sind Behauptungen, denen nicht auf den Grund gegangen werden soll, rhetorisches Lametta fast ohne Substanz.
Alexander Kissler, bekannt scharfzüngiger Autor im politischen Berlin, greift zum Rasiermesser der Logik und seziert die Begriffe hinter den Worten, die Mechanik hinter der Rhetorik, den Sinn jenseits des Unsinns. Humorvoll, pointiert und elegant stößt er das allgegenwärtige große Blabla vom Thron. Fünfzehn exemplarisch ausgewählten Sätzen von „Wir schaffen das“ bis zu „Das ist alternativlos“ verweigert er die Gefolgschaft.
»Wen beim freihändigen Gebrauch politischer Phrasen eine leichte Übelkeit erfasst, dem sei dieses Buch ans Herz gelegt. Nach der Lektüre ist einem, wie bei einem guten Tonikum, bedeutend wohler.«
Jan Fleischhauer
- Neues vom Meister des Widerspruchs
- Kisslers klare Kante
- Scharfzüngig und debattenfreudig
- Tacheles statt Täuschung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 246
Ähnliche
Alexander Kissler
Widerworte
Warum mit PhrasenSchluss sein muss
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
Copyright © 2019 Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
Umschlagmotiv: © basketman26 – Fotolia.com
ISBN 978-3-641-24121-6V001
www.gtvh.de
Die Sprache wurde einmal erfunden, um sich zu verständigen und um etwas auszudrücken.
Heute soll mit der Sprache etwas versteckt werden.
(Felix Magath)
INHALT
EINLEITUNG
Fünfzehn Phrasen, denen widersprochen werden muss
KAPITEL 1
»Heimat gibt es auch im Plural«
KAPITEL 2
»Vielfalt ist unsere Stärke«
KAPITEL 3
»Wir schaffen das«
KAPITEL 4
»Jeder verdient Respekt«
KAPITEL 5
»Religion ist Privatsache«
KAPITEL 6
»Europas Werte ertrinken im Mittelmeer«
KAPITEL 7
»Willkommenskultur ist der beste Schutz vor Terror«
KAPITEL 8
»Solidarität ist keine Einbahnstraße«
KAPITEL 9
»Unser Reichtum ist die Armut der Anderen«
KAPITEL 10
»Menschlichkeit kennt keine Obergrenze«
KAPITEL 11
»Angst hat man vor dem, was man nicht kennt«
KAPITEL 12
»Gewalt ist keine Lösung«
KAPITEL 13
»Haltung zeigen!«
KAPITEL 14
»Das ist alternativlos«
KAPITEL 15
»Wir müssen zur Sacharbeit zurückkehren«
EINLEITUNG
Fünfzehn Phrasen, denen widersprochen werden muss
Wer über die Worte bestimmt, der beherrscht das Denken. Wer ein neues Denken etablieren will, muss den Worten einen neuen Sinn geben. Solche Umwertungsversuche hat es immer gegeben, und es gibt sie heute. Der Begriff »Mut« etwa meint manchmal die Tugend dessen, der im Widerspruch zu den herrschenden Tendenzen seiner Zeit handelt, und manchmal ist er nur das Etikett auf einem gewünschten Konsumverhalten. Mutig soll es nach dem Willen der werbetreibenden Industrie sein, gewisse Möbel zu kaufen, eine gewisse Ernährungsform zu befolgen, die richtigen exotischen Urlaubsziele anzusteuern. Oder seine Zustimmung zur Mehrheit zu signalisieren. »Sei mutig, sei du selbst«, wird dann praktisch zu: »Sei wie alle anderen!«
Lange freilich, bevor es zu einer globalen Umwertung der Worte kommt, die vom Sinn den Laut zurücklässt und diesen neu beschriftet, gibt es ein Interregnum der entleerten Begriffe. Wenn die Zeichen nicht trügen, befinden wir uns in einer solchen Zwischenphase. Im Interregnum sind die vertrauten Worte alle noch da, und sie rufen noch den bekannten Sinn hervor. Heimat ist die Gegend, der man entstammt, Respekt die Achtung, die ein Mensch aufgrund seiner Taten oder seiner Überzeugung verdient, Solidarität der verlässliche Zusammenhalt in schwieriger Zeit, Menschlichkeit das moralische Minimum und Angst die Wachsamkeit nach schlimmer Erfahrung. Durch ihre ritualisierte Verwendung zu strategischen Zwecken jedoch passen die Worte nicht mehr in den Kontext, in dem man sie aufruft. Sie werden zu Platzhaltern, Leerstellen, verbalem Treibsand – und behaupten doch das Gegenteil.
Der Ausdruck ist im Interregnum nicht zur Lüge geworden, aber zur Phrase, zum Allgemeinplatz, der das Denken verriegelt. Die Phrase ist allgegenwärtig, weil sie konkurrenzlos bequem eingesetzt werden kann. Sie täuscht die Tiefe eines Gedankens vor, den ein anderer gedacht hat. Sie simuliert Originalität. Sie inszeniert Individualität. Sie bedürfte der Auslegung, die sie durch ihren rhetorischen Gestus und ihren Kontext gerade verhindern will. Sie gibt sich differenziert und ist ein einziges Basta. Sie klingt nach individueller Sorge und ist ein kollektives Herrschaftsinstrument. Deshalb ist die Politik das natürliche Habitat der Phrase.
Der französische Schriftsteller Léon Bloy veröffentlichte 1902 und 1912 seine zweibändige »Auslegung der Gemeinplätze«. Sie besteht aus insgesamt 127, wie es im Vorwort heißt, Klischees oder Redensarten oder »abgedroschenen Sentenzen«. Bloy wollte zeigen, dass sich hinter gedankenlos dahingeplapperten Sätzen oder Ausdrücken wie »Das Bessere ist des Guten Feind«, »Man kann nicht alles haben«, »Ohne Schweiß kein Preis«, »Man stirbt nur einmal«, »Zeit ist Geld« ein Sinn verbergen kann, der der unmittelbaren Behauptung glatt entgegensteht. Im Eintrag »Der Fanatismus« heißt es kühl, »Fanatismus – das ist, wenn man in Hinsicht auf etwas Beliebiges ja oder nein sagt.« Der Begriff wurde durch ständigen Gebrauch und durch die Zeitumstände vom Ausnahmetatbestand zum Regelfall. Nicht mehr die extreme, sondern bereits jede klar umrissene, feste Meinung zieht sich den Vorwurf des Fanatismus zu. Gefragt ist laut Bloy das allzeit geschmeidige Sowohl-als-auch, die nette Unverbindlichkeit. Geschieht heute Vergleichbares mit den Begriffen »Hetze«, »Hass«, »Alternativlosigkeit«?
Am Beispiel von »Geschäft ist Geschäft« erläutert Bloy, wie Phrasen funktionieren: »Von allen gewöhnlich so respektablen und sachlichen Gemeinplätzen halte ich diesen hier für den gewichtigsten, für den erhabensten. Er ist der Nabel aller Gemeinplätze, er ist der Schlüsselsatz des Jahrhunderts. (…) Es ist unmöglich, haargenau zu sagen, was das ist – das Geschäft. Es ist die geheimnisumwobene Gottheit, etwas wie die Isis der Großschnauzen, von der alle anderen Götter verdrängt werden. (…) Geschäft ist Geschäft, wie Gott Gott ist, das heißt jenseits aller Erklärungen. Das Geschäft ist das Unerklärliche, das Unbeweisbare, das Unbeschreibliche, und zwar so weitgehend, dass es genügt, diesen Gemeinplatz auszusprechen, um auf der Stelle alle Vorwürfe, alle Wutausbrüche, alle Klagen, alle Bitten, alle Entrüstungen und alle Gegenanklagen zum Verstummen zu bringen. Wenn man diese Fünf Silben ausgesprochen hat, ist alles gesagt; man hat auf alles Erdenkliche geantwortet, und es besteht keinerlei Hoffnung mehr auf fernere Offenbarung.«
Die bewährte Phrase beendet jenen Dialog, für den sie wirbt. Und hat im Zentrum eine allgemeine Leere – unerklärlich, unbeweisbar, unbeschreiblich –, die das Kleid des Besonderen und Konkreten sich übergeworfen hat. In der Politik sorgen Phrasen dafür, dass verlautbart und monologisiert und applaudiert werden kann, ohne das Risiko der Widerrede einzugehen. Phrasen vermitteln den irrigen Eindruck, sie wären das Ergebnis eines langen Nachdenkens; dabei stehen sie dessen Beginn breit und feist im Weg. Stoppschilder sind sie, nicht Wegweiser. Schon Ambrose Bierce, ein amerikanischer Schriftstellerkollege Bloys, verzweifelte schier an den durch moralischen Dauergebrauch oder strategische Instrumentalisierung ausgeleierten Worten. Er schrieb zwischen 1869 und 1906 an seinem ebenso süffigen wie gehässigen »Wörterbuch des Teufels«, streng alphabetisch geordnet. »Redekunst« definierte er darin als eine »Verschwörung zwischen Sprache und Handeln zu dem Zweck, den Verstand zu hintergehen.« Das Adjektiv »widerlich« beschreibe die »Eigenart fremder Meinungen«.
Der Publizist Gabor Steingart schrieb Mitte Oktober 2018 nach der bayerischen Landtagswahl mit fast Bierce’scher Bissigkeit: »Alle besitzen heute verbriefte Rechte, um sich wehren zu können. Nur die Worte nicht. Sie werden entwurzelt, entführt und schließlich misshandelt, als sei die Geschichte der menschlichen Zivilisation grußlos an ihnen vorbeimarschiert. Alle sprechen vom Tierwohl, das Wohl der Worte wird weiträumig ignoriert. Andrea Nahles sagt ›Erneuerung‹ und meint doch nur wieder sich selbst. Horst Seehofer spricht von ›gründlicher Analyse‹ und übersetzt das mit ›jetzt nicht‹. Alle Wahlverlierer verlangen nach ›Klarheit und Wahrheit‹ und meinen damit die Vertuschung derselben. Wer ›Rücktritt‹ sagt, hat ausschließlich den des Gegners im Sinn. Jeder erklärt jeden zum ›Populisten‹ und will damit doch nur den Andersdenkenden diffamieren. So wird die demokratische Unmöglichkeit zur neuen Normalität.«
War das je anders, ließe sich entgegnen. Wann ging man zu Politikern, um dort Klarheit und Wahrheit zu bekommen, reinsten Wassers? Dürfen Politiker überhaupt mit ihrem Herz auf der Zunge hausieren gehen, wenn ihr Tagesgeschäft darin besteht, hinter verschlossenen Türen Kompromisse zu erzielen? Doch die Lage ist verzwickter denn je. Das rhetorisch-moralische Tremolo der Politik läuft zunehmend hohl und wird befeuert durch eine öffentlich-mediale Redeweise, die die Implosion der Begriffe im Gleichklang vorantreibt. In einer liberalen Republik sollte es ein Gegenüber geben, einen oppositionellen öffentlichen Geist, wie er sich etwa in den 1960er und 1970er Jahren manifestierte. Wohin ist er entschwunden?
Man lese etwa beim linken Sozialphilosophen Ulrich Sonnemann, einem Vor- und Mitdenker der Studentenbewegung, wie sehr er sich über den Konformitätszwang in Adenauers Deutschland, dieser »einheitlichen Banausokratie«, empören konnte. In seinem 1964 erschienenen Buch über »Die Einübung des Ungehorsams in Deutschland« wandte er sich explizit gegen die »Diffamierung des Dagegenseins«. Sonnemann beklagte bitter, dass der Staat in Deutschland »nicht Funktion menschlicher Freiheit ist, sondern umgekehrt: er selbst also sie dem Volk erst gewährt.« Der staatsfromme Bürger, der sich Freiheit gerne zuteilen lässt, weil er es in ihrem Zuviel nicht aushielte: Ist diese deutsche Malaise wirklich Vergangenheit?
Damals war, in Sonnemanns Worten, »die Freiheit, welche die Vernunft ebenso postuliert wie voraussetzt, (…) in Deutschland (…) kein Besitz, sondern immer noch eine Aufgabe.« Ist sie, die Freiheit, heute errungen, oder sind die faktischen Fortschritte durch mannigfach ausdifferenzierte neue Freiheitsrechte nur Bruchstücke, die neue Unfreiheiten mit sich tragen? Damals, 1964, war der Deutsche laut Sonnemann ein gehorsamkeitsfixiertes Gewohnheitstier. »Ein Wort wie Einmütigkeit«, schrieb er, »schwellt heute noch (…) dem Durchschnittsdeutschen das anderweitig so langsame Herz, weit entfernt ist er, sich zu schütteln, wie er doch sollte, wenn er es hört oder anwendet: Beschlüsse, das ist seine feste Überzeugung, sind umso besser, je einmütiger sie gefasst werden.« Der Deutsche, ein Stabilitätsnarr im Konsenswahn: Ist das so lange her? Oder gilt Kritik, die heute vor allem eine Kritik der Phrase sein muss, noch oder wieder als Unbotmäßigkeit?
Es war ebenfalls Ulrich Sonnemann, der der Kraft des aus den Fängen der Phrase befreiten Wortes vertraute: »Überraschen kann das Wort, wo es am genauesten, festesten, hellsten, kurz aufklärendsten ist«. Wo es den Allgemeinplatz verlässt und sich erklärt, gelegen oder ungelegen. Kurt Tucholsky hätte da zugestimmt, denn »nichts ist schwerer und erfordert mehr Charakter, als sich im offenen Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen: Nein.«
Eben darum muss mit Phrasen Schluss sein: damit das Denken beginnen und die Freiheit wachsen kann.
KAPITEL 1
»Heimat gibt es auch im Plural«
Es nahm kein gutes Ende mit der »Neuen Heimat«. Die gleichnamige Immobiliengesellschaft des Deutschen Gewerkschaftsbundes musste Ende der 1980er Jahre abgewickelt werden. Mehrere Vorstandsmitglieder hatten sich persönlich bereichert, die Schulden waren enorm gestiegen. Damit verschwand ein vorbelasteter Name endgültig vom Markt. Schon die Nationalsozialisten hatten unter derselben Überschrift Wohnungen gebaut und verwaltet, vornehmlich für Arbeiter. Lag das finale Fiasko der »Neuen Heimat« nur an Missmanagement und Korruption? Oder wurde da von Anfang an ein falscher Traum verkauft? Kann es eine neue Heimat geben für den, der umzieht, weil er es will oder muss?
Heute sind wir einen Schritt weiter. Nicht mehr die Frage, ob es eine neue Heimat geben kann, beschäftigt die spätmoderne Multioptionengesellschaft, sondern die Frage, ob ein Mensch mehrere Heimaten haben kann. Nicht nur sprachlich lauern da Herausforderungen. »Plural selten« steht im Sprachlexikon hinter der Form »Heimaten«. Kein Wunder, ist Heimat doch etymologisch der Ort, wo der Mensch sein Heim gefunden hat, wo er daheim ist. Man kann sich beheimaten, kann heimatverwurzelt oder heimatvertrieben sein, kann heimgehen, heimkommen, heimkehren. Bewegungen sind damit beschrieben, die ein klares Ziel haben und nur eines. Heimat ist demnach, wo man ankommt aus der Ferne. Wo man aufbricht, kann nicht schon Heimat sein, sonst wäre es ein Kreislauf, unterschiedslos, bitter, von Heimat über Heimat zur Heimat. Wenn alles Heimat wäre, gäbe es keine.
Dennoch war es dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier von der SPD wichtig, in seiner Rede am Tag der Deutschen Einheit 2017 zu sagen und im Mai 2018 zu bekräftigen: »Heimat gibt es auch im Plural. Ein Mensch kann mehr als eine Heimat haben und neue Heimat finden. Das hat die Bundesrepublik für Millionen von Menschen bewiesen, und es hat uns bereichert.« Besagte Bundesrepublik – es ist wohl die deutsche gemeint – ist in der Tat ein Fleckenteppich verschiedener Herkünfte. Steinmeier sprach im Mai 2018 vom »Respekt vor der Vielfalt unserer Wurzeln«. Lassen wir hier offen, ob bloße Vielfalt, eine schiere Menge also, schon Anspruch auf »Respekt« habe – eher: nein, hat sie nicht –, was Respekt eigentlich meint (siehe dazu die Kapitel 2 und 4) und wenden uns der Steinmeier’schen Doppelthese zu. Sie lautet: Es gibt Menschen mit mehreren Heimaten, und diese mehrfache Verwurzelung tut Deutschland gut.
Bei Letzterem ergeben sich freilich neue Schwierigkeiten, diesmal botanische, nicht sprachliche. Keine Pflanze, kein Baum ist bekannt, der mehrere Wurzelgeflechte hätte. Wurzeln können tiefer reichen oder flacher gründen, doch es ist immer ein und dasselbe Geflecht. Wurzeln wandern nicht, sie teilen sich mit. Auf diesem Gedanken basiert die philosophische Weltbegründung Emanuele Coccias, »Die Wurzeln der Welt«. Und der Mensch, ein Naturwesen auch er, soll desto stärker die spätmoderne Welt bereichern, je überzeugter er darauf beharrt, mehrere Wurzeln zu haben? Das fasse, wer es kann.
Der deutsche Schriftsteller Rudolf Borchardt, der sich zuweilen zu den Heimatlosen rechnete und weite Teile seines Lebens in der Toskana verbrachte, wusste schon in der Weimarer Republik: »Wir haben eine gemeinsame Wurzel, aber unsichtbar tief im Boden.« Die Deutschen seien »nicht wirklich uneinig, wir sind verschieden.« Eine solche »deutsche Vielfachheit« mache Deutschland als Idee wie als Realität geradezu aus. Borchardt meinte damit den Reichtum der Regionen und Stämme, zwischen Königsberg und München, Köln und Berlin, aber auch die »gemeinsame Bildungsgeschichte«. Irgendwann erwächst aus dieser für jeden Zugewanderten, Angekommenen, Heimatlosen die Zugehörigkeit zu dieser und keiner anderen Heimat – oder die bewusste Abkehr. In Italien begriff sich Borchardt mit wachsender räumlicher und zeitlicher Distanz als programmatischen Deutschen. Im Barbarismus der Nationalsozialisten sah er, der Preuße jüdischer Herkunft, einen Verrat deutscher Traditionen. Er trug seine Wurzel mit sich, verpflanzte sie in fremder Erde, ohne neue Wurzeln auszubilden. Verhält es sich mit Mesut Özil und Ilkay Gündogan anders?
Die beiden Profifußballer vom FC Arsenal London und von Manchester City besuchten im Mai 2018 auf ihren eigenen Wunsch oder auf sanftes Drängen des DFB hin Bundespräsident Steinmeier auf Schloss Bellevue. Danach gab das Staatsoberhaupt die Worte von der »Heimat im Plural« von sich. Harmonie und Normalität sollten vermittelt werden. Die beiden Millionäre in sportiver Kleidung, sakkolos, krawattenfrei, stehen auf dem Foto, das vom Dreiergipfel Kunde gibt, einigermaßen lässig, leicht gebogen, neben einem lächelnden Schlossherrn. Alles gut, alles supi. Die Fußballweltmeisterschaft in Russland stand vor der Tür und keinem der Beteiligten der Sinn nach Eskalation oder Prinzipienstreit.
Özil und Gündogan sind deutsche Fußballnationalspieler. Beide wurden in Deutschland geboren, beide im nordrhein-westfälischen Gelsenkirchen. Dennoch hatten sie wenige Tage zuvor mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan in London für ein Foto posiert. Özil lacht darauf sehr herzlich und schaut gelöster aus als auf den meisten überlieferten Fotos an der Seite von Nationaltrainer Joachim Löw oder bei seiner Stippvisite bei Präsident Steinmeier. Der 27-jährige Gündogan hatte Erdogan ein Trikot mit handschriftlicher Widmung überreicht: »Mit großem Respekt für meinen Präsidenten«. Daran entzündete sich jener öffentliche Streit, der auf Bellevue beendet werden sollte.
Beide deutschen Staatsbürger hatten die Taktlosigkeit begangen, einem autokratischen Herrscher in dessen Wahlkampf mit propagandistisch verwertbaren Fotos beizuspringen. Schaut her, konnte der Freiheitsfeind und Kriegsherr vom Bosporus nun sagen, schaut, ihr lieben Türken weltweit und besonders in Deutschland, eure Fußballidole zeigen sich gerne mit mir, ich bin ein Ehrenmann, wählt mich. Dieser Interpretation müssen sich beide Fußballer bewusst gewesen sein. Gündogans schriftliche Ehrerbietung für »seinen« Präsidenten machte aus politischer Torheit eine Staatsaffäre. Wie kann ein gebürtiger Deutscher einen Türken zum Oberhaupt seines, des Deutschen Landes erklären? Zumal Gündogan keine doppelte, sondern nur die deutsche und Erdogan nach allem, was wir wissen, nur die türkische Staatsbürgerschaft besitzt.
Ilkay Gündogan erklärte nach der Rückkehr von Bellevue am 19. Mai auf Facebook: Er bekenne sich »zu Deutschland und der deutschen Nationalmannschaft«, habe aber durch seine »Familie auch eine türkische Seite« in sich; er respektiere die Liebe seiner Eltern »zu ihrer Heimat und zu ihrem Dorf, in dem auch meine Großeltern noch leben und das für meine Familie ein zweites Zuhause nach Gelsenkirchen ist.« Davon abgesehen, dass auch hier das Wort Respekt in einer Weise gebraucht wird, die es zum gegenwärtig am meisten missverstandenen Wort macht, ist Gündogans Unterscheidung zwischen Heimat und Zuhause frappant. Die Eltern, die seit mindestens 30 Jahren in Deutschland leben, haben demnach nur eine Heimat, die Türkei. Er selbst nennt die Türkei sein »zweites Zuhause nach Gelsenkirchen«, wodurch er eine Reihenfolge der Zugehörigkeiten statuiert, in der der Türkei der zweite Platz zukommt, jedoch beide Länder gleichermaßen auf den Rang eines Zuhause zurückstuft.
Bekanntlich gibt es ein »Zuhause auf Zeit« – mit diesem Slogan werben möblierte Appartements um wochen- oder monateweise Belegung –, jedoch keine Heimat zur Miete. Die Frage nach Ilkay Gündogans persönlicher Heimat lässt der Nationalspieler hier unbeantwortet. Wer sich zu einem Land bekennt, muss es nicht unbedingt als seine Heimat empfinden. Rudolf Borchardt hat sich in den 1930er Jahren sehr zu seinem langjährigen Gast- und Schutzland Italien bekannt, ohne es deshalb zur Heimat erklären zu können. Er blieb Deutscher, er hatte keine »deutsche Seite« in sich.
Den Bundespräsidenten ficht solche Unterscheidung nicht an. In der von ihm im Selbstzitat paraphrasierten Rede zur Deutschen Einheit am 3. Oktober 2017 hatte Frank-Walter Steinmeier bereits ausgeführt, »wir müssen noch mehr tun, um Frieden zu stiften und die Not in großen Teilen Afrikas zu wenden«, und erklärt: »Je schneller die Welt sich um uns dreht, desto größer wird die Sehnsucht nach Heimat. Dorthin, wo ich mich auskenne, wo ich Orientierung habe und mich auf mein eigenes Urteil verlassen kann. (…) Die Sehnsucht nach Heimat – nach Sicherheit, nach Entschleunigung, nach Zusammenhalt und vor allen Dingen Anerkennung –, diese Sehnsucht dürfen wir nicht den Nationalisten überlassen. (…) Heimat ist der Ort, den wir als Gesellschaft erst schaffen.«
Stimmt das? Heimat als Wohlfühloase wechselseitiger Anerkennung, als produktive Diskursgemeinschaft der gerade an einem Ort Versammelten? Dann wäre Heimat ein stationäres Phänomen, heute hier, morgen da und immer im Werden. Die Gesellschaft wäre ihr Baumeister, der nie ans Ende käme. Heimat: ein ideeller Großflughafen nach Art des Berliner BER. Ein gedankliches Richtfest bei allzeit fehlenden Wänden, auf schwankenden Planken. So kann man es sehen, so sehen es viele, so überzeugt es nicht. Die Rede von den multiplen Identitäten kommt uns geschwind über die Lippen, ehe wir ihren Inhalt begriffen, geschweige denn erfahren hätten. Natürlich ist der Mensch ein vielfach gemischtes Wesen, seinen Launen ebenso ausgesetzt wie seinen Hormonen. Wertmaßstäbe verändern sich lebenslang, Aufenthaltsorte nicht minder, Vorlieben und Abneigungen wechseln, das Ja von heute kann zum Nein von morgen werden.
Bei Botho Strauß heißt es einmal, so sei es um uns alle bestellt, »heute Hymniker, morgen Zyniker«. Natürlich. Doch diese innere Flexibilität verlangt nach einer überwölbenden Kontinuität, nach einem Ich, das jeden Wandel übersteht und ihn darum gestalten kann, nach Identität also. Der Mensch ohne Identität – und das ist der Mensch ohne Heimat – wäre billigste Beute aller politischen wie ökonomischen Manipulationsversuche; wird er deshalb derart eifrig beschworen? Ist Identität, ist Heimat das letzte Bollwerk wider die Banalität des Blöden?
Selbst Kirchenfunktionäre reden mittlerweile der Unbehaustheit das Wort. Der katholische Erzbischof Reinhard Marx sagte im Juli 2016 beim Jahresempfang der Erzdiözese München und Freising, die Kirche müsse »offene Identitäten« befördern. Vermutlich war damit zunächst gemeint, jeder müsse sich ernst genommen, jede akzeptiert fühlen in der für alle offenen Kirche. Identitäten aber, Seinsbestimmungen der Individuen, können nur insofern offen sein, als sie auf je neue Nachfrage treffen. Der Mensch an sich hat eine Identität, hat eine Heimat, welche Häutungen auch immer er durchlaufen mag. Einmal nur wird es gegeben haben den Klang der Muttersprache, den Geruch der frühen Jahre, die Farben des Herkommens. Heimat ist, wo du zum ersten Mal geliebt hast, angenommen wurdest, angenommen hast, abgelehnt wurdest. Heimat sind die ersten Schritte und ist die Einsicht, dass du wurdest, ehe du warst. Gedeihlich miteinander leben können die allerverschiedensten Menschen an Orten, die sie schon immer kennen oder neu sich erfahren haben. Jeder trägt dazu seine eigene Heimat bei. Am Ende kann es eine neue Heimat geben, die die alte im Fluss der Zeiten abträgt, doch keine zweite, keine zusätzliche, keine dritte, vierte, achte. Identität ist nicht Polygamie.
Wenn also unter dem Projekttitel »Heymat« in Berlin »Hybride europäisch-muslimische Identitätsmodelle« wissenschaftlich untersucht werden, ist das hölzerne Eisen nicht weit. Es gibt verschiedene Herkünfte, verschiedene Zugangswege zur Staatsbürgerschaft auch, aber nur die je eine Heimat. Wer im 31. oder 32. Jahr seines Hierseins vom elterlichen Dorf in Südanatolien oder Nordossetien tagein, tagaus schwärmt, der hat seine alte Heimat behalten. Dadurch wird er nicht zum besseren oder schlechteren Menschen, wohl aber zum Heimatbürger im Exil. Die große Heimatlüge erhebt ihr Haupt, wo immer der Eindruck erweckt wird, beim Betreten eines neuen Landes öffne sich augenblicklich eine neue Heimat.
Es kann ein zähes Ringen sein, sich zu beheimaten. Was dem einen glücklich in die Wiege gelegt wurde, erwirbt der andere sich am Zielpunkt mühseliger Wanderungen nach vielen Jahren. Irgendwann aber kommt es zum Schwur: Heimat ist, wozu du Ja sagst und wo du bleiben willst für lange Zeit, dem du die Treue hältst über Abstoßungen hinweg. Heimat verlangt Bekenntnis, geht aber im Bekenntnis nicht auf. Sie ist ein Ort, der alles Örtliche übersteigt, eine Kindheit, die erwachsen werden muss, eine Reife, die es ohne Wurzeln im inneren Kind nicht gäbe. Heimat muss sein, damit das Ich werden kann. Heimaten sind angewandte Schizophrenien: theoretisch interessant, praktisch eine Katastrophe.
Wenn Frank-Walter Steinmeier also ausspricht, worin ihm sehr viele zustimmen, dass nämlich »Heimat im Plural« möglich sei, will er mit der Mehrzahl den Singular zähmen. So reitet er beide zuschanden. Der Deutschen Heimat soll erträglich werden, indem man sie zerteilt. Eine deutsche Staatsbürgerschaft, doppelt oder singulär, soll die deutsche Seite in jedem zum Klingen bringen, der einen entsprechenden Pass sein Eigen nennt. Dagegen ist nichts einzuwenden – doch über die Heimat der Staatsbürger ist damit wenig ausgesagt. Der Heimatbegriff, den Steinmeier stärken will, wird auf diese Weise von seinen Wurzeln gekappt. Die Heimat wird zum offenen Meer, das Freiheit verheißt und im Angesicht des Horizonts keinen Halt finden kann. Abenteuer- und Horrorgeschichten beginnen so, der Klabautermann lauert.
Ein Sänger, der sich Purple Schulz nennt, besang einmal mit einer Band namens »Neue Heimat« seine eigene »Sehnsucht«. Es waren die frühen achtziger Jahre, der Deutsche Gewerkschaftsbund war noch im Besitz einer Immobiliengesellschaft mit vorbelastetem Namen. Die titelgebende »Sehnsucht« des Purple Schulz lautete: »Ich hab Heimweh. Fernweh? Sehnsucht. Ich weiß nicht, was es ist. Ich will nur weg. Ganz weit weg. Ich will raus!« Damit ist der Schmerz des »müden Wanderers, der keine Heimat hat« (Laotse) benannt. Wir alle kennen solche Erfahrungen. Sie gehören zum Menschsein. Unvermeidlich sind sie und unschön. Ein Staat lässt sich darauf nicht bauen und ein »gemeinsames Wir« (Frank-Walter Steinmeier) auch nicht.
KAPITEL 2
»Vielfalt ist unsere Stärke«
Mephisto weiß Bescheid: »Grau« sei, »teurer Freund, (...) alle Theorie und grün des Lebens goldner Baum.« Vielleicht auch aufgrund dieser Aussage lässt der angesprochene Herr, ein studierter Universitätstheologe namens Doktor Faust, sich zu einer Wette hinreißen und einer Reise durch erst die kleine, dann die große Welt. Denn wo, wenn nicht in einer dem Stubengelehrten so fernen Lebenswelt, muss sich echte Erquickung finden lassen, in einer bunten Welt, in der das Goldne auch grün sein kann und das Grüne golden zu schimmern verspricht? Alles muss diesem deutschen Nationalgrübler, wie ihn Goethe auf die Bühne wuchtete, als Verheißung erscheinen, ist es nur endlich, endlich bunt.
Was nämlich lockt generell im Vielfarbigen und übt besonders auf den Bücherwurm, Büchernarren einen unwiderstehlichen Reiz aus? »Bunte Möglichkeiten« (Franz Grillparzer) locken dort, alles scheint möglich und nur eine je neue Variation endloser Veränderung zu sein, wenn die Dinge keinen eindeutigen, keinen ein für allemal festgestellten Farbwert haben, wenn »die schönsten blauen, grünen und rötlichen Linien zum Vorschein« kommen auf einem eben noch grauen, schwarzen oder opaken Stein. Auf dem »Taufstein« etwa, einem von vielen »Bunten Steinen«, die Adalbert Stifter in seinem gleichnamigen Erzählungsband mit dem ganz unterschiedlichen Schicksal von Menschen verknüpft. Besagter Taufstein, »so fein und weich (…), dass man ihn mit einem Messer schneiden kann«, ein Tuffstein also, muss nur mit einem »zarten Firnisse« angestrichen werden, damit sich blaue, grüne und rote Linien offenbaren. Das Unwahrscheinliche, das Bunte wird dann Ereignis. Aus farbigem Abglanz wird Leben.
Auch das eigene Dasein, wusste Goethe mehr noch als Stifter, gelangt erst dann auf die Höhe seiner Möglichkeiten, wenn es die ganze Vielfalt, die ihm innewohnt, entbindet. Dass die Abwechslung erfreut – variatio delectat – gilt eben nicht nur für die schöne Natur, das schöne Bild, sondern auch für die »bunten Möglichkeiten«, die dem Individuum offenstehen. Franz Grillparzer lässt in seinem Schauspiel vom »Bruderzwist im Hause Habsburg« Kaiser Rudolf II. davon sprechen, freilich in kritischer Absicht. Rudolf II. ist des Regierens müde, ergeht sich am Vorabend des Dreißigjährigen Kriegs in düsteren Zukunftsszenarien und erwartet schicksalsergeben sein Ende. Der Bruder, Erzherzog Matthias, wird die Regentschaft übernehmen.
»Matthias herrsche denn«, sagt Rudolf kurz vor seinem Tod auf der Prager Burg, dem Hradschin, »er lerne fühlen, dass Tadeln leicht und Besserwissen trüglich, da es mit bunten Möglichkeiten spielt; doch handeln schwer, als eine Wirklichkeit, die stimmen soll zum Kreis der Wirklichkeiten.« Der konservative Rudolf verortet die »bunten Möglichkeiten« im Reich des folgenlosen Redens, nicht im »Kreis der Wirklichkeiten«. Wer handelt, der muss entscheiden und aus der Fülle der Möglichkeiten jene eine richtige wählen, die stimmt. Rudolf II., ließe sich sagen, und damit auch Grillparzer selbst wird die neue Zeit zu bunt. Er vermisst Klarheit und Prinzipientreue im »Spiel der buntbewegten Welt«, »dass deine Väter glaubten was du selbst, und deine Kinder künftig treten gleiche Pfade«.
Insofern ist der Gegensatz zum Vielerlei des Bunten nicht unbedingt das Einfältige, sondern das Einfache. Ganz in diesem Sinn konnte in der Goethezeit Johann Joachim Winckelmann in Ansehung der berühmten Laokoon-Gruppe die bekannte Formel prägen von »edler Einfalt und stiller Größe«. Damit war das klassizistische Schönheitsideal benannt. Menschliche Größe wurzelte nicht in der Darstellung formenflüchtiger, formsprengender Ekstase, sondern im Gebundenen und damit in der Stille. Das Edle fand sich im Einfachen, nicht, wie zuvor in Rokoko, Barock, Manierismus, im Verspielten oder Grellen. Tischbein statt Caravaggio.
Das Vielfache statt des Einfachen ist heute Realität, in der Kunst wie im Leben. Anders kann es nicht sein. Spätmoderne Gesellschaften, in denen das Recht herrscht und das Kapital flottiert, sind heterogen. Vielfältige Lebensentwürfe zeugen von den Freiheiten im Rechtsstaat. Das Uniforme kommt letztlich in Uniformen daher und könnte ohne teils subtilen, teils brachialen Zwang nicht durchgesetzt werden. Insofern ist es gut, dass da viele Blumen blühen und jeder sein eigener Gärtner ist.
Die Frage freilich, auf welchen »buntbewegten« Pfaden aus dem Sein ein Sollen werden kann, ist nicht trivial. Ist heute ein ursprünglich ästhetisches Phänomen bereits soziale Norm geworden, ein schönes Sein gar kategorischer Imperativ? Stoßen sich die Begriffe da nicht hart im Raum und geht manches über Bord, wenn umstandslos behauptet wird, »unsere Identität« heiße Vielfalt, und Vielfalt sei ein Projekt, das es unbedingt zu unterstützen gelte? Taugt »Seid bunt!« zur Losung für eine Gesellschaft?
Das Individuum ist das Unteilbare. Darum kann der Mensch nur eine Identität haben. Wenn die Polizei beispielsweise einem ungepflegten Gossenpoeten nachsetzt, weiß dieser, worauf es hinausläuft: »›Die wollen immer nur eine Identität.‹ Das Wort ›Identität‹ sprach er aus, als zitiere er es. Er blickte Friedrich Keller an und sagte: ›Wollen Sie auch eine Identität?‹ ›Ich? Wie bitte?‹ (…) ›Sie sind ja ganz schön nervös. Haben Sie etwa keine?‹«. So steht es in Steven Uhlys Roman »Den blinden Göttern« von 2018 und ist humorvoll gemeint. Außerliterarisch müsste verzweifeln, wer über wechselnde Identitäten oder über keine verfügte. Es sei denn, es handelte sich um das Opfer eines Identitätsdiebstahls oder um einen Identitätsschwindler.
Ein Asylbewerber aus dem Sudan wurde im Februar 2017 zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt, weil er sich durch »sieben verschiedene Identitäten« über 20.000 Euro Sozialleistungen erschlichen hatte; ein Landsmann musste im Februar 2018 für zwei Jahre und acht Monate ins Gefängnis, nachdem er mit »elf Identitäten« rund 70.000 Euro vom deutschen Staat ergaunert hatte – »die wahre Identität hat das Gericht nicht eindeutig klären können« –, und der tunesische Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz hatte sogar »14 verschiedene Identitäten« genutzt, ehe er seinen Hass auf den Westen durch einen Massenmord vollendete. Sie alle sind keine Helden einer bunten Multioptionengesellschaft, sondern Verbrecher.
Aber kann vielleicht wenn schon nicht das Ich, so wenigstens das Wir Vielfalt zur identifikatorischen Leitidee erklären? »Unsere Identität heißt Vielfalt«, verkündete das Dresdner Deutsche Hygiene-Museum im August 2018, und es war sehr vermutlich nicht nur die lokale museale Identität gemeint, sondern die deutsche. Der Veranstaltungstag mit »freiem Eintritt in unsere Rassismus-Ausstellung«, Breakdance und Musik der multikulturellen Brass-Band »Banda Internationale« verstand sich als Gegengewicht zu einer für den 25. August angekündigten Demonstration der »Identitären Bewegung« unter dem Motto »Europa Nostra«. Deren monokulturelles Identitätsprogramm sollte gekontert werden.
Welch weitreichende praktische Folgen das Vielfaltskonzept haben kann, belegt die Unterstützung von »Banda Internationale« für die Aktion »Seebrücke«, die »humane Migrationsmöglichkeiten« fordert und den Claim prägte »Grenzenlose Solidarität statt tödliche (sic!) Abschottung«. Vielfalt und Solidarität sind begrifflich ebenso eng verzahnt wie Vielfalt und Offenheit. Hierdurch ergeben sich neue gedankliche Probleme. Kann es etwa eine »grenzenlose Solidarität« geben, Solidarität mit allen und jeden überall? Wir werden davon noch hören, im achten Kapitel.
Zunächst aber: Was ist unter politischen Bedingungen mit sozialer Vielfalt als Leitidee gemeint? Eine Rückübersetzung aus der Wirtschaftssoziologie wird auf die Gesamtgesellschaft übertragen und wandelt so ihren Charakter vom Phänomen zum Appell. »Diversity« oder »Diversität« mit Wurzeln in der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung meint eine »Grundannahme der neue Arbeitswelt: Die steigende Komplexität auf der Welt lässt sich nur mit steigender Vielfalt in den Unternehmen begegnen. Das belegt eine Untersuchung der Unternehmensberatung McKinsey. Die Autoren untersuchten dafür 1007 Unternehmen – mit dem Ergebnis, dass Firmen mit einem hohen Frauen- und Ausländeranteil im Top-Management mit größerer Wahrscheinlichkeit überdurchschnittlich profitabel sind. Was in der Theorie einfach klingt, ist in der Praxis schwer umzusetzen. Es kann harte Arbeit sein, ein Team mit vielen unterschiedlichen Erfahrungen und Hintergründen zu führen – inklusive Missverständnissen, Konflikten und Diskussionen. Um diese Aufgabe zu meistern, müssen auch die Chefs neu denken.« So erklärt es das Fachblatt »Wirtschaftswoche« in seinem »Glossar des neuen Arbeitens«.