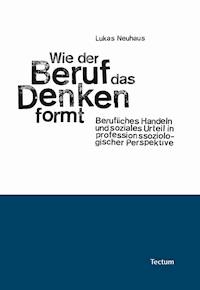
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie beurteilen Lehrerinnen, Pflegefachleute, Ingenieure oder Architekten die Gesellschaft? Gibt es typische Muster und warum? Welche Anforderungen stellt der berufliche Alltag und lässt sich das berufliche Handeln in Beziehung setzen zum sozialen Urteil? Lukas Neuhaus untersucht in dieser innovativen professionssoziologischen Studie den Zusammenhang zwischen der Struktur des beruflichen Handelns und den Mustern sozialer Klassifizierung. Er zeigt außerdem auf, dass die gängige Rede vom "dichotomen Gesellschaftsbild der Arbeiter" problematisch ist und unterzieht zentrale Begriffe der klassischen Gesellschaftsbildforschung einer kritischen Nachlese.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Lukas Neuhaus
Wie der Beruf das Denken formt. Berufliches Handeln und soziales Urteil in professionssoziologischer Perspektive
© Tectum Verlag Marburg, 2010
Zugl.: Univ. Diss. Universität Bern, 2010
ISBN 978-3-8288-5643-1
Bildnachweis Cover: gestempelte Schrift © Lukas Neuhaus
(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Buch unter der ISBN 978-3-8288-2507-9 im Tectum Verlag erschienen.)
Besuchen Sie uns im Internet unter www.tectum-verlag.de
www.facebook.com/Tectum.Verlag
INHALT
1. Einleitung
2. Begriffe, Konzepte, Vorüberlegungen
2.1. Klassifizierung, Klassifikation, Gesellschaftsbild
2.2. Ein klassischer Befund und anhaltende Verwirrung
2.3. Paradigmatische Studien zu Gesellschaftsbildern
2.3.1. Ossowski: Klassenstruktur im sozialen Bewusstsein
2.3.2. Willener: Images de la société et classes sociales
2.3.3. Popitz et al.: Das Gesellschaftsbild des Arbeiters
2.3.4. Habermas et al.: Student und Politik
2.3.5. Auswahl weiterer klassischer Befunde
2.4. Synthese und Ausblick
2.5. Missverständnisse und Operationalisierungsprobleme
Exkurs 1: Das Denken über Berufe
3. Das Forschungsvorhaben
3.1. Forschungsprojekt und Fragestellungen
3.2. Analytischer Fokus
3.3. Methodisches Vorgehen
4. Empirischer Teil
4.1. Pädagogische Berufe
4.1.1. Die berufliche Handlungsstruktur
4.1.2. Materialanalysen
4.1.2.1. Erika Tschannen, Realschullehrerin
4.1.2.2. Claudia Fillinger, Primarlehrerin
4.1.2.3. Sonja Neuberger, Primarlehrerin
4.1.2.4. Regula Christen, Primarlehrerin
Exkurs 2: Professionssoziologische Positionen
4.1.3. Kontrastmaterial: Die deutschen Lehrerinnen
4.1.3.1. Dagmar Windler, Realschullehrerin
4.1.3.2. Stefanie Kron, Sonderschullehrerin
4.1.3.3. Maike Folkerts, Berufsschullehrerin
4.1.3.4. Helga Mosbach, Realschullehrerin
4.1.4. Pädagogisches Feld: Synthese
4.2. Medizin und Pflege
4.2.1. Die berufliche Handlungsstruktur
4.2.2. Materialanalysen
4.2.2.1. Caroline Wegmüller, Intensivpflegerin
4.2.2.2. Gerda Aufenanger, Altenpflegerin
4.2.2.3. Franziska Kraimer, Spitex-Pflegerin
4.2.2.4. Christian Frege, HNO-Pfleger
4.2.3. Kontrastmaterial: Die Ärzte
4.2.3.1. Anna Reinhardt, Orthopädin
4.2.3.2. Bruno Teuscher, Anästhesist
4.2.4. Feld der Medizin und Pflege: Synthese
Exkurs 3: Eine Analyse wertender Urteile über Hausärzte
4.3. Ingenieurwesen und Architektur
4.3.1. Die berufliche Handlungsstruktur
4.3.2. Materialanalysen
4.3.2.1. Alfred Itten, Maschinenbauingenieur
4.3.2.2. Bastien Grange, Architekt
4.3.2.3. Thierry Mueller, Tiefbauingenieur
4.3.3. Feld der Architektur und des Ingenieurwesens: Synthese
4.4. Das juristische Feld
4.4.1. Die berufliche Handlungsstruktur
4.4.2. Materialanalysen
4.4.2.1. Theophil Nievergelt, Gerichtspräsident
4.4.2.2. Jürg Schwitter, Rechtsanwalt
4.4.2.3. Kurt Neiger, Rechtsanwalt
4.4.3. Juristisches Feld: Synthese
4.5. Die Unterstellung von Berufsklassenhomogenität
5. Schlussfolgerungen und Résumé
Literatur
Verzeichnis der Tabellen und Schemata
DANK
Die vorliegende Arbeit wurde Ende Mai 2010 von der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern als Dissertation angenommen. Ohne die Unterstützung durch eine Vielzahl wohlgesinnter Personen wäre sie nicht entstanden.
Herzlich danken will ich namentlich: Claudia Honegger für die Einführung in das soziologische Denken; Martin Schmeiser für zahllose substanzielle Anregungen und für die Gelegenheit, die Dissertation im Rahmen des von ihm initiierten Forschungsprojekts zu verfassen; Peter Schallberger dafür, mir das hermeneutisch-rekonstruktive Forschen näher gebracht zu haben. Denis Hänzi, Andrea Hungerbühler, Caroline Arni, Rohit Jain, Chantal Magnin und Marianne Rychner danke ich für nütz- und erbauliche Hinweise; Christian Zingg und den anderen Verrückten für die willkommene Zerstreuung; Adrian Schild und Stefan Müller für die langjährige Verbundenheit. Katrin und Esther Neuhaus danke ich dafür, mir das Lesen und das Schreiben beigebracht und so den Grundstein zum Gelingen dieser Arbeit gelegt zu haben. Margrit Neuhaus-Rubi und Werner Neuhaus danke ich für Katrin und Esther und für den niemals versiegenden Rückhalt in all seinen Formen. Schließlich und endlich danke ich Tina Maurer für das Glück und für vergangene und kommende gemeinsame Jahrzehnte.
Bern, im September 2010
»In Wahrheit handelt es sich nicht darum, zu wissen, ob durch Berührung mit einem Spechtschnabel Zahnschmerzen geheilt werden, sondern vielmehr darum, ob es möglich ist, in irgendeiner Hinsicht Spechtschnabel und Menschenzahn ›zusammenzubringen‹ […] und durch solche Gruppenbildungen von Dingen und Lebewesen den Anfang einer Ordnung im Universum zu etablieren. Wie immer eine Klassifizierung aussehen mag, sie ist besser als keine Klassifizierung.«
Claude Lévi-Strauss, Das wilde Denken (1968: S. 20 f.)
»La société suppose […] une organisation consciente de soi qui n’est autre chose qu’une classification.«
Emile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse (1991 [1912]: S. 734)
»Worauf es bei der Arbeit zuallererst ankommt, ist, ob sie anstrengend ist oder nicht. Die am wenigsten anstrengende Arbeit haben vor allem die Beamten, die Freiberufler, wobei die Ärzte allerdings eine psychisch sehr aufreibende Arbeit ausüben. Der Beamte hingegen leistet seine acht Stunden, geht nach Hause, hat seine festen Bezüge, also ein gesichertes Leben. Nach dieser Kategorie folgen die Händler. Je größer ihr Geschäft, desto weniger anstrengend ist es. Dann kommen die Handwerker, die sich in etwa mit mittleren Angestellten, Facharbeitern und Technikern auf eine Stufe stellen. Nach diesen kommen dann die Arbeiter.«
Algerischer Koch, ca. 1965, aufgezeichnet von Pierre Bourdieu, Die zwei Gesichter der Arbeit (2000: S. 150 f.)
1. EINLEITUNG
Das Denken über den Aufbau der Gesellschaft, über die gesellschaftliche Ordnung und über die Stellung der Berufe lässt sich auf vielgestaltige Art und Weise erforschen. Für die vorliegende empirische Studie wurde ein indirektes Vorgehen gewählt, mit welchem die Repräsentationen rekonstruierbar werden, die sich Angehörige verschiedener Berufsgruppen von der gesellschaftlichen Welt machen, in der sie leben. Dass die berufsspezifischen Handlungsprobleme und -routinen und die beruflichen Milieus wichtige Quellen von Denkweisen und Überzeugungen darstellen, dürfte sowohl intuitiv unmittelbar einleuchten wie auch soziologischer Mindestkonsens sein. Diesen Quellen empirisch auf den Grund zu gehen, ist indes ein Vorhaben, das mit vielerlei Tücken verbunden ist und über das sich trefflich streiten ließe. Insbesondere stellt sich die Frage, welche von den beobachtbaren und rekonstruierbaren Elementen plausibel mit der beruflichen Tätigkeit in Verbindung gebracht werden können – von der Entdeckung ›kausaler Zusammenhänge‹, die von vielen sich als wissenschaftlich verstehenden Köpfen als notwendige Bedingung für valable Forschungsergebnisse erachtet werden, soll hier gar nicht erst die Rede sein.
Wer sich mit einem standardisierten Fragebogen ins Feld begibt, stellt bald einmal fest, dass sich die Klassifikationen ähneln, dass viele der Befragten die Berufe gleich oder sehr ähnlich beurteilen und dasselbe oder Ähnliches erzählen, und man ist schon versucht, die Übung abzubrechen. Bis Muster aufzuscheinen beginnen, die es sich zu verfolgen lohnt. Und man hinter den oberflächlich sich ähnelnden Klassifikationen unterschiedliche generative Logiken und unterschiedliche Prozesse der Klassifizierung erahnt.
Die Studie ist im Rahmen des vom Schweizerischen Nationalfonds geförderten Forschungsprojekts Soziale Klassifizierungen: Neue Dichotomien der gegenseitigen Wahrnehmung von Berufsgruppen? zustande gekommen. Das leitende Forschungsinteresse der vorliegenden Arbeit war der Zusammenhang zwischen der potentiell problematischen Struktur des beruflichen Handelns und den Mustern sozialer Klassifizierung. Da dieser Zusammenhang sich bei den in der Soziologie gemeinhin als Professionen bezeichneten Berufen besonders akzentuiert zeigt (bzw. dort überhaupt erst aufweisbar ist), stehen vier professionalisierte bzw. professionalisierungsbedürftige Berufsfelder im Mittelpunkt: die pädagogischen, die pflegerisch-medizinischen und die juristischen Tätigkeiten sowie das Feld der Architektur und des Ingenieurwesens. Für zwei dieser Felder stellt das erhobene empirische Material Anhaltspunkte zur Verfügung, die den Zusammenhang zwischen einem beruflichen Dilemma und den Mustern sozialer Klassifizierung stützen. Im Fall der Jurisprudenz und des Ingenieurwesens ist der Zusammenhang nicht direkt aufweisbar – was indes wiederum theoretisch erklär- und begründbar scheint: es liegt in diesen Feldern kein berufliches Dilemma im engeren Sinne vor. Entlang der Akutheit des Dilemmas können innerhalb der Berufe zudem Bereiche unterschieden werden, die mutmaßlich in unterschiedlichem Grade professionalisierungsbedürftig sind.
Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert: In einem ersten Schritt arbeite ich anhand einer kritischen Rekonstruktion einiger klassischer Studien und von Untersuchungen, die an selbige anzuschließen versuchten, zentrale Begriffe und Konzepte rund um den vielschichtigen Themenkomplex des Gesellschaftsbildes heraus (Kapitel 2). Dieser Teil bildet das begriffliche und konzeptuelle Fundament der Studie. Hier wird insbesondere deutlich, dass eine Reflexion zentraler Begriffspaare (Klassifizierung und Klassifikation, Dichotomie und Antagonismus) viel zum Verständnis der zu untersuchenden Phänomene beizutragen vermag.
Im Anschluss an die begrifflichen Rekonstruktionen leite ich zum eigentlichen Forschungsvorhaben über und erläutere Forschungsinstrument, Vorgehen und Fragestellung (Kapitel 3.1.). Ebenfalls in diesen Teil fallen die theoretischen Vorüberlegungen zur analytischen Trennbarkeit der drei Faktoren Biografie, Sozialstruktur und Struktur des beruflichen Handelns (Kapitel 3.2.) sowie eine Darlegung des methodischen Vorgehens (Kapitel 3.3.).
Das empirisch-materiale Herzstück der Studie bildet Kapitel 4: hier werden exemplarische Fälle aus den vier untersuchten Berufsfeldern ausgiebig rekonstruiert. Zunächst wird für das pädagogische Feld (Kapitel 4.1.) deutlich, dass die drei als analytisch isolierbar postulierten Faktoren Biografie, Sozialstruktur und Struktur des beruflichen Handelns bei allen Fällen eine Rolle spielen, dass letzterer Faktor indes besonders bei den noch ungenügend professionalisierten Fällen mit hoher Dilemmaexposition sinnfällig wird. Dieser Befund wird zur These verdichtet, dass sich eine ungenügende Professionalisierung bei bestehender Professionalisierungsbedürftigkeit in den Mustern der sozialen Klassifizierung dokumentiert. Mit dieser These im Handgepäck werden schließlich drei weitere berufliche Felder (das Feld der Medizin in Kapitel 4.2., das Feld des Ingenieurwesens und der Architektur in Kapitel 4.3. sowie das juristische Feld in Kapitel 4.4.) auf entsprechende Zusammenhänge hin befragt.
In der Synthese (Kapitel 5) werden die Erkenntnisse auf vier wesentliche Punkte zugespitzt: Erstens reklamiere ich einen begrifflich-theoretischen Gewinn aus der Rekonstruktion der klassischen und neueren Studien zu ›Gesellschaftsbildern‹, zweitens postuliere ich die analytische Isolierbarkeit der beruflichen Handlungsstruktur als prinzipiell von Biografie und sozialer Lage unabhängiges Element der Logik sozialer Klassifizierung, drittens stelle ich zur Diskussion, ob die Muster der sozialen Klassifizierung als Dokumente fehlender Professionalisierung identifiziert werden können. Viertens schließlich zeige ich, dass die Erkenntnisse der Studie auch zur Kritik an der gängigen Unterstellung von Berufsklassenhomogenität dienen können.
2. BEGRIFFE, KONZEPTE, VORÜBERLEGUNGEN
Wer es sich zum Ziel setzt, soziale Klassifizierungen zu untersuchen, ist gut beraten, sich zunächst einmal eine ungefähre Vorstellung davon zu machen, was der Begriff Klassifizierung bezeichnen und wie dem Phänomen der sozialen Klassifizierungen auf die Spur gekommen werden könnte. Im Folgenden beabsichtige ich nicht in erster Linie Definitionen aneinanderzureihen, sondern eine Art Abriss der Begriffs- und Ideengeschichte zum Themenkomplex Klassifizierung, Klassifikation und Gesellschaftsbild zu präsentieren.
2.1. Klassifizierung, Klassifikation, Gesellschaftsbild
Ein fruchtbarer Ausgangspunkt für ein Untersuchungsvorhaben zur Logik sozialer Klassifizierungen ist die breite soziologische Forschungstradition über Gesellschaftsbilder. Im Anschluss an die 1957 erschienene klassische Studie Das Gesellschaftsbild des Arbeiters von Heinrich Popitz, Hans Paul Bahrdt, Ernst August Jüres und Hanno Kesting hat sich die Forschung eine Zeitlang intensiv mit den Gesellschaftsbildern weiterer Berufsgruppen auseinander gesetzt. So sind beispielsweise die Gesellschaftsbilder von Ingenieuren (Hortleder 1970), Juristen (Weyrauch 1970), Studierenden (Habermas et al. 1961), Stadtplanern (Berndt 1968), Gymnasiallehrern (Schefer 1969) oder Angestellten (Jaeggi und Wiedemann 1966; Braun und Fuhrmann 1970) zum Gegenstand soziologischer Betrachtung geworden. Seither ist diese Tradition der Gesellschaftsbildforschung allerdings beinahe vollständig zum Erliegen gekommen, da ihre Fragestellungen weitgehend in der Milieu- und Lebensstilforschung aufgegangen sind (vgl. zur Milieuforschung als Überblick Vester et al. 2001). Innerhalb der soziologischen Disziplin gibt es indes nach wie vor keinen Konsens über Begriff und Inhalt von Gesellschaftsbildern. Dies – so meine Vermutung – dürfte auch mit der mangelnden Differenzierung der Begriffe Klassifizierung und Klassifikation zu tun haben: während Popitz und seine Kollegen nämlich bei den Hüttenarbeitern vor allem auf der Ebene der Klassifizierung dichotomische (oder präziser: antagonistische) Vorstellungen gefunden haben, versuchten viele (vornehmlich quantifizierend verfahrende) Folgeuntersuchungen eine Dichotomie auf der Ebene der Klassifikation festzustellen oder zu widerlegen, etwa indem den Probanden zwei- bzw. mehrgliedrige Gesellschaftsschemata vorgelegt wurden (vgl. für die Zeit nach Popitz et al. etwa Mayntz 1958, Moore und Kleining 1959, Mayer 1975, Sandberger 1977). Dieses Unterfangen war allerdings von vornherein zumindest partiell zum Scheitern verurteilt, denn auch mehrgliedrige Gesellschaftsbilder können einer idealtypisch antagonistischen Logik folgen, wie Ossowski (1972) in Anlehnung an die marxsche Synthese schon früh plausibel gemacht hat; ein Umstand, der von den Nachfolgestudien meines Erachtens zu wenig gewürdigt wurde und der es verdient hätte, für die aktuelle Ungleichheitsforschung wiederbelebt zu werden. Meist wird also der Begriff Klassifikation unterschiedslos für die Bedeutung als forma (Gestalt) wie für jene als formatio (Gestaltung) verwendet. Die Unterscheidung zwischen Klassifikation (forma) und Klassifizierung (formatio) wird hier in der Folge konsequent berücksichtigt, weil sie mir analytisch sinnvoll erscheint. Ich komme weiter unten noch mehrmals auf diesen Punkt zurück.
Klassifizieren und Klassifikation
Im Fokus der grundsätzlichen begrifflichen Überlegungen steht also unter anderem die analytische Trennung der in der bisherigen einschlägigen Literatur überwiegend synonym verwendeten Begriffe Klassifizieren und Klassifikation. Die Differenzierung besteht darin, dass mit Klassifizieren der Prozess des Herstellens einer Ordnung gemeint ist, während die Klassifikation das Ergebnis eines solchen Prozesses benennt, mit anderen Worten eine hergestellte Systematik. Wenn eine Klassifikation als Taxonomie bezeichnet werden kann (Desrosières 2005: S. 271), dann wären die in der vorliegenden Arbeit untersuchten soziale Klassifizierungen als spontane Ordnungsbildungen eine Art ›Ethnotaxonomie‹.1 »Ordnung einführen heißt Unterscheidung einführen, heißt die Welt in entgegengesetzte Wesenheiten aufteilen«, so Bourdieu (1993: S. 369). Das Klassifizieren kann damit als basaler Modus des Welterkennens und der Weltauslegung verstanden werden. Eine Klassifikation wäre dann ein geordnetes System solcherart klassifizierter Elemente.
Klassifizieren als basaler Modus des Welterlebens
Das Klassifizieren ist eine universelle Basisoperation der Wahrnehmung, die in vielen Fällen einer dichotomen Logik folgt, wenn beispielsweise in Oben und Unten, Links und Rechts, Groß und Klein etc. differenziert wird.2 Zur dichotomen Qualität von Klassifizierungen bestehen indes mindestens zwei sich widersprechende Thesen (vgl. z. B. Schwartz 1981, insbesondere S. 10–33). Einerseits kann anthropologisch (bzw. biologistisch) argumentiert werden: Lévi-Strauss beispielsweise verweist auf die mutmaßlich binären Strukturen des Bewusstseins, an welche jegliche Wahrnehmung zwangsläufig gebunden sei. Oder aber man argumentiert soziologisch und greift beispielsweise auf Durkheim zurück, der in der dichotomen Klassifizierung ein Resultat der sozialen Erfahrung sieht (hier insbesondere der Erfahrung zweier Geschlechter) und die Dichotomie der Klassifizierung daher wohl ein ›fait social‹ nennen würde. Paradigmatisch deutlich wird dies in der durkheimschen religionssoziologischen Gegenüberstellung von Profanem und Heiligem (vgl. Durkheim 1991 [1912]). In der durkheimschen Perspektive wäre die Rede von sozialen Klassifizierungen redundant, da hier gar keine außersozialen Klassifizierungen denkbar sind.
Es besteht also entweder die symbolische Fundierung der sozialen Kategorien in der dichotomen Funktionsweise des Gehirns oder aber die soziale Fundierung der symbolischen Kategorien beruht auf der gesellschaftlichen Erfahrung. Lévi-Strauss postuliert, dass der binäre Prozess der Wahrnehmung die Vorbedingung jeglicher Erfahrung ist und dass aus der Wahrnehmung per Analogie Konzepte werden (Schwartz 1981: S. 3), während Durkheim davon ausgeht, dass die Wahrnehmung von Unterschieden alleine noch keine Klassifikation begründet:
»Der Mensch klassifiziert […] durchaus nicht spontan und gewissermaßen aus einer Naturnotwendigkeit heraus; vielmehr ermangelte es der Menschheit zu Anfang an den nötigsten Voraussetzungen für die Funktion des Klassifizierens.« (Durkheim und Mauss 1987 [1901/02]: S. 175)
Das Klassifizieren beinhaltet neben dem Bilden von Gruppen auch die Konstitution von (wertenden) Beziehungen: »Wir stellen sie [die Gruppen, L. N.] uns als wechselseitig gleichgeordnet oder als einander überbzw. untergeordnet vor« (Durkheim und Mauss 1987 [1901/02]: S. 176).
Können nun aber dichotome Klassifizierungen zu dichotomen Bildern der Gesamtgesellschaft aggregiert werden? Die vorläufige Antwort auf diese Frage lautet: es gibt aggregierbare (oder gewissermaßen teleskopisch verlängerbare) Basisklassifizierungen, zum Beispiel die arbeitende gegenüber der nicht arbeitenden Bevölkerung, die zu antagonistischen Bildern der Gesamtgesellschaft typisiert werden können; Die meisten dichotomen Klassifizierungen dürften aber lediglich den Prozess der Herstellung von Klassifikationen begleiten und ermöglichen. Es ist also für die Analyse der Vorstellungen über eine Gesellschaft von Vorteil, die Klassifizierung als Prozess von der Klassifikation als Resultat bzw. als System klassifizierter Elemente zu trennen.
Die Klassifikation als System klassifizierter Elemente
Damit von einer Klassifikation gesprochen werden kann, müssen mindestens zwei Voraussetzungen erfüllt sein: es muss (1) eine Menge von unterscheidbaren Elementen vorliegen, und diese Elemente müssen (2) in einem Verhältnis zueinander stehen. Aus der Gesamtheit der klassifizierten Elemente ergibt sich dann eine Klassifikation, welche die Funktion und/oder den Rang der einzelnen Elemente bestimmt. Prominente Beispiele von Klassifikationen sind die International Classification of Diseases (ICD) für die Medizin, die linnésche Klassifikation für Flora und Fauna, das Periodensystem der Elemente oder auch die in vielen Hauswirtschaftslehrmitteln abgebildete Lebensmittelpyramide (siehe z. B. SGE 2009). Gesellschaftsbilder können nun als spezielle Klassifikationen angesehen werden, denn auch sie setzen mehr oder weniger willkürlich definierte Elemente – soziale Gruppen – logisch zueinander in Beziehung. Dies kann – wie Ossowski (1972: S. 182–193) gezeigt hat – in der Form von Ordnungs- oder von Abhängigkeitsrelationen geschehen. Im Unterschied zu den außersozialen Klassifikationen schließen die sozialen überdies die klassifizierenden Subjekte selber mit ein, was zweifellos epistemologisch relevant ist, wie auch Bourdieu (1987: S. 752) ausführt:
»Die gesellschaftlichen Subjekte begreifen die soziale Welt, die sie umgreift. Das heißt, dass zu ihrer Bestimmung die materiellen Eigenschaften und Merkmale nicht ausreichen […]. Denn kein Merkmal und keine Eigenschaft, die nicht zugleich auch symbolischen Charakter trüge – Größe und Umfang des Körpers so gut wie des Grundbesitzes: sie unterliegen immer der Wahrnehmung und Bewertung von Akteuren mit den entsprechenden, gesellschaftlich ausgebildeten Schemata.«
Das Gesellschaftsbild als spezielle Klassifikation
Das Gesellschaftsbild als spezielle Klassifikation ist die Summe der Vorstellungen über den Aufbau der Gesellschaft und die Funktionen ihrer Teile. Rein ordnender Natur wären solche Klassifikationen beispielsweise im Falle gradueller Schemata, welche auf der Steigerung eines oder mehrerer ›objektiver‹ Kriterien wie Einkommen, Vermögen etc. beruhen. Schemata, welche für den Erhalt der Gesellschaft die Notwendigkeit sämtlicher Elemente betonen, folgen einer Logik der gegenseitigen Abhängigkeit. Die antagonistischen Schemata legen den Fokus auf eine einseitige Abhängigkeit, indem sie eine benachteiligte untere Klasse oder Schicht einer privilegierten oberen Gruppe gegenüberstellen. Eine gegenseitige Abhängigkeit kann beispielsweise durch ein Ständemodell oder in organizistisch-funktionalen Gesellschaftsbildern ausgedrückt werden. In letzterem Modell sind »die Erfolge einer Klasse« dann eben nicht »zugleich die Misserfolge der anderen« (Ossowski 1972: S. 184).
Ein Gesellschaftsbild kann nun durchaus – um am klassischen Befund der ›Dichotomie‹ im Gesellschaftsbild der Arbeiter (vgl. Popitz et al. 1977) anzuschließen – auf einer binären Opposition zweier antagonistischer Klassen basieren, es sind in der Literatur aber auch zahlreiche nicht-antagonistische Gesellschaftsbilder beschrieben worden, namentlich das hierarchisch-graduelle oder das Bild der ›nivellierten Mittelstandsgesellschaft‹. Ossowski (1972: S. 100) zeigt am Beispiel der von Marx vorgenommenen Synthese, dass Dichotomien auch gekreuzt werden können.3 Dichotomien auf der Ebene der alltäglichen Wahrnehmung müssen sich also nicht auf der Ebene des Gesellschaftsbildes wiederfinden – zum Beispiel als antagonistische Klassifikation –, sie können aber als Strukturierungsprinzip der Wahrnehmung insbesondere von Berufstätigkeit fungieren (hier sind zum Beispiel die Unterscheidungen von körperlichen und geistigen Tätigkeiten oder die Gegenüberstellung von praktischer und theoretischer Arbeit zu nennen). Es sind folglich durchaus Klassifikationen denkbar, die zwar mehrere Gruppen umfassen, also streng formal gesprochen mehrgliedrig sind, die aber zu einem Antagonismus typisiert werden können. Die einzelnen Gruppen basieren dann auf einem Antagonismus einseitiger Abhängigkeit. Eine Dichotomie auf der Ebene der Klassifikation – beispielsweise die Gegenüberstellung einer (und nur einer) Gruppe von Arbeitern und einer (und nur einer) Gruppe von Kapitalisten – wäre demnach nicht die einzige denkbare Form antagonistischer Klassifikationen. Mit Ossowski (1972: S. 46) kann argumentiert werden, dass auch mehrgliedrige Klassifikationen einer antagonistischen Logik der Klassifizierung folgen können. Dies bedingt allerdings, dass die bewusst oder unbewusst geleistete Typisierung erkannt wird, was nur über eine Rekonstruktion der Klassifizierungspraktiken möglich ist und sich nicht formal von selbst aufdrängt.
Bourdieu argumentiert mit Verweis auf Leibniz, dass bei der notwendig auf Komplexitätsreduktion angewiesenen Bewältigung des Alltags eine Vielzahl von sozial geteilten und dichotom formulierten Gegensatzpaaren herangezogen werden:
»Alle Akteure einer Gesellschaft verfügen […] über einen gemeinsamen Stamm von grundlegenden Wahrnehmungsmustern, deren primäre Objektivierungsebene in allgemein verwendeten Gegensatzpaaren von Adjektiven vorliegt, mit denen Menschen wie Dinge der verschiedenen Bereiche der Praxis klassifiziert und qualifiziert werden.« (Bourdieu 1987: S. 730)
Diese Dichotomie von begrifflichen Gegensatzpaaren ist auf der Ebene der einzelnen Klassifizierungen angesiedelt und nicht zwingend auf der Ebene des Gesellschaftsbildes. Das Gesellschaftsbild wird im Rahmen des empirisch-materialen Teils der Untersuchung (Kapitel 4) dennoch als theoretischer Ausgangspunkt relevant, denn die zu diskutierenden Ergebnisse betreffen ein Element dieser Bilder: die einzelnen Klassifizierungen und deren Beziehung zur Struktur des beruflichen Handelns.
In der soziologischen Literatur wurde und wird der Zusammenhang zwischen sozialer Lage und gesellschaftlichem Bewusstsein nach wie vor diskutiert, in jüngerer Zeit wird das Ausmaß dieses Zusammenhangs unter dem zeitdiagnostischen Stichwort ›Individualisierung‹ zunehmend infrage gestellt (vgl. z. B. zur diesbezüglichen Gegenüberstellung von ›Konsistenz-‹ und ›Differenzierungsparadigma‹ Berger 1987). Die vorliegende Untersuchung greift nun insofern nicht direkt in diese Debatte ein, als bei der hier vorgenommenen Analyse der Klassifizierungslogiken verschiedener (semi-)professionalisierter Berufe nicht auf die soziale Lage bzw. die Position in der Sozialstruktur fokussiert wird, sondern auf die besondere Struktur der beruflichen Tätigkeit. Die Debatte darüber, ob und in welcher Weise soziale Lage, Klasse, sozialmoralisches Milieu oder ähnliche Konzepte auf die Wahrnehmung der sozialen Welt einwirken, erscheint für den hier interessierenden Zusammenhang nämlich wenig ergiebig. Erörtert werden soll vielmehr der Einfluss der Struktur der beruflichen Tätigkeit auf die Muster der Klassifizierung.
Zunächst folgt nun jedoch eine kritische Rekonstruktion einiger klassischer Studien zur Gesellschaftsbildforschung.
2.2. Ein klassischer Befund und anhaltende Verwirrung
Die Veröffentlichung der Studie Das Gesellschaftsbild des Arbeiters erfolgte 1957 – zu einer Zeit also, in welcher der Arbeiterschaft von Seiten der Soziologie besondere Aufmerksamkeit zuteil wurde. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und vor dem Hintergrund des Kalten Kriegs zwischen den kapitalistisch und den kommunistisch dominierten Ländern stieg in der westlichen Soziologie das Interesse für die Entwicklung des Klassenbewusstseins der Arbeiterschaft. Im Zuge dieser intensivierten Aufmerksamkeit wurden vermehrt Studien zum Verhältnis von Klassenlage und Klassenbewusstsein durchgeführt (beispielsweise Centers 1949, Geiger 1949). Für die marxistische Tradition besteht ein mehr oder weniger4 direkter Zusammenhang zwischen der sozialen Lage bzw. dem ›sozialen Standort‹ (Mannheim) und den Repräsentationen, welche die Individuen sich machen (dem ›Bewusstsein‹). Während das Interesse am Arbeiterbewusstsein bei den marxistischen Autoren äußerst ausgeprägt war,5 bestand im Zuge der Ausbreitung des Wohlstandes auch von Seiten der Konsumsoziologie, der Marktpsychologie und der damit zusammenhängenden Erforschung des Konsumverhaltens (vgl. Dreitzel 1962 oder Kleining 1961) seit den 1940er Jahren Interesse an der Erforschung jener Vorstellungen, die im damals inflationär verwendeten Begriff vom ›Image‹ bzw. vom ›Gesellschaftsbild‹ zusammengefasst werden können. Unter einem Gesellschaftsbild verstand man wahlweise ein »Wertsystem« oder eine »Subkultur« (Lepsius 1962: S. 453), »übereinstimmende Einstellungen« und »Einstellungsbündel« (Schefer 1969: S. 15) oder einfach das »Image, das ein einzelner von der Gesellschaft, in der er lebt, hat.« (Dreitzel 1962: S. 189)
Zur Frage des Aufkommens eines »Neuen Arbeiters« bzw. einer »Neuen Arbeiterklasse«6 gab es zwischen 1965 und 1975 eine Vielzahl kontrovers diskutierter Publikationen. Goldthorpe und Lockwood beispielsweise (1968/69) versuchten die zu jener Zeit geläufige These von der Verbürgerlichung der Arbeiterklasse empirisch zu widerlegen; sie stellten die alternative These einer zunehmend ›instrumentellen Arbeitsorientierung‹ auf: Für viele Arbeiter sei die Arbeit nur mehr Mittel zum Zweck, die Sphären der Arbeit und der Freizeit bzw. der Produktion und des Konsums würden vermehrt getrennt, die Einstellung zur Arbeit werde zunehmend ›instrumentell‹ statt – wie fälschlicherweise angenommen – identifikatorisch. Der Fokus der Arbeiterschaft liege folglich künftig auf der Verbesserung ihrer Stellung auf der Seite der Konsumtion, nicht mehr auf der Verbesserung ihrer Macht als Produzenten (nach Hörning 1971: S. 11). Eine generelle Verbesserung der Lage bzw. eine Angleichung an den Mittelstand versprachen sich viele Theoretiker der Arbeiterbewegung vom damals gängigen Phasenmodell der Industrialisierung (vgl. z. B. Kern und Schumann 1970: S. 28), das eine generelle Erhöhung der Qualifikation erwarten ließ (z. B. Touraine 1966: S. 63/116 oder Blauner 1964: S. 67, der zudem von einer rückläufigen Entwicklung der ›Entfremdungskurve‹ spricht, S. 182). Auch die gegenteilige Prognose wurde indes vertreten: Bright (1959: S. 176 ff.) glaubte an einen längerfristigen Qualifikationsrückgang (vgl. hierzu auch Braverman 1977, der die gängige These von der zunehmenden Qualifizierung ebenfalls infrage stellt). Nach den ›Septemberstreiks‹ von 1969 wurde der Mangel an gesicherten empirischen Erkenntnissenzum politischen Bewusstsein der Arbeiter deutlich, denn bis zu diesem Zeitpunkt gingen auch die Sozialwissenschaften davon aus, dass eine Verbürgerlichung der Arbeiterklasse stattgefunden habe und das geringere Widerstands- und Mobilisierungspotenzial dieser Tatsache geschuldet sei (Kudera et al. 1979: S. 9 f.).
Die siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts waren dann wiederum reich an Veröffentlichungen zum ›Arbeiterbewusstsein‹ sowie zu den Gesellschaftsbildern verschiedener anderer Berufsgruppen (z. B. Goldthorpe und Lockwood 1968/69, Schefer 1969, Hortleder 1970 und 1971, Kern und Schumann 1970, Weyrauch 1970, Deppe 1971, Herkommer 1969 und 1971, Hörning 1971, Oetterli 1971, Schwebke 1974, Bulmer 1975, Tjaden-Steinhauer 1975, Braverman 1977, Hack et al. 1979, Kudera et al. 1979, Fröhlich 1981). Ein Konsens über Zustand und Inhalt des Arbeiterbewusstseins ließ sich allerdings nicht herstellen – im Gegenteil: die vermeintlich empirisch abgestützten Ergebnisse widersprachen sich teilweise, vor allem bezüglich der ›Neuen Arbeiterklasse‹, der man durch den neuen Wohlstand entweder eine Verbürgerlichung, eine neuartige ›instrumentelle Arbeitsorientierung‹ (Goldthorpe und Lockwood 1969) oder aber anhaltende entfremdende Abhängigkeit (Kern und Schumann 1970, Braverman 1977) attestierte.
Relativ einhellig aber unterstellte man im Anschluss an diese verschiedenen Studien – und vor allem an jene zum ›Gesellschaftsbild des Arbeiters‹ (Popitz et al. 1977) – der Arbeiterschaft eine Vorstellung des gesellschaftlichen Gefüges, die sich entlang des Klasseninteresses ausforme, während den Angestellten eine hierarchische Schichtung vorschwebe. Die Arbeiterschaft verfüge also über ein dichotomes Gesellschaftsbild mit entgegengesetzten Klassen, die Angestelltenschaft über ein hierarchisches Gesellschaftsbild mit abgestuften Schichten. Der Unterschied zwischen diesen beiden Repräsentationsweisen des gesellschaftlichen Aufbaus kann wie in Schema 1 veranschaulicht werden.
Diese Darstellung kann im Prinzip um weitere Elemente erweitert werden, ohne dass die zugrunde liegende Logik verändert werden muss – zum Beispiel durch eine ›obere‹ und ›untere Mitte‹ oder durch eine ›Dienstklasse‹ (ein Terminus, der ursprünglich bei Karl Renner (1953) eingeführt und mit dem Klassenschema von Erikson, Goldthorpe und Portocarero (1979) zuletzt breiter bekannt wurde). Auf die Erweiterungen wird im Exkurs 1 zum Denken über Berufe und zur Genese der Klassifikationssysteme nochmals Bezug genommen.
Schema 1: Unterschied zwischen Klassen und Schichten (nach Solga, Powell und Berger 2009: S.26)
Die Gegenüberstellung von Schichten und Klassen hat eine lange und starke Tradition. Dass die beiden Begriffe aber gar nicht auf derselben logischen Ebene korrespondieren und demnach auch keine sich gegenseitig ausschließenden Repräsentationsweisen von sozialer Ungleichheit darstellen, kann anhand einer Differenzierung plausibel gemacht werden, die von Dahrendorf vorgeschlagen wurde. Die Kategorie Schicht diene demnach der Beschreibung eines statischen Zustandes der gesellschaftlichen Ordnung. »Soziale Schichtung in diesem Sinne ist analog etwa geologischen Schichtungen ein Querschnitt durch ein bestehendes Gefüge.« Demgegenüber könne mit dem Konzept der Klasse erklärt werden, wie verschiedene Kräfte mit unterschiedlichen Interessen sozialen Wandel anstoßen und tragen. Der Klassenbegriff diene dann »zur Kennzeichnung derjenigen Kräfte in einer Gesellschaft, die die Akteure dieser Veränderungen sind« (Dahrendorf 2009 [1968]: S. 211). Um an diese begrifflichen Differenzierungen anzuknüpfen, ließe sich auch sagen: Dichotomie ist der statische Ausdruck einer gesellschaftlichen Frontstellung, Antagonismus der dynamische. Klassen und Schichten können also durchaus gewissermaßen friedlich nebeneinander koexistieren – in der aktuellen (zumindest deutschsprachigen) Sozialstrukturforschung scheint die Bruchlinie innerhalb dieser beiden Konzepte ohnehin überholt zu sein. Als ›alte‹ schichtungstheoretische Ansätze stehen sie gemeinsam den neueren Lebensstilansätzen gegenüber (vgl. dazu etwa Geißler 1996).
Das Gesellschaftsbild
Als Ausgangspunkt zur Erörterung des Gesellschaftsbild-Konzepts soll an dieser Stelle eine basale Bestimmung von Dreitzel (1962) dienen. Dieser hielt fest, dass Gesellschaftsbilder durch normativ strukturierte Wahrnehmung der Realität entstünden und eine »Neigung zur Simplizität« hätten. Im Gesellschaftsbild schlage sich »ein Verlangen nach Ordnung und Übersichtlichkeit« nieder. Funktion von Gesellschaftsbildern sei es, »die ›Verkehrssicherheit‹ im Dschungel der reziproken menschlichen Verhaltensweisen zu garantieren« (1962: S. 220 f.). An diese Bestimmung anschließend können eine weite und eine enge Definition unterschieden werden: Im weiteren Sinne wäre das Gesellschaftsbild ein in Abhängigkeit der sozialen Lage7 variierender ›Überbau‹ von Vorstellungen über die Beschaffenheit der Gesellschaft, ausgestattet mit mehr oder weniger Autonomie gegenüber der materiellen Basis bzw. mit mehr oder weniger Stabilität (abhängig vom Grad der Institutionalisierung und der sozialen Nähe). Darunter könnten auch beispielsweise religiöse Vorstellungen fallen.8 Die engere Definition würde dann die konkreten Vorstellungen über soziale Ungleichheit und Schichtung und über das Verhältnis der einzelnen Gruppen in der Gesellschaft umfassen. Eine offene Frage hierbei bliebe, ob die bloße Vorstellung einer Schichtung oder Ordnung (z. B. als ›Bolte-Zwiebel‹, vgl. Bolte et al. 1967: S. 316) ausreicht, damit von einem Gesellschaftsbild gesprochen werden kann, oder ob die Vorstellung von Ungleichheit nicht vielmehr auch eine Vorstellung der gegenseitigen Verweisung beinhalten bzw. die Ungleichheit nicht auch irgendwie gedeutet, erklärt und/oder legitimiert werden müsste. Zu dieser Frage, die letztlich darauf hinausläuft, ob es möglich sei, kein Gesellschaftsbild zu haben, bemerkt Willener (1975: S. 184 f.) beispielsweise: »Why should only a structured, permanent or lucid image deserve the label ›image‹?« Und daran anschließend: »A non-ideology is an extreme case, a particularly insidious limiting case, of ideology.« (1975: S. 185) Soziale Ungleichheit wäre für ein Gesellschaftsbild in dieser Perspektive nur ein optionales Element. Tatsächlich gibt es in den klassischen Studien zahlreiche Fälle ohne »darstellbares Gesellschaftsbild« (Popitz et al. 1977: S. 227) bzw. mit »nicht fungierende[n] Gesellschaftsbilder[n]« (Habermas et al. 1961: S. 221). Diese Gruppen ergeben sich indes aus den jeweiligen methodischen und theoretischen Vorannahmen, so dass sie nicht die Prämisse anzufechten vermögen, dass Gesellschaftsbilder im engeren und weiteren Sinne die Erklärung der wechselseitigen Verweisung der Gruppen aufeinander voraussetzen – sei es in der Form einseitiger oder gegenseitiger Abhängigkeit oder lediglich als Ordnungsrelation (vgl. zu dieser Unterscheidung Kapitel 2.3.1. weiter unten).
Johann Sandberger (1983: S. 117) schlägt in seinem Überblicksartikel zum Stichwort ›Gesellschaftsbild‹ einen Merkmalskatalog für Gesellschaftsbilder vor. Demnach fänden sich in den verschiedenen Gesellschaftsbildkonzepten idealerweise die folgenden Elemente:
a. Die Reichweite bzw. der Umfang der abgedeckten sozialen Tatbestände wird thematisiert, außerdem der Grad, in dem das Gesellschaftsbild über die Primärerfahrung hinausreicht.
b. Ein Gesellschaftsbild muss ein gewisses Maß an Kohärenz, also an innerer Widerspruchsfreiheit, aufweisen.
Die Kriterien a. und b. würden hierbei oft nicht als variable Merkmale, sondern gewissermaßen als Mindestanforderungen gelten, damit überhaupt von einem Gesellschaftsbild die Rede sein kann. Weiter hält Sandberger folgende Punkte fest:
c. Wie ist der Realitätsgehalt des Gesellschaftsbildes? Welcher Grad der Übereinstimmung mit der primären oder der ›veranstalteten‹ Erfahrung besteht?9
d. Wie lassen sich Affekt- und/oder Wertbesetzung und Neutralität gegenüberstellen? (Hier interessiert der Grad der persönlichen Involviertheit.)
e. Welcher Grad der Interessenbindung besteht?
f. Welcher Grad der Handlungsrelevanz besteht? Inwiefern ist das Gesellschaftsbild also handlungsleitend?
g. Wie können gesellschaftliche Institutionalisierung und subjektive Beliebigkeit gegenübergestellt werden? (Inwiefern wird also auf institutionalisierte Topoi zurückgegriffen?)
h. Wie ist die Verbreitung eines Gesellschaftsbildes innerhalb einer Population? (Hier interessiert insbesondere die Verbreitung in der als mehr oder minder homogen angesehenen ›Arbeiterschaft‹.)
i. Welcher Grad der Stabilität des Gesellschaftsbildes besteht über die Zeit?10
Die Bestimmung von Sandberger gibt eine erste Vorstellung davon, welche Faktoren bei der Beschreibung von Gesellschaftsbildern überhaupt in den Blick kommen können. Dass ein Gesellschaftsbild – im Unterschied zu bloßen Statushierarchien – auch eine Alltagstheorie der sozialen Ungleichheit darstellt und Vorstellungen von Gerechtigkeit beinhaltet, wäre ebenfalls noch zu bedenken.
»Für die Mehrzahl der Ungleichheitstheorien gilt, dass sie unter sozialer Gerechtigkeit eine weitgehende Gleichverteilung von Ressourcen, Chancen, Zukunftsperspektiven, Rechten und Anrechten etc. verstehen. Dies trifft insbesondere für Schicht-, Lebenslagen- und Statusmodelle zu.« (Barlösius 2005: S. 21)
Als theoretischer Referenzrahmen und als Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit dienten zunächst einige klassische Studien zu den ›Gesellschaftsbildern‹ verschiedener Berufsgruppen, darunter die notorische Studie zum Gesellschaftsbild des Arbeiters von Popitz et al. Von diesen Befunden ausgehend ließen sich dann verschiedene Unterfragestellungen wie jene nach dem Status der Dichotomie oder dem Stellenwert der beruflichen Handlungsstruktur für die Muster der sozialen Klassifizierung entwickeln.
Im Folgenden werden also zunächst einige zentrale Studien kritisch rekonstruiert und das jeweilige Konzept des Gesellschaftsbildes erörtert. Damit wird nicht nur eine historisch-kritische Einbettung in den Forschungsgegenstand erreicht, sondern auch die erste Phase des Forschungsprozesses dokumentiert.
2.3. Paradigmatische Studien zu Gesellschaftsbildern
In diesem Unterkapitel werden einige klassische Studien der Gesellschaftsbildforschung zusammengefasst und daraufhin befragt, wie sie zum Verständnis des Phänomens ›Gesellschaftsbild‹ beitragen können. Es handelt sich um Stanisław Ossowskis Schrift zur Klassenstruktur im sozialen Bewusstsein (2.3.1.), Alfred Willeners Studie zu den Images de la société et classes sociales (2.3.2.), die klassische Untersuchung zum Gesellschaftsbild des Arbeiters von Popitz et al. (2.3.3.) sowie um die Studie Student und Politik von Habermas et al. (2.3.4.).
2.3.1. Ossowski: Klassenstruktur im sozialen Bewusstsein
Stanisław Ossowski weist in seiner 1957 in Polen erschienenen und 1962 ins Deutsche übersetzten Arbeit auf eine lange Tradition dichotomer Gesellschaftsvorstellungen in Literatur, Philosophie und Religion hin. Die dichotomische Auffassung der gesellschaftlichen Schichtung sei »die populärste, auf jeden Fall die bedeutendste […]. Sie darf wegen ihren Funktionen in den sozialen Bewegungen als eine idée force bezeichnet werden« (Ossowski 1972: S. 34, kursiv im Original).
Zunächst unterscheidet Ossowski dreierlei binäre Gegenüberstellungen (S. 38): (a) die Regierenden und die Regierten (herrschende und beherrschte Klassen); (b) die Reichen und die Armen (besitzende und besitzlose Klassen); (c) jene, für die man arbeitet und jene, die arbeiten (exploitierende und exploitierte Klassen). Die historisch häufigste und früheste Gegenüberstellung sei jene nach Reichtum und Armut: »Im allgemeinen sind für die christlichen Autoren der ersten fünf Jahrhunderte unserer Ära die zwei Schichten, in welche die Gesellschaft sich teilt, die Reichen und die Armen.« Und darüber hinaus sei die Teilung »in Arbeitende und Nichtarbeitende eine Konsequenz dieses Gegensatzes« (S. 45). Dass es sich bei den Gegenüberstellungen zweier Großgruppen historisch meist um wertende gehandelt habe, zeige sich in Formulierungen wie ›unterdrückende vs. unterdrückte Klasse‹, ›Ausbeuter vs. Ausgebeutete‹. Diese Redeweisen seien Ausdruck der »moralischen Aspekte der Hauptdichotomie« (S. 38). Die Zweiteilung sei in der Geschichte immer auch zu erklären bzw. zu legitimieren versucht worden – in der einen Perspektive werde der Ursprung der Ungleichheit mit der Machtposition begründet: jene, die oben sind, sind reich, weil sie regieren; In der anderen Perspektive liege der Ursprung im Reichtum: jene, die oben sind, regieren, weil sie reich sind (S. 39).11
Die Dichotomie ist bei Ossowski ein Gesellschaftsmodell mit »korrelative[n] Klassen« (S. 46–48), das heißt: eine Klasse bedingt logisch eine andere, ihr gegenüberliegende Klasse.12 Auch die – im Prinzip in kontinuierlichen Stufen denkbare – Gegenüberstellung von Reichen und Armen sei als Modell ebenso gegenseitig ausschließend, denn der Reichtum der einen basiere im dichotomen Modell auf der Armut der anderen:
»Dichotomische Konzeption der sozialen Struktur – das ist die Verallgemeinerung der zweigliedrigen asymmetrischen Relation auf die ganze Gesellschaft, wobei die eine Seite auf Kosten der anderen privilegiert ist. Die Gesellschaft zerfällt dieser Konzeption nach in zwei korrelative Klassen, die sich auf diese Weise gegenüberstehen, dass jede von ihnen durch das Verhältnis jedes ihrer Angehörigen zum Angehörigen der entgegengesetzten Klasse charakterisiert wird.« (S. 47)
An dieser Stelle kann festgehalten werden, dass binäre Klassifizierungen durchaus die Basis für korrelative Klassen liefern können, zum Beispiel reich/arm, arbeitend/nicht arbeitend, oben/unten, etc. Das dichotome Gesellschaftsbild kann bei Ossowski konkret zwei Ausgestaltungen haben: entweder (a) liegt die
»Betonung auf den antagonistischen Verhältnissen in der Gesellschaft […], wobei man voraussetzt, dass die, welche oben sind, und die, welche unten sind, zwei große Klassen sind, die sich als Ganze gegenüberstehen. Es können viele Klassen sein, es geht nur darum, dass jede von ihnen in analoger Weise einer anderen Klasse zugeordnet ist.« (S. 46)
Eine dichotome Sichtweise auf die Gesellschaft ist Ossowski zufolge also durchaus vereinbar mit dem Anerkennen weiterer Klassen oder Gruppen. Nur in der (b) engen Konzeption wird die Gesellschaft nämlich behandelt als »Gesamtheit von zweischichtiger Struktur« (S. 46). Dies ist ein für die Kritik der Gesellschaftsbildforschung zentraler Gedanke. Ossowski zeigt hier, dass eine ›Dichotomie‹ auch als eine Art komprimierter Idealtypus gedacht werden kann, der sich – allerdings mutmaßlich erst auf Nachfrage hin – differenzieren lässt.
Im Gegensatz zu den dichotomischen Gesellschaftsbildern, bei welchen die Existenz einer Mittelklasse »nur eine Abweichung vom Idealtypus der Dichotomie« sei und bei denen die Mittelklasse »der sozialen Struktur nicht ihren dichotomischen Charakter« nehme, bilde sie bei den graduellen Gesellschaftsbildern die Hauptklasse, von welchen die extremen Klassen abweichen. Zwischen diesen beiden Interpretationen gebe es auch eine neutrale, »die alle drei Glieder als mehr oder minder gleichwertig behandelt« (S. 56). Die idealisierte Mittelklasse entspricht dann der aristotelischen ›besten Ordnung‹, in welcher die ausgewogene Mitte zwischen den (als schädlich angesehenen) Extremen vermittelt. Das Gradationsschema teile die Gesellschaft nicht in zwei, sondern in
»drei oder mehr Klassen, von denen jede in derselben Beziehung höher oder niedriger ist als die anderen. Auch hier wird jede Klasse durch ihr Verhältnis zu anderen Klassen bestimmt, aber dieses Verhältnis ist hier nicht als ein Abhängigkeitsverhältnis verstanden, sondern als ein (logisch) ordnendes Verhältnis.« (S. 59)
Die Gradation könne wiederum nach der Anzahl der Kriterien unterschieden werden, auf denen sie aufbaue: die einfache Gradation beruhe »auf der Steigerung irgendeines objektiv messbaren Merkmales« (S. 59), also Vermögen, Besitz, Einkommen. Damit ergebe sich das besondere Problem der Festlegung der Klassengrenzen, denn diese sei einfacher bzw. überhaupt erst möglich, wenn mindestens ein weiteres Kriterium dazu komme, die Gradation also synthetisch sei (S. 119). Im Prinzip sei bei der einfachen Gradation auch ein anderes Kriterium als ein ökonomisches denkbar, zum Beispiel der Bildungsgrad, aber
»solche Konzeptionen interessieren uns hier nicht, denn sie haben keine Rolle in der Geschichte des sozialen Gedankens gespielt; solchen Konzeptionen der sozialen Struktur sind wir im sozialen Bewusstsein nicht begegnet.« (S. 59 f.)
Der Bildungsgrad sei daher meist nur für die synthetische Gradation relevant. Die synthetische Gradation bilde Klassen nicht bloß nach einem Kriterium, zum Beispiel dem ökonomischen, sondern zusätzlich nach weiteren Kriterien, zum Beispiel nach der Quelle des Einkommens, nach dem Lebensstil, dem Beruf, der Bildung.
»Es gibt Fälle, wo eine Gradation, die scheinbar nur auf einem Kriterium beruht, doch eine synthetische Gradation ist. Dies ist dann der Fall, wenn man zum Beispiel die soziale Stratifikation auf der Grundlage der Berufe der einzelnen Individuen aufstellt.« (S. 67)
Jede Schichtung nach Status müsse logisch eine synthetische Gradation sein, da sich Ansehen nicht aus eindimensional messbaren Aspekten ableiten ließe. Dies gelte auch für den Status der Berufe:
»Da die Hierarchie der Berufe sich mit der Hierarchie der Einkommenslagen nicht deckt, muss sie auf einer Synthese mannigfaltiger Faktoren beruhen, welche sich im sozialen Bewusstsein vollzieht. Eine solche Synthese hängt vom Milieu ab.« (S. 67)
Durch Synthese der ökonomischen Gradation mit Elementen der Ständehierarchie komme man zum Beispiel zur Vorstellung eines ›Lebensstils‹ (S. 70). Eine teilweise Kompensation einzelner Elemente der synthetischen Gradation sei möglich, allerdings gelinge dies nur bedingt (S. 71) – analog zu der von Bourdieu postulierten partiellen Konvertierbarkeit der Kapitalsorten (z. B. Bourdieu 1983). Die synthetische Gradation beruhe auf mehreren inkommensurablen Kriterien, was zur Folge habe, dass auf eine bestimmte interessierende soziale Position nicht objektiv geschlossen werden könne, die Resultante sei immer von Wertungen abhängig (S. 74).
»Die synthetischen Wertungen der sozialen Position als Ergebnis des Vergleichs der inkommensurablen Werte werden zu sozialen Tatsachen, die für einzelne beurteilende Milieus charakteristisch sind, wenn sie ein Ausdruck des ›sozialen Bewusstseins‹ sind, d. h. wenn sie mehr oder weniger in Übereinstimmung gebracht werden im Bewusstsein der Angehörigen eines Milieus, welche den gegenseitigen Suggestionen unterliegen. Das Milieu vollführt die Synthese, und diese Synthese fällt in verschiedenen Milieus verschieden aus.« (S. 74 f.)
Wie verschiedene Personen sozial positioniert werden, ist für Ossowski also milieuvermittelt.
Ein weiteres von Ossowski erörtertes Modell der Gesellschaft sind die funktionellen Schemata (S. 78–90). Anstelle von einseitiger Abhängigkeit (Dichotomie) herrsche hier eine gegenseitige Abhängigkeit bzw. eine funktionale Verflechtung der Klassen. Im mittelalterlichen ordo lautete diese Einteilung beispielsweise ›Lehrstand – Wehrstand – Nährstand‹, zu Zeiten der Industrialisierung seien die Klassen oft nach Einkommensquelle unterschieden worden, was eine Einteilung der Gesellschaft in Grundbesitzer, Kapitalbesitzer und Arbeiter ergeben habe. Jeder dieser Klassen komme eine bestimmte Art des Einkommens zu: der Grundbesitzer lebe von der Landrente (rent of land), der Kapitalbesitzer vom Kapitalertrag (profit of stock), der Arbeiter von der Lohnarbeit (wages of labour) (S. 79). Dieses von Adam Smith geprägte funktionale Modell der Stände sei heute aber nicht mehr populär (S. 84). Hier bleibt anzumerken, dass andere funktionelle Gesellschaftsbilder durchaus verbreitet sind, insbesondere wenn eine Zuordnung nach beruflicher Tätigkeit vorgenommen wird. Konservative oder von Religionen getragene Gesellschaftsbilder orientieren sich zudem oft an funktionalen Schemata, da diese sich am besten zur Legitimation einer bestehenden Ordnung eignen: Was funktional ist, funktioniert und soll daher nicht geändert werden.13
Eine Interpretation der Gesellschaftsstruktur wird von Ossowski schließlich besonders hervorgehoben: die marxsche Synthese (S. 91– 113):
»Marx in seiner Eigenschaft als Revolutionär, Nationalökonom und Soziologe erbt […] alle drei prinzipiellen Typen der Auffassung der Klassenstruktur, mit denen wir es in der Geschichte der europäischen Ideen zu tun haben: dichotomisches Schema, Gradationsschema und funktionelles Schema.« (S. 107)
Zugleich führe Marx ein viertes Modell ein: die Kreuzung zweier oder dreier dichotomischer Teilungen. Marx erkenne, dass die Basisdichotomien ›Besitz vs. Nichtbesitz von Produktionsmitteln‹ und ›Arbeit vs. Nichtarbeit‹ nicht nur die Einteilung der Gesellschaft in eine besitzendmüßige und in eine besitzlos-arbeitende Klasse ergibt, sondern durch die Kreuzung dieser Dichotomien zugleich eine Mittelklasse entsteht, die zwar über Produktionsmittel verfügt, aber trotzdem arbeiten muss: das Kleinbürgertum. Dieses »gehört in bezug auf die aktuellen Verhältnisse zur besitzenden Klasse, und in bezug auf die Zukunftsperspektiven zum Proletariat« (S. 101). Die Dichotomie sei in der marxschen Konzeption als solche nur fiktiv, sie werde erst im Endstadium der kapitalistischen Gesellschaftsordnung real erreicht und schließlich durch die klassenlose kommunistische Gesellschaft abgelöst. Auch hier ist es für meine Argumentation in der Folge zentral festzuhalten, dass die marxsche Dichotomie keine real festgestellte, sondern eine künftig idealiter zu erreichende und wieder aufzulösende ist.
Zusammenfassend unterscheidet Ossowski vier basale »Typen der Interpretation der Klassenstruktur« (S. 190): das funktionelle Schema, das dichotomische Schema sowie die einfache und die synthetische Gradation. Logisch geschieden werden können diese vier Typen außerdem danach, ob sie (a) auf einer Abhängigkeitsrelation beruhen (funktionelles Schema mit gegenseitiger Abhängigkeit, dichotomisches Schema mit einseitiger Abhängigkeit, letzteres wiederum unterteilt in einfache Dichotomie und Kreuzung zweier oder dreier Dichotomien) oder (b) auf einer Ordnungsrelation (einfache und synthetische Gradation). Insgesamt bietet Ossowskis Arbeit eine fundierte Basis zur heuristischen Einordnung von empirisch beobachteten Klassifikationen und Gesellschaftsbildern. Auch in Bezug auf das Verhältnis von Gesellschaftsbild, Dichotomie und Idealtypus liefert Ossowski wichtige Anregungen. So macht er deutlich, dass dichotome Vorstellungen idealtypisch gedacht werden können und durchaus nicht einfach durch ›mangelnde Realitätskenntnis‹ entstehen. Dies relativiert die oft vereinfachende Rede vom »dichotomen Gesellschaftsbild des Arbeiters«.
2.3.2. Willener: Images de la société et classes sociales
Alfred Willener ging in seiner Erhebung, die in den 1950er Jahren in der Stadt Lausanne durchgeführt wurde, von folgenden Fragen aus: Gibt es bei den im Hinblick auf das Thema ›Klassen‹ interviewten Personen spontane Verweise auf Schichtung und/oder auf deren Effekte? Welches sind die Schemata der Schichtung? Wie benennen die Befragten ihre eigene soziale Klasse oder Kategorie? Von zentralem Interesse sind die jeweils gewählten Begriffe. Das Resultat von Willeners Studie bilden die sechs Typen der Repräsentation der Gesellschaft, die er »Types de ›classes‹« nennt. Die Typen und ihre jeweilige quantitative Verteilung in der Stichprobe sind in Tabelle 1 dargestellt.
Tabelle 1: Types de ›classes‹ nach Willener (1957: S.153)
Die Typen wurden durch inhaltsanalytische Auswertung der erhobenen Aussagen gebildet. Für die sozioökonomischen Kategorien (1) wählten die Befragten Termini wie ›reiche, mittlere und arme Klasse‹ oder ›Reiche, Arme und der große Rest‹. Für die Subsumtion unter die sozio-professionellen Kategorien (2) sind Begriffe auf Grundlage der beruflichen Tätigkeit ausschlaggebend gewesen, beispielsweise ›die Intellektuellen; die Angestellten und Händler; die Arbeiter; die Bauern‹.14 Die Dichotomie der Abhängigkeit (3) äußerte sich in der Existenz zweier antagonistischer Klassen, also beispielsweise ›Die kapitalistische Klasse und die Arbeiterklasse‹. Im Bild vom Klassenkampf (4) war die Stellung im Produktionsprozess oder die Macht für die Gegenüberstellung der Klassen entscheidend, es sei hier meist eine dritte Klasse hinzugekommen, so dass eine Unterteilung beispielsweise in ›Kapitalisten; Kleinbürger; Proletarier‹ resultiert habe. Für die Schichtung nach sozialem Prestige (5) sei oft nur eine diffuse Klassifikation bzw. eine vage Vorstellung von Schichtung vorhanden gewesen, die verwendeten Begriffe beruhten auf der Idee des Prestiges, beispielsweise ›Aristokratie; höhere Mittelklasse, mittlere Mittelklasse; untere Mittelklasse‹. Die als politische Kategorien (6) eingestuften Klassifikationen (etwa der Art ›Linke und Rechte‹) wurden von Willener als nicht genügend zahlreich fallen gelassen. Bemerkenswert erscheint Willener, dass die Typen (1), (2), (3) und (5) fast genau gleich häufig vorkommen (1957: S. 160).
In einem weiteren Reduktionsschritt (S. 205) versteht Willener die Typen (1), (2) und (5) als von einer ›Schichtlogik‹ bestimmt. Die Position der sozialen Gruppen folge hier einer kontinuierlichen Skala. Das Problem der Schichtgrenzen wird von Willener nicht behandelt15. Die Typen (3) und (4) folgten einer Logik der ›Klasse‹, so Willener, die sozialen Gruppen würden antagonistisch gefasst. Nach entsprechenden Kreuztabellierungen (S. 206 f.) folgert Willener, dass die abhängig Beschäftigten, die weniger Verdienenden und die manuell Tätigen die Gesellschaft eher als Klassen wahrnähmen; Selbständige, besser Verdienende und nicht-manuell Tätige hätten demgegenüber eher ein ›geschichtetes‹ Bild der Gesellschaft. Durch die Zusammenfassung der ›Types de classe‹ zu zwei dominanten Teilungsprinzipien (Schicht und Klasse) wird ein frappanter Unterschied zwischen Arbeitern und Angestellten deutlich (S. 208). Während Angestellte die Gesellschaft zu 77 Prozent als Schichtung wahrnähmen, hegten nur 47 Prozent der Arbeiter diese Vorstellung. Umgekehrt fassten Arbeiter die Gesellschaft zu 48 Prozent als Klassengesellschaft auf, während nur gerade 23 Prozent der Angestellten dies täten (vgl. Tabelle 2).
Tabelle 2: Wahrnehmung der Gesellschaft durch Arbeiter bzw. Angestellte, unterteilt nach Types de ›classe‹ bzw. nach Schichten oder Klassen (angepasste Darstellung nach Willener 1957: S.208)
Insgesamt liefert die Studie von Willener einige empirische Hinweise auf die je nach Beschäftigungsstatus unterschiedliche Wahrnehmung von Gesellschaft. Im Wesentlichen stützt sie die Befunde der im Folgenden erörterten Studie von Popitz et al., welche den Arbeitern ein dichotomes und den Angestellten ein hierarchisches Gesellschaftsbild attestieren.
2.3.3. Popitz et al.: Das Gesellschaftsbild des Arbeiters
Den Auftakt zur Studie zum Gesellschaftsbild von Hüttenarbeitern bildet die Feststellung, dass »ein beschränkter Mensch […] sich besonders törichte oder besonders vage Vorstellungen von den Leuten machen [mag], die hinter den Bergen wohnen« (Popitz et al. 1977: S. 1). Diesen Einstiegssatz als Hinweis auf das Bild zu deuten, das Popitz et al. von ihrem Untersuchungsobjekt – den Arbeitern eines Stahlhüttenwerks – haben, wäre indes böswillig, denn, wie einige Zeilen weiter unten klar wird, es geht hier eigentlich um das universelle Schicksal aller Menschen: sie »sind gezwungen, sich Vorstellungen von Ereignissen zu bilden, die ihr Tun und Lassen bestimmen, ohne stets die Möglichkeit zu haben, den Realitätsgehalt dieser Vorstellungen kontrollieren zu können.« Daraus folge dann das »Dilemma, Vorstellungen von Sachverhalten entwickeln zu müssen, die sich selbst einer mittelbaren Prüfung weitgehend entziehen, obwohl sie für die eigene Existenz unmittelbar relevant sind« (S. 1). Das Unwissen über die Ursachen und die Unwägbarkeiten der eigenen Existenz hat neben der materiellen Not auch eine ideelle Not zur Folge, welche in Deutungsprobleme mündet (so die klassische Bestimmung Max Webers). Diese Deutungen können – so Popitz et al. – zum Teil durch Institutionen und Normen bereitgestellt werden (S. 2).
Der Fokus der Untersuchung von Popitz et al. liegt auf den Industriearbeitern, weil hier die marxistische Ideologie eine Denktradition darstelle, welche die undurchsichtigen gesellschaftlichen Zusammenhänge zu erklären vermöge und weil die Arbeiterschaft, insbesondere nach Ende des Zweiten Weltkriegs, einem besonderen Kampf um Aufmerksamkeit unterliege – die »Verfügungsgewalt über ihre Gesinnung« stehe auf dem Spiel (S. 5). Außerdem sei »die Einheitlichkeit der gesellschaftlichen Position der Industriearbeiterschaft […] noch immer verhältnismäßig groß« (S. 6).16 In der Diskussion um die Studie ist häufig die Frage aufgeworfen worden, ob die Befunde von Popitz et al. auf die Hüttenarbeiter beschränkt sind oder ob sie für die gesamte Arbeiterschaft generalisiert werden können. Letzteres wird wohl gängigerweise stillschweigend angenommen, obwohl Popitz et al. an vielen Stellen (so z. B. auf S. 170) deutlich machen, dass die Ergebnisse nur für die relativ isolierte und als besonders solidarisch beschriebene Gruppe der Hüttenarbeiter gelten.17 Eine gewisse Mitverantwortung an der problematischen Rezeption ist den Autoren allerdings anzulasten, nennen sie ihre Studie doch trotz der eingeräumten Einschränkungen plakativ Das Gesellschaftsbild des Arbeiters.18
Die Definition des Gesellschaftsbilds ist bei Popitz et al. an den Begriff der »Verortung« geknüpft, die beiden Begriffe setzen sich wechselseitig voraus (S. 9).19
»Das Wort ›Verortung‹ ist zunächst möglichst wörtlich zu nehmen: Der Mensch schafft sich seinen ›Ort‹, indem er die ihm zugänglichen Gegebenheiten einer natürlichen oder gestalteten Objektwelt in eine Rangordnung des für ihn Relevanten bringt.« (S. 7)
Dieses Sich-zur-Welt-in-Beziehung-Setzen »kann sich niemals ausschließlich auf das Handgreiflich-Zugängliche beschränken. Es müssen Vorstellungen gebildet werden, die über die eigenen unmittelbaren Erfahrungen hinausgehen« (S. 8). Für die Repräsentation der Gesellschaft als Bild ist demnach ein zusätzliches Element erforderlich. Der Erfahrung hafte »unausweichlich etwas Teilhaftes, Partielles an. Sie verweist stets zugleich auf ein ›Mehr‹, das innerhalb des eigenen Erlebnisbereichs nicht greifbar ist« (S. 8). Das Gesellschaftsbild müsse,
»um seine Funktion erfüllen zu können, den Charakter des Dauerhaften haben, eine gewisse Stimmigkeit einzelner Vorstellungen innerhalb eines Ganzen besitzen und jeweils ein ›Mehr‹ gegenüber dem unmittelbar Erfahrenen enthalten.« (S. 9)
Stabilität und Kohärenz sind bei Popitz et al. für das Gesellschaftsbildkonzept zentral, ebenso die Trennung eines Bereichs der Erfahrung von einem Bereich, der prinzipiell nicht erfahren werden kann und der Spekulation unterliegt – das in den Zitaten zweimal unbestimmt gelassene »Mehr«.
Für die empirische Untersuchung entwickeln Popitz et al. ein Leitfadeninterview auf der Basis von drei Fragekomplexen: (a) Welche Erfahrungen liegen vor? (b) Welche Kenntnisse gesellschaftlicher Probleme sind vorhanden? (c) Welche nicht-erfahrungsbezogenen Vorstellungen werden entwickelt? Durch die analytische Trennung dieser drei Ebenen lässt sich deren jeweiliger Anteil am Gesellschaftsbild konstruieren. Die Protokolle erlauben indes nur eine inhaltsanalytische Auswertung, weil die bis zu vierstündigen Interviews erst unmittelbar im Anschluss an das Gespräch »möglichst wörtlich« (S. 13) niedergeschrieben wurden und sie somit beispielsweise für eine streng rekonstruktiv-hermeneutische Interpretation unbrauchbar wären. Aus heutiger Sicht muten die Aussagen zur Legitimation dieser ›Erinnerungsmethode‹ eigenartig an: »Der Sprachschatz der meisten Befragten [ist] übersehbar. Durch die ständige Wiederholung bestimmter Wörter und Redewendungen prägt sich ein großer Teil der Aussagen recht gut ein« (S. 13). Es finden sich noch weitere Beispiele für den problematischen methodischen Status der 600 Interviewprotokolle (z. B. S. 14, 89 und 167), die meisten dieser Unzulänglichkeiten sind indes – weil zeitgebunden – nicht legitimerweise kritisierbar. Wenn allerdings im Fragebogen die Frage auftaucht: »Was sagen denn die da oben dazu?« (S. 23) und diese Formulierung später als einer der empirischen Hauptbelege für das dichotome Gesellschaftsbild verwendet wird, so lässt dies aufhorchen. Die weitere Anweisung zu dieser Frage lautete: »Die Wendung durfte nur durch eine konkretere ersetzt werden, wenn eine unmittelbare Anknüpfung an eine vom Befragten selbst gebrauchte Wendung möglich war« (S. 24). Der Unmut über diesen analytischen Schritt scheint den Autoren zwar klar gewesen zu sein, denn in einer Fußnote heißt es:
»Wegen seiner Gebräuchlichkeit, die uns bekannt war, und seiner Unkonkretheit glaubten wir, diesen Ausdruck auch selbst bei der Befragung verwenden zu dürfen.« (S. 168, Fußnote 54) Dennoch wird der Ausdruck »die da oben« in der Folge als der »häufigste und unkonkreteste, aber deshalb vielleicht am besten passende Bezeichnung« in seiner Bedeutung nochmals unterstrichen (S. 168).
Aus dem Umstand, dass die Aussagen der Befragten zum technischen Fortschritt und zur »Welt in 50 Jahren« weitgehend unabhängig waren von sozialstrukturellen Merkmalen, folgern Popitz et al., dass die festgestellte Stereotypik
»auf einen allgemeinen, relativ fest umrissenen Bestand an Vorstellungen, Gesichtspunkten und Thesen [deutet], der den Arbeitern gemeinsam zur Verfügung steht und auf den sie bei ihren Antworten zurückgreifen können.« (S. 82)
Diesen Bestand nennen die Autoren Topik, die einzelnen darin versammelten Vorstellungen Topoi. »Jede Topik, d. h. der Gesamtbestand verfügbarer Topoi, hat ihren sozialen Ort, an dem sie sich […] als sinnvoll erweist.« (S. 84). Der Gebrauch der Topik sei »unabhängig von den persönlichen Erfahrungen dessen, der die Aussage macht« (S. 84). Die Topoi sind also nicht zufällig über die Population verteilt, sondern auf die Erfahrungen der Klasse – hier der Arbeiterschaft – zurückzuführen:
»Man gebraucht die Topoi, die einem einleuchten. Und zwar einleuchten nicht auf Grund persönlicher Erfahrungen, sondern im Zusammenhang mit einer Grundeinstellung, mit einer im Laufe des Lebens allmählich gewachsenen Grundentscheidung, die Dinge so und nicht anders zu sehen und zu nehmen.« (S. 87)
Diese Beobachtung nimmt Teile des bourdieuschen Habituskonzeptes vorweg, mit dem Unterschied, dass Bourdieu hier vermutlich kaum von einer ›Grundentscheidung‹ sprechen würde, sondern von unbemerkt vermittelten und inkorporierten Denkweisen, Werten und Einstellungen, die in einen milieuspezifischen Habitus münden.
Deutlich grenzen sich die Autoren zudem von der in den 1950er Jahren aufkommenden Meinungsforschung ab:
»Wir versuchten zu zeigen, dass die Frage nach dem Gesellschaftsbild der Arbeiter nicht mit dem Interesse für irgendwelches unverbindliche, freischwebende ›Meinen‹ zu verwechseln ist, sondern eine konkrete anthropologische und soziologische Basis besitzt.« (S. 9)
Zusammenfassend bilden Popitz et al. in einem separaten Kapitel (S. 184–249) sechs Typen von Gesellschaftsbildern, welche sie in drei Hauptkategorien gliedern: Entweder die Gesellschaft werde (a) als Ordnungsgefüge (Typen I und II), (b) als unabwendbare Dichotomie (Typen III und IV), oder (c) als Klassengesellschaft (Typen V und VI) wahrgenommen. Die Typologie lässt sich nachträglich nicht mehr im Detail nachvollziehen, die Abgrenzung von theoretischer Konstruktion und empirisch Rekonstruktion wird aber nicht immer deutlich. Im Einzelnen zeichnen sich die Typen folgendermaßen aus:





























