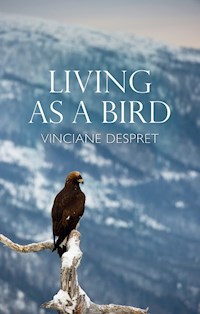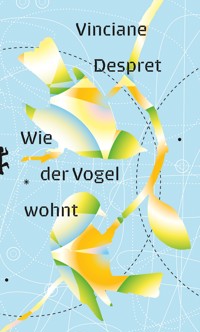
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Nach einem langen Winter der gemeinsamen Migration und des friedlichen Zusammenlebens beginnen Vögel in den ersten Frühlingstagen plötzlich mit aller Kraft zu singen und erschaffen einen eindrucksvollen audiophonen Raum. Sie werden zu Konkurrenten, können die Anwesenheit anderer nicht ertragen und fangen an, sie zu bedrohen und anzugreifen, wenn sie eine Grenze überschreiten, die für den Menschen unsichtbar ist. Was verbirgt sich dahinter? Ein Spiel, die Balz oder eine Form von Territorialität? Oder ist alles doch nur Show? Die belgische Wissenschaftsphilosophin untersucht mit liebevollem Blick die Art und Weise, wie Vögel ihre Welten konstruieren, und Ornithologen versuchen, sie zu verstehen. Sie nimmt Vögel wie Ornithologen genau unter die Lupe und indem sie beide in einem gemeinsamen Raum beobachtet, öffnet sie uns die Augen für die vielfältigen Welten und Existenzweisen auf unserem Planeten, den der Mensch sich mit Vögeln und anderen Arten teilt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wie der Vogel wohnt
Vinciane Despret
Wie der Vogel wohnt
Aus dem Französischenvon Nicola Denis
Für Donna Haraway,Bruno Latour undIsabelle Stengers
Inhalt
ERSTER AKKORD
Kontrapunkt
Kapitel 1Territorien
Kontrapunkt
Kapitel 2Die Mächte des Anscheins
Kontrapunkt
Kapitel 3Überpopulation
Kontrapunkt
ZWEITER AKKORD
Kontrapunkt
Kapitel 4Aneignungen
Kontrapunkt
Kapitel 5Aggression
Kontrapunkt
Kapitel 6Polyfone Partituren
Kontrapunkt
Nachworte
Stéphane Durand: Poetik der Aufmerksamkeit
Baptiste Morizot: Das aus dem Nest gefallene Wissen bergen
Dank
Anmerkungen
ERSTER AKKORD
Kontrapunkt
Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde (dem Platz der Vögel), als unsere Philosophie mühelos erklären kann.
Étienne Souriau1
Anfangs ging es um eine Amsel. Zum ersten Mal seit Monaten war mein Schlafzimmerfenster offen geblieben, ein Zeichen des Sieges über den Winter. Ihr Gesang weckte mich im Morgengrauen. Sie sang voller Inbrunst, aus Leibeskräften, mit ihrem ganzen Amseltalent. Eine andere antwortete ihr in einiger Entfernung, wahrscheinlich von einem der umliegenden Schornsteine aus. Ich konnte nicht wieder einschlafen. Diese Amsel sang, wie der Philosoph Étienne Souriau sagen würde, mit der Begeisterung ihres Körpers, die sich bei allen vom Spiel und den Verstellungskünsten eingenommenen Tieren beobachten lässt.2 Doch weder diese Begeisterung hat mich wachgehalten noch das, was ein griesgrämiger Biologe als lärmenden Evolutionserfolg bezeichnen könnte. Vielmehr war es das deutliche Bemühen dieser Amsel, jede Notenabfolge zu variieren. Ab dem zweiten oder dritten Lockruf war ich restlos gebannt von jener Klangerzählung, deren melodische Kapitel ich mit einem stummen »und jetzt?« herbeisehnte. Jede Sequenz unterschied sich von der vorherigen, jede gestaltete sich als neuer Kontrapunkt.
Von diesem Tag an blieb mein Fenster Nacht für Nacht offen. Nach jenem ersten Morgen begrüßte ich jede weitere Schlaflosigkeit mit der gleichen Freude, der gleichen Überraschung und der gleichen Erwartung, sodass ich gar nicht wieder einschlafen wollte. Der Vogel sang. Noch nie war ein Gesang mir der Sprache so verwandt erschienen. Es sind Sätze, die man wiedererkennen kann, Sätze, die sich im Übrigen genau dort in meinem Ohr festsetzen, wo sich auch die Wörter einnisten. Gleichzeitig ist ein Gesang in diesem absoluten Anspruch der Nicht-Wiederholung der Sprache noch nie ferner gewesen. Es ist eine Sprache, aber eine, die sich nach Schönheit sehnt, in der jedes einzelne Wort zählt. Die Stille hielt die Luft an, ich spürte, wie sie flimmerte, um mit dem Gesang zu harmonieren. Ich spürte deutlich, dass das Schicksal der ganzen Welt, vielleicht sogar die Existenz der Schönheit an sich in diesem Augenblick auf den Schultern der Amsel ruhte.
Étienne Souriau schreibt von der Begeisterung des Körpers; manche Ornithologen, sagte mir der Komponist Bernard Fort, sprechen in Bezug auf die Feldlerche von einem Hochgefühl.3 Für diese Amsel wäre der Begriff »Dringlichkeit« zutreffend: Neben dem Gesang verliert alles andere seine Dringlichkeit. Die Dringlichkeit erwachte im Gesang einer Amsel, sie durchdrang und transportierte ihn, sandte ihn in die Ferne, zu anderen, zu der Amsel dort drüben, zu meinem sehnsüchtig lauschenden Körper, an die Grenzen ihres Stimmvermögens. Und das Gefühl der absoluten Stille, die in dem städtischen Siedlungsgebiet vor meinem Fenster eigentlich unmöglich ist, zeigte wohl, wie sehr mich diese Dringlichkeit bewegte, so sehr, dass sie jenseits dieses Gesangs alles andere ausblendete. Der Gesang hatte mir die Stille geschenkt. Die Dringlichkeit hatte mich berührt.
Vielleicht berührte mich dieser Gesang auch nur deshalb so nachhaltig, weil ich kurz zuvor Donna Haraways Manifest für Gefährten4 gelesen hatte. In diesem wunderbaren Buch beschreibt die Philosophin die Beziehung zu ihrer Hündin Cayenne. Sie erzählt, wie tiefgreifend sich diese Beziehung auf ihr Verhältnis zu anderen Lebewesen oder, genauer gesagt, zu »signifikanten, andersartigen Lebewesen« ausgewirkt hat, wie sie lernte, die Welt achtsamer zu betrachten, besser auf sie zu hören und neugieriger zu sein; und dass sie hoffe, mit den Geschichten über ihre Hündin die Entdeckung andersartiger, signifikanter Lebewesen zu fördern. Haraway gelingt es, wie ich bei meiner Amsel-Erfahrung merkte, andere Formen der Aufmerksamkeit zu bewirken und attraktiv zu machen.5 Und es gelingt ihr, Aufmerksamkeit für diese Aufmerksamkeitsformen zu schaffen. Nicht etwa, sensibler zu werden (eine allzu bequeme Floskel, auf die manche allergisch reagieren könnten), sondern zu lernen, wie man sich auf eine bestimmte Aufmerksamkeit einlassen kann: wie man sowohl »etwas seine Aufmerksamkeit widmen« als auch erkennen kann, auf welche Weise andersartige Lebewesen Aufmerksamkeit bekunden. Es ist eine andere Form, Dringlichkeit zu äußern.
Der Ethnologe Daniel Fabre sagte über seinen Beruf, er interessiere sich für das, was die Menschen am Schlafen hindere. Der Anthropologe Eduardo Viveiros de Castro gibt eine ähnliche Definition von der Anthropologie: Sie sei das Studium variierender Dringlichkeiten. Weiter schreibt er, »[w]enn es etwas gibt, das der Anthropologie von Rechts wegen zukommt, dann ist es nicht die Aufgabe, die Welt des anderen zu erklären, das heißt zu explizieren, sondern die, unsere Welt zu vervielfachen«.6 Die Verhaltensforscher, die Tiere beobachten und analysieren, wie es vor ihnen die Naturforscher getan haben, verfolgen meiner Meinung nach meist ein vergleichbares Vorhaben: Sie wollen dokumentieren und die Seinsweisen vermehren, sprich »die Weisen zu empfinden, zu fühlen, Sinn zu geben und den Dingen eine Dringlichkeit zu verleihen«7. Wenn der Verhaltensforscher Marc Bekoff sagt, jedes Tier sei für sich genommen eine Art, die Welt zu erfahren, meint er nichts anderes. Natürlich können die Wissenschaftler nicht auf Erklärungen verzichten, doch das Erklären kann die unterschiedlichsten Formen annehmen: Es kann darin bestehen, komplexe Geschichten, wahre Abenteuererzählungen über das Leben und die hartnäckig von ihm erprobten Möglichkeiten zu ersinnen; es kann die Probleme zu erhellen versuchen, für die dieses oder jenes Tier eine Lösung gefunden hat, oder aber nach einer allgemeingültigen Patenttheorie streben. Kurzum, es gibt Erklärungen, die die Welten vervielfachen und unzählige Seinsweisen berücksichtigen, und es gibt solche, die sie bändigen und auf ein paar Grundprinzipien beschränken.
Die Amsel hatte zu singen begonnen. Etwas Dringliches beschäftigte sie, und in diesem Moment zählte nichts anderes als das, was sie um jeden Preis zu Gehör bringen wollte. Begrüßte sie das Winterende? Brachte sie ihre Daseinsfreude zum Ausdruck, das Gefühl, wieder aufzuleben? Sang sie ein Loblied auf den Kosmos? Wissenschaftler könnten darüber so nicht sprechen. Aber sie könnten bestätigen, dass sämtliche kosmischen Kräfte des aufkeimenden Frühlings der Amsel die Grundbedingungen für ihre Verwandlung bieten.8 Denn tatsächlich haben wir es hier mit einer Verwandlung zu tun. Diese Amsel, die vermutlich einen recht friedlichen, wenn auch nicht einfachen Winter mit seltenen Momenten halbherziger Empörung über ihre Artgenossen verbracht hatte, die sich um ein unauffälliges, problemloses Leben bemühte, diese Amsel sang nun aus Leibeskräften, möglichst weit oben und sichtbar. Und alles, was die Amsel in den vergangenen Monaten hatte erleben und empfinden mögen, alles, was bis dahin den Dingen und den anderen ihren Sinn verliehen hatte, bekam jetzt eine neue, ebenso unausweichliche wie fordernde Dringlichkeit, die ihre Seinsweise von Grund auf verändern sollte: Die Amsel wurde territorial.
Kapitel 1
Territorien
Unicum arbustum haud alit Duos erithacos
(Ein Baum beherbergt nicht zwei Rotkehlchen)
Zenodotos von Ephesos (3. Jahrhundert v. Chr.)
Diese Verwandlung beschäftigte, ja, beeindruckte die Wissenschaftler. Wie können Vögel, die im Winter zum Teil ruhig zusammenleben, einträchtig miteinander fliegen, gemeinsam nach Nahrung suchen und sich nur manchmal über offenbar bedeutungslose Kleinigkeiten zanken, plötzlich komplett ihr Verhalten ändern? Sie ziehen sich voneinander zurück, suchen sich einen Ort und singen von ihren exponierten Sitzwarten aus unaufhörlich. Sie scheinen die Anwesenheit ihrer Artgenossen nicht mehr zu ertragen und überlassen sich einem ungezügelten Droh- und Angriffsverhalten, wenn einer von ihnen eine für unsere Augen unsichtbare Linie missachtet, die einer präzisen Grenzziehung zu entsprechen scheint. Ihr merkwürdiges Verhalten wirkt verblüffend, insbesondere ihre Aggressivität, ihre entschlossenen und kampflustigen Reaktionen auf die anderen, vor allem das, was man später als »Luxus« ihrer Gesänge und Posituren bezeichnen sollte – Farben, Tänze, Flugverhalten, Bewegungen: Alles ist spektakulär, alles ist Stoff für eine Theatralisierung. Dazu kommt die nicht minder verblüffende Routine des Nistverhaltens. 1920 beschreibt Henry Eliot Howard die Territorialisierung einer männlichen Rohrammer, die er in der Nähe seines Hauses in der Region Worcestershire beobachtet. Der Vogel nistet in der Sumpflandschaft an einer mit Erlen und Weiden bestandenen Stelle. Theoretisch könnte ihm ein beliebiger Baum zum Überwachen der Umgebung dienen, doch die Rohrammer sucht sich einen ganz bestimmten aus, der zum wichtigsten Punkt des beanspruchten Raums wird, zu ihrem, wie Howard sagt, »Hauptquartier«, dem Sitz, von dem aus sie singend ihre Anwesenheit kundtut, die Bewegungen ihrer Nachbarn verfolgt und nach Nahrung sucht. Mit der Zeit lässt sich eine regelrechte Routine beobachten, die stets von der Reviermitte ausgeht: Der Vogel fliegt von seinem Baum auf, lässt sich in einiger Entfernung auf einem Gebüsch nieder, dann auf einer noch weiter entfernteren Binse, bevor er wieder auf seinen Baum zurückkehrt. Er absolviert alle Strecken mit einer bemerkenswerten Regelmäßigkeit. Diese Wiederholungsbewegungen stecken nach und nach sein Territorium ab.
Natürlich sind auch andere Beschreibungen möglich. Sie ließen nicht lange auf sich warten, denn Howard gab den Anstoß zu einer ganzen Forschungsrichtung, als deren Gründungsvater er angesehen wurde. Sein 1920 erschienenes Buch Territory in Bird Life bietet nicht nur präzise Beschreibungen, sondern darüber hinaus eine kohärente Theorie, mit der sich seine Beobachtungen einordnen lassen: Die Vögel sichern sich ein Territorium, in dem sie sich paaren, ihr Nest bauen, ihre Jungen beschützen und ausreichend Nahrung für ihre Brut finden.
Es sei vorausgeschickt, dass Howard kein Wissenschaftler war, sondern ein begeisterter Naturforscher, der jeden Morgen mehrere Stunden mit der Beobachtung von Vögeln verbrachte, bevor er zur Arbeit aufbrach. Dennoch sollte die Wissenschaft seine Ideen aufgreifen. Nach Howards Verständnis ist das Territorium ein geeignetes Forschungsobjekt: Es erklärt sich aus den »Funktionen«, die es für das Überleben der Art erfüllt. Die Ornithologen sprechen im Übrigen von einer »präterritorialen« Phase, um das Feld der theoretischen Ansätze vor Howard zu markieren. Dabei ist Howard nicht der Erste, der das territoriale Verhalten mit den Erfordernissen der Fortpflanzung verknüpft. Zwei andere Autoren waren ihm darin vorausgegangen: zum einen der deutsche Zoologe Bernard Altum, der bereits 1868 eine ausgefeilte Theorie des Territoriums entwickelt hatte, allerdings in einem Buch, das erst sehr viel später übersetzt werden sollte; zum anderen ein weiterer Vogelliebhaber, der Journalist Charles Moffat, dessen 1903 in einer obskuren irischen Zeitschrift (Irish Naturalists’ Journal) veröffentlichte Forschungen keine Beachtung in der Wissenschaft finden sollten. Howard hingegen wurde von den englischen und amerikanischen Ornithologen als erster Autor anerkannt, der eine detaillierte und einheitliche Theorie auf ein bisher nur von ungewissen Hypothesen beherrschtes Feld anwandte.1 Im Folgenden war er für die rasche Verbreitung einer neuen Methode verantwortlich: die Geschichte individueller Vogelleben. Bemerkenswerterweise handelte es sich hier ausdrücklich um das Leben von Vögeln, denn bis dato hatten viele Ornithologen und Liebhaber die Vögel zu Studienzwecken vor allem getötet oder ihnen zum Aufbau von Sammlungen oder mit Klassifizierungsabsichten ihre Eier weggenommen.
Was die Forschung als »präterritoriale Phase« der Territorialtheorie bezeichnet, meint also die Tatsache, dass die Beobachtungen bislang eher bruchstückhaft waren und einer soliden theoretischen Grundlage entbehrten. Das eingangs zitierte Sprichwort des Zenodotos sollte so zum Beispiel später in der Annahme, dass Rotkehlchen gerne allein seien, wiederaufgenommen werden. Bereits vor ihm hatte Aristoteles in seiner Historia animalium die Beobachtung angestellt, dass Tiere – hier die Adler – den Raum zu ihrer Nahrungsversorgung verteidigten, und außerdem bemerkt, dass an manchen Orten mit spärlicher Nahrung nur ein Paar Raben lebte.
Für andere scheint das Territorium vor allem an die Rivalität der Männchen geknüpft zu sein. Der verteidigte Raum würde dem Männchen entweder die Exklusivität des dort angesiedelten Weibchens sichern oder ihm zumindest einen bevorzugten Platz zum Werben bieten, an dem es singen und balzen kann, um eine mögliche Partnerin anzulocken. So lautet eine von Moffats Hypothesen. In diesem Fall entspräche das Territorium also weniger einem Raum als einem Komplex unterschiedlicher Verhaltensweisen.
Man ahnt bereits, dass der Hypothese des einsamkeitsliebenden Rotkehlchens der Sprung in die Wissenschaft nicht gelingen sollte. Die Annahme hingegen, dass der Vogel sich mit seinem Revier den exklusiven Zugriff auf die lebensnotwendigen Ressourcen sichert, erfreute sich bei vielen Ornithologen lange großer Beliebtheit. Die (besonders von Darwin bevorzugte) These eines Territoriums, das an einen Wettstreit um die Weibchen geknüpft ist, prägte wiederum nachhaltig die präterritoriale Szene. So umstritten sie auch ist, wurde sie nie ganz aufgegeben und tauchte noch häufig in naturwissenschaftlichen Schriften auf – möglicherweise hatten manche ein Faible für das dramatische Potenzial der Rivalität, während sich andere (gelegentlich dieselben) offenbar nicht von der Idee freimachen konnten, dass die Weibchen den Männchen als Ressourcen dienten. Dabei hatte Howard die Hypothese des männlichen Rivalitätsverhaltens heftig angefochten, weil sie einigen seiner Beobachtungen widersprach. Sie habe sich seiner Meinung nach nur so lange halten können, wie man die Konflikte allein den Männchen zuschrieb. Dabei, argumentiert er weiter, kämpften bei manchen Arten durchaus auch Weibchen gegen Weibchen oder Paare gegen Paare, ja bisweilen könne ein Paar sogar ein einzelnes Männchen oder Weibchen angreifen. Und wie sei zu verstehen, dass bei Arten, die ihre Brutplätze anderswo aufsuchen, die Männchen oft vor den Weibchen eintreffen und sofort ein feindliches Verhalten an den Tag legen? Trotz allem bleibt das Revierverhalten eine männliche Angelegenheit: Wenn die Weibchen sich genauso verhalten und sich isolieren würden, käme es nie zu einer Begegnung, schreibt Howard.
Die Vorstellung, dass Vögel sich Lebensorte einrichten und deren Exklusivität schützen, ist also nicht neu, wie Aristoteles, Zenodotos und manche ihrer Nachfolger bezeugten. Der Begriff »Territorium« kommt bei ihnen indes nicht vor. In Bezug auf Vögel sollte er sich erst im 17. Jahrhundert durchsetzen. In dem Überblick, den die amerikanische Ornithologin Margaret Morse Nice 1941 diesem Begriff widmet, siedelt sie ihn erstmals in einem 1678 erschienenen englischsprachigen Buch an, The Ornithology of Francis Willughby von John Ray (1627–1705), dessen Autor sich auf die Forschungen seines Freundes Francis Willughby (1635–1672) bezieht. Im Hinblick auf die Nachtigall zitiert Ray einen anderen Autor, Giovanni Pietro Olina, der 1622 in Rom die vogelkundliche Abhandlung Uccelliera, ovvero, Discorso della natura, e proprietà di diversi uccelli veröffentlichte. Darin schildert er, auf welch unterschiedliche Arten man Vögel fangen und pflegen kann, um eine Vogelzucht zu betreiben: »Wie Olina schreibt, ist es die Eigentümlichkeit dieses Vogels, einen Ort zu vereinnahmen oder in Beschlag zu nehmen, den er als sein Eigentum betrachtet und an dem er außer seiner Partnerin keine andere Nachtigall duldet.« Ray zufolge erwähne Olina außerdem die Tatsache, dass »es für die Nachtigall charakteristisch ist, keinen anderen Gefährten an ihrem Lebensort zu ertragen und denjenigen, der diesen Anspruch missachtet, rücksichtslos anzugreifen«.2 Nach Meinung der Ornithologen Tim Birkhead und Sophie Van Balen3 soll Antonio Valli da Todi jedoch schon 1601 ein Buch über den Vogelgesang vorgelegt haben, was in Anbetracht der stark übereinstimmenden Beobachtungen die Vermutung nahelegt, dass Olina von seinem Vorgänger abgeschrieben hatte: Die Nachtigall »sucht sich einen Besitz aus, in dem keine andere Nachtigall außer dem eigenen Weibchen zugelassen wird, und falls andere Nachtigallen eindringen, singt sie in der Mitte des Ortes«. Valli da Todi vergleicht die Größe dieses Reviers mit dem Radius eines weiten Steinwurfs. Nebenbei bemerkt scheint auch Valli da Todi einen Großteil seiner Informationen aus einem 1575 veröffentlichten Werk von Manzini übernommen zu haben, der allerdings nicht die Frage des Reviers erwähnt.
Natürlich könnte man hier einer zeitlichen Überschneidung auf den Grund gehen: Der Begriff »Territorium« mit der unmissverständlichen Konnotation eines »exklusiven, in Beschlag genommenen Eigentums« taucht in der ornithologischen Literatur erstmals im 17. Jahrhundert auf, also genau zu dem Zeitpunkt, da der moderne Mensch nach Philippe Descola und zahlreichen Rechtshistorikern die Nutzung der Erde ausschließlich als Aneignung verstand.4 Descola zufolge habe sich diese Auffassung derartig durchgesetzt, dass heutzutage nur noch schwer von ihr abzusehen sei. Grob gesagt geht sie auf Hugo Grotius und das Naturrecht zurück,5 auch wenn sie eigentlich in der Theologie des 16. Jahrhunderts wurzelt. Die Territorialauffassung definiert das Besitzrecht als individuelles Recht und beruht gleichzeitig auf der Vorstellung eines Vertrags, der die Menschen als Individuen, nicht als soziale Wesen definiert (im römischen Recht war das »Eigentum« nicht das Ergebnis eines individuellen Handelns, sondern einer Teilung, die vom Gesetz, den Gepflogenheiten und Gerichten gebilligt wurde); sie beruht auf neuen Erschließungstechniken der Erde, die deren Eingrenzung und die Garantie ihres Eigentums fordern; und nicht zuletzt auf einer philosophischen Theorie des Subjekts, einem besitzergreifenden Individualismus, der die politische Gesellschaft als Schutzvorrichtung für das Privateigentum versteht. Über die dramatischen Folgen und Auswüchse dieser neuen Besitzauffassung sind wir zur Genüge informiert. Zum Beispiel über die Geschichte der enclosures, die Vertreibung bäuerlicher Gemeinden von bisher ihrem Nutzungsrecht unterstehenden Ländereien; oder über das ihnen auferlegte Verbot, sich lebenswichtige Ressourcen aus den Wäldern zu beschaffen. Diese Besitzauffassung bedeutet das Ende dessen, was man heute als commons bezeichnet – Bewässerungskanäle, gemeinsame Weiden, Wälder etc.6 –, Ressourcen also, die aus selbstorganisierten Prozessen stammten und kollektiv genutzt wurden. Wie Karl Polanyi schreibt, »wurde im Jahr 1600 die Hälfte der Ackerflächen im englischen Königreich kollektiv genutzt, 1750 nur noch ein Viertel und 1840 fast keine einzige mehr«.7 Die über die Jahrhunderte gewachsenen vielfältigen Arten, die Erde zu teilen, sollten bloße Eigentumsrechte bleiben, die zwar manchmal eingeschränkt wurden, immer jedoch als Ausschließlichkeitsrechte für Gebrauch oder Missbrauch galten.
Ich wende mich nun wieder den Vögeln zu, den Nachtigallen und Rotkehlchen, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob uns die epochengeschichtliche Parallele sehr viel weiterbringt. Mit diesem vorschnellen Rückschluss würde ich beispielsweise die Tatsache übergehen, dass der Begriff des Territoriums in Bezug auf Tiere nicht im luftleeren Raum auftauchte, sondern im Kontext der Beschreibungen, wie Vögel in Volieren zu halten seien –ebenfalls Techniken der Inbesitznahme, des Einsperrens, aber auch solche, die auf eine Deterritorialisierung der Vögel zielen, um sie »bei uns«, in »unseren« Territorien heimisch werden zu lassen. Sollte ich, wenn ich diese Parallele für die Geschichte des Territoriums heranziehen wollte, nicht auch erwähnen, dass die Vogelzucht ursprünglich aus der Absicht entstand, die Ernte vor den Vögeln zu schützen? Dass sie dementsprechend mit der Kunst der Jagd und der Falknerei verknüpft ist, die Gewitztheit und eine genaue Kenntnis von den Gewohnheiten der Vögel voraussetzten? Im 14. Jahrhundert etwa wurden Fasane mithilfe eines Spiegels gejagt, weil man die Beobachtung gemacht hatte, dass »ein Männchen die Anwesenheit eines anderen nicht erträgt« und sofort Streit mit ihm sucht. Man band einen Spiegel an einen Faden, und der Fasan, der in seinem Spiegelbild einen Artgenossen zu erblicken meinte, attackierte den Spiegel; dieser kippte um, wobei ein Käfig auf den Vogel herabfiel. Außerdem sollte ich mich für die Tatsache interessieren, dass sich die Vogelzucht just im 17. Jahrhundert von der Falknerei trennte und zahlreiche Vögel zwar gefangen, aber nicht mehr ausschließlich getötet, sondern für ihre Anwesenheit und ihren Gesang geschätzt wurden.8 Die beispiellose Begeisterung für Volieren konzentrierte sich besonders auf Singvögel, die zum Großteil Territorialvögel waren. Dementsprechend entstanden zahlreiche Abhandlungen zu deren Sitten und Gewohnheiten, zu Fang- und Haltungsmethoden. Wahrscheinlich bräuchte ich noch viele andere Geschichten, um diese zeitliche Überschneidung zu untermauern, weitere Querbezüge zwischen den verschiedenen Ereignissen, ergänzende Ausführungen zu einer Welt, die ich nur unzureichend kenne, aber deren Erbe ich – in diesem Buch ganz besonders – verwalte. Wenn ich diese Überschneidung also als offene Frage stehen lassen muss, so animiert sie mich doch wenigstens zu einer erhöhten Aufmerksamkeit: Das »Territorium« ist ein keineswegs unschuldiger Begriff, dessen ganzes Gewalt- und Zerstörungspotenzial in manche seiner aktuellen Bedeutungen eingeflossen ist. Ein Begriff, der möglicherweise zu Denkgewohnheiten geführt hat, die ebenso uninspiriert sind wie die verschiedenen Nutzungsarten, die ab dem 17. Jahrhundert mit dem Bewohnen und Teilen der Erde verknüpft waren.
Insofern ist Misstrauen angebracht. Und Neugier. Natürlich sind mir schon extrem zweideutige Formulierungen begegnet: ein Männchen zum Beispiel, das »Anspruch erhebt« auf einen Raum oder sich dessen »Besitz« sichert; Kolibris, die ein »privates Jagdrevier« verteidigen. Auch die Tatsache, dass die Aggressivität im Territorialverhalten so ausgeprägt und scheinbar festgelegt ist, hat manche Beobachter aufmerken lassen, zumal wenn sie es mit dem Raster der Rivalität betrachteten und auf ihrer aversiven Wirkung insistierten. Die Wörter, die manche Ornithologen für Verhaltensbeschreibungen benutzen, haben oft kriegerische oder militärische Konnotationen: Konflikte, Kämpfe, Herausforderungen, Proteste, Angriffe, Verfolgungen, Patrouillen, Revierverteidigung, Hauptquartier (sehr beliebt, um die Mitte des Territoriums zu bezeichnen, wo der Vogel singt) oder Kriegsbemalung (als Bezeichnung für die Farben der Reviervögel). Andere Ornithologen wiederum sollten sich schon früh gegen eine solche Wortwahl wenden – nicht, weil sie die Vögel anthropomorphisiert, sondern weil sie das Rivalitäts- und Aggressionsgebaren bei der Territorialisierung gegenüber anderen Aspekten überbewertet.
Davon abgesehen, das sollte ich im Laufe meiner Forschungen feststellen, vertreten nur wenige Ornithologen die Vorstellung eines »Besitzes«. Die meisten folgen der Definition des amerikanischen Zoologen Gladwyn Kingsley Noble aus dem Jahr 1939 – »das Territorium ist ein beliebiger verteidigter Ort« –, weil sie sachlich ist und gut dazu geeignet, praktisch alle territorialen Situationen zu beschreiben. Je nach Theorie lassen sich dieser Definition bestimmte Funktionen zuordnen: Der Vogel kann einen Ort verteidigen, um sich seine Lebensgrundlage zu sichern, um bei der Fortpflanzung nicht gestört zu werden, um sein »Werbeverhalten« – das Zurschaustellen, Balzen und Singen – auszuleben, um sich die Ausschließlichkeit eines Weibchens oder die Beständigkeit eines jährlichen Treffpunkts zu sichern oder um eine Reihe weiterer, im zweiten Kapitel behandelter Funktionen zu erfüllen. Rasch begriffen die Ornithologen, dass es nicht nur eine Art der territorialen Nutzung gab. Die Definition eines »aktiv verteidigten Ortes« wurde im Laufe der späteren Entdeckungen und der zunehmenden Vielfalt der Territorialisierungsarten noch weiter ausdifferenziert. Die Grenzen sollten sich als sehr viel dehnbarer, verhandelbarer und durchlässiger erweisen, als nach den ersten Beobachtungen anzunehmen war, und manche Forscher gelangten zu der überraschenden Schlussfolgerung, dass sie bei vielen Vögeln nicht nur die Funktion hatten, gegen Eindringlinge zu schützen und die exklusive Nutzung eines Ortes zu sichern – doch dazu später mehr.
Das Territorium sollte also andere Bedeutungen annehmen, die weit über die Vorstellung von Eigentum hinausgehen. Manche Ornithologen weisen eigens darauf hin, dass das, was Vögel unter einem Territorium verstehen, nicht die gleiche Bedeutung hat wie das, was Menschen üblicherweise mit diesem Begriff verbinden. Howard zum Beispiel betont, das Territorium sei vor allem ein Prozess oder genauer gesagt Teil eines Prozesses innerhalb des Reproduktionszyklus: »So betrachtet vermeiden wir das Risiko, die ›Sicherung eines Territoriums‹ als unabhängiges Ereignis im Leben eines Vogels zu begreifen, und damit hoffentlich auch das Risiko, einer mehr auf menschliche als auf tierische Prozesse zutreffenden Auffassung stattzugeben.«9 Ein paar Seiten weiter setzt er hinzu, dass das, was er als Bereitschaft zum Bewahren eines Territoriums beschreibe, der Bereitschaft entspreche, zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort zu bleiben. Selbst Konrad Lorenz, der Vater der Verhaltensforschung, dessen Buch Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression bei Weitem nicht über suspekte Analogien erhaben ist, besteht auf einer Unterscheidung zwischen Territorium und Eigentum: »[Man darf] sich das Revier nicht als einen Grundbesitz vorstellen, der durch feste geographische Grenzen bestimmt und gewissermaßen im Grundbuch eingetragen ist.«10 Das Territorium sei unter bestimmten Umständen und für manche Tiere weniger an den Raum als an die Zeit geknüpft. So etablierten Katzen zum Beispiel eine sogenannte »Nutzungsdauer«: Das Areal wird also nicht räumlich, sondern zeitlich aufgeteilt. Katzen hinterlassen in regelmäßigen Abständen Duftmarken. Eine Katze kann an einer solchen Duftmarke erkennen, ob sie frisch oder bereits ein paar Stunden alt ist. Je nachdem ändert sie ihre Route oder geht gelassen ihres Weges. Diese Marken wirkten Lorenz zufolge wie »das Blocksignal auf der Eisenbahn, das ja in analoger Weise darauf abzielt, ein Zusammenstoßen zweier Züge zu verhindern«.
Doch Lorenz’ Vorsicht in Bezug auf mögliche Missverständnisse (eine nur relative Vorsicht, findet man doch auf derselben Seite die Bezeichnung des Territoriums als »Hauptquartier«) ist lange nicht so verbreitet, wie man angesichts der obigen Ausführungen vermuten könnte. Ich habe bisher die Ornithologen ins Feld geführt, aber sie interessieren sich nicht als Einzige für die Territorien der Tiere. An dieser Stelle wird es kritisch.11
So finde ich zum Beispiel in dem historischen Abriss der Ornithologin Margaret Nice ein Zitat von Walter Heape, der in seinem Buch Emigration, Migration and Nomadism (1931) Folgendes schreibt:
Die Bodenrechte sind Rechte (rights), die sich bei einer Mehrheit der Tierarten etabliert haben. Es besteht kein Zweifel daran, dass das Verlangen nach der Inbesitznahme eines bestimmten Territorialgebiets, die Entschlossenheit, dieses wenn nötig kämpfend zu behaupten, sowie die Anerkennung von Individual- und Stammesrechten bei allen Tieren dominieren. Tatsächlich kann man argumentieren, dass die Anerkennung der Bodenrechte, eines der aussagekräftigsten Attribute der Zivilisation, nicht nur eine Sache des Menschen ist, sondern ein Faktor im Leben aller Tiere.12
Muss ich eigens betonen, dass Heape Embryologe war und nicht Ornithologe? Muss ich berücksichtigen, worauf ich bei meinen Nachforschungen gestoßen bin: dass er berühmt wurde, weil es ihm 1890 gelungen war, einem weiblichen Hauskaninchen, dem sogenannten Belgischen Kaninchen, zwei befruchtete Eizellen eines Angorakaninchens zu transplantieren? Spielt das eine Rolle? Hat der geglückte Transfer zwischen unterschiedlichen Lebewesen Heape in einer Art Selbstermächtigung dazu animiert, sich an andere Transferversuche zu wagen, ohne zu ermessen, dass er es hier mit einem völlig anders gelagerten Risiko zu tun hatte, das dementsprechend andere Vorsichtsmaßnahmen erforderte? Mit dieser Hypothese übertreibe ich natürlich und versuche mich selbst an unvorsichtigen und eher geschmacklosen Übertragungen. Derlei Analogien und Vergleiche sind nämlich nicht nur eine Frage des Stils, eines politischen oder epistemologischen Stils, sondern auch eine Frage des Geschmacks. Isabelle Stengers schlägt vor, dem Kant’schen sapere aude(»Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!«) den ursprünglichen, poetischen Sinn aus einer Epistel des römischen Dichters Horaz zurückzugeben: »Habe Mut, zu schmecken.« Sich seines Verstandes zu bedienen, bedeute ihr zufolge, zu differenzieren; zu erkennen, was wichtig ist, zu lernen, was Unterschiede ausmachen, mit den Risiken und Auswirkungen der Begegnung umzugehen, sich auf die Vielschichtigkeit dessen einzulassen, was für diese Wesen, die es zu erforschen gilt, von Bedeutung ist und dem sie umgekehrt zu Bedeutung verhelfen. Eine Kunst der Auswirkungen.13
Aus diesem Grund fühlte ich mich bei der Lektüre von Michel Serres’ Buch Le Mal propre14 komplett vor den Kopf geschlagen. Und zwar umso mehr, als seine bisherigen Bemühungen, Fragen und Konzepte zu »deterritorialisieren«, sie aus den ihnen zugewiesenen disziplinären Feldern und Zeitstrukturen zu befreien, den ebenso gewagten wie kreativen Versuch dargestellt hatten, neue Querbezüge, Übertragungen und inspirierende Zusammenhänge zu schaffen. Wenn er zum Beispiel in Der Naturvertrag die Frage stellt »Welche Sprache sprechen die Dinge der Welt, damit wir uns mit ihnen – auf Vertragsbasis – verständigen können?«,15 entsteht in unseren Köpfen sofort ein ganzes Netz aus generativen Analogien, die differenziertere Vergleichsmöglichkeiten erlauben, durch neue Zusammenhänge bisher unentdeckte Eigenschaften zutage fördern und einen fruchtbaren Austausch zwischen Dingen und Lebewesen reaktivieren: Nach Michel Serres spricht die Erde in Kräften, Beziehungen und Interaktionen zu uns. In einem späteren Buch, Darwin, Bonaparte et le Samaritain, une philosophie de l’histoire, sollte er diese Idee wiederaufnehmen und explizit mit der Schrift verknüpfen. Das Lesen, schreibt er, beschränke sich nicht, wie wir gemeinhin glauben, auf kodifizierte Schriftzeichen – alle guten Jäger, die aus den Spuren eines Wildschweins Alter, Geschlecht, Gewicht, Größe und unzählige andere Details lesen können, wissen das: »Der gute Jäger liest, nachdem er zu lesen gelernt hat. Was entziffert er? Einen codierten Abdruck. Diese Definition kann aber auch die historische menschliche Schrift beschreiben.«16 Die Schrift, fährt Serres fort, sei vielmehr das Merkmal aller lebendiger und nicht lebendiger Lebewesen, die sämtlich »über die Dinge und untereinander schreiben, über die Dinge der Welt untereinander.« Der Ozean schreibt auf die Felsenklippe, die Bakterien schreiben auf unsere Körper, alles – Fossilien, Erosionen, Schichtstufen, Licht der Galaxien, Kristallisierung des Vulkangesteins – will gelesen werden. Man las, bevor man schrieb, und diese Möglichkeit öffnet die Schrift für viele andere Register als »Gesamtheit von Spuren, die einen Sinn codieren«. »Wenn die Geschichte mit dem Schreiben beginnt, dann treten alle Wissenschaften mit der Welt in eine neue Geschichte ohne Vergessenheit ein.« Natürlich knüpft Serres gewagte Querbezüge; Übertragungen, die verbinden, was scheinbar unverbunden bleiben sollte, und sei es nur, weil die menschliche Sonderstellung streng über die Trennung dieser Register wacht. Genau darin aber besteht Michel Serres’ Antrieb: Er will mit der tristen Gewohnheit brechen, den Menschen in den Mittelpunkt der Welt und der Erzählungen zu stellen; die Geschichte für die unterschiedlichsten Lebewesen öffnen, die eine Bedeutung haben und ohne die wir nicht existieren würden.
Das eigentliche Übel antwortet auf einen völlig anderen Beweggrund, was sofort aus dem Untertitel ersichtlich wird: Verschmutzen, um sich anzueignen?. Bereits auf den ersten Seiten geht es um das Territorium: »Der Tiger pisst an die Grenzen seines Reviers. Ebenso der Löwe und der Hund. Wie diese fleischfressenden Säuger markieren