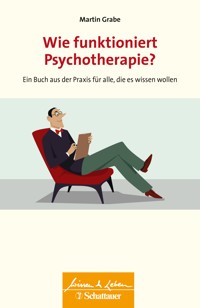
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schattauer
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Wissen & Leben
- Sprache: Deutsch
Viel bunte Erfahrung statt graue Theorie. Selten wurde ein Buch so konsequent aus der Praxiserfahrung heraus geschrieben: Dr. Martin Grabe, Leiter eines psychotherapeutischen Weiterbildungsinstitutes und Chefarzt einer psychosomatischen Abteilung, schildert fern jeglicher grauer Theorie, wie erfahrene Therapeutinnen und Therapeuten arbeiten und Psychotherapie gelingt. - Auf welchem Weg werden Änderungen angestoßen? - Wie gelangt man zu Modellen über die jeweilige Störung der Patientin/des Patienten? - Was geht in der Therapeutin/im Therapeuten vor, während sie/er mit der Patientin/dem Patienten spricht? Ein Buch für Psychologinnen und Psychologen und Ärztinnen und Ärzte in psychotherapeutischer Weiterbildung, wie es wirklich benötigt wird. Ein Buch für Patientinnen und Patienten und deren Angehörige, die einmal wissen möchten, was sich in einer Psychotherapie abspielt, zwischenmenschlich und in deren Innenleben. Ein Buch für alle, die mehr wissen wollen über die Wirkung von Psychotherapie. Therapieschulen-übergreifend, durch zahlreiche Exkurse höchst erhellend – und immer frei heraus. Dieses Buch richtet sich an: - Psychologinnen und Psychologen - Ärztinnen und Ärzte in psychotherapeutischer Weiterbildung - Patientinnen und Patienten und deren Angehörige; alle, die mehr wissen wollen über die Wirkung von Psychotherapie Aus dem Inhalt Wie innere Konflikte das Leben einengen und wo Therapie ansetzen kann | Wie findet man den zentralen Beziehungskonflikt? | Die Therapeutische Beziehung | Verstrickungen lösen und Entscheidungen treffen | Psychotherapie und Spiritualität | Therapieschulen im Überblick | Spezielle Störungsbilder
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Martin Grabe
Wie funktioniert Psychotherapie?
Ein Buch aus der Praxis für alle, die es wissen wollen
Schattauer
Dr. med. Martin Grabe
Klinik Hohe Mark
Dt. Gemeinschafts-Diakonieverband GmbH
Friedländerstraße 2
61440 Oberursel (Taunus)
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung in elektronischen Systemen.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Besonderer Hinweis:
In diesem Buch sind eingetragene Warenzeichen (geschützte Warennamen) nicht besonders kenntlich gemacht. Es kann also aus dem Fehlen eines entsprechenden Hinweises nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Schattauer
www.schattauer.de
© 2018 by J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagabbildung: © Aleutie, www.shutterstock.com
Gesetzt von am-productions GmbH, Wiesloch / Eberl & Koesel Studio, Kempten
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Printausgabe: ISBN 978-3-608-43296-1
E-Book: ISBN 978-3-608-19134-9
PDF-E-Book: ISBN 978-3-608-29133-9
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Geleitwort
Angesichts der Vielzahl von Büchern zur Psychotherapie kann man sich fragen: Braucht es ein weiteres Buch zu diesem Thema? Wenn man in dieses Buch hineinschaut, meine ich: Ja!
Das Buch ist äußerst praktisch angelegt. Es arbeitet sich sozusagen vom äußerlichen Erstkontakt mit den Patienten in deren Innenwelt vor. Genau entsprechend dem Prozess in der therapeutischen Begegnung: Über die Symptompräsentation über die Einordnung des Verhaltens in das Spektrum der Abwehrmechanismen hin zur »Szene« bzw. dem zentralen Beziehungs-Konfliktthema. Daraus ergibt sich der therapeutische Fokus. Dabei finden neben der klassischen Anamnese und Patientenbeobachtung auch kreative Techniken wie das Familienbrett, Zeichnungen und Plastiken der Patienten Berücksichtigung. Das geht natürlich im Kliniksetting am leichtesten, ist aber grundsätzlich auch im ambulanten Bereich möglich. Damit erweist sich das Buch als sehr facettenreich und integrativ; hier mit psychodynamischen Schwerpunkt.
Die theoretischen Bezugssysteme wie die OPD kommen erst im zweiten Schritt als Rahmen zum Zuge, in den das individuell gewonnene Bild der Patienten eingeordnet wird. Und das immer an konkreten Beispielen. Die Verortung spezieller theoretischer Aspekte in Kästchen als Exkurse erhöht die Lesbarkeit des Buches und überlässt es den Lesern, wie tief sie in die Materie einsteigen wollen.
Als Vertreter der Schematherapie freut es mich besonders, dass der Autor das Schematherapiemodell in seine Fallkonzeptionserstellung und in sein therapeutisches Vorgehen harmonisch einbindet. Damit ist dies das erste Buch, das die Anwendung der Schematherapie in die psychodynamische Perspektive einbettet. Dies ist meines Erachtens hervorragend gelungen und dafür bin ich dem Autor persönlich sehr dankbar.
Ein besonderes Merkmal dieses Buches ist es, dass es auch die spirituelle Dimension einbezieht. Hier bringt der Autor seine besonderen Kompetenzen und Erfahrungen ein. Dabei gelingt ihm eine sehr differenzierte und auch konstruktiv-kritische Darstellung. Auch das Konzept der »psychosomatischen Rhythmusstörungen« von Hanne Seemann, deren Buch immerhin in der 16. Auflage erschienen ist, wird hier einer breiteren Leserschaft zugänglich gemacht. Es bietet eine anschauliche Ordnungsstruktur der vielschichtigen somatoformen Syndrome, ähnlich den »Grundformen der Angst« von Fritz Riemann. Derartige Systematiken sind nicht Teil des Mainstream, aber sie haben als Heuristiken einen großen praktischen Nutzen und geben dem Buch einen besonderen Akzent.
Im zweiten Teil des Buches wird eine Übersicht über die verschiedenen Therapieschulen und Störungsbilder gegeben. Diese Kapitel sind sehr kompakt und gut gegriffen und vermitteln einen hervorragenden Überblick. Sie zeugen von breiten und profunden Kenntnissen des Autors. Sie sind auch für Anfänger gut lesbar und vermitteln die Essenz auf sehr verständliche und praxisnahe Weise.
Es ist nicht leicht, so gekonnt sowohl die Therapieschulen als auch die Störungsbilder auf den Punkt zu bringen. Da ist dem Autor etwas Besonders gelungen. Durch das Sachverzeichnis wird das Buch zu einem »Mini-Lehrbuch«. Daher kann ich besonders Anfängern im Feld der Psychotherapie das Buch nur wärmstens empfehlen und wünsche viel Freude und Gewinn beim Lesen.
Frankfurt, im Juni 2017
Eckhard Roediger
Dank
Einige Menschen hatten besonderen Anteil am Gelingen dieses Buches:
Elfi Orth, meine langjährige Kollegin, mit der gemeinsam ich viele der hier vorgestellten Gedanken entwickelt habe, das Team der Psychotherapiestation Herzberg 2, meine liebe Christiane, die mir immer wieder Unterstützerin und konstruktives Gegenüber war – und das nette Team vom Schattauer Verlag.
Herzlichen Dank euch allen!
Inhalt
1 Einleitung
2 Wie innere Konflikte das Leben einengen und wo Therapie ansetzen kann
Exkurs 1: Die kreative Vielfalt der Abwehrmechanismen
3 Wie findet man den zentralen Beziehungskonflikt?
3.1 Dreieck der Einsicht
Aktuelle Situation
Biografie
Szenisches Erleben
Die Schnittmenge
3.2 Wie läuft eine Fokusrunde ab?
Exkurs 2: Was ist Psychodynamik?
Exkurs 3: Welche inneren Konflikte gibt es eigentlich?
3.3 Beispiel Herr B.
Exkurs 4: Was ist ein neurotischer Kompromiss?
4 Die Therapeutische Beziehung
4.1 Ein guter Start
4.2 Empathie
4.3 Therapeutische Distanz
4.4 Die Seite des Patienten in der therapeutischen Beziehung
5 Verstrickungen lösen und Entscheidungen treffen
5.1 Klassische tiefenpsychologische Arbeit
Exkurs 5: Was ist Internalisierung?
Exkurs 6: Sind die Eltern immer schuld?
5.2 Der schematherapeutische Zugang
5.3 Die Arbeit an realen Verlusten und Verletzungen
5.4 Was hat Vorrang in der Bearbeitung?
5.5 Wann ist eine Therapie zu Ende?
6 Psychotherapie und Spiritualität
7 Therapieschulen im Überblick
7.1 Allgemeines
7.2 Psychoanalyse
7.3 Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie
7.4 Verhaltenstherapie
7.5 Schematherapie
7.6 Annäherung der Therapieschulen
8 Spezielle Störungsbilder
8.1 Allgemeines
8.2 Depressionen
8.3 Angsterkrankungen
8.4 Zwänge
8.5 Essstörungen
Exkurs 7: Was ist eigentlich Psychosomatik? Die wichtigsten Modelle
8.6 Somatoforme Störungen
8.7 Posttraumatische Belastungsstörung
8.8 Dissoziative Bewegungs- und Sinnesstörungen (Konversionsstörungen)
8.9 Borderline-Störung und Strukturniveau
Exkurs 8: Das Strukturniveau nach OPD-3
9 Kurzes Schlusswort
10 Literatur zum Weiterlesen
Literatur
Sachverzeichnis
1 Einleitung
Herr S., ein großgewachsener, etwas jungenhaft wirkender Manager, lässt sich schwer in den Sessel in meinem Büro fallen. Heute ist das erste reguläre Therapiegespräch. Herr S. lächelt verlegen, atmet noch einmal durch, öffnet resignierend die Hände und sagt beherzt: »Na, dann machen Sie mal …«
Ich muss innerlich ein wenig schmunzeln über so viel tapfere Schicksalsergebenheit. Wer weiß, was Herr S. jetzt erwartet. Vielleicht, dass ich ihn einer Hypnose unterziehe oder nach höchst peinlichen Dingen befrage. Stattdessen erkläre ich ihm freundlich, dass ich gar nicht vorhabe, etwas »zu machen«. Sondern dass Therapie immer gemeinsame Arbeit bedeutet.
Wie sieht diese gemeinsame Arbeit in der Therapie aber nun aus? Genau darüber möchte dieses Buch Auskunft geben.
Beim Schreiben habe ich an folgende Personengruppen gedacht, und diesen – Ihnen – widme ich jetzt dieses Buch:
allen, die mehr darüber wissen möchten, wie Psychotherapie funktioniert;
Menschen, die sich gerade in Therapie befinden, und ihren Angehörigen;
psychotherapeutisch Tätigen verschiedener Berufsgruppen und
meinen Kolleginnen und Kollegen in Weiterbildung. Dieses kleine Buch kann und will nicht die renommierten Lehrbücher ersetzen, es erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, hat kein langes Literaturverzeichnis und enthält keine Manuale. Aber es ist genau das Buch, das ich mir zu Beginn meiner Weiterbildung dringend gewünscht hätte! Wo mir ein erfahrener Praktiker ohne lange Absicherungsschleifen erklärt, wie er denkt und arbeitet. Sozusagen als Basis, als Grundwortschatz, möglicherweise auch als Wegweiser. So ist dieses Buch auch gemeint.
Natürlich muss jede Leserin und jeder Leser für sich selbst filtern, was er oder sie anwendbar findet und wo er oder sie vielleicht auch anderer Meinung ist.1
Sich mit Psychotherapie zu beschäftigen, ist ein lebendiger Prozess, der viel mit der eigenen Person zu tun hat, der auf meine Person zurückwirkt, den ich aber auch mit vollem Recht selbst prägen darf.
Vielleicht hat jemanden von Ihnen die etwas technisch anmutende Formulierung des Buchtitels irritiert. Wie kann man denn in einem psychologischen Zusammenhang von »Funktionieren« sprechen? Dann bin ich froh, dass Sie bis hier weitergelesen haben. Der Schwerpunkt dieses Textes soll nämlich tatsächlich darauf liegen, was an Psychotherapie verstehbar und vermittelbar ist. Sehr vieles ist auch nur schwer – oder nicht – verstehbar. Therapie ist eine sehr komplexe Interaktion zwischen Menschen. Aber es gibt Grundlinien, die generell gelten. Wo Therapie gelingt, bedient sie sich in immer neuen Variationen dieser Muster. Mein Ziel ist, diese Grundlinien möglichst deutlich und verstehbar herauszuarbeiten.
Auf den ersten Blick sehen Therapieansätze oft recht verschieden aus. Es gibt Therapieschulen wie die Psychoanalyse, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie oder die Verhaltenstherapie (▶Kap.7). In der Klinik Hohe Mark in Oberursel, in der ich tätig bin, ist unsere Ausgangsprägung tiefenpsychologisch, und so wird auch dieses Buch einen gewissen Akzent in dieser Richtung nicht verleugnen können. Wir arbeiten jedoch in der Praxis als psychoanalytisch, tiefenpsychologisch, verhaltenstherapeutisch und schematherapeutisch ausgebildetes Kollegium zusammen und nutzen die Methoden und Modelle unterschiedlicher Schulen. So bemühe ich mich auch in diesem Buch durchgehend, schulenübergreifend zu denken. Das erhöht in der Arbeit mit Patienten2 deutlich die Wahrscheinlichkeit, einfache Modelle mit großer Erklärungskraft zu finden, wie wir in Kapitel 3 noch sehen werden. Und solche Modelle sind Voraussetzung für eine wirkungsvolle Psychotherapie.
Was auch schon an dieser Stelle gesagt werden soll: Es gibt psychische Krankheitsbilder, bei denen Psychotherapie nur eine untergeordnete Rolle spielt. Von diesen wird in diesem Buch nicht die Rede sein. Insbesondere sind das organisch bedingte Störungen wie z.B. eine Depression, die durch eine Schilddrüsenunterfunktion ausgelöst wurde – wo die Therapie natürlich in einer Regulierung der Schilddrüsenhormone bestehen muss. Es sind aber auch Störungen, die vorwiegend neurophysiologisch ausgelöst wurden, wie eine schizophrene Psychose, eine schwere phasisch auftretende Depression oder die manisch-depressive Erkrankung. Hier sind oft kaum äußere Auslöser fassbar, stattdessen sprechen die Betroffenen aber meist gut auf eine medikamentöse Behandlung an. Es geht in diesen Fällen zunächst einmal darum, den Stoffwechsel der Botenstoffe im Gehirn (Neurotransmitter) wieder zu regulieren. Auch hier ist eine unterstützende Psychotherapie sinnvoll. Diese dient aber in der Regel mehr der Verarbeitung des Krankheitsgeschehens an sich, als dass dadurch eine Heilung zu bewirken wäre. Gerade in diesem Bereich gibt es inzwischen für jedes Störungsbild gute Literatur für Betroffene und Angehörige.
Auch im Bereich der Suchterkrankungen, insbesondere der stoffgebundenen Süchte, gelten z.T. andere Regeln. Oft stehen hier zunächst medizinisch-körperliche Probleme im Vordergrund (Entzug), später dann die Etablierung notwendiger Strukturen, was als Thema den hier vorgegebenen Rahmen sprengen würde.
In diesem Buch soll es dagegen um jene psychischen Erkrankungen gehen, wo das Wesentliche im Heilungsprozess über Verstehen zu erreichen ist. Also um das, was in einer ambulanten Psychotherapie passiert und ebenso auf einer psychotherapeutisch-psychosomatischen Station. Me- dikamente, wenn sie denn verordnet werden, haben hier nur eine unterstützende Funktion.
2 Wie innere Konflikte das Leben einengen und wo Therapie ansetzen kann
In der Klinik wundern wir uns manchmal, wie lange es Menschen in eigentlich unerträglichen Situationen ausgehalten haben, bevor sie endlich Hilfe in Anspruch nehmen. Auch heutzutage liegt immer noch ein Tabu auf der Psychotherapie. Glücklicherweise bröckelt es etwas. Immer mehr Menschen, Frauen sind da oft mutiger als Männer, trauen sich, offen darüber zu sprechen, dass sie einen Therapeuten haben. Aber die Regel ist immer noch, dass man sich lange mit einem Problem herumquält. Viele Menschen nehmen Psychotherapie erst dann in Anspruch, wenn gar nichts mehr geht, sie z.B. lange Zeit einfach nicht mehr zur Arbeit gehen konnten.
Jeder Mensch, der sich in Therapie begibt, bringt seine ganz eigene Geschichte mit – eine unendliche Vielfalt. Für die Ausgangssituation sind aber zwei Möglichkeiten typisch:
Es geht den Betroffenen um belastende Symptome, die sie möglichst schnell wieder los sein möchten. Das könnten Ängste sein, körperliche Symptome wie Schmerzen, Depressivität oder Zwänge.
Eine Person ist stark betroffen von dem, was ihr im Vorfeld widerfahren ist. Und sie kann sagen, wer daran Schuld hat: der Vorgesetzte am Arbeitsplatz, Kollegen, Eltern, erwachsene Kinder, sehr oft auch der Partner – die sie »völlig fertiggemacht« haben.
Wenn man diese Sichtweise zugrunde legt, könnte damit das Projekt Therapie schon am Ende sein. Denn eines ist meistens klar: Wir können nicht direkt helfen. In Bezug auf viele Symptome wie Ängste und Zwänge wissen die Betroffenen oft schon selbst sehr gut, dass diese völlig unangemessen sind – trotzdem haben sie sie. Körperliche Beschwerden wurden schon mit allen technischen Mitteln der modernen Medizin untersucht – geholfen hat es aber bisher nicht. Und in Bezug auf die äußeren belastenden Umstände können wir auch nicht den Heimatort der Person aufsuchen, um dort für sie alles zum Besten zu regeln.
All das, was den Kummer verursacht im Erleben unserer Patienten, können wir nicht ändern. Es kann sich nur eines ändern: der Mensch selbst.
Wie dieser Prozess nun aber vor sich gehen soll, ist für die Betroffenen nicht leicht abzusehen. Denn schließlich haben sie sich ja auch vor der Therapie schon Mühe gegeben, oft große Anstrengungen unternommen, um das Beste aus sich und ihrer Situation zu machen.
In manchen Fällen mag das Scheitern daran gelegen haben, dass Menschen bestimmte Fähigkeiten nicht erworben haben oder aus verschiedensten Gründen wieder verlernt haben. In diesen Fällen sind entsprechende, auf den Einzelnen zugeschnittene Übungsprogramme hilfreich, die wir auch immer wieder therapieunterstützend anwenden.
Meistens wird aber schnell deutlich, dass es nicht darum ging, dass eine bestimmte Fertigkeit gefehlt hat, sondern dass es um ganz tiefgreifende emotionale Verflechtungen unserer Patienten mit ihrer Umwelt ging, die sie aus eigener Kraft nicht mehr entwirren konnten und nur noch als Sackgasse wahrnahmen. Unter diesem überhandnehmenden Druck haben sich dann Symptome entwickelt wie eine Depression, Zwänge, Ängste, psychisch bedingte Körperbeschwerden (somatoforme Störungen) oder Essstörungen.
Es muss in der Therapie darum gehen, dieses undurchschaubare Geflecht aus Gefühlen, Wünschen und Befürchtungen zu entwirren, um es dem Betroffenen zu ermöglichen, wieder eigene Entscheidungsfreiheit zurückzugewinnen. Und das geht nur über einen Umweg: Wir müssen der Person dabei helfen, sich besser und tiefer zu verstehen, als sie es je getan hat.
Fallbeispiel
Frau F. kommt wegen eines »Burnout« in die Klinik. Diese Diagnose hat sie schon selbst gestellt, und ihr Hausarzt hat sie ihr auf die Einweisung geschrieben, auch wenn es eigentlich keine medizinische Diagnose ist.
Die etwa 40-jährige Frau F. ist Lehrerin an einer Grundschule und jetzt schon vier Monate krankgeschrieben. Sie berichtet ihrer Therapeutin im Aufnahmegespräch, dass sie sich zu Hause zu nichts mehr habe aufraffen können, viel geweint habe und sehr depressiv gewesen sei. Ihre Arbeit möge sie eigentlich. Es sei aber in den Jahren immer mehr dazugekommen. Ständig müsse sie Vertretungen machen, sich in neue Klassen einarbeiten, manchmal sitze sie abends bis Mitternacht an den Unterrichtsvorbereitungen. Was aber am schlimmsten sei: Die neue Konrektorin, die vor zwei Jahren an die Schule kam, habe eindeutig etwas gegen sie. Diese sei für die Stundenpläne und Vertretungspläne zuständig. So habe diese sie einmal vor allen kritisiert, als sie zu spät zu einer Konferenz gekommen sei. Sie gebe ihr immer die »allerletzten« Vertretungsstunden und sei überhaupt kühl und arrogant. Mit der jetzt pensionierten Vorgängerin habe sie sich immer sehr gut verstanden. Die Vorgängerin habe sie manchmal gelobt, als es ihr einmal ganz schlecht ging, habe diese sie sogar in den Arm genommen.
Mit Männern habe sie bisher immer Pech gehabt. Es gab wenige kürzere Beziehungen. Irgendwie habe es nicht gepasst. Das hätten aber jeweils beide gemerkt.
Zur Vorgeschichte war zu erfahren, dass Frau F. als die Ältere von zwei Schwestern aufwuchs und eine sehr strenge, fordernde Mutter hatte. Die Ehe der Eltern war schon in der frühen Kindheit auseinandergegangen, zum Vater bestand kaum Kontakt. Die jüngere Schwester war Nesthäkchen und wurde vorgezogen, für Frau F. gab es nur ein wenig Zuwendung, und zwar dann, wenn sie besondere Leistungen zeigte, vor allem gute Schulnoten.
Dass Frau F. Hilfe braucht und in der Klinik richtig ist, ist an diesem Punkt schon einmal unstrittig: Sie ist deutlich depressiv und seit Monaten nicht mehr arbeitsfähig.
Theoretisch könnte die Therapeutin jetzt versuchen, die Probleme von Frau F. im Hier und Jetzt zu lösen, so wie diese sie beschrieben hat. In Bezug auf die langen Arbeitszeiten könnte sie ihr einen Coach vermitteln, der sie darin trainiert, effektiver zu sein und angemessene Prioritäten zu setzen. Um mit der neuen Konrektorin besser fertigzuwerden, könnte ein Durchsetzungstraining hilfreich sein. Mit den Männern wäre es etwas schwieriger, aber auch hier wären viele der Meinung, dass man doch bei sorgfältiger Eingrenzung in heutigen Partnerportalen etwas finden müsste.
Die Therapeutin lässt aber all diese guten Möglichkeiten links liegen, weil sie davon ausgeht, dass Lösungen auf einer anderen Ebene zu finden sind. Auch wenn sie noch nicht weiß, welche Lösungen es sein werden.
Nur im Miteinander mit Frau F. wird sie herausbekommen, was in deren Geschichte relevant war, was Druck gemacht hat, was geängstigt hat, aber auch, was Sicherheit gegeben hat. Die Patienten sind immer die Experten für ihre eigene Geschichte! Und nur die Gefühle, die bei bestimmten Themen bei dem Patienten und Therapeuten entstehen, können zu weiteren Erkenntnissen leiten – nicht das theoretische Vorwissen des Therapeuten.
Schon bald zeigt sich, dass nicht nur die Mutter von Frau F. hohe Leistungsansprüche an sie stellte, sondern auch sie selbst, denn sie hat diese längst in sich aufgenommen (internalisiert). Frau F. kann bis jetzt gar nicht anders denken, als dass ihre Arbeit nur dann gerade eben gut genug ist, wenn sie ihr Bestes gegeben hat. So sitzt sie bis in die Nacht und laminiert noch Handouts für die Kinder, weil »weniger als perfekt« gar nicht geht in ihren Augen.
Schon im Aufnahmegespräch hatte die Therapeutin das Gefühl, dass die neue Konrektorin gar nicht so besonders schlimme Dinge getan hat, was weiteres Nachfragen auch bestätigt. Es ist aufseiten von Frau F. vielmehr die große Enttäuschung darüber, dass das warmherzige Verhältnis zur Vorgängerin nicht mehr besteht. In weiteren Gesprächen wird deutlich, wie sehr sie sich früher nach der Liebe ihrer Mutter sehnte. Die frühere Konrektorin konnte ihr immerhin einige mütterliche Zuwendung geben, wofür sie dieser dankbare Verehrung entgegenbrachte.
Partnerschaftliche Beziehungen hatte sie bisher meist zu deutlich älteren Männern. Es wird bald deutlich, dass es ihr hier mehr um väterliche Versorgung als um reife Partnerschaft ging.
Therapie wird bei Frau F. vor allem bedeuten, dass sie sich mit ihrer »inneren Antreiberin«, der internalisierten Mutter und deren Leistungsansprüchen auseinandersetzt. Mit dem Ziel, sich endlich einmal von dieser zu emanzipieren. Und zweitens wird es darum gehen müssen, dass sie lernt, liebevolle Zuwendung nicht immer noch von äußeren Mutterfiguren zu erwarten. Frau F. muss lernen, »sich selbst eine gute Mutter zu werden«. Oft wird in Therapien auch das Bild vom »inneren Kind« gebraucht, dem Kind, das wir früher einmal waren. Dann würde es darum gehen zu lernen, diesem endlich einmal Schutz und gute Versorgung zu geben.
Was dieses Fallbeispiel zeigen soll: Ein Therapieerfolg ist in der Regel nicht auf direktem Wege zu erreichen: durch Bekämpfung der Symptome oder Änderung äußerer Umstände. Stattdessen braucht es den Umweg über die Entwicklungsgeschichte der Betroffenen, einschließlich der dort verankerten Gefühle.
Bei der Entwicklung einer psychischen Krankheit haben in der Regel bestimmte Gebote, Verbote, Versagungen, Prägungen der frühen Kindheit zu Einengungen geführt, die das spätere Leben spezifisch beeinflusst und behindert haben. Weil die Betroffenen aber natürlich Wünsche, Bedürfnisse und Hoffnungen haben wie andere Menschen auch, musste es zu Reibungen mit diesen inneren Einschränkungen kommen. Innere Konflikte sind entstanden und haben immer mehr Energie gebunden.
Die frühe Kindheit ist deshalb so wichtig für die Entwicklung eines Menschen, weil der Mensch sich hier, in der Säuglingsphase am stärksten, in einer vollständigen Abhängigkeit von seinen frühen Bezugspersonen befindet. Für einen Säugling oder ein Kleinkind ist die häusliche Umgebung, in der es aufwächst, die ganze Welt. Das Kind hat keine Alternative. Was am Anfang des Lebens auf einen Menschen einwirkt, wenn der Machtunterschied zu den primären Bezugspersonen (meist die Eltern) noch nahezu unendlich ist, hat weit größere Prägekraft als spätere Ereignisse. Es hat die größten Auswirkungen – und gleichzeitig ist es der bewussten Erinnerung am wenigsten zugänglich. Ein Säugling verschmilzt die Erfahrungen, die er im Elternhaus in sich aufnimmt, mit seiner Persönlichkeit. Ein Kind nimmt tief in sich auf, dass die Welt so funktioniert, wie es das im Elternhaus erlebt.
Deshalb hat es entscheidende Bedeutung, ob Eltern als freundlich-zugewandt oder kühl, als gewährend oder geizig, als zuverlässig oder unzuverlässig erlebt und in sich aufgenommen (internalisiert) werden. Genau diese Erfahrungen prägen später auch das Bild über sich selbst, das ein Mensch mit ins Leben nimmt. Hatten die Eltern wenig Zuwendung für ein Kind übrig, könnte dieses den Leitsatz mit ins Leben nehmen: »Ich bin es nicht wert, dass man sich mit mir beschäftigt.« Bei unzuverlässigen Eltern vielleicht: »Ich muss ganz schnell zugreifen, wer weiß, wann ich wieder etwas bekomme.« Es gibt unzählige Möglichkeiten.
Ein Kind nimmt einen ganzen Satz von Erfahrungen mit Menschen, Gedanken über sich selbst und Regeln im Zusammenleben mit ins Leben. Einen bestimmten Blickwinkel sozusagen, aus dem heraus es die Außenwelt wahrnimmt und erfährt. Manches bleibt weitgehend verborgen, weil es gar nicht im vorgeprägten Gesichtsfeld erscheint. Und anderes erscheint überdeutlich. Natürlich ist auch sehr viel Gutes und Brauchbares dabei. Wer wollte bestreiten, dass es nicht sinnvoll gewesen ist, sprechen und laufen gelernt zu haben.
Aber es gibt kein Elternhaus, das nicht auch recht spezielle »Wahrheiten« mitgibt. Eltern sind auch nur Menschen – nämlich ebenfalls durch ihr Elternhaus machtvoll geprägte ehemalige Säuglinge.
Für unser Thema gilt es festzuhalten: Jeder Mensch hat in seiner Ursprungsfamilie (ob es eine größere Familie oder ein alleinerziehendes Elternteil war) einen ganzen Set an Prägungen, Vorstellungen über das Leben, über sich selbst und die Menschen mitbekommen. Und diesen Blickwinkel nimmt jeder Mensch zunächst einmal mit ins Leben. Sehr oft merken Menschen wenig davon, dass dieser Blickwinkel ziemlich speziell ist. So lange das Leben einigermaßen läuft, so lange wir unseren Platz in der Gesellschaft zur Verfügung gestellt bekommen, so lange es keine echten Krisen und Blockierungen gibt, halten wir es für die Normalität, und zwar für die einzig mögliche.
Insofern müssen Erklärungen, damit sie hilfreich werden, auch diese Bereiche miterfassen. Um einen weiteren Blick bekommen zu können, muss ich erst einmal etwas über meine Einschränkungen, meine Spezialitäten, meine tiefsitzenden Ängste erfahren. Ein Mensch muss sich in seinem ganz besonderen Gewordensein wahrnehmen und verstehen, damit er Alternativen erkennen kann. Und dann gilt es auch, den weiteren Verlauf der Biografie einzubeziehen: Wo überall haben diese ganz frühen Prägungen sich in meinem Leben ausgewirkt und tun es bis heute?
Wie oben beschrieben, führen frühe Versagungen und Verbote oft zu inneren Konflikten. Jeder Mensch trägt eine Vielzahl von Konflikten in sich und immer wieder mit sich aus. Das gehört zu uns als sehr komplexe und in Entscheidungsfreiheit lebende Wesen. Krankmachend wird diese Tatsache nur, wenn wir für wichtige und schwerwiegende innere Konflikte keine Lösung finden, weil durch innere Verbote alle Lösungswege verbaut sind. Bestimmte, eigentlich wichtige und normale Lebensregungen mussten je länger desto mehr unterdrückt werden, weil sie verboten waren. Dabei geht es z.B. um den Wunsch nach guter Versorgung, um aggressive oder sexuelle Impulse, die nicht sein dürfen. Was nicht sein darf, kann aber auch nicht konstruktiv genutzt werden. Zum Beispiel ein gewisses Maß an Aggression, um eine nötige Grenze zu ziehen oder darauf zu bestehen, am Arbeitsplatz gerecht behandelt zu werden. Oder eine einigermaßen entspannte Beziehung zur eigenen Sexualität, um eine Partnerschaft beginnen zu können. Stattdessen tauchen diese Wünsche und Impulse (die natürlich nicht »weg« sind) dann in verschleierter Form irgendwo auf, treiben merkwürdige Blüten und richten eine Menge indirekten Schaden an.
Menschen, die wegen innerer Ge- und Verbote nicht in der Lage sind, unerträgliche innere Konflikte zu lösen, müssen deshalb – unbewusst – »faule Kompromisse« eingehen, um das Leben trotzdem einigermaßen erträglich zu gestalten. Diese beseitigen die vorhandenen Regungen und Impulse nicht wirklich, sondern verbannen sie nur von der Oberfläche der bewussten Wahrnehmung. Solche Kompromisse definieren den Bereich des Neurotischen. In der Tiefenpsychologie wird dieses unbewusste Nicht-mehr-wahrnehmbar-Machen Verdrängung genannt. Gemeint ist damit, dass unliebsame oder verbotene Inhalte aus dem Bewusstsein verbannt werden. Die Verdrängung hat viele Unterformen. Man könnte sagen: Das Unbewusste ist sehr erfinderisch darin, für einen Konflikt jeweils den Weg herauszufinden, auf dem dieser so unauffällig wie möglich beiseitegeschoben werden kann.
Der Gewinn an der Verdrängung und den daraus entstehenden neurotischen Kompromissen ist, dass vermieden werden kann, den Konflikt weiter wahrzunehmen und daran zu leiden. Der Preis ist, dass das Leben enger und langweiliger wird.
Und nicht selten treten auch an unvorhergesehenen Stellen Störungen ein, denen die Betroffenen hilflos gegenüberstehen.
Exkurs 1
Die kreative Vielfalt der Abwehrmechanismen
In der Psychoanalyse (▶Kap.7.2) wurden zahlreiche verschiedene dieser Mechanismen definiert, deren gemeinsames Ziel einzig und allein ist: unliebsame Inhalte nicht ins Bewusstsein dringen zu lassen. Besonders Anna Freud machte sich um die folgende Liste verdient, die bis heute nützlich und anwendbar ist.
Verdrängung. Die Person verschiebt einen inneren Konflikt ins Unbewusste. Dadurch wird er mitsamt der daran hängenden Emotionen unerlebbar. Die »Verdrängung« ist gleichzeitig ein Dachbegriff für all die folgenden neurotischen Abwehrmechanismen.Verleugnung: Die Person wehrt von außen kommende Reize ab, sie erkennt äußere Realitäten nicht an.Projektion: Die Person verlagert einen (eigenen) Impuls in die Außenwelt. »Nicht ich bin aggressiv, sondern du bedrohst mich ständig mit deiner Wut!«Reaktionsbildung: Die Person ersetzt einen Impuls durch das direkte Gegenteil, z.B. »Übergüte« statt Aggression.Intellektualisierung: Die Person verlagert negative Impulse aus dem emotionalen Bereich in den intellektuell-theoretischen Bereich. »Ich mache mir keine Sorgen. Ich stelle nur generell fest, dass es im heutigen Wirtschaftsleben immer schwieriger wird, sich gegenüber der Konkurrenz zu behaupten.«Rationalisierung: Die Person ersetzt den tatsächlichen, aber für sie unbewusst nicht akzeptablen Grund für ihr Verhalten durch eine vernünftig wirkende Scheinerklärung. Zum Beispiel trennt sich ein Mann von seiner Partnerin, mit der er immer wieder in erbitterte Machtkämpfe hineingeraten war. Rationalisierung ist jetzt ein Weg, nicht weiter über eigene Anteile nachdenken zu müssen. Er erklärt: »Eine Architektin als Partnerin passt einfach nicht zu mir, das war ja gleich klar.«Isolierung: Die Person kann sich an ein Erlebnis erinnern, fühlt aber das dazugehörige Gefühl nicht.Verschiebung: Die Person verschiebt den Impuls (meist Aggression), der einer Person gilt, auf eine andere, weniger bedrohlich erlebte Person. Zum Beispiel kritisiert ein Manager seinen Mitarbeiter, obwohl ihn eigentlich eine unsinnige Anweisung des Chefs geärgert hat.Wendung gegen das Selbst: Zum Beispiel wird aus der Wut gegen mächtige Elternfiguren Wut auf sich selbst. Dies ist klassisch in der Depression (▶Kap.8.2).Identifizierung mit dem Aggressor: Die Person übernimmt Eigenschaften und Werte des Aggressors, um unerträgliche Angst erträglicher zu gestalten. Dazu gehört z.B. das »Stockholm-Syndrom« bei Flugzeugentführungen.Regression: Die Person gerät aufgrund bestimmter Auslöser in frühere Erlebnisweisen, die auf der psychischen Ebene einer bestimmten kindlichen Entwicklungsstufe entsprechen. Dieser Abwehrmechanismus ist eine Grundbedingung zur Entstehung der neurotischen Symptomatik.Introjektion: Die Person verinnerlicht frühere Bezugspersonen; sie handelt wie diese, z.B. strafend oder fordernd – vor allem sich selbst gegenüber.Ungeschehenmachen: Die Person erklärt die konfliktauslösende Ursache für nicht existent, übt stattdessen magische Abwehrrituale aus. Dieser Abwehrmechanismus wird besonders von Zwangskranken angewendet.Fallbeispiel
Ein Beispiel für Abwehr: Ein Mann ist stark aggressionsgehemmt. In seinem Elternhaus wurden damals Widerworte brutal bestraft, strikte Unterordnung wurde eingefordert. Als Erwachsener versucht er, unter allen Umständen freundlich und hilfsbereit zu sein, was manchmal von anderen auch ausgenutzt wird. Unter den Nachbarn ist er als besonders nett bekannt. Er leidet aber daran, dass es in größeren Abständen immer wieder zu »Explosionen« kommt. Er schreit dann seine Frau und die Kinder regelrecht zusammen. Anschließend schämt er sich und weiß nicht, wie das passieren konnte. In Therapie begibt er sich, weil ihm die Ehefrau ernsthaft eine Trennung angedroht hat. Offensichtlich hat sich seine Aggression, die bis jetzt eigentlich nicht sein darf, unbewusst dieses – wenig hilfreiche – Ventil gesucht. Sein Hauptabwehrmechanismus ist die Reaktionsbildung (▶Exkurs 1: »Die kreative Vielfalt der Abwehrmechanismen«, oben): übertriebene Freundlichkeit gerade dann, wenn sich innen immer mehr Ärger staut.
Das Leben eines Menschen wird störanfälliger, wenn er wichtige Inhalte abwehrt. Er bindet viel seiner Energie in der »Verwaltung« bzw. Bändigung innerer Konflikte. Wenn dann stärkere äußere Anforderungen oder Veränderungen eintreten, kann er nicht mehr ausreichend reagieren, um in der neuen Situation wieder einen guten Platz zu finden. Er wird krank. Seine Situation wird zur Sackgasse ohne Ausweg.
Meist entwickeln sich im Umkreis von Menschen mit starken inneren Konflikten auch immer mehr äußere Konflikte. Manche Patienten haben, wenn sie in Therapie kommen, schon eine ganze Kette von immer wieder ähnlichen (schlimmen) Erlebnissen hinter sich, die sie dann natürlich immer weiter frustriert. Ob das wiederholte Partnertrennungen sind, immer nach ein paar Jahren und einem hoffnungsvollen Anfang, ob es die Tatsache ist, immer wieder süchtige Partner zu haben, oder ob es immer wieder ähnlich strukturierte Konflikte am Arbeitsplatz sind – es gibt viele Möglichkeiten für Wiederholungen desselben Musters.
Um einem Menschen auf psychotherapeutischem Wege helfen zu können, ist es entscheidend, gemeinsam mit ihm seine wichtigsten destruktiven Muster zu erkennen und deren Herkunft zu verstehen. Lester Luborsky (1988) hat dafür den Begriff »zentraler Beziehungskonflikt« geprägt.
Hier sind Therapeuten Wegweiser. Sie wissen, welche Bereiche unbedingt dazugehören und was angeschaut werden muss, um ein umfassendes Bild eines Menschen zu erhalten. Ein weiterer Schritt ist, all diese einzelnen Erkenntnisse und Beobachtungen in einem guten Modell zusammenzufassen. Nur dann wird das Wissen anwendbar.
An dieser Stelle liegt ein entscheidendes Stück der therapeutischen Kompetenz. Ein fachlich guter Therapeut hat eine besondere Fähigkeit, solche umfassenden und stimmigen Modelle zu entwickeln. So lange noch alle möglichen Einzelheiten unverbunden nebeneinander stehen, ist ein guter Therapeut höchst unzufrieden. Es drängt ihn, immer weiter darüber nachzudenken, Fachwissen, Wahrnehmung und Intuition zu nutzen, um die Tatsachen zu integrieren. Steht ein brauchbares Modell, ist die Befriedigung, die ein engagierter Therapeut empfindet, durchaus vergleichbar mit derjenigen, die ein guter Architekt erlebt, wenn er gerade einen tollen Entwurf skizziert hat, oder ein Kriminalbeamter, wenn er einen kniffeligen Fall gelöst hat.
Natürlich fallen je nach Therapierichtung – ob Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie oder eine andere Richtung – die Modelle verschieden aus. Doch haben sich heute die Schulen so weit angenähert, dass die inhaltlichen Unterschiede oft nicht mehr erheblich sind (▶Kap.7). Die Fachsprache ist allerdings immer noch auf den ersten Blick weitgehend inkompatibel.
Um erfolgreich therapeutisch arbeiten zu können, gilt es, eine möglichst zutreffende Theorie darüber zu entwickeln, ein Modell, wie es so weit hat kommen können. Wie immer in der Wissenschaft gilt: Eine Theorie ist desto besser, je einfacher sie ist und je mehr sie gleichzeitig erklären kann. Und sie darf erst dann genutzt werden, wenn es keine wesentlichen Fakten mehr gibt, die ihr widersprechen. Bei einer mäßig guten Theorie gibt es immer Fakten, die mit ihr nicht erklärt werden können. Aber wenn ihr bestimmte Tatsachen ernsthaft widersprechen, dann stimmt mit der Theorie etwas nicht, und sie muss verworfen oder überarbeitet werden. Das gilt auch in der Psychotherapie.
Auch wenn wir in unserer Klinik im Grundsatz tiefenpsychologisch ausgerichtet sind, ist es oft der Fall, dass in der Formulierung eines Therapiefokus erlerntes Verhalten im Vordergrund steht und ein Therapieziel auch als Verlernen bzw. Erlernen von Alternativen formuliert wird, also ein verhaltenstherapeutisches Modell erstellt wird. Im Sinne der Patienten sollte tatsächlich schulenübergreifend das einfachste Modell mit der größten Erklärungskraft genutzt werden. Voraussetzung ist allerdings, dass die Therapeuten auch über den Tellerrand ihrer ursprünglichen Ausbildungsrichtung hinausschauen können.
Wie solch ein Modell, solch eine Theorie über eine Störung gefunden werden kann, wird Thema des nächsten Kapitels sein. In den Therapiekapiteln 4 und 5 wird es dann darum gehen, wie die gefundenen Zusammenhänge im täglichen Leben angewendet und für Veränderungsprozesse genutzt werden können.
3 Wie findet man den zentralen Beziehungskonflikt?
3.1 Dreieck der Einsicht
Karl A. Menninger hat 1958 das »Dreieck der Einsicht« formuliert, das immer noch als Grundlage des therapeutischen Erkenntnisgewinns gelten kann. Zunächst war es ein rein psychoanalytisches Modell, doch inzwischen geht die neuere Verhaltenstherapie prinzipiell sehr ähnlich vor, ebenfalls die Schematherapie (▶Kap.7).
Dieses Einsichtsdreieck ist in der Folge mehrfach verändert und erweitert worden, liegt aber z.B. auch dem Klassiker von Hermann Argelander (2009) über das Erstinterview in der Psychotherapie und dem Konzept des »Zentralen Beziehungskonfliktthemas« zugrunde, das Lester Luborsky 1988 formulierte (1988, 1995). Es gibt danach drei Hauptbereiche, die es zu berücksichtigen gilt, um therapeutische Einsichten zu ermöglichen:
Die aktuelle Situation
Die Biografie (mit Schwerpunkt auf den ersten Jahren)
Das szenische Erleben
Diese drei Bereiche bilden das Dreieck der Einsicht (▶Abb.3-1). Man kann sich eine Theorie über eine bestehende psychische Störung wie einen Hocker vorstellen, der auf drei Beinen steht: Man kann nicht auf eines davon verzichten. Auf zwei Beinen ließe sich der Hocker nicht belastbar aufstellen, ebenso wenig wie eine Theorie für wirksame Hilfe taugen würde, die einen dieser essenziellen Bereiche nicht berücksichtigt.
Was bedeuten jetzt diese drei Faktoren im Einzelnen?
Abb.3-1 Dreieck der Einsicht (Menninger)
Aktuelle Situation
Hier geht es zum einen um die Frage: Was bringt diesen Menschen jetzt dazu, dass er Hilfe in Anspruch nehmen möchte? Was empfindet er als Sackgasse, als Problem, das mit »Bordmitteln« nicht mehr zu lösen ist? Was führte seiner jetzigen Wahrnehmung nach zur Erkrankung? Wo spürt er derzeit den meisten Druck, welcher Lebensbereich belastet am meisten?
In was für Beziehungen lebt der Patient zurzeit? Insbesondere sind hier die Beziehungen in der Familie und am Arbeitsplatz wichtig. Wer unterstützt hier und wer raubt Energie? Wo gibt es Konflikte und Probleme und warum genau?
Dazu gehört auch, ein gutes Bild von der Familien- und Wohnsituation zu bekommen und ebenfalls ein möglichst plastisches Bild vom Arbeitsumfeld und der Tätigkeit, die der Betreffende ausführt. Hat er sein Auskommen oder gibt es finanzielle Not?
Gezielt gefragt werden sollte auch gerade nach Bereichen, die möglicherweise zunächst umgangen werden, weil es dem Betroffenen peinlich ist. Es ist nicht möglich, ein sinnvolles Modell zu entwickeln, wenn hier vielleicht ein wichtiger Punkt verschwiegen oder in stillschweigendem Einverständnis umgangen wurde. So sollte klar und offen nach der genauen Höhe von Schulden gefragt werden, dem Ausmaß von Alkoholmissbrauch, nach anderen Abhängigkeiten, nach sexuellen Problemen jeder Art und bei Andeutung von ausgeübter körperlicher Gewalt auch genau, was da schon passiert ist. Es gibt kaum einen besseren Einstieg in eine therapeutische Beziehung, als wenn ein Ratsuchender merkt, dass der Therapeut nicht verurteilend mit diesen ihm oft höchst peinlichen Inhalten umgeht, sondern fachlich interessiert ist und der Überzeugung, dass gerade hier gemeinsam eine positive Entwicklung in Gang gesetzt werden sollte.
In den meisten Fällen entwickeln Menschen in für sie ausweglosen Lagen eine Depression. Diese bildet entweder das Hauptsymptom oder begleitet dieses. Wenn ja, wie ausgeprägt ist die Depressivität? Hauptsymptom können auch Ängste bzw. eine Form einer Angsterkrankung sein (z.B. Panikstörung, soziale Phobie, eine Agoraphobie oder eine andere spezielle Phobie). Vielleicht liegen auch Zwänge (Zwangsgedanken, Zwangshandlungen) vor?
Ebenfalls eine Vielfalt an Symptomen gibt es im Rahmen der Psychosomatik. Meist haben die Betroffenen schon umfangreiche medizinische Abklärungen hinter sich.
Wenn es sich um eine Essstörung handelt oder eine Borderline-Störung, dann gelten z.T. andere Behandlungsregeln (▶Kap.8). In Bezug auf Persönlichkeitsstörungen, insbesondere die Borderline-Störung, braucht es auch einen anderen theoretischen Zugang als den unten dargestellten (▶Kap.8.9).
Ausgeschlossen werden muss eine stoffgebundene Abhängigkeit, wie am weitaus häufigsten ein Alkoholabusus. Das würde eine spezielle Suchtbehandlung erfordern, die auf jeden Fall einer klassischen Psychotherapie vorgeschaltet werden sollte. Und natürlich müssen auch vorwiegend neurophysiologisch bedingte Störungen wie eine schizophrene Psychose, eine schwere Depression oder eine Manie ausgeschlossen werden, die ebenfalls eine andere Behandlung erfordern würden.
Biografie
Gerade für die besonders wichtige Zeit der frühen Kindheit sind die Informationen, verglichen mit späteren Jahren oder den jetzigen Problemen, am Anfang einer Therapie oft relativ karg. Manche Patienten idealisieren rundweg ihre Kindheit. »Ich hatte eine wunderbare Familie!« Meist möchten sie dann schnell zum nächsten Punkt übergehen und haben sichtlich wenig Lust, sich weiter damit zu beschäftigen.
Immerhin lassen sich auch am Anfang einige objektive Daten erfassen: Wo stand das Kind in der Geschwisterreihe? Musste das Kind früh Verantwortung übernehmen? Wie war die wirtschaftliche Situation der Familie? Was haben die Eltern beruflich gemacht, wie stark waren sie beschäftigt, wie bildungsfern oder -nah waren sie? Sind die Eltern die Kindheit über zusammengeblieben? Wenn nicht, durfte das Kind ununterbrochen bei einem Elternteil bleiben? War eines der Elternteile vielleicht psychisch krank oder litt an einer Sucht?
Aus diesen objektiven Daten lässt sich oft schon eine ganze Menge ersehen, wenn auch natürlich nur als Hypothese. Erwiesen ist ein Zusammenhang erst dann, wenn er mit dem Gefühl des Betroffenen übereinstimmt.
Fallbeispiel
Ein Mann berichtet, in der Herkunftsfamilie das älteste von vier Kindern gewesen zu sein. Das könnte sehr verschiedene Dinge bedeuten. Möglicherweise hatte er freundliche, recht gesunde Eltern, die darauf achteten, dass er kindgerecht aufwachsen konnte und keine ausgeprägte Rolle einnehmen musste. Oft bedeutet die Rolle des Ältesten aber auch eine markante, lebensprägende Position. Es könnte z.B. eine ausgesprochene Kronprinzenrolle gewesen sein. Das fördert unrealistische narzisstische Erwartungen an sich selbst und andere, die im späteren Leben zum Scheitern führen müssen. Andere älteste Geschwister werden schon früh mit Verantwortung überladen. Sie müssen auf die Jüngeren aufpassen und im Haushalt helfen. Insbesondere Mädchen werden in unserer Gesellschaft in kinderreichen Familien oft in die Rolle einer »Zweitmutter« gedrängt. Zuwendung durch die überforderte echte Mutter ist karg, und wenn, dann als Anerkennung für effektives Arbeiten in der Familie. Oder älteste Kinder werden zum Träger der gesamten Erwartungen der Eltern. Vielleicht sollen sie endlich das Studium schaffen, das dem Vater damals verwehrt blieb.
Die Information, Ältester in der Familie gewesen zu sein, also der objektive Befund, sagt an sich also noch wenig aus. Erst im Zusammenhang mit der gefühlsmäßigen Besetzung dieser Rolle erfahren wir Wesentliches.
Glücklicherweise ist es allerdings so, dass bei den Patienten meistens schon bei einer genauen Anamneseerhebung Gefühle in Bezug auf die Tatsachen hochkommen und auch gezeigt werden. Oft wird dann schon im Erstgespräch oder wenig später Wesentliches klar. Mir ist von Therapieunerfahrenen, z.B. in den Begrüßungsgruppen unserer Abteilung, oft die Frage gestellt worden, wie man denn mit ihnen arbeiten wolle. Sie hätten gehört, dass die Kindheit so wichtig sei, sie könnten sich aber gar nicht mehr daran erinnern. Das ist in dem Moment auch ihr Gefühl, aber in der Regel erfordert es, wie gesagt, kein langes Schürfen, bis die wesentlichen Bedingungen zutage kommen.
Bei uns in der Klinik gibt es zwei Mittel, die sehr fördern können, einen gefühlsmäßigen Zugang zur eigenen Geschichte zu bekommen.
Zum einen ist das der »Fragebogen zur Lebensgeschichte«, den jeder Patienten innerhalb der ersten Zeit ausfüllt. Hier werden verschiedenste Lebensbereiche und Lebensphasen abgefragt. In der Regel entsteht dadurch eine Menge gefühlsmäßige Anregung und Gesprächsbedarf. Im Schutzraum der Station dürfen Dinge bedacht und gefühlt werden, die vorher unter festem Verschluss waren. Unsere Psyche verdrängt so viel wie möglich dessen ins Unbewusste, was uns im täglichen Leben am Funktionieren hindern könnte. Und die meisten Menschen, die in Psychotherapie kommen, haben bis kurz vorher, manchmal am Tag vorher noch funktioniert. Erst wenn sie im Schutzraum der Station keine Rolle mehr erfüllen müssen, dürfen sich die Dinge zeigen, die schon die ganze Zeit gedrückt und belastet haben.
Der andere Zugang zum Gefühl, das mit der frühen Kindheit verbunden ist, ist der »Baukasten für Familienkonstellationen« (▶Kap.3.2).3 Die Familienaufstellung der Kindheitssituation in Klötzchenskulpturen kann sehr helfen, diesen Prozess zu beschleunigen.
Aber natürlich interessiert auch die Adoleszenz und der weitere Lebensweg eines Menschen, die ebenfalls erfragt werden müssen.
Szenisches Erleben
Mit dem szenischen Erleben ist gemeint, wie ein Mensch sich – in jeder Hinsicht – darstellt bzw. »inszeniert«. Letztlich ist jedes aktive Handeln immer auch ein »In-Szene-Setzen«, ohne dass dieser Begriff in diesem Zusammenhang etwa herabsetzend gemeint ist. Es ist kein Zufall, ob ich z.B. fröhlich und selbstbewusst auf einen mir unbekannten Menschen zugehe oder mürrisch und misstrauisch. Es ist auch nicht genetisch festgelegt. Sondern es hängt ganz stark damit zusammen, welche Gefühle der andere in mir auslöst, und das wiederum hängt damit zusammen, welche Vorerfahrungen ich mit Menschen gesammelt habe, die mich in irgendeiner Hinsicht an seinen Typ erinnern. Es sind Reaktionsbereitschaften, die in meinem Nervensystem eingespeichert sind. Sie bestimmen, auf welche Muster ich wie reagiere. Mit Logik haben jedenfalls beide Möglichkeiten (die freundliche und die misstrauische) wenig zu tun: Ich kenne den anderen wirklich nicht, und es könnte ein äußerst netter Mensch sein, genauso aber auch ein hinterhältiger Betrüger. Übrigens: Auch unsere Meinung darüber, ob es mehr freundliche oder mehr schlechte Menschen gibt, hat ganz wesentlich mit unseren früheren (und ganz besonders den frühesten) Prägungen zu tun.
Damit sind wir schon bei der ersten Situation des Szenischen, dem Kontakt zwischen zwei Menschen. Das ist die Konstellation jeder Einzeltherapie. Hier spielt für das Szenische, dafür, wie ein Mensch sich gibt und – als Patient – auf den Therapeuten zugeht, die Übertragung eine entscheidende Rolle. Was ist damit gemeint?
»Übertragung« ist ein Begriff aus der Tiefenpsychologie und beschreibt das Gefühl, das ein Patient seinem Therapeuten entgegenbringt, obwohl es nicht durch den gegenwärtigen Kontakt begründet ist. Das Konzept Übertragung meint viel mehr, dass ein Therapeut z.





























