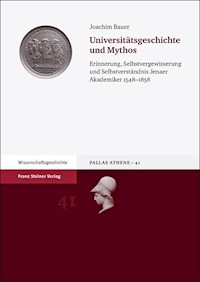9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Das neue große Buch des Bestsellerautors: Die Bedeutung des Selbst für Erziehung, Partnerschaft und Gesellschaft
Jeder Mensch hat die Gewissheit: Ich bin. Das in uns vorhandene Wissen, dass wir sind und wer wir sind, nennt die moderne Hirnforschung das Selbst. Wo es im Gehirn seinen Sitz hat, wurde erst vor Kurzem entdeckt. Menschliche Säuglinge kommen ohne ein Selbst zur Welt. Wie also kommt das Selbst ins Kind? Der renommierte Neurowissenschaftler, Arzt, Psychotherapeut und Bestsellerautor Professor Joachim Bauer beschreibt hier auf allgemein verständliche Weise nicht nur, wie unser Selbst entsteht, sondern auch, welchen Gefahren es im Laufe des Lebens ausgesetzt ist und wie wir es bewahren und stärken können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Zum Buch
Neue Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften zeigen: Der Mensch wird ohne ein Selbst geboren. Wie aber entsteht unser Ich, das sich später von anderen Menschen abgrenzen kann? Wie gelingt es uns, ein Ich, Du oder Wir zu denken, zu fühlen, zu erleben? Was macht einen Menschen zum Individuum?
Diesen zentralen Fragen geht Joachim Bauer in seinem neuen großen Werk nach und legt dar, dass unser »wahres Selbst« nicht in uns schlummert wie ein Bodenschatz, der darauf wartet, gefunden und poliert zu werden. Vielmehr ist es das Produkt von Resonanzen – unserer geteilten Erfahrungen, Freuden und Ängste.
Zum Autor
Prof. Dr. med. Joachim Bauer ist Neurowissenschaftler, Arzt und Psychotherapeut. Nach erfolgreichen Jahren an der Universität Freiburg lehrt und arbeitet er heute in Berlin. Für seine Forschungsarbeiten erhielt er den renommierten Organon-Preis der Deutschen Gesellschaft für biologische Psychiatrik. Er veröffentlichte zahlreiche Sachbücher, u.a. »Warum ich fühle, was du fühlst«. Zuletzt erschienen bei Blessing der SPIEGEL-Bestseller »Selbststeuerung – Die Wiederentdeckung des freien Willens« (2015).
JOACHIM BAUER
–––––––
WIE WIR WERDEN,
WER WIR SIND
Die Entstehung
des menschlichen Selbst
durch Resonanz
Blessing
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Auszüge aus Helene Hegemanns Der Bungalow © 2018 Hanser Berlin in der Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © 2019 by Karl Blessing Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: Geviert, Grafik & Typografie, München
Covermotiv: Shutterstock.com / lolloj
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-22372-4V005
www.blessing-verlag.de
Inhalt
Vorwort
1 Wie kommt der Mensch zu einem »Selbst«?
2 Ausbau des Selbstsystems und Autonomieerwerb
3 Wenn das Selbst verhungert: Eine Romanfigur aus »Der Bungalow«
4 Neurobiologische Rezeptoren für den Geist
5 Selbst, Körper und Sexualität
6 Selbstkonstruktion: Individualität und Identität
7 Pädagogik als Öffnung von Möglichkeitsräumen
8 Menschliche Arbeit
9 Partnerschaften: Resonanz, Routine und die Neuentdeckung des Anderen
10 Leiden am Selbst: Narzissmus, Abhängigkeit, Depression
11 Erschütterung und Auflösung des Selbst: Traumatisierung, Gaslighting, Demenz
12 Kulturen, Psyche und Gehirn: »Ich« und »Wir«
13 Das aufgeblähte Selbst: Die Schwierigkeit, im Selbst zu Hause zu sein
14 Selbst-Fürsorge
15 Im Resonanzraum der Gesellschaft
Dank
Anmerkungen
Literatur
VORWORT
»Man könnte Spiegelung und Resonanz als das Gravitationsgesetz lebender Systeme bezeichnen.«
Joachim Bauer, Warum ich fühle, was du fühlst (2005)
Der menschliche Säugling, obwohl ein fühlendes, mit der Würde des Menschseins ausgestattetes Wesen, verfügt über kein Selbst. Die neuronalen Netzwerke, in denen sich Letzteres einnisten wird, sind zum Zeitpunkt der Geburt noch unreif und funktionsuntüchtig. Seine Entstehung und Grundstruktur verdankt das menschliche Selbst jenen Bezugspersonen, die uns – vor allem in den ersten Lebensjahren – als »Extended Mind«*, das heißt, als eine Art externe Leitstelle gedient haben. An der Komposition des Selbst sind Resonanzvorgänge beteiligt, wie sie sich zum Beispiel zwischen zwei Gitarren beobachten lassen: So, wie der Klang der einen Gitarre die Saiten einer zweiten Gitarre zum Klingen bringen kann, so können Bezugspersonen ihre inneren Melodien – ihre Art zu fühlen, die Welt zu deuten und in ihr zu handeln – via Resonanz auf den Säugling übertragen. Da dieser Transfer sich – in reduzierter Form – lebenslang fortsetzt, ist unser Selbst eine Komposition aus entsprechend vielen Themen und Melodien.
Die Entdeckung der Selbst-Systeme durch die modernen Neurowissenschaften hatte bedeutsame Erkenntnisse zur Folge. So ließ sich eindrucksvoll bestätigen, was schon Philosophen wie Friedrich Nietzsche und Martin Buber konstatierten: Unser Selbst ist unauflöslich verbunden mit dem Du und, mehr als uns das bewusst ist, immer auch ein Wir. Dies gilt für Menschen aller Ethnien. Das Ausmaß, in dem Ich und Wir identisch sind, ist allerdings kulturabhängig. Auch dazu liegen aus den sogenannten Cultural Neurosciences Befunde vor.
In Säuglingen und Kleinkindern komponiert sich ein Selbst, dessen Themen von ihren Bezugspersonen über Resonanzvorgänge in sie hineingelegt wurden. Je weiter wir heranwachsen und persönlich reifen, desto mehr wird das Selbst zu einem Akteur, der mitspricht und beeinflusst, was mit ihm geschieht. Wir entwickeln ein Gefühl, das uns spüren lässt, welche an uns herangetragenen Angebote zu uns passen und zu einem stimmigen Teil unseres Selbst werden könnten, und welche unserer Identität Gewalt antun würden. Der Mensch ist das einzige Wesen, das sich an der Konstruktion seiner selbst – und seines Selbst – beteiligen kann, ein Hinweis, der in dieser expliziten Form erstmals durch den Renaissance-Philosophen Pico de la Mirandola gegeben wurde.
Ganz besonders im Kindes- und Jugendalter, aber auch danach bedarf das Selbst interessanter Angebote, die ihm das Material für seine lebenslange Selbstkonstruktion bieten. Dazu benötigt der Mensch in der Zeit der Kindheit und Jugend Mentorinnen und Mentoren. Danach wird es zu einer Instanz, die in Eigenverantwortung herauszufinden und darüber zu bestimmen hat, was es integrieren oder als fremd von sich weisen möchte. Vielen Menschen bleibt der Weg zu persönlicher Autonomie jedoch versperrt. Selbst-Enteignung kann in unterschiedlichen Varianten auftreten. Das Selbst kann unter den Einfluss externer Manipulatoren – zu diesen zählen heute zahlreiche Plattformen des Internets – geraten. Manche Menschen haben große Teile ihres Selbst und die Selbststeuerung ganz und gar auf einen anderen Menschen übertragen, der für sie sozusagen wie eine externe Festplatte fungiert.
Vieles, was sich im Laufe des Lebens, von unserem Bewusstsein überwiegend unbemerkt, in unser Selbst einschleicht, entgeht unserer Aufmerksamkeit. Damit sich derartige Vorgänge unserer Wahrnehmung nicht völlig entziehen, bedarf der Mensch eines guten Kontakts mit dem eigenen Selbst – den wir aus verschiedenen Gründen, auf die ich eingehen werde, aber oft nicht haben. Unser Lebensglück setzt beides voraus: einerseits, dass wir unsere Identität bewahren und nichts in uns hineindrücken lassen, was sich nicht als mit uns kongruent anfühlt; andererseits, dass wir durchlässig bleiben, eigene Haltungen und Werturteile in Frage stellen und uns von anderen Menschen inspirieren und verändern lassen.
Mit diesem Buch möchte ich meine Leserinnen und Leser an neuen Erkenntnissen der modernen Neurowissenschaften teilhaben lassen und darlegen, was diese für unser Leben bedeuten, für die Erziehung unserer Kinder, für das Leben an unseren Arbeitsplätzen, für den gegenseitigen Umgang in der Partnerschaft und für das gesellschaftliche und politische Leben. Vor allem aber geht es mir um eines: dass wir uns selbst besser verstehen lernen und erkennen, was gute Selbstfürsorge bedeutet.
Joachim Bauer, Berlin im Frühjahr 2019
* Der Begriff des »Extended Mind« wurde von den Philosophen Andy Clark und David Chalmers geprägt (Clark und Chalmers, 1998). [zurück]
»Überhaupt können wir bemerken, dass die Seelen der Menschen sich gegen einander wie Spiegel verhalten.«
David Hume, Ein Traktat über die menschliche Natur (1740)
»Das Du ist älter als das Ich.«
Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra (1883)
»Der Mensch wird am Du zum Ich.«
Martin Buber, Du und Ich (1923)
1 WIE KOMMT DER MENSCH ZU EINEM »SELBST«?
Die stärkste Droge für den Menschen ist der andere Mensch. Die enormen Wirkungen, die Menschen auf andere haben, zeigen sich nicht nur im Privatleben, sondern auch im öffentlichen Raum, in den Medien und ganz besonders in den sozialen Netzwerken. Die Wirkungen, die von anderen Menschen ausgehen können, werden in den meisten Fällen nicht bemerkt, weil die wechselseitige zwischenmenschliche Beeinflussung in der Regel sublim, schleichend und unmerklich vonstattengeht. Viele nehmen erst dann wahr, dass Einflüsse, die von Mitmenschen ausgehen, uns tatsächlich verändern, wenn sie mit einer gewissen Wucht – wie zum Beispiel bei einer Liebeserklärung oder im Falle einer groben Kränkung – daherkommen. Vor allem die spektakulären Beschädigungen, die durch körperliche Gewalt angerichtet werden, haben den Blick dafür verstellt, dass es keiner sichtbaren physischen Einwirkung bedarf, um einen anderen Menschen biologisch zu verändern. Der bedeutsamste Einfluss, dem der Mensch ausgesetzt ist, solange er sich unter seinesgleichen aufhält oder mit seinesgleichen kommuniziert, beruht auf Resonanz.1 Ihre Wirkungen auf den Menschen sind die stärksten überhaupt, unabhängig davon, ob sie uns wachsen lassen und stärken oder verletzen und schwächen. Ich werde darlegen, dass wir dem Resonanzgeschehen die Entstehung des menschlichen Selbst verdanken. Der Säugling kommt ohne ein Selbst zur Welt. Die Anfänge der Selbst-Werdung vollziehen sich in den ersten etwa vierundzwanzig Lebensmonaten und beruhen auf Resonanzen, die der Säugling in seinen Bezugspersonen auslöst und die zu ihm zurückkehren. Seine Bezugspersonen dienen dem Säugling als eine Art externes Selbst. Andy Clark und David Chalmers prägten im Jahre 1998 den Begriff des »Extended Mind«2, den sie damals und seither aber vor allem auf technische Hilfsmittel und nur am Rande auf die zwischenmenschliche Beziehung anwandten. Der bedeutsamste »Extended Mind« des Menschen ist der andere Mensch. Resonanzen beeinflussen unser Selbst über die Kindheit hinaus, wir werden lebenslang von ihnen adressiert und verändern uns dabei ständig weiter. Da das Resonanzphänomen nicht allen, die dieses Buch in die Hand nehmen, vertraut ist, werde ich ausführlich darlegen, was darunter zu verstehen ist und auf welchen neurologischen Grundlagen es beruht. Menschen, die einer Einwirkung ausgesetzt sind, die sie in Resonanz versetzt, verändern sich. Diese Veränderungen ereignen sich überwiegend unterhalb des Radarschirms unserer Wahrnehmung. Wer nicht wie eine Marionette an unsichtbaren Fäden geführt durchs Leben stolpern will, sollte sich dafür interessieren, was es mit diesem Geschehen auf sich hat. Den Einflüssen, die im Säugling das Selbst entstehen lassen, bleiben wir lebenslang ausgesetzt. Die Zusammenhänge zwischen dem, was unser Selbst ist, und den uns ständig adressierenden Resonanzen zu verstehen, kann uns helfen, die Beziehungen zwischen uns und unseren Mitmenschen besser zu regulieren und ein glücklicheres Leben zu führen. Doch kehren wir zunächst zum Anfang des Geschehens, an den Beginn des Lebens zurück.
Ohne die atmosphärische Hülle, die unsere Erde umgibt, gäbe es auf dieser Welt kein Leben. Auch jeder Mensch hat eine Hülle. Zwischen den Entstehungsbedingungen der Erdatmosphäre und der Entwicklung dessen, was die Hülle einer Person, ihr »Selbst« oder »Ich« ausmacht, bestehen einige Parallelen. Als unser Planet entstand, fehlte ihm die Hülle aus Sauerstoff und Stickstoff, die ihn heute umgibt. Dass auch der Mensch am Beginn des Lebens ohne eine schützende psychische Hülle, ohne einen »Ich-Sinn«, ohne ein »Selbst« das Licht der Welt erblickt, war eine von Psychologen – insbesondere von Psychoanalytikern – schon länger gehegte Vermutung. Den letztgültigen Nachweis für deren Richtigkeit erbrachten jedoch erst die modernen Neurowissenschaften. Die Entdeckung der neuronalen Selbst-Netzwerke – sie werden im Englischen als »Self Networks« bezeichnet – ist erst wenige Jahre alt. Sie haben ihren Sitz im Stirnhirn, einer Gehirnregion, die zum Zeitpunkt der Geburt neurobiologisch noch unreif und nicht funktionsfähig ist. Menschliche Säuglinge sind zwar erlebende Subjekte und besitzen die jedem Menschen zukommende unantastbare Würde, über ein Selbst verfügen sie jedoch – noch – nicht. Wie also werden wir, wer wir sind?
Auch was ihre Entstehungsgeschichte betrifft, weisen Erdatmosphäre und die psychische Hülle des Menschen Parallelen auf. Die Hülle unseres Planeten war – und ist – das Ergebnis eines Wechselspiels zwischen Erde und Sonne.3 Ganz ähnlich verdankt auch das Selbst des Menschen seine Existenz einer richtig bemessenen Dosis von zwischenmenschlicher »Sonne«, die der Säugling aus seiner sozialen Umwelt empfängt. Die Annahme, ein Kleinkind, ein Kind oder ein Jugendlicher entwickle sich, wenn man sie nur nicht daran hindere, von alleine, ist ein gefährlicher Irrtum, für den viele Jugendliche und Erwachsene später teuer bezahlen. Nicht nur was ihre Entstehung, auch was ihre mögliche Zerstörung angeht, sind Erdatmosphäre und die psychische Hülle des Menschen vergleichbar. Äußere Faktoren, zum Beispiel der Einschlag eines Meteoroids wie der vor rund 65 Millionen Jahren, könnten unserer Atmosphäre ein Ende bereiten. Die Zerstörung der Erdatmosphäre kann, wie wir heute wissen, aber auch von innen her geschehen. Unsere Spezies, ein Produkt der Hülle unseres Planeten, ist in der Lage, dazu einen fatalen Beitrag zu leisten. Auch die psychische Hülle, das Selbst des Menschen, kann Schaden erleiden, nicht nur durch Einwirkungen von außen wie zum Beispiel durch traumatische Gewalt. Das Selbst des Menschen ist in der Lage, auch sich selbst Schaden zuzufügen. Wie also entsteht im Menschen ein Selbst, wie kann es sich erhalten und welchen Gefahren ist es ausgesetzt?
Wer die schöne Gelegenheit hatte, mit einem menschlichen Säugling in dessen ersten Lebensmonaten etwas Zeit zu verbringen, macht zwei Erfahrungen, die – wenn man nüchtern darüber nachdenkt – eigentlich nicht zusammenpassen, sondern einen Widerspruch bilden. Das Paradox besteht im Eindruck einer krassen Hilflosigkeit und Unreife des Säuglings einerseits. Andererseits gelingt es dessen ungeachtet vielen Erwachsenen, mit dem Winzling »irgendwie« in Kontakt zu kommen und zu kommunizieren. Erfahrene Hebammen beherrschen dieses »irgendwie« mit Abstand am besten, gefolgt von den Müttern und Großmüttern. Aber auch Väter stellen sich hier oft sehr geschickt an. Viele Menschen sind von der Zartheit und Unreife des Säuglings allerdings derart beeindruckt, dass sie es, jedenfalls in dieser frühen Phase, vorziehen, ganz die Finger von den Allerkleinsten zu lassen, um nur nichts falsch zu machen oder gar Schaden anzurichten. Diese Angst ist nachvollziehbar und teilweise sogar berechtigt, denn tatsächlich ist die Unreife des menschlichen Säuglings phänomenal. Bevor wir das »irgendwie« analysieren, das uns mit Säuglingen trotzdem gut in Kontakt bringen kann, sollten wir uns die Gründe ihrer Hilflosigkeit näher vor Augen führen.
Weshalb sind Neugeborene der Spezies Mensch, wenn sie das Licht der Welt erblicken, weitaus hilfloser als die aller anderen Säugetiere? Warum sind Säuglinge unserer Spezies weit davon entfernt, bereits wenige Tage nach ihrer Geburt auf allen vieren zu stehen und sich, zumindest im näheren Umfeld, halbwegs gut zurechtzufinden, so wie dies bei jungen Katzen, Hunden oder Pferden zu beobachten ist? Die scheinbare Benachteiligung des Menschen hat einen Grund. Die Natur hat im Laufe der letzten Millionen Jahre den menschlichen Körperbauplan verändert. Der Plan der Evolution, den menschlichen Kopf größer werden zu lassen, war nicht unproblematisch und hätte zur Folge haben können, dass irgendwann keine Mutter die Geburt ihres Kindes überleben würde. Die von der Natur für dieses Dilemma vorgesehene Lösung war die Vorverlegung der Geburt. Evolutionär gesehen sind menschliche Säuglinge Frühgeburten, auch dann, wenn sie aus frauenärztlich-geburtshilflicher Sicht zum richtigen Zeitpunkt, also in der vierzigsten Schwangerschaftswoche, den Mutterleib verlassen.
Verglichen mit der Situation von Neugeborenen anderer Säugetiere, fehlt dem Menschen bei der Geburt mindestens ein Jahr. Abhängig davon, mit welcher anderen Spezies man den Vergleich anstellt und auf welche Kompetenzen man den Vergleich bezieht, kann dieses zeitliche Defizit sogar deutlich höher beziffert werden. Die Unreife des menschlichen Säuglings betrifft die Wahrnehmung, die Orientierung und die Motorik, also seine Fähigkeit, sich gezielt fortzubewegen. Es sind vor allem die relativ kurz nach der Geburt funktionstüchtigen Sinne und die entwickelten motorischen Kompetenzen, wie sie zum Beispiel Katzen- oder Hundejunge aufweisen, welche diesen Tieren bereits früh so etwas wie einen Ich-Sinn, einen »sense of agency« verleihen, ein Gefühl also, handelnder Akteur zu sein. Der menschliche Säugling ist bei seiner Geburt – und über einen längeren Zeitraum danach – nicht nur motorisch inkompetent, sondern auch ohne scharfe Wahrnehmung. Was ihm nach der Geburt völlig fehlt, ist Orientierung, sowohl zur äußeren Situation als auch zur eigenen Person. Säuglinge wissen nach der Geburt und einige Zeit danach weder, wer sie sind, noch, was sich »da draußen« abspielt. Sie sind anfangs nicht einmal in der Lage, zwischen sich und der Außenwelt zu differenzieren, sie können beides noch nicht trennen. Und trotzdem kommen wir mit ihnen in Kontakt. Aber wie?
Wen oder was wir im jeweils anderen Menschen eigentlich adressieren, wenn wir als Erwachsene untereinander kommunizieren, mag auf den ersten Blick als eine unsinnige Frage erscheinen. Vor dem Hintergrund der Überlegung, wie Erwachsene mit Säuglingen kommunizieren, gewinnt diese scheinbar dumme Frage plötzlich an Berechtigung. Aus neurowissenschaftlicher Perspektive adressieren wir, wenn wir einen erwachsenen Menschen in einer persönlichen Art und Weise ansprechen, dessen Selbst-Systeme. Dies lässt sich mit modernen neurowissenschaftlichen Methoden nachweisen: Wenn Andere uns ansprechen oder wenn wir hören, wie Andere über uns sprechen, zeigen die in unserem Stirnhirn beheimateten Nervenzellnetzwerke eine messbare heftige Sofortreaktion. Wie aber kommunizieren wir mit Säuglingen, bei denen ein Ich-Sinn, ein Selbst und dessen neuronale Grundlage, die Selbst-Systeme, fehlen? Wir tun etwas, das Personen, die sich einem Säugling zuwenden, in der Regel gar nicht bewusst ist. Bei denen, welche die Kommunikation mit Säuglingen beherrschen, passiert es intuitiv: Das Erste und Wichtigste ist die Aufnahme von Blickkontakt. Säuglinge suchen Blickkontakt, über ihn suchen sie nach einer Verbindung. Doch alleine damit ist es nicht getan. Nun beginnt eine Art Spiel. Wir spiegeln den Säugling, wir gehen zu ihm in Resonanz. Der Ablauf dieses kommunikativen Spiels besteht darin, dass wir in einem ersten Schritt das Kind, seine Mimik, seine Bewegungen und seine Stimme – kurz gesagt seine Körpersprache – auf uns wirken lassen und in einem sich daran unmittelbar anschließenden zweiten Schritt die von der Körpersprache des Kindes ausgehende Botschaft unwillkürlich imitieren, wobei wir sie etwas abändern und ergänzen, bevor wir sie an das Kind zurücksenden.
Säuglinge bieten für das zauberhafte Spiel des Miteinander-in-Kontakt-Kommens immer wieder Anlass. Oft verziehen sie, ohne dass ihnen das bewusst ist, das Gesicht, spitzen den Mund oder gähnen. Darauf lässt sich wunderbar »einsteigen«: »Ja, bist du denn müde?«, lässt sich der Erwachsene mit liebevollem und scheinbar verwundertem Sprachsingsang vernehmen, wendet sich dem Gesichtchen des Kindes zu und spitzt nun selbst den Mund oder öffnet ihn zu einem imitierenden Mitgähnen. Ein anderes Mal zeigt der Säugling strampelnde Bewegungen, die Ärmchen schlagen jetzt vielleicht auf und ab wie bei einem startenden Maikäfer. Ein wunderbarer Anlass, Blickkontakt aufzunehmen, dem Säugling seine Bewegungen zu spiegeln und ihn dabei wiederum – zum Beispiel mit einem liebevoll intonierten »Ja prima, du bist ja ganz tatendurstig!« – anzusprechen. Weint oder schreit der Säugling, wird eine einfühlsame Bezugsperson, die sich dem Kind nun zuwendet, mit ihrer eigenen Stimme in den Klageton zu Beginn für einen winzigen Moment mit einstimmen, bevor sie dann ihrer Stimme einen tröstenden Klang gibt. Dass Säuglinge – intuitiv und völlig unbewusst – im Prinzip in der Lage sind, ihrerseits in Resonanz zu gehen und zum Beispiel die Mimik eines Erwachsenen zumindest ansatzweise zu imitieren, war eine der bedeutendsten Entdeckungen der Säuglingsforschung. Wer dies mit einem Wickelkind ausprobieren möchte, muss allerdings auf den richtigen Abstand zwischen sich und dem Gesicht des Kindes – etwa fünfunddreißig Zentimeter – achten und muss, zum Bespiel mit der Präsentation einer immer wieder herausgestreckten Zunge, lange genug »durchhalten«, bevor das Kind, sich selbst dessen völlig unbewusst, darauf mit einer Imitation antwortet. Mit diesen wechselseitigen Spiegelungs- oder Resonanzphänomenen ist ein Weg gebahnt, auf dem Säugling und Bezugsperson in Kontakt kommen können.
Zwischenmenschliche Kommunikation am Beginn des Lebens nimmt ihren Anfang also mit dem Prinzip der Imitation. Vergleichen wir die Situation des unreifen, weitgehend desorientierten Neugeborenen mit einem Gefangenen, der auf einer mittelalterlichen Burg in einem Verlies eingeschlossen und isoliert ist. Was würde dieser Gefangene tun, wenn er hören würde, wie ein Jemand, der sich offenbar in der Nachbarzelle befindet, plötzlich drei Mal an die Wand klopft? Ohne jede Frage würden wir, befänden wir uns in der Situation des Gefangenen, drei Mal zurückklopfen, um dem Anderen zu signalisieren, dass wir ihn wahrgenommen haben. Dieses Vorgehen entspräche jedenfalls dem Lösungsweg, den die Evolution wählte, um den neugeborenen, unreifen menschlichen Säugling aus seinem kommunikativen »Gefängnis« herauszuführen. Im Gegensatz zum hypothetischen, in einer Burg eingesperrten Gefangenen, der bewusst und mit Bedacht reagiert haben dürfte, haben wir es beim Säugling mit einem desorientierten Wesen zu tun, in welchem noch keine handlungsfähige »Selbst-Zentrale« vorhanden ist. Ein Spiegelungs- und Resonanzmechanismus, der den Säugling in Kontakt mit seinen Bezugspersonen bringen könnte, müsste, wenn er hilfreich sein sollte, daher spontan, intuitiv, prä-reflexiv, also unabhängig von gedanklichen Turnübungen und anstrengungsfrei, funktionieren. Tatsächlich hat die Evolution dem Menschen – und einigen weiteren Spezies – einen solchen Mechanismus zur Verfügung gestellt.
Die neuronale Grundlage, die es ermöglicht, mit Säuglingen und Kleinkindern via Spiegelung und Resonanz in Kontakt zu kommen, wird durch das System der Spiegelneurone oder Spiegelnervenzellen gebildet.4 Es ist bereits kurz nach der Geburt – zwar noch nicht perfekt, aber hinreichend – funktionstüchtig. Dieses System ist kein Echosystem und produziert keine Echophänomene, wie gelegentlich zu lesen ist. Es ist ein Resonanzsystem. Wer zwei korrekt gestimmte Gitarren in geringem Abstand einander gegenüberstellt und die tiefe E-Saite der einen Gitarre kräftig zupft und sie so zum Klingen bringt, diese Saite kurz darauf dann aber mit der Hand dämpft und wieder verstummen lässt, der wird die E-Saite der anderen Gitarre leise nachklingen hören, obwohl sie nicht angetastet wurde. Sie wurde von der inzwischen verstummten E-Saite der ersten Gitarre zum Mitklingen (lateinisch: »resonare«) gebracht, sozusagen »angesteckt«. Ganz anders beim Echo: Der Schrei, den wir in einer Bergschlucht ausstoßen und der von der gegenüberliegenden Felswand als Echo zurückkehrt, ist unser Schrei, nicht der Schrei der Felswand. Wenn der Berg ruft, dann allenfalls im übertragenen Sinne eines früher ziemlich bekannten Buchtitels des Bergsteigers Luis Trenker. Was wir beim Echo hören, sind dieselben Schallwellen, die unseren Hals verlassen haben, sie wurden von der Felswand lediglich reflektiert. Im Gegensatz dazu handelt es sich beim Klang der in Resonanz versetzten E-Saite der zweiten Gitarre um einen Klang dieser zweiten E-Saite. Im Moment der Resonanz verändert sich das, was in Resonanz geht, in unserem Beispiel: die zweite E-Saite. Die Felswand dagegen bleibt im Moment des Echophänomens das, was sie war, sie verändert ihren Zustand nicht und fängt nicht an, zu rufen oder zu erklingen!
Signale, die der Säugling, ohne sich dessen bewusst zu sein, in Richtung einer Bezugsperson aussendet, sind Blicke, Mimik, ungerichtete Bewegungen, körpersprachliche Zeichen der Wonne oder Unruhe, stimmliche Laute der Lust, des Missvergnügens oder der Angst. Sie erzeugen im Erwachsenen eine Resonanz, allerdings nur dann, wenn er seine Sinne auf den Säugling gerichtet hat, ihn also wahrnimmt, und wenn er ihn auf sich wirken lässt. Die Situation lässt sich mit einer Begegnung vergleichen, wie sie sich auch zwischen zwei Erwachsenen abspielen kann, zum Beispiel wenn eine Patientin oder ein Patient das ärztliche Sprechzimmer betritt: Auch vom Patienten gehen körpersprachliche Signale aus, die dem Arzt – ebenso wie der Bezugsperson bei der Begegnung mit einem Säugling – wichtige intuitive Informationen über das Befinden des Patienten geben, allerdings nur dann, wenn der Arzt vom Bildschirm aufschaut und seinen Patienten – zum Beispiel seinen Blick oder seine Art, den Raum zu betreten – wahrnimmt. Wenn Bezugspersonen ihre Sinne nicht auf den Säugling richten, gehen die Signale des Säuglings ins Leere, wie zum Beispiel dann, wenn Bezugspersonen Zeit mit ihrem Säugling verbringen, ihre Aufmerksamkeit aber auf das Smartphone oder den Laptop richten. Dabei geht nicht nur wertvolle Zeit verloren, in der mit dem Kind Resonanzen hin und her gespielt werden könnten. Eltern und Betreuungspersonen bringen sich so um potenziell beglückende Erfahrungen.
Die Bezugspersonen, die sich dem Säugling zuwenden, spüren in sich, wie es dem Kind geht, und werden seine Stimmung, einem intuitiven Programm folgend, zurückspiegeln, wobei sie ihrer Resonanz in der Regel etwas Hilfreiches – zum Beispiel einen aufheiternden oder tröstenden Unterton – hinzufügen, mit dem sie ihrerseits wiederum beim Säugling Resonanz auslösen. Beide Seiten befinden sich wechselseitig das eine Mal in der Rolle der ersten, kurz darauf in der Rolle der zweiten Gitarre. Im ständigen Wechsel senden und empfangen sie Resonanz. Wer in Resonanz geht, verändert sich: Wenn der Säugling quiekende Laute des Glücks von sich gibt, wird er uns mit seiner Wonne anstecken. Zu einer Resonanz wird es in der Bezugsperson aber auch dann kommen, wenn sie den Angst- oder Schmerzschrei eines Säuglings hört. Diese Resonanz lässt sie das Kind verstehen. Nur wenn sie es – dank der in ihr ausgelösten Resonanz – versteht, kann sie dem Kind auch helfen. Beide an einem interpersonellen Resonanzgeschehen beteiligte Parteien verändern sich nicht nur psychisch, also in ihrer Gestimmtheit, sondern auch neurobiologisch: Jedes innere Gefühl – sei es Freude, Schmerz, Angst, Ärger oder Ekel – entwickelt sich, weil im Gehirn bestimmte neuronale Netzwerke zeitgleich aktiv geworden sind. Nehme ich wahr, wie ein Mensch, der sich in meiner Nähe befindet, ein bestimmtes Gefühl erlebt, kommt es nicht nur in seinem, sondern auch in meinem Gehirn zu einer Aktivierung der zu diesem Gefühl gehörenden Netzwerke. Die Gegenwart anderer kann daher, ohne dass uns das bewusst ist, unser Gehirn verändern. Die Gegenwart seiner Bezugspersonen formt das Gehirn des Säuglings. Die an das Kind adressierten Resonanzen geben dem Kind eine Auskunft über sich, sie lassen in ihm ein erstes Selbstgefühl und etwas später ein Selbst entstehen.
Einfühlende Wahrnehmung und die stimmige Beantwortung der vom Säugling ausgehenden körpersprachlichen Signale und Impulse sind eine Kunst, bei der Gefühl und Verstand zusammenwirken. Menschen, die in ihrem Leben selbst wenig Einfühlung erlebt haben und denen Gefühle daher unangenehm sind, tun sich mit dieser Kunst schwer. Der Resonanzmechanismus hat zum Beispiel zur Folge, dass ein schreiender Säugling im Anteil nehmenden Erwachsenen, von dem er auf den Armen getragen wird, zunächst eine kleine Dosis Unruhe und Ratlosigkeit auslöst. Viele Erwachsene, die sich vor negativen Gefühlen dieser Art fürchten – am ehesten deshalb, weil sie als Kinder einst selbst oft alleine gelassen wurden –, fühlen sich angesichts eines schreienden Säuglings ratlos. Nur wer keine Angst vor Angstgefühlen hat, wird in einer solchen Situation nicht nervös werden und mit der eigenen Stimme in die erregte Tonalität des Säuglings kurz spielerisch-liebevoll einschwingen, den Winzling dann mit der eigenen Stimme beruhigend »herunterfahren« und sich auch dann nicht irritieren lassen, wenn dieser Vorgang etwas länger dauert als gewünscht (Säuglinge vermitteln einem manchmal das Gefühl, dass sie, wenn sie sich erst einmal in eine Aufregung hineingesteigert haben, trotz Tröstung eine Weile sozusagen auf ihrem Zorn beharren, als wollten sie deutlich machen, dass die Situation für sie jetzt echt schlimm war; hier helfen dem Erwachsenen nur Geduld und Humor). Gleichzeitig hat die Bezugsperson in einer solchen Situation bereits begonnen zu überlegen, was der Grund für den Unmut des Kindes gewesen sein könnte. Sie wird die Ursache, verbunden mit tröstendem Zuspruch, schließlich abstellen. Resonanzfähigkeit bedeutet, Gefühle der Zärtlichkeit und der Wonne, aber auch der Angst und des Zorns sowohl im Säugling als auch in sich selbst wertfrei sein zu lassen und mit ihnen geduldig, liebevoll und spielerisch umgehen zu können. Die zarte, unter dem Ton der Saiten vibrierende Decke einer Gitarre ist resonanzfähig, sie ist mein Bild für den empathiefähigen Erwachsenen. Eine Felswand – ein in seinen Gefühlen abgestumpfter oder verhärteter Mensch – ist nicht resonanzfähig.
Was der Säugling, viele Male am Tag, über viele Wochen und Monate hinweg im Kontext von Spiegelungserfahrungen erlebt, verändert ihn und wird zum Kern seines Selbst. Die den Säugling adressierenden Resonanzen entstammen dem Selbst seiner Bezugspersonen, die dem Säugling bis dahin zunächst als »Extended Mind« (als externer Träger von Geist) bzw. als »Extended Self« (als externes Selbst)5 dienen. Sie transportieren deren Gestimmtheiten dem Kind gegenüber, sie beinhalten die sich daraus ergebende Art des Umgangs mit dem Kind, aber auch eine bestimmte Sicht auf die Welt und eine bestimmte Art, in der Welt zu handeln und mit Problemen umzugehen. Vor allem geben sie dem Kind eine Auskunft über sich selbst. Was den Säugling erreicht und bei ihm Eingang findet, sind »Selbst-Elemente« derer, die sich um ihn kümmern. Das Selbst-Reservoir, aus dem Bezugspersonen schöpfen, wenn sie den Säugling mit ihren Resonanzen adressieren, beinhaltet implizite Wahrnehmungs- und Interpretationsstile, Handlungs- und Reaktionsweisen und einen bestimmten – impliziten – Umgang mit Körperlichkeit. Es enthält implizite Vorstellungen, Haltungen, Zukunftserwartungen, Vorlieben, Abneigungen und ethische Einstellungen. Im Rahmen eines vertikalen Selbst-Transfers6 finden Teilstücke dieses Inventars Eingang in das Kind und werden zum Material, aus dem sich im Kind ein »Selbst« bilden wird. Zu diesem Geschehen gibt es keine Alternative, ein Selbst kann sich im Kind nur auf diesem Wege bilden. Säuglinge suchen in den sich ihnen zuwendenden Gesichtern ihrer Bezugspersonen intensiv nach Möglichkeiten zu wechselseitiger Resonanz, sie verfolgen die ihnen gesandten Signale und saugen diese regelrecht auf. Der Entzug von Resonanzen würde die gleichen fatalen Ergebnisse zeitigen wie der vom Stauferkönig Friedrich II. im 13. Jahrhundert veranlasste Versuch, mit einem Kind nicht zu sprechen.7 Wird ein Säugling von einem Erwachsenen über längere Zeit mit eingefrorener, regloser Mimik angestarrt,8 erlebt der Säugling dies als Horror und gerät in Panik. Das Kind wird zunächst verzweifelt weinen oder schreien, dann irgendwann erstarren und schließlich emotional einfrieren, also typische Symptome einer Traumatisierung zeigen.
Die an das Kind adressierten Resonanzen sind überlebenswichtig, sie führen den bei der Geburt hochgradig unreifen Säugling langsam aus seiner postnatalen Desorientierung heraus. Wieder und wieder zu erleben, dass immer dann, wenn ich – der Säugling – mich melde, »da draußen« jemand auf mich reagiert, lässt in mir – im Säugling – langsam, aber sicher so etwas wie eine Ahnung entstehen: Hier – auf meiner Seite – muss ein »Jemand« sein, und dort – »da draußen« – ist auch jemand, nämlich ein Anderer. Die anfängliche Desorientierung des Säuglings weicht einer sich Stück für Stück etablierenden inneren Grundordnung zwischen zwei Polen: einem Ich und einem Du, einem Selbst und einem signifikanten Anderen. Beide Vorstellungen, sowohl die vom Du als auch die des Ich, entstehen gemeinsam. Das Selbst des Menschen ist sozusagen ein Zwei-Perspektiven-Selbst. Innere Bilder von Du und Ich werden – worauf ich noch näher eingehe – tatsächlich in einem gemeinsamen neuronalen Netzwerk abgespeichert. Das Stirnhirn, welches zum Zeitpunkt der Geburt noch funktionsuntüchtig ist und beim späteren Erwachsenen die Selbst-Netzwerke beheimaten wird, durchläuft in den ersten zwei Lebensjahren einen neurobiologischen Reifungsprozess. Daher können sich im Verlauf der ersten vierundzwanzig Monate langsam erste Vorläufer eines neuronalen Selbst-Systems bilden. Die Entwicklung und Reifung der neuronalen Selbst-Systeme setzt sich in den nachfolgenden zwei Jahrzehnten fort und geht danach, wenn auch in weit geringerem Umfang, lebenslang weiter.
In den ersten Lebensmonaten kontinuierlich erlebte Resonanzerfahrungen lassen im Säugling nicht nur eine Ahnung davon entstehen, dass er existiert, dass es auf seiner Seite offenbar so etwas wie ein Ich geben muss. Sie informieren ihn, sozusagen qualitativ, auch darüber, wer er ist. Jedes Kind wächst in ein bestimmtes soziales Umfeld hinein, dessen Atmosphäre durch die anwesenden Bezugspersonen geprägt wird. Es macht einen Unterschied, ob ein Säugling, der sich meldet, regelmäßig ungeduldige Reaktionen erlebt oder die genervte Stimme eines Menschen zu hören bekommt, die dem Säugling eine nonverbale Botschaft vermittelt, welche in etwa lauten könnte: »Ich habe dich doch gerade gefüttert und trockengelegt, kannst du mich nicht endlich einmal in Ruhe lassen?!« Oder ob das Kind – auch dann, wenn es sich innerhalb kurzer Zeit wiederholt meldet – eine geduldige und liebevolle Resonanz wahrnimmt. Natürlich verstehen Säuglinge den Inhalt dessen, was Erwachsene ihnen sagen, noch nicht. Sprache und Sprachverständnis beginnen sich erst im Laufe des zweiten und dritten Lebensjahres zu entwickeln. Sie verstehen aber die Tonalität, mit der sie angesprochen werden. Und sie spüren, ob die Art, mit der sie angefasst, aufgenommen, getragen und wieder abgelegt werden, liebevoll und geduldig oder ungeduldig und grob ist. Was Säuglinge präverbal erleben, wird im neuronalen Körpergedächtnis abgespeichert – hier zu nennen ist die sogenannte Inselregion, die dem Gehirn als Körperlandkarte dient; des Weiteren die Mandelkerne, wo die Angstbereitschaft eines Menschen eingestellt wird; und schließlich die Belohnungszentren, die immer dann ansprechen, wenn sich eine Sache gut anfühlt.9 In dieser Zeit bildet sich ein Grundgefühl, ob sich die Präsenz anderer Menschen gut anfühlt oder Unbehagen oder gar Angst bereitet. Die frühen, im Körpergedächtnis abgelegten Erfahrungen der ersten Lebensmonate werden sozusagen aufsummiert und abstrahiert und bilden die Grundlage des langsam entstehenden Selbst-Systems. In den ersten Lebensmonaten erlebte Resonanzen werden im Säugling zu einem inneren Text, sie lassen eine Art stillen inneren Monolog entstehen. Sie können das Kind präverbal spüren lassen: »Man freut sich, wenn ich mich melde, man ist an mir interessiert, ich bin willkommen auf der Welt«, ihm aber auch die Botschaft vermitteln: »Wenn ich mich melde, belaste ich die anderen, es ist daher das Beste, wenn ich mich klein mache, mich unauffällig verhalte und keine Ansprüche anmelde.« Viele Kinder, die in ihrer Familie emotional vernachlässigt waren, in Heimen nur wenig oder keine emotionale Resonanz erhielten oder einer Massenabfertigung ausgesetzt waren, nahmen eine solche innere Botschaft mit ins Leben. Wie immer die Auskunft der an das Kind adressierten Resonanzen lautete – sie wird zu einem Teil des Selbst.
Ein seit Jahren wachsender Anteil von Kleinkindern unter drei Jahren, darunter viele Kinder im ersten Lebensjahr, werden tagsüber in Krippen oder Kitas versorgt. Dagegen wäre nichts einzuwenden, wenn die Einrichtungen, die Kinder unter drei Jahren betreuen, qualitativen Mindestanforderungen entsprechen würden. Ihr wichtigstes Qualitätsmerkmal ist nach Meinung aller Expertinnen und Experten ein Personalschlüssel von 1 (Kindheitspädagogin) : 3 (Kinder unter drei Jahren). Im ersten Lebensjahr sollte der Schlüssel 1 : 2 sein. Der Grund für dieses Erfordernis ist, dass nur eine spezifisch auf den einzelnen Säugling gerichtete Resonanz das Kind spüren lässt, dass es persönlich gemeint ist. Auch die körperliche Pflege der Kleinsten erfordert Eins-zu-eins-Interaktionen, die nicht gehetzt abgewickelt, sondern liebevoll und zugewandt erbracht werden sollten. Kinder im ersten Lebensjahr bedürfen einer vorzugsweise dyadischen, also zweiseitigen Ansprache. An das Kleinkind gerichtete Resonanzen sollen zudem kontingent sein, was bedeutet, dass sie eine zeitnahe Antwort auf das sein sollten, was vom Säugling gemeldet wurde. Die Bedürfnisse von Kindern in den ersten etwa achtzehn bis vierundzwanzig Lebensmonaten unterscheiden sich fundamental von dem, was Kinder ab dem etwa dritten Lebensjahr brauchen. Kinder sind im dritten Lebensjahr, nachdem sie ihren zweiten Geburtstag gefeiert haben. Während es für Kinder im Kindergartenalter wichtig ist, dass sie nicht nur individuell, sondern auch in der Gruppe angesprochen werden und sich sozial einfügen lernen, sind in den ersten beiden Lebensjahren Kontingenz (zeitnahe Reaktion) und ein hinreichendes Maß an dyadischer Ansprache (Eins-zu-eins-Situationen) von überragender Bedeutung. Kindertagesstätten müssen personell nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ gut ausgestattet sein. Die Betreuung der Kleinsten ist keine Aufgabe, die an Praktikantinnen abgeschoben werden kann, sondern erfordert qualifizierte Kindheitspädagoginnen. In dieser Beziehung wird derzeit fast überall nur der Mangel verwaltet. Aus diesem Grunde ist es eine gute Investition, wenn sich Eltern in den ersten achtzehn Lebensmonaten selbst möglichst viel Zeit für die Betreuung ihres Säuglings nehmen. Jenseits der ersten neun Lebensmonate sollten sich hier vor allem die Väter angesprochen fühlen. Dies reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind später kinderpsychiatrische Behandlung benötigt. Eine Gesellschaft wird das, was sie bei der frühkindlichen Betreuung einspart, wenig später für kinderpsychiatrische und heilpädagogische Einrichtungen, für Schulsozialarbeiter und für die Jugendgerichtsbarkeit wieder ausgeben müssen.