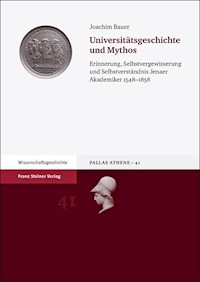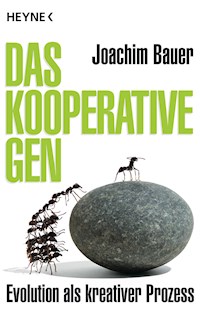2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blessing
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Schmerz erzeugt Aggression. Doch die „Schmerzgrenze“ des Gehirns verläuft anders, als wir bisher dachten
Brutale Gewalt in aller Öffentlichkeit, Amokläufe an Schulen, tödliche ethnische Konflikte und Kriege um knapper werdende Ressourcen: Das Phänomen der Aggression wird immer bedrängender und macht uns Angst.
Der „Aggressionstrieb”, folgenreiche Erfindung von Sigmund Freud und Konrad Lorenz, erklärte die Gewalt zur unverrückbaren Konstante der menschlichen Natur. Joachim Bauer entlarvt den Mythos des Aggressionstriebes und liefert mit Schmerzgrenze eine Neukonzeption des Gewaltphänomens, die auf neuesten neurowissenschaftlichen Erkenntnissen beruht. Evolutionärer Zweck der Aggression ist, uns gegen die Zufügung von Schmerzen wehren zu können. Doch die Schmerzgrenze des Gehirns verläuft anders, als wir bisher dachten. Unser Gehirn bewertet Ausgrenzung und Demütigungen wie körperlichen Schmerz und reagiert deshalb auch darauf mit Aggression. Dies bedeutet: Aggression steht im Dienste der Verteidigung sozialer Bindungen.
Auch Armut bedeutet Ausgrenzung und Demütigung, zumal wenn sie sich im Angesicht von Reichtum ausbreitet. Wasser, Nahrung und Rohstoffe werden auf unserem Globus zur immer knapperen Ressource. Wenn wir das Problem der ungerechten Ressourcenverteilung nicht in den Griff bekommen, wird die Gewalt weltweit zunehmen und die menschliche Existenz bedrohen.
Joachim Bauers neues Buch „Schmerzgrenze” zeigt: Nur Fairness, Kooperation und ein neues Verständnis der Mechanismen der Gewalt können einen Weg aus der Aggressionsspirale weisen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Copyright © 2011 by Karl Blessing Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Layout und Herstellung: Gabriele Kutscha Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-05435-9 V002
www.blessing-verlag.de
www.randomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
1
Mythos Aggression
Die Chancen für eine Selbstzerstörung des Menschen im 21. Jahrhundert stehen nicht schlecht. Die Weltbevölkerung nimmt stetig zu. Die Ressourcen Wasser, Nahrung, Energie und natürliche Umwelt sind begrenzt. Große Teile der Menschheit leben in Armut. Das hinter uns liegende Jahrhundert mit seinen weit über 200 Millionen Toten, die durch Kriege und andere menschengemachte Grausamkeiten starben, war ein Jahrhundert der Gewalt1. Zahlreiche Konfliktherde unseres Globus bergen das Potenzial für weitere verheerende Kriege.
Ich möchte aufzeigen, welchen Beitrag die modernen Neurowissenschaften leisten können, um ein Problem zu entschlüsseln, an dessen Lösung das 20. Jahrhundert wiederholt und eindrucksvoll gescheitert ist: das Phänomen der menschlichen Gewalt. Das Buch soll nicht nur diejenigen inspirieren, die in Politik, Wirtschaft und in den Medien Verantwortung tragen. Es soll uns allen einen Anstoß geben, Erkenntnisse der modernen Hirnforschung nutzbar zu machen, indem sie uns dabei helfen können zu verstehen, nach welchen Regeln sich zwischenmenschliche Aggression entwickelt und wie das Phänomen der Gewalt funktioniert.
Beiträge verschiedener Mediziner und Biologen – allen voran Sigmund Freud und Konrad Lorenz –, die das Konzept eines »Aggressionstriebes« entwickelten und den öffentlichen Diskurs zum Thema Gewalt im letzten Jahrhundert implizit begleitet haben, wirken bis in unsere Gegenwart hinein.
Obwohl frühere Grundannahmen über die Gewalt aus heutiger Sicht unhaltbar geworden sind, erfreuen sich diese Theorien weiterhin großer Popularität. Anthropologische und soziobiologische Theorien – vom Menschen als blutrünstigem Jäger (»man the hunter«)2 bis hin zu den »egoistischen« Genen3 – haben sich im Denken vieler Zeitgenossen (und in vielen Lehrbüchern) festgesetzt, obwohl sie durch neuere Befunde überholt sind.
Tötungsdelikte in U-Bahnen, Amokläufe in Schulen, aber auch Kriege werden immer noch gerne auf unerforschliche, unbeeinflussbare menschliche Grundkonstanten zurückgeführt und zum »Dunklen im Humanum«4 erklärt, obwohl zur Frage der Ursache menschlicher Gewalt inzwischen klare wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen. Über Jahrzehnte hinweg haben namhafte Anthropologen die evolutionäre Entwicklung des Menschen in den letzten rund sieben Millionen Jahren als einen durch blutrünstiges Jagdverhalten sowie durch Mord und Totschlag charakterisierten Prozess dargestellt, als dessen Ergebnis uns heute angeblich eine biologisch verankerte Lust auf Gewalt und eine Liebe zum Krieg innewohne 5.
Eine sorgfältige Überprüfung dieser Mythen ergibt ein völlig anderes Bild: Unsere evolutionären Vorfahren waren weder blutrünstige Jäger noch Mörder, sondern überwiegend vegetarisch lebende Wesen, deren Überleben nur deshalb gelang, weil sie, begleitet von einer beachtlichen Zunahme ihres Gehirnvolumens, nicht nur eine überlegene Intelligenz, sondern vor allem ein phänomenales soziales Kooperationsverhalten entwickelten6.
Eine in größerem Umfang betriebene Jagd ist, evolutionär gesehen, ein relativ junges Phänomen, das erst in einer Zeit auftrat, als unser Gehirn biologisch bereits weitgehend das war, was wir auch heute noch in unseren Köpfen tragen. Auch als der Mensch schon die Fähigkeit zur Jagd entwickelt hatte, blieb er über einen langen weiteren Zeitraum ein überwiegend friedliches, egalitär eingestelltes und auf Kooperation ausgerichtetes Wesen7.
Während wir heute in fast allen Bereichen den Versuch unternehmen, die uns umgebenden natürlichen Phänomene wissenschaftlich zu erklären, sie zu verstehen und diese Erkenntnisse in einer für uns günstigen Weise zu nutzen, verbreiten manche Zeitgenossen den Eindruck, Aggression sei ein unheimliches, letztlich unerforschliches Phänomen. Die Mystifizierung der Aggression kann und muss beendet werden. Dieses Buch soll dazu einen Beitrag leisten, indem es neurowissenschaftliche und anthropologische Erkenntnisse der letzten Jahre zum Thema Gewalt beleuchtet.
Theorien haben Einfluss auf die Wirklichkeit
Theorien, die sich Menschen über sich selbst bilden, finden ihren Niederschlag nicht nur im akademischen oder feuilletonistischen Raum. Entsprechend waren auch Vorstellungen, die über die menschliche Aggression verbreitet wurden, nicht folgenlos. Tatsächlich haben Konzepte, an die wir zu glauben bereit sind, massive Rückwirkungen auf unsere Realität, in der Regel im Sinne einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Dies lässt sich auch experimentell zeigen. Frauen, die der (irrtümlichen) Meinung waren, eine von ihnen eingenommene Placebo-Tablette habe das männliche Sexualhormon Testosteron enthalten, verhielten sich in Versuchstests prompt weniger fair und kooperativ. Warum? Das gezeigte Verhalten fügte sich in eine Theorie, von der die Probandinnen überzeugt waren und der zufolge sich Männer vorzugsweise kompetitiv verhalten8. Sie entsprachen also in ihrem Verhalten den eigenen Vorstellungen über männliche Verhaltensweisen. Ein anderes Beispiel für die sich selbst erfüllende Kraft von Überzeugungen liefert ein Experiment, in dem man Personen sagt, im Menschen staue sich – unabhängig von den Lebensumständen – Aggression auf, die im Sinne einer reinigenden »Katharsis« regelmäßig abgelassen werden müsse (eine wissenschaftlich widerlegte Theorie 9). Derart beeinflusste Personen beginnen sich, wie Experimente zeigen, in ihrem Alltag prompt aggressiver zu verhalten10.
Das Phänomen, dass von Theorien reale Effekte im Sinne einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung ausgehen können, hat einen Namen: Es wird als »Thomas-Theorem« bezeichnet 11. Dass dieses Theorem sich auch dann erfüllt, wenn sich die Theorie später als wissenschaftlich falsch erweist, zeigen zahlreiche Beispiele. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verbreiteten prominente Biologen und Mediziner die Lehrmeinung, bei den unterschiedlichen Ethnien des Menschen handle es sich um »Rassen«, die in einer unweigerlichen, durch die Natur begründeten Konkurrenz stünden. Es entspräche den regelhaften Gesetzen der Evolution, dass sich die Völker und Nationen dieser Erde einem kämpferischen Ausleseverfahren, der sogenannten »natürlichen Selektion« zu stellen hätten12. Damit hatten namhafte, seinerzeit tonangebende Wissenschaftler nicht nur ihren Zeitgenossen, sondern auch mehreren nachfolgenden Generationen eine überaus resistente Laus in den Pelz gesetzt.
Als Folge begannen vor hundert Jahren, lange vor Hitlers Machtergreifung, in fast allen entwickelten Ländern Rassenkampftheorien zu grassieren, die sich – zumal sie von den akademischen Eliten verbreitet wurden – als seriöse Wissenschaft ausgaben, tatsächlich aber ideologischer Unsinn waren. In Deutschland und Österreich leistete dieser pseudowissenschaftliche biologische Mythos einen wichtigen Beitrag zur Anbahnung zweier Weltkriege13. Nachdem die fatalen realen Folgen der Theorie eingetreten waren, dienten sie nachträglich als »Beweis« für das, was eingangs behauptet worden war: dass Menschen unterschiedlicher Ethnien ein natürlicher Kampfinstinkt innewohne. Ein Paradebeispiel für die Kraft des Thomas-Theorems.
Freuds »Aggressionstrieb«
Auch der »Aggressionstrieb« hat das Potenzial einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Er verdankt seine Entstehung den wenig erfreulichen Zeitumständen des vergangenen Jahrhunderts. Sigmund Freud (1856 – 1939), Begründer der Psychoanalyse, hatte im Ersten Weltkrieg zwei Söhne verloren14. Der Erste Weltkrieg, der in einigen Teilnehmerländern bei Kriegsausbruch noch begrüßt worden war wie eine Art Olympiade15, bei der sich die »Tüchtigsten« im Sinne der natürlichen Auslese bewähren sollten, hinterließ Europa schließlich im Schock. Dieser Krieg hatte eine für die damalige Zeit völlig neue Dimension des massenhaften gegenseitigen Abschlachtens erreicht. Erstmals war in Form von Giftgas auch eine Massenvernichtungswaffe eingesetzt worden. Sigmund Freud ging es, nachdem zwei seiner Kinder als Soldaten gefallen waren, nicht anders als vielen Zeitgenossen: Er war traumatisiert und versuchte, die Schrecken dieses Krieges zu verarbeiten. Diese Situation bildete 1920, zwei Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges, den Hintergrund für seine Postulierung eines »Aggressionstriebes«16.
Freud war sich seines »Aggressionstriebes« zunächst alles andere als sicher17. Der in den folgenden Jahren in Europa wieder erstarkende Nationalismus schien seiner These dann jedoch recht zu geben. Einmal in die Welt gesetzt, erfreute sich der »Aggressionstrieb« nicht nur bei einem Teil der kritischen Intelligenz der westlichen Länder zunehmender Beliebtheit. Eine problematische Übereinstimmung in Sachen »Aggressionstrieb« sollte sich auch mit einer Denkschule ergeben, mit der Freud ansonsten nichts gemein hatte. »Leben heißt kämpfen« wurde eine der Leitparolen des Nationalsozialismus, der sich selbst als ein modernes, weil scheinbar biologisch fundiertes, wissenschaftlich begründetes Projekt verstand. Bei all ihrem pseudowissenschaftlichen Popanz hatten die Nazis fatalerweise einen Großteil der akademischen Eliten an ihrer Seite, die das Rassedenken und das Konzept der Selektion durch Kampf bereits über Jahrzehnte hinweg propagiert hatten. Der »Aggressionstrieb« passte den Nationalsozialisten durchaus ins Konzept. Freud allerdings, der sich persönlich als »Pazifisten« bezeichnete18, war vom Nationalsozialismus angewidert und emigrierte 1938.
Ein »Trieb zum Hassen und Vernichten«
Wie der »Aggressionstrieb« das Denken einengte, zeigte sich bereits wenige Jahre nach seiner Erfindung: In einem bewegenden, am 30. Juli 1932 verfassten Brief wandte sich Albert Einstein im Auftrag des Völkerbundes an den damals bereits weltberühmten Arzt und Psychologen Sigmund Freud. Einsteins Frage war, was man gegen die heraufziehende Gefahr eines erneuten Krieges tun könne19. Ist es Anmaßung, wenn wir uns heute erlauben, die Frage zu stellen, ob es nicht schon damals erkennbare Einflussfaktoren für die Entstehung von Gewalt gab, über die Freud hätte sprechen können – auch ohne die uns heute dazu vorliegenden Erkenntnisse? War es dem Seelenforscher wirklich verborgen geblieben, welchen immensen Einfluss Demütigungen und Ausgrenzung auf die Entstehung von Gewalt haben (man denke an Deutschlands demütigende Situation nach dem Ersten Weltkrieg)? Hatte er nicht erkannt, wie sehr soziales Elend und die Ungleichverteilung von Ressourcen (verschärft durch die damalige Weltwirtschaftskrise) Gewalt begünstigen können? War dem Gründer der Psychoanalyse verborgen geblieben, welche gefährlichen, die Aggression enthemmenden Effekte sich aus Dehumanisierungsstrategien ergeben, insbesondere daraus, dass renommierte Wissenschaftler bereits seit Beginn des 20. Jahrhunderts begonnen hatten, einen Unterschied zwischen rassisch bzw. biologisch »höherwertigen« und »minderwertigen« Menschen zu machen? Leider findet sich nichts von alledem in Freuds Antwort an Einstein vom Herbst 1932.
Sein Brief ist ein deprimierendes Dokument20. »Die Tötung des Feindes [befriedige] eine triebhafte Neigung«. Der Mensch unterliege einem »Trieb zum Hassen und Vernichten«, es gebe eine »Lust an der Aggression und Destruktion«, »Krieg [sei] ein Ausfluss des Destruktionstriebes«. Freuds Rat mündete in den bemerkenswerten Satz: »Warum empören wir uns so sehr gegen den Krieg, […], warum nehmen wir ihn nicht hin wie eine andere der vielen peinlichen Notlagen des Lebens? Er scheint doch naturgemäß, biologisch wohl begründet, praktisch kaum vermeidbar.« Einsteins begrenzte Begeisterung über diese Empfehlungen wohl vorausahnend, bemerkte Freud: »Vielleicht haben Sie den Eindruck, unsere Theorien seien eine Art von Mythologie […]. Aber läuft nicht jede Wissenschaft auf eine Art Mythologie hinaus?« Darin, dass seine Theorie eine »mythologische Trieblehre« sei (Freud äußerte den Gedanken in seinem Brief gleich zwei Mal), kann aus heutiger Sicht kein Zweifel mehr bestehen. Der »Aggressionstrieb« sollte sich als der große Flop der Psychoanalyse erweisen21.
Das Aggressionsverständnis bei Darwin: »Soziale Instinkte« statt »Aggressionstrieb«
Für die Einschätzung der Aggression ist es besonders bedeutsam, was Charles Darwin, einer der Gründerväter der modernen Biologie zu diesem Thema zu sagen hatte. Die mit dem Begriff »Darwinismus« verbundenen Assoziationen würden intuitiv vermuten lassen, dass der »Aggressionstrieb« in seinem Denken verankert war. Diese Annahme erscheint intuitiv naheliegend, doch sie ist falsch. Obwohl Freuds Erfindung unter den Biologen einige Jahre später mit Konrad Lorenz durchaus noch einen prominenten Anhänger finden sollte, war Charles Darwin (1809 – 1882) ein »Aggressionstrieb« fremd. Zwar erkannte er, wie sollte es anders sein, die Aggression als ein in Säugetieren und in Menschen verankertes, biologisch fundiertes Programm. Doch einen »Aggressionstrieb« sucht man bei ihm vergebens. Darwin machte deutlich, dass es sich bei der Aggression – wie bei der Angst – um ein reaktives Verhaltensprogramm handelt (wer würde auf die Idee kommen, einen »Angsttrieb« zu postulieren?). Darwin beschrieb, dass es zur Abrufung der Aggression spezifischer Situationen und geeigneter provozierender Reize bedarf22. Die modernen Neurowissenschaften geben Darwin recht.
Als zentralen menschlichen »Instinkt« oder Trieb beschreibt Charles Darwin nicht etwa die Aggression, sondern das Bedürfnis des Menschen nach Bindung und Zugehörigkeit 23. Nichts motiviere, so Darwin, den Menschen grundlegender als sein Bedürfnis nach Gemeinschaft. »Der Mensch findet, übereinstimmend mit dem Schiedsspruch aller Weisen, dass die höchste Befriedigung sich einstellt, wenn man ganz bestimmten Impulsen folgt, nämlich den sozialen Instinkten. Wenn er zum Besten anderer handelt, wird er die Anerkennung seiner Mitmenschen erfahren und die Liebe derer gewinnen, mit denen er zusammenlebt; und dieser Gewinn ist ohne Zweifel die höchste Freude auf dieser Erde«.24 »Da ohne Zweifel Zuneigung eine Vergnügen erregende Empfindung ist, so verursacht sie allgemein ein leichtes Lächeln und ein Erglänzen der Augen. … Ganz allgemein wird eine starke Begierde empfunden, die geliebte Person zu berühren. … Bei niederen Tieren sehen wir dasselbe Prinzip tätig, dass sich Vergnügen aus der Berührung in Assoziation mit Liebe herleitet.«25
Moderne neurowissenschaftliche Erkenntnisse vorwegnehmend, beschreibt Darwin auch die Vitalitätseinbußen, die durch Bindungsverluste hervorgerufen werden können: »Sobald der Leidende [nach Verlust einer geliebten Person] sich vollständig bewusst wird, dass nichts mehr getan werden kann, nimmt Verzweiflung oder tiefer Kummer die Stelle des wahnsinnigen Schmerzes ein. Der Leidende sitzt bewegungslos da oder schwankt langsam hin und her. Die Zirkulation wird träge. … Ist der Schmerz sehr heftig, so führt er bald äußerste Niedergeschlagenheit oder Erschöpfung herbei.«26 Ohne Frage hatte Darwin die Akzente damit anders gesetzt als fünfzig Jahre nach ihm Freud. »Rückblickend erscheint Freud jedenfalls darwinistischer als Darwin selbst« – so überraschend es klingen mag, so zutreffend ist diese Aussage von Julia Voss.27
Konrad Lorenz und »Das sogenannte Böse«
Richtig bekannt wurde der »Aggressionstrieb« nach dem Zweiten Weltkrieg durch den Biologen Konrad Lorenz (1903 – 1989). Dieser hatte aufgrund seiner Linientreue in den Jahren des Naziregimes seine akademischen Weihen erlangt, 1940 war er zum Hochschullehrer in Königsberg berufen worden28. Im Deutschland der 30er-Jahre waren die aggressive Attitüde und das »Recht des Stärkeren« inzwischen zur Staatsräson geworden. In seinem 1963 erschienenen Buch »Das sogenannte Böse«29 führte Konrad Lorenz den »Aggressionstrieb« als »primären Instinkt« in die Biologie des Menschen ein, wobei er sich ausdrücklich auf Sigmund Freud berief. Unter Bezugnahme auf Charles Darwin (den er insoweit komplett missverstand) und auf spezifische Beispiele bei verschiedenen kleinen Fischspezies (die sofort in aggressives Verhalten verfallen, wenn ein anderes Individuum sich ihrem Revier nähert) formulierte Konrad Lorenz seine Theorie vom primären Aggressionstrieb des Menschen.
Obwohl die von ihm angeführten Tierbeispiele allesamt reaktive, im Dienste der Verteidigung von Revier oder Bindung stehende Aggressionsmodi illustrieren, definierte Lorenz sie in seinem Buch als Nachweise für primäre »Angriffslust«. Den Steinzeitmenschen sah Lorenz, ohne dies empirisch zu belegen, im permanenten Kriegszustand30. Von in US-Reservaten lebenden Indianern behauptet Lorenz, unter Ausblendung der sozialen Lebensbedingungen, die bei diesen zu beobachtende Aggressivität sei »herausgezüchtet« worden und daher biologisch verankert31. Bindungsbedürfnisse tauchen bei Lorenz, anders als bei Darwin, als primäres Motiv nicht auf, sondern sind das sekundäre Produkt von gegen einen gemeinsamen Feind gerichteter Aggression. Wo es keine gegen Dritte gerichtete Aggression gebe, so Lorenz explizit, könne es auch keine zwischenmenschlichen Bindungen geben32. Dem komplett widersprechende Befunde der experimentellen Bindungsforschung, insbesondere die seit den 50er-Jahren durchgeführten Untersuchungen des britischen Verhaltensforschers John Bolwby (1907 – 1990), bleiben bei Konrad Lorenz unerwähnt. Die Tatsache, dass die »Instinkttheorie« von Lorenz inzwischen von Fachkollegen grundlegend infrage gestellt wurde33, konnte jedoch der bis heute fortdauernden Popularität des »Aggressionstriebes« nichts anhaben.
Wem und wozu dient der »Aggressionstrieb«?
Wie erklärt sich die bis heute – vor allem in Deutschland und in den angelsächsischen Ländern – beliebte These, dass dem Menschen eine natürliche innere Lust an der Gewalt, ein »Aggressionstrieb« also, innewohne? Meine Vermutung ist, dass die Beliebtheit des »Aggressionstriebes« in den USA und Großbritannien völlig andere Gründe hat als bei uns. Dort scheint mir das Konzept des Aggressionstriebes vor allem deshalb so widerstandsfähig zu sein, weil es als biologische Legitimation eines auf puren Egoismus gegründeten Finanz-, Wirtschafts- und Gesellschaftssystems zu dienen scheint34. Nachdem sich seit etwa einem Jahrzehnt wissenschaftliche Befunde über die phänomenale natürliche Kooperationsneigung des Menschen häufen, gerät die Theorie über den »Aggressionstrieb« auch in den USA immer mehr in Zweifel.
Die Haltbarkeit des »Aggressionstriebes« in Deutschland hat meines Erachtens andere Gründe als in den USA. Diese haben mit der unvorstellbaren Grausamkeit der nationalsozialistischen Verbrechen zu tun, die sich in unserem Lande zwischen 1933 und 1945 abgespielt haben. Meine Hypothese ist, dass sich die Nachkommen der Tätergeneration, insbesondere die sogenannten »68er«, in einer zwiespältigen Situation befunden haben und noch befinden. Einerseits musste es eine Revolte geben, die sich gegen das Verschweigen der Geschichte und gegen die autoritären Strukturen in Familie und Gesellschaft richtete. Diese fällige Revolte hat in den Jahren vor und nach 1968 stattgefunden. Zugleich jedoch gab es bei den Nachfahren der Nazigeneration unbewusst ein Motiv, die eigene Scham zu lindern: Schließlich waren es nun einmal doch tatsächlich die eigenen Väter und Mütter, Großväter und Großmütter, die das Unfassbare getan oder zumindest zugelassen hatten. Eine moralische Legitimation war ausgeschlossen. Eine Möglichkeit, die Scham der Nachfahren zu lindern, bestand jedoch darin, die Verbrechen der Eltern und Großeltern biologisch zu legitimieren, indem man sie mit einer dem Menschen angeblich innewohnenden Lust an der Gewalt relativierte.
Die Theorie des Aggressionstriebs begegnet uns – überwiegend implizit – im öffentlichen Diskurs unseres Landes auf Schritt und Tritt. Sie beherrscht vor allem die Diskussion zu der Frage, »wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden«35. So wird von maßgeblichen Autoritäten argumentiert, dass bevor die Nationalsozialisten den Weg für die Verbrechen frei machten, »der Raum des rassistischen Ressentiments, der Ausgrenzungs- und Vernichtungswünsche zwar schon existierte, aber nicht zur freien Entfaltung kommen konnte«. Die nationalsozialistische Theorie von »Rassen« ungleicher Wertigkeit habe lediglich die Tür für eine biologisch angelegte Tendenz des Menschen zur Ausgrenzung anderer geöffnet. Die nationalsozialistischen Verbrechen werden so quasi zu einem biologisch begründeten menschlichen Grundbedürfnis umdefiniert. Die von den nationalsozialistischen Besatzern in Litauen, in der Ukraine oder in Weißrussland an Zivilisten begangenen Grausamkeiten – einschließlich der schlimmen sexuellen Übergriffe gegen Frauen – seien »wenig weit entfernt« von dem gewesen, was Menschen »in einer Situation geringerer Macht und sexueller Verfügungsgewalt auch gern getan hätten oder – in kleinerem Maßstab – getan haben«. Was sich im Nationalsozialismus an Verbrechen ereignet hat, wird so zum Ausdruck des »Bedürfnispotenzials ganz normaler Menschen« erklärt, das sich »unter neuen Umständen neu entfalten« konnte. Die gleichen Argumente werden aber auch dann bedient, wenn es um weit weniger als um die Grauen der Nazizeit geht. Besonders deutlich wurde dies in den letzten Jahren bei den Kommentaren, die zu den Amokläufen jugendlicher Gewalttäter in Schulen und zu anderen Beispielen von Jugendgewalt zu lesen und zu hören waren.
Das Milgram-Experiment: viel zitiert, nie genau gelesen
Als wissenschaftlicher Nachweis der Theorie, dass der Mensch ein tief verankertes Vergnügen am Leiden anderer habe, dient in Deutschland ein gerne zitiertes Experiment des US-Amerikaners Stanley Milgram36. Leider wird die Studie meist falsch wiedergegeben. »Die Technik des Milgram-Experiments«, so liest man in soziologischen Standardwerken, »bestand ja exakt darin, dass niemand aufgefordert wurde, jemand anderes um eines höheren Zieles wegen umzubringen, sondern dass die Versuchspersonen lediglich dazu veranlasst wurden, jeweils eine kleine Stufe nach der anderen auf der nach oben offenen Skala der Gegenmenschlichkeit heraufzusteigen. Und das Sprechendste an diesem Experiment war vielleicht, dass die Versuchspersonen selbst am meisten darüber überrascht waren, dass sie ohne Weiteres dazu in der Lage waren, Stufe um Stufe weiterzugehen«37. Schilderungen wie diese klingen wunderbar gruselig, sie haben nur einen Nachteil: Sie sind nicht wahr. Milgrams Experimente werden in psychologischen und soziologischen Seminaren offenbar seit Jahrzehnten von Jahrgang zu Jahrgang unrichtig weitergegeben, ohne dass sich jemand jemals die Mühe gemacht hätte, die Experimente einmal genau nachzulesen. So sind inzwischen ganze Generationen deutscher Sozialwissenschaftler und Psychologen der festen, aber definitiv falschen Überzeugung, Stanley Milgram habe gezeigt, dass es Menschen Freude mache, andere zu quälen.
Milgrams Experimente bestanden darin, dass man erwachsene Versuchspersonen, alles Normalbürger von der Straße, mit einer kleinen Bezahlung dafür geworben hatte, an einem Experiment in der angesehenen Yale University teilzunehmen. Den Teilnehmern wurde erklärt, sie sollten als »Lehrer« überwachen, wie gut andere erwachsene Versuchspersonen (die »Schüler«) einen Wort-Erinnerungstest absolvierten (es ging um die korrekte Erinnerung und Wiedergabe einer Wortliste). Die »Schüler«, die den Worttest zu absolvieren hatten, waren in einem Nebenraum platziert. Sie waren für die »Lehrer«, die über die Richtigkeit wachen sollten, nicht zu sehen, aber zu hören. Die »Lehrer« wurden nun ausdrücklich angewiesen, die für sie nicht sichtbaren, aber hörbaren »Schüler« immer dann, wenn ein Fehler gemacht wurde, mit einem Elektroschock zu strafen. Der Elektroschock, so wurde den »Lehrern« gesagt, würde am Arm der »Schüler« appliziert werden. Die »Lehrer« wurden instruiert, die Intensität der Schocks, die von den »Lehrern« mit einem Hebel eingestellt werden konnte, mit jeder weiteren Strafmaßnahme zu steigern. Hinter jedem der »Lehrer« stand ein weiß bekittelter Untersuchungsleiter, der die Rolle einer wissenschaftlichen Autorität ausübte. Mit zunehmender Stärke der Stromstöße hörten die »Lehrer« die bestraften »Schüler«, die sie nicht sehen konnten, entsprechende Schmerzenslaute ausstoßen38. Wenn die »Lehrer« zögerten, die »Schüler« mit immer intensiveren Schocks zu bestrafen, wurden sie vom hinter ihnen stehenden Versuchsleiter schroff angewiesen, sie hätten die Schocks weiter zu steigern und anzuwenden: »Nun machen Sie schon, es gehört zum Experiment!«
In der von Milgram erzeugten Drucksituation gaben 63 Prozent der als »Lehrer« fungierenden Testpersonen dem Druck der hinter ihnen stehenden Autorität nach und verabreichten, wie gefordert, die schmerzhaften Strafen39. Alle Versuchspersonen zeigten jedoch starkes Widerstreben, die Schocks auszuteilen. Viele hatten nach dem Experiment Nervenzusammenbrüche und zeigten Symptome einer posttraumatischen seelischen Störung40. Entscheidend aber war ein bei Zitierung der Milgram-Experimente so gut wie immer unterschlagener, aber äußerst wichtiger Bestandteil des Experiments: Keiner der als »Lehrer« fungierenden Teilnehmer verabreichte die stärker werdenden Schocks, wenn hinter jedem »Lehrer« nicht nur ein, sondern zwei weiß bekittelte Untersuchungsleiter standen, wobei der eine dazu aufforderte, die Schocks zu applizieren, der andere aber sagte: »Sie brauchen es nicht zu tun, wenn Sie nicht wollen!« Bei genauer Betrachtung halten die Milgram-Experimente also keineswegs, was sie im Dienste des Aggressionstriebes versprechen sollen, im Gegenteil. Sie zeigen, was auch zahllose neurowissenschaftliche Studien heute eindeutig belegen: Psychisch durchschnittlich gesunden Menschen, die nicht unter äußerem Druck stehen und die durch niemanden provoziert wurden, ist es zuwider, anderen Leid zuzufügen. Ähnlich wie mit Milgrams Studien verhält es sich mit Philip Zimbardos fragwürdigen Experimenten41.
Der Aggressionstrieb ist tot, doch die Aggression lebt
Auch wenn der Nachweis für die Existenz eines Aggressionstriebes aussteht, so ist und bleibt die Aggression ein Faktum. Was sich an Gewalt bis in die jüngste Vergangenheit auf unserem Globus ereignete, lässt jeden erschaudern. So ereigneten sich in den Jahren nach 1992 auf dem Balkan, zuvor jahrzehntelang das Reiseziel mitteleuropäischer Touristen, unfassbare Grausamkeiten. Über 100 000 Menschen wurden im Rahmen von »ethnischen Säuberungen« in Bosnien systematisch umgebracht. Im Jahre 1995 wurden bei einem Massaker in Srebreniza 7 000 Moslems getötet. Im Kosovo kamen 3 000 Albaner ums Leben. Im afrikanischen Ruanda, bis 1962 unter belgischer Kolonialherrschaft, wurden 1994 während eines Bürgerkrieges zwischen zwei verfeindeten Volksstämmen (Hutu und Tutsi) mehr als 800 000 Zivilisten (überwiegend Tutsis) systematisch und grausam hingemetzelt42. Weltweit werden derzeit ca. 30 Kriege und weitere ca. 100 bewaffnete Konflikte ausgetragen 43, darunter immer mehr Kriege »neuen Typs«, bei denen auch Kindersoldaten im Einsatz sind und Gewalt überwiegend (zu 80 – 90 Prozent) gezielt gegen Zivilisten ausgeübt wird44. Doch Kriege sind nicht die einzige Form der uns begegnenden Gewalt. Mehr als 30 000 Menschen starben seit dem Jahr 2000 durch Terrorakte45. Hinzu kommt das große Feld der im zivilen Umfeld ausgeübten Gewalt. Die Mehrzahl der jährlich weltweit gewaltsam umkommenden etwa 1,43 Millionen Menschen verliert ihr Leben derzeit nicht im Krieg, sondern durch individuell begangene bzw. erlittene Gewalt46. Besondere Aufmerksamkeit fanden in den letzten Jahren Gewaltakte, die von Jugendlichen begangen wurden, darunter die mittlerweile ca. 100 Fälle von tödlichen Amoktaten an Schulen47.
Warum wir lernen müssen, Aggression neu zu verstehen
Welchen Sinn soll es angesichts chronisch virulenter, weltweit verbreiteter Aggression haben, darüber nachzudenken, ob den Menschen eine natürlich mitgegebene Freude am Ausüben von Gewalt beseelt, ob uns ein »Aggressionstrieb« innewohnt oder nicht? Ich will mit diesem Buch deutlich werden lassen, dass es einen für unser Leben entscheidenden Unterschied macht, ob und wie wir die menschliche Aggression verstehen. Denn abhängig davon, wie wir sie verstehen, werden wir ihr begegnen. Sollten wir zu dem Ergebnis kommen, dass dem Menschen ein natürliches Bedürfnis mitgegeben wurde, Gewalt auszuleben, dann wäre Aggression eine hinzunehmende Konstante unseres Zusammenlebens. Kriege, Mord und Totschlag wären dann, um mit Freud zu sprechen, »naturgemäß«, »wohlbegründet« und »kaum vermeidbar«. Maßnahmen gegen die Aggression müssten sich auf ihre Repression (Unterdrückung) und Sublimation (Umlenkung) beschränken. Damit wären wir mit unserem Menschenbild zu einem »Klassiker« zurückgekehrt, der fast zweitausend Jahre lang unser Denken bestimmt hat: Dass der Mensch ein durch und durch »böses« oder »sündiges« Wesen sei48, dem die Moral als contra-natürliches Prinzip, sozusagen »von oben« aufoktroyiert werden muss(te). Ironischerweise bleibt der in Teilen der Biologie derzeit noch herrschende Neodarwinismus dieser manichäischen Aufspaltung treu, indem er den Egoismus als primäres, bis in die Gene hinein verankertes, im Menschen »natürlich« verankertes Motiv definiert. Waren es früher die Kirchen, die von diesem anthropologischen Konzept profitierten, so sind es heute die Anhänger eines ungezügelten Raubtierkapitalismus49.
Die moderne Neurobiologie kann das Konzept eines primär blutrünstigen, durch einen Aggressionstrieb getriebenen Menschen nicht stützen50. Allerdings ist sie weit davon entfernt, den Menschen »gut« zu beten. Doch was in den letzten etwa zwanzig Jahren durch neurowissenschaftliche Studien über die »Natur des Menschen« zutage gefördert wurde, darf ohne Übertreibung als eine Revolution bezeichnet werden. Das nachfolgende Kapitel 2 soll zunächst deutlich machen, wie sich – neurowissenschaftlich betrachtet – definieren lässt, was in früherer Zeit als »Trieb« bezeichnet wurde. Neuere Untersuchungen weisen den Menschen als ein in seinen Grundmotivationen primär auf soziale Akzeptanz, Kooperation und Fairness ausgerichtetes Wesen aus, ein Umstand, der von neodarwinistischen Biologen ironischerweise inzwischen als ein ernstes »Problem« bezeichnet wird51. Die in Kapitel 2 gegebene Darstellung der menschlichen Grundmotivationen muss der Analyse des Aggressionsapparates in Kapitel 3 vorangehen, da – wie sich zeigen wird – der Aggressionsapparat vor allem dann anspringt, wenn die Ziele der Grundmotivationen – Fairness und zwischenmenschliche Akzeptanz – bedroht sind. Da die Grundmotivationen die »Schmerzgrenze« markieren, bei deren Überschreitung mit Gewalt zu rechnen ist, ist die Analyse des Aggressionsapparates erst dann sinnvoll, wenn wir verstehen, was den Menschen wirklich »treibt«.
2
Worauf sind die Grundmotivationen des Menschen gerichtet?
Eine wirklich überzeugende Entsorgung der Theorie vom menschlichen »Aggressionstrieb« war erst vor wenigen Jahren möglich. Sie setzte ein neurobiologisch fundiertes Wissen über das voraus, was in früherer Zeit und über viele Jahrzehnte hinweg beim Menschen als »Trieb« (im Englischen als »instinct«) bezeichnet worden war. Als »Trieb« wurden spontan auftretende Verhaltensprogramme bezeichnet, von denen man nicht nur annahm, sie seien biologisch fixiert (also nicht durch soziales Lernen erworben), sondern auch Ausdruck eines biologischen Grundbedürfnisses. Da alle lebenden Organismen lernende Systeme sind und ihre biologische Aktivität von der Aktivität ihrer Gene bis hin zu den Verschaltungen des Nervenzellsystems den Bedingungen ihrer jeweiligen Umwelt anpassen, ist genau betrachtet alles, was ein Organismus tut, biologisch fixiert52.
Alles, was wir erleben oder tun, verändert unser Gehirn. Das Gehirn macht aus Psychologie sozusagen Biologie. Andererseits verhalten wir uns entlang dessen, was wir biologisch sind. Die Grenzen zwischen »sozial gelernt« und »biologisch verankert« sind zwar keineswegs aufgehoben, aber fließend53. Obwohl alles, was wir als Menschen tun und wie wir uns verhalten, letztlich in den Aktivitätsprogrammen unserer Gene und den Verschaltungen unseres Gehirns eine biologische Entsprechung hat, ist nicht alles Verhalten zugleich auch »Trieb«. Denn nicht alles, was biologisch verankert ist, ist zugleich auch Ausdruck eines spontan auftretenden biologischen Grundbedürfnisses.
Was sind Grundbedürfnisse des Menschen?
Solange man nichts über die neurobiologischen Grundlagen des Verhaltens wusste, neigte man verständlicherweise dazu, vor allem solche Verhaltensweisen als biologisch-triebhaft verankert anzusehen, die besonders häufig zu beobachten waren. Tatsächlich jedoch ist Häufigkeit kein hinreichendes Kriterium dafür, dass es Ausdruck eines Grundbedürfnisses ist. Vieles, was vordergründig den Eindruck hervorruft, es entspreche einem biologischen Triebverhalten, ist tatsächlich Ausdruck von kulturellen, ökonomischen oder von im Rahmen eines Experiments (manchmal unbemerkt) eingeführten Bedingungen54. Da im Westen so gut wie alle Menschen nach dem Besitz von Geld streben, könnte man auf die Idee eines natürlichen »Erwerbstriebes« kommen. Doch wie sollte sich in der Evolution ein biologisch verankerter »Erwerbstrieb« herausgebildet haben, da es während mehr als 90 Prozent der Zeit, seit welcher Homo sapiens existiert55, weder Handel als Erwerbsgrundlage noch so etwas wie Geld und Geldverkehr gegeben hat? Selbst wenn man einen biologischen »Selbsterhaltungstrieb« postuliert, kann man auf unerwartete Schwierigkeiten stoßen. Sozial lebende Säugetiere, zu denen auch der Mensch zu zählen ist, büßen ihren »Selbsterhaltungstrieb« ein, sobald sie für längere Zeit isoliert und gezwungen werden, gegen ihren Willen alleine zu leben: Nicht nur der Wunsch nach Nahrungsaufnahme, auch weitere Anzeichen von Vitalität (z. B. die spontane Neigung, sich zu bewegen) lassen unter Isolationsbedingungen, auch wenn genügend Nahrung zur Verfügung steht, drastisch nach. Soweit es sozial lebende Arten betrifft, gehen über lange Zeit isolierte oder sozial ausgegrenzte Individuen, ungeachtet eines angeblichen »Selbsterhaltungstriebes«, zugrunde56.
Das verführerische Kriterium der Häufigkeit dürfte es gewesen sein, welches Sigmund Freud am Ende des Ersten Weltkrieges zu dem Schluss verleitete, bei der Aggression handle es sich um ein biologisch verankertes menschliches Grundbedürfnis. Tatsächlich hatte ein Großteil der Bevölkerung in Deutschland und Österreich die jungen Soldaten 1914 begeistert in den Krieg verabschiedet, wie historisches Filmmaterial auf beklemmende Weise zeigt. Doch die Kriegsbegeisterung war strategisch-propagandistisch erzeugt worden. Auch die Wissenschaft der Biologie spielte damals, indem sie sich zu Propagandazwecken einsetzen ließ, eine ungute Rolle: Namhafte Persönlichkeiten in beiden deutschsprachigen Ländern hatten den Krieg zu einem ebenso unausweichlichen wie freudigen Ereignis erklärt, bei dem sich die biologisch Besten bewähren sollten (wobei man davon ausging, den französischen Nachbarn und weiteren Kriegsgegnern biologisch überlegen zu sein)57. Freuds Position zur Aggression, die später in dem von mir bereits zitierten Briefwechsel mit Albert Einstein gipfelte, offenbart eine merkwürdige Einseitigkeit: Warum sprach er, nachdem er seinen »Aggressionstrieb« postuliert hatte, nicht auch von einem »Angsttrieb«? Bei der Angst, ein beim Menschen mindestens ebenso häufig auftretendes Phänomen wie die Aggression, erkennen wir intuitiv, dass es sich um ein zwar biologisch verankertes, aber reaktives Verhaltensprogramm zur Bewältigung potenziell gefährlicher Situationen handelt58. Umso merkwürdiger erscheint im Rückblick, dass Freud und später Konrad Lorenz – anders als Charles Darwin – die Aggression kurzerhand zum spontanen Triebbedürfnis erklärten.
Die Entdeckung des Motivationssystems
Eine definitive Klärung der widersprüchlichen Positionen zur Natur der Aggression war erst möglich, nachdem neurobiologische Untersuchungen in den letzten etwa 25 Jahren im Gehirn ein Nervenzellsystem aufgedeckt hatten, welches heute als »Motivationssystem« bezeichnet wird59. Es ist nicht nur beim Menschen, sondern bei allen Säugetieren anzutreffen und hat seine Position im sogenannten Mittelhirn. Wie sich zeigen sollte, hat es als einziges neurobiologisches System die Macht, menschliche Verhaltensweisen im Sinne einer Triebhaftigkeit zu verstärken. Die Macht des Motivationssystems beruht darauf, dass die Nervenzellen dieses Systems Botenstoffe produzieren, ohne die wir uns nicht wohlfühlen, ja ohne die wir auf Dauer gar nicht leben können60. Allerdings werden diese Botenstoffe nur dann ausgeschüttet, wenn wir bestimmte Erfahrungen machen oder uns in einer bestimmten Art und Weise verhalten. Verhaltensweisen, die eine Voraussetzung dafür sind, dass im Gehirn Motivationsbotenstoffe ausgeschüttet werden und sich ein Lebewesen wohl, fit und vital fühlt, erfüllen die Bedingung für das, was früher als »Trieb« bezeichnet wurde: Es sind Verhaltensweisen, die aufgrund eines biologischen Mechanismus subjektiv als angenehm erlebte Folgen haben und daher ein spontan auftretendes, triebhaftes Grundbedürfnis konstituieren61.
Die Entdeckung des Motivationssystems und die Erforschung seiner Funktionsweise ermöglichte es erstmals, wissenschaftlich zu überprüfen, welche menschlichen Verhaltensweisen tatsächlich die Voraussetzungen für das erfüllen, was über viele Jahrzehnte hinweg – auf intuitiver oder spekulativer Basis – als spontanes Triebbedürfnis bezeichnet wurde. Nachdem moderne Untersuchungsmethoden die Möglichkeit eröffnen, die Aktivitätszustände bestimmter Hirnregionen zu messen, ohne in das Innere des Gehirns eindringen zu müssen62, war es in den vergangenen Jahren erstmals möglich, exakt diejenigen Erfahrungen oder Tätigkeiten zu bestimmen, die eine beobachtbare Aktivierung des Motivationssystems zur Folge haben. Die modernen Neurowissenschaften konnten somit einen entscheidenden Beitrag zur Beantwortung der Frage leisten, welche Erlebnisse oder Handlungen beim Menschen einem spontan auftretenden »Trieb«-Bedürfnis entsprechen: Die Voraussetzungen eines »Triebs« erfüllen, wie bereits erwähnt, nur solche menschlichen Strebungen oder Versuchungen, die dann, wenn wir ihnen nachgehen bzw. nachgeben, eine Aktivierung der Motivationssysteme und damit die Ausschüttung von Wohlfühlbotenstoffen zur Folge haben63.
Aggression ohne Provokation »lohnt« sich nicht
Was sind menschliche Grundmotivationen? Welche Erlebnisse und Tätigkeiten des Menschen sind in der Lage, das Motivationssystem seines Gehirns zu aktivieren? Zur Logik der naturwissenschaftlichen Arbeitsweise gehört, dass wir unsere Aufmerksamkeit vor allem dorthin richten, wo sich positive Effekte beobachten lassen. Tatsächlich wurden zahlreiche positive Reize identifiziert, die eine Aktivierung des Motivationssystems und eine Ausschüttung seiner Wohlfühlbotenstoffe verursachen (dazu nachfolgend gleich mehr). Von besonderer Bedeutung für die Aggressionsforschung war aber eine Erkenntnis, die einen negativen Effekt betraf: Einem Menschen die Möglichkeit zu geben, einer anderen Person, von der keine Provokation ausging oder ausgeht, Leid zuzufügen oder sich ihr gegenüber aggressiv zu verhalten, ist aus Sicht des Motivationssystems kein »lohnendes« Unterfangen. Aggressivität ohne vorherige Provokation führt bei psychisch durchschnittlich gesunden Menschen weder zu einer Aktivierung des Motivationssystems noch zu einer Ausschüttung von Glücksbotenstoffen. Aggression ist daher eindeutig keine spontan auftretende Grundmotivation im Sinne des »Aggressionstriebes«. Um Aggression zu einem »Bedürfnis« bzw. zu einer Motivation werden zu lassen, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Vergleichbar mit der Angst, handelt es sich bei Aggression um ein reaktives Verhaltensprogramm, dessen biologische Funktion darin besteht, diejenigen äußeren Umstände zu bewältigen, die als Auslöser das Angst- oder Aggressionsprogramm abgerufen haben. Ausnahmen hiervon finden sich nur bei psychisch Kranken und bei Psychopathen.
Vertrauen und soziale Akzeptanz als »Triebziel«
Was »treibt« – wenn es unprovozierte Aggression nicht ist – den Menschen an? Welche Reize haben das Potenzial zur Aktivierung des Motivationssystems und können die Ausschüttung von Vitalitäts- und Glücksbotenstoffen veranlassen? Es sind, wie eine Serie von Experimenten der letzten Jahre belegen konnte, soziale Interaktionen, die mit gegenseitigem Vertrauen und guter Zusammenarbeit verbunden sind (siehe Abbildung 1)64. Bereits die bloße Erfahrung, freundlich zugewandten anderen Menschen zu begegnen, erweist sich beim Menschen als eine biologisch verankerte Grundmotivation 65. Von anderen Vertrauen zu erhalten und zu erleben, dass Mitmenschen bereit sind, in einer konkreten Situation mit der eigenen Person zu kooperieren, wird vom Motivationssystem des Menschen mit einer sofortigen positiven Reaktion beantwortet66. Umgekehrt ist ein auf diese Weise in Gang gesetztes Motivationssystem – auch dies ließ sich experimentell belegen – ein sicheres Vorzeichen dafür, dass die Betroffenen sich ihrerseits vertrauensvoll und kooperativ verhalten werden67. Nicht nur eine infektiöse Erkrankung, auch kooperatives Verhalten scheint beim Menschen also biologisch »ansteckend« zu sein. Zusammenfassend zeigen zahlreiche jüngere Untersuchungen, dass der Wunsch, sozial akzeptiert und in einer Gemeinschaft integriert zu sein, ein zentrales menschliches »Triebziel« darstellt.
Das Motivationssystem des Menschen springt keineswegs nur dann an, wenn andere uns Gutes tun. Es ist weit mehr als ein auf die »egoistischen« Bedürfnisse der eigenen Person ausgerichteter neurobiologischer Mechanismus. Personen, die sich in einer finanziell besser gestellten Situation befinden als ein ihnen zugeordneter Partner, beantworten die Zuteilung eines weiteren finanziellen Bonus an die eigene Adresse mit einer nur mäßig ausgeprägten Glücksreaktion ihrer im Mittelhirn sitzenden Triebzentren. Eine deutlich stärkere Reaktion zeigt das Motivationssystem jedoch dann, wenn ein finanziell besser Gestellter erlebt, dass ein zusätzlich ausgegebener Bonus nicht dem eigenen, sondern dem Konto des minder Bemittelten zugutekommt68. Das menschliche Gehirn ist, wie Experimente belegen, nicht nur auf sozialen Zusammenhalt geeicht (es ist nicht nur ein »social brain«). Es besitzt einen biologisch verankerten Fairness-Messfühler und strebt im Sinne einer natürlichen, durchaus »triebhaften« Tendenz nach einem Mindestmaß an fairer Ressourcenverteilung (es erweist sich zusätzlich also auch als ein »egalitarian brain«). Da wir heutzutage allem »Gutmenschentum« gegenüber aus guten Gründen skeptisch eingestellt sind, neigen wir dazu, Personen zu belächeln, die uns weiszumachen versuchen, es mache sie glücklich, anderen zum eigenen Nachteil Gutes zu tun. Neurobiologische Studien zeigen allerdings, dass Geben aus der Sicht des menschlichen Motivationssystems ein »lohnendes« Unterfangen ist, auch dann, wenn keine vorteilhaften Effekte für die eigene Reputation zu erwarten sind: Unser Trieb- bzw. Motivationssystem antwortet auch darauf mit einer Ausschüttung von Glückshormonen69.
Abbildung 1: Wie bereits Charles Darwin erkannte, ist es das »Trieb«-Ziel eines jeden Lebewesens, sich wohl und vital zu fühlen. Lust, Wohlgefühl und Vitalität setzen beim Menschen Botenstoffe voraus, die nur vom Motivationssystem des Gehirns ausgeschüttet werden können. Die Ausschüttung dieser Wohlfühlbotenstoffe hat wiederum gute zwischenmenschliche Beziehungserfahrungen zur Voraussetzung. Gute Beziehungen werden dem erwachsenen Menschen nicht auf dem Tablett serviert, wir können – und müssen – mit unserem Verhalten dazu einen Beitrag leisten. Verhaltensweisen, die unser biologisches System so beeinflussen, dass wir uns wohlfühlen, haben »Trieb«-Charakter. Unprovozierte Aggression führt bei psychisch durchschnittlich gesunden Menschen nicht zur Ausschüttung von Wohlfühlbotenstoffen.
Die auf Zusammenhalt, Fairness und Kooperation ausgerichtete »Konstruktion« seines Gehirns verdankt der Mensch seiner evolutionären Vorgeschichte. Sozial gut vernetzte Menschen hatten während der Evolution unserer Spezies eine deutlich bessere Lebenserwartung. Daran hat sich bis heute nichts geändert70. Unsere »triebhaft« auf soziale Akzeptanz und gegenseitige Hilfeleistung ausgerichtete Neurobiologie ist der Grund, warum bereits Säuglinge im ersten Lebensjahr – und lange vor dem Spracherwerb – kooperative Strategien eindeutig favorisieren71. Untersuchungen, die Michael Tomasello und andere Forscher bei Kleinkindern – und vergleichend dazu bei Schimpansen – durchführten, zeigen, dass 14 bis 18 Monate alte Kleinkinder anderen, die in Schwierigkeiten sind, spontan helfen, so gut sie können. Sie tun dies auch dann, wenn es sich bei den Hilfsbedürftigen um Fremde handelt und wenn keinerlei Belohnung winkt (Belohnungen können das hilfreiche Verhalten sogar mindern!)72. »Young children are naturally empathetic, helpful, generous, and informative.« »Kleinkinder«, fasst Michael Tomasello seine Untersuchungen zusammen, »sind natürlicherweise empathisch, hilfreich, großzügig und helfen anderen, indem sie Informationen geben« (z. B. indem sie etwas zeigen, J. B.). Dies bedeutet natürlich keineswegs, dass Kinder grundsätzlich »gut« seien.
Gerechtigkeit als menschliche Grundmotivation
Unsere Spezies wird von einer natürlichen, neurobiologisch verankerten Abneigung gegen zu große Ungleichheit (»inequalitiy aversion«) geleitet. Dass Menschen – unabhängig von Gesichtspunkten eines gegenseitigen Vorteils oder eines eventuellen Ansehensgewinns – ein natürliches, durchaus »triebhaftes« Bedürfnis empfinden, etwas abzugeben, wenn andere weniger haben oder in Not sind, zeigen nicht nur zahlreiche experimentelle Untersuchungen, sondern auch statistische Daten zur Spendenbereitschaft innerhalb der Allgemeinbevölkerung. Das jährliche Spendenaufkommen liegt in Deutschland derzeit – je nach Art der Erfassung – bei drei bis viereinhalb Milliarden Euro. Werden gemeinnützige, kostenlos geleistete soziale Tätigkeiten als Geldwert veranschlagt, dann müssen weitere etwa 4,6 Milliarden Euro pro Jahr hinzugerechnet werden73. Viele andere Länder stehen uns in ihrer Spendenbereitschaft keineswegs nach.
Ironischerweise wurde Darwins Erkenntnis, dass die »sozialen Instinkte« der stärkste menschliche Trieb seien, ausgerechnet von darwinistischen Ideologen verneint. »Seien Sie gewarnt«, so werden wir bei Richard Dawkins, dem Erfinder der angeblich egoistischen Gene belehrt, »wenn Sie – so wie ich – eine Gesellschaft formen wollen, in welcher Individuen großzügig und selbstlos zugunsten des Gemeinwohls kooperieren, dann können Sie vonseiten der biologischen Natur kaum eine Hilfestellung erwarten«74. Es sollte nicht die einzige Ansage dieses Autors bleiben, die sich als Unsinn erwies 75. Zu kooperieren, anderen zu helfen und Gerechtigkeit walten zu lassen ist eine global anzutreffende, biologisch verankerte menschliche Grundmotivation. Dieses Muster zeigt sich über alle menschlichen Kulturen hinweg und findet sich auch in jenen wenigen Gesellschaften, die sich heute noch auf dem Niveau der Steinzeit bewegen76. »Gerechtigkeitsstreben, «, so formulierten es Golnaz Tabibnia, Ajay Satpute und Matthew Lieberman von der University of Califormia, »ist ein basaler menschlicher Impuls.« Fairness, so fahren sie fort, sei ein hedonistisches, mit Wohlgefühl verbundenes Geschehen 77.
Kein »Zeitalter des allgemeinen Gutmenschentums«
Für die Ausrufung eines neuen Zeitalters des allgemeinen »Gutmenschentums« ist es allerdings zu früh. Die Fairness-Messfühler seines Gehirns machen den Menschen – dies wird im nachfolgenden Kapitel 3 hinreichend deutlich werden – keineswegs zu einem »guten« Wesen. Sie erweisen sich jedoch als ein sensibler neurobiologischer Apparat und üben massiven Einfluss auf unsere alltäglichen Entscheidungen aus. Dies zeigt sich selbst dann, wenn das Insistieren auf Fairness zur Folge hat, dass dafür ein eigener (z. B. finanzieller) Nachteil in Kauf genommen werden muss. Experimente belegen, was wir aufgrund unserer Alltagserfahrungen intuitiv schon lange wissen: Zwar verhält sich das menschliche Gehirn gegenüber einer maßvollen Ungleichverteilung von Ressourcen durchaus tolerant (es folgt insoweit also keineswegs einem kommunistischen Dogma). Wer jedoch bei der Verteilung einer Ressource in massiver Weise benachteiligt werden soll und die Möglichkeit hat, die Verteilungsaktion insgesamt zu blockieren, der wird dies auch tun, selbst dann, wenn damit auch der Verlust der eigenen – als zu klein betrachteten – Zuweisung verbunden ist78.
Schmerzgrenze Unfairness
Wer das auf Kooperation und Fairness ausgerichtete Motivations- bzw. Triebsystem des menschlichen Gehirns nicht kennt, wird die Grundregeln der Aggression nicht verstehen können. »Aus Sicht des Gehirns« bedeutet die Verweigerung von sozialer Akzeptanz und Gerechtigkeit nicht nur, dass die Aktivierung des Motivationssystems ausbleibt, obwohl bereits dies alleine schwerwiegende Folgen haben kann. Denn dauerhaft verweigerte Akzeptanz kann einen kritischen Abfall von gesund erhaltenden Botenstoffen und psychische und körperliche Erkrankungen zur Folge haben. Wer einen Menschen unfair behandelt, tangiert die neurobiologische Schmerzgrenze und muss mit Aggression rechnen (siehe Abbildung 2 und Kapitel 3). In massiver Weise ungerecht behandelt zu werden hat beim Menschen eine Aktivierung der neurobiologischen Ekelzentren (sie sind ein Teil des Aggressionsapparates) zur Folge. Sich spontan aggressiv aufzuführen oder anderen ohne Grund Gewalt zuzufügen ist – wie von mir bereits eingangs deutlich gemacht wurde – aus Sicht des menschlichen Motivationssystems kein lohnendes Unterfangen. Völlig anders verhält es sich jedoch, wenn eine Person sich gegenüber anderen unfair verhalten hat: Wie Experimente zeigen, wird Gewaltausübung in einer solchen Situation – und nur in einer solchen Situation – attraktiv79. Der Aggressionsapparat des Menschen ist ein neurobiologisches Hilfssystem, er steht seiner biologischen Grundkonzeption nach im Dienst des sozialen Zusammenhalts.
Abbildung 2: